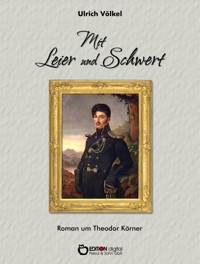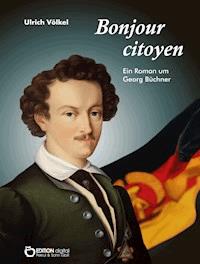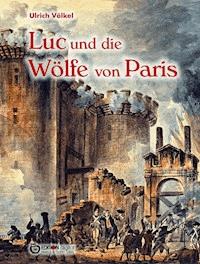Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Die künstlerische Leistung des Schriftstellers Ulrich Völkel liegt in der überzeugenden Darstellung eines jungen Arbeiters, den der gesellschaftliche Umbruch besonders abrupt trifft. Hier riecht nichts nach Bitterfelder Unkräutern, die am Wege welken. Die existenzielle Krise, in die der Völkelsche Protagonist durch den sozialen Erdrutsch gleich mehrerer Gesellschaftsordnungen gerät, zwingt ihn zu einer Rückschau. Das Leserinteresse für diesen Stoff steht in östlichen Regionen außer Frage. Er kann aber auch zum psychologisch-menschlichen Verständnis massenhafter östlich geprägter Biografien beitragen. Völkels Erzählung wäre übergreifend mit Solingers „Fänger im Roggen" und Plenzdorfs „Neuen Leiden des jungen W.“ ins Verhältnis zu setzen, das Schicksal des jungen Mannes Otto Lehmann lässt wie die beiden Genannten kaum jemand kalt. LESEPROBE: Wir fuhren mit dem Auto von Kolja. Kolja war Ingenieur im Eisenwerk und mit Wolfgang befreundet. Das Auto nenne ich lieber ein Fahrzeug. Ich weiß nicht, aus wie viel Teilen verschiedenster Herkunft es zusammengesetzt war, aber es müssen ein paar Hundert gewesen sein. Abenteuerlich. Mit so etwas haben die den zweiten Weltkrieg gewonnen. Es war ein Mittelding zwischen Handwagen und Panzer, der hintere Teil ein Kübel ohne Fenster. In dem saßen wir vier, außer Wolfgang und mir noch Achim und Huckleberry Finn, der eigentlich Hubert hieß, aber ungern so gerufen werden wollte. Ich erfuhr seinen Familiennamen erst viel später: Hubert Friedrich Ginther von Auwald-Steckelsheim. Als Huckleberry Finn fühlte er sich sehr wohl. Wir mussten uns in diesem Käfig einsperren lassen, denn mit einem Trassen-Fahrzeug hätten wir uns nicht in die Basa otdycha trauen dürfen. Es gab Vorschriften der Miliz, nach denen sich unsere Autos nur auf der exakt eingezeichneten Marschrut bewegen durften. In größeren Abständen dieser Wege befanden sich die Wachtürme der GAI, die Staatliche Straßeninspektion, in deren unmittelbarer Nähe in aller Regel ein wahnsinnig demoliertes Auto auf einer Hebebühne stand, was wenigstens für die nächsten Kilometer warnend wirkte. Die Miliz registrierte jedes Fahrzeug und meldete es an den folgenden Posten weiter. Kam es dort nicht nach einer angemessenen Zeit an, wurde eine Suchaktion gestartet. Und wehe, der Fahrer hatte die vorgeschriebene Route verlassen! Die Miliz verstand keinen Spaß. Und sie ließ keine noch so gute Ausrede gelten, schon gar nicht die Wahrheit, wenn sich einer tatsächlich verfahren hatte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Ulrich Völkel
Daheim, in meinem fremden Land
Erzählung
ISBN 978-3-95655-530-5 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1999 im Rhino Verlag, Arnstadt und Weimar.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Für meine Frau
Für meine Kinder
Für meine wenigen Freunde
Vergangenheit war Gegenwart, als sie noch Zukunft werden wollte
Nina liest Zeitung. Sie hat noch Probleme mit der deutschen Sprache und möchte sie möglichst schnell lernen. Deshalb liest sie jeden Morgen während des Frühstücks ausgiebig das Blatt. Wir haben sehr viel Zeit. Wir haben so viel Zeit, dass wir bis zum abendlichen Fernsehen frühstücken könnten. Arbeitslos. Beide. Nina sowieso, die ist Russin, nein, eigentlich kommt sie aus der Ukraine. Ich bin auch arbeitslos. Maler, Anstreicher, wenn du verstehst, was ich meine.
Ich sage zu Nina: „Wenn du richtig deutsch lernen willst, darfst du keine Zeitung lesen. Die teilen nicht einmal ordentlich ab. Da brauchst du dir gar keine Mühe geben.”
Und Nina sagt: „Mühe zu geben. So viel Zeit muss sein, Oleg.”
Sie sagt Oleg zu mir, obwohl ich Otto heiße, Otto Lehmann. Otto Lehmann, genannt Oleg, sechsunddreißig, Anstreicher. Arbeitslos seit sieben Monaten.
Nina ist fertig mit Essen. Sie schiebt ihren Teller zur Tischmitte, rückt die Teetasse gut erreichbar zur Seite und lehnt sich in ihrem Stuhl bequem zurück. Ich esse noch. Ich schiele halbwegs zu ihr hinüber, sehe aber nur ihren Wuschelkopf über den Zeitungsrand lugen und denke bei mir: Warum willst du eigentlich richtig deutsch lernen, Täubchen, wenn die richtigen Deutschen, also die, die behaupten, dass sie die richtigen Deutschen sind, dich gar nicht haben wollen in ihrem richtigen Deutschland, jetzt, wo es wieder das richtige Deutschland ist und nicht mehr der Westen und die DDR? Täterä. „Die DDR, mein Vaterland, ist sauber immerhin ...” - hat mal einer gedichtet. Prost, Mahlzeit!
Ich komme mit diesem Deutschland nicht klar. Muss an mir liegen, denke ich. Die anderen finden es prima. Sagen die. Es ist nicht mein Deutschland. Mein Deutschland gibt es sowieso nicht, nur in meinem Kopf. Und ich weiß nicht, ob es gut wäre, wenn es das richtig gäbe. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was gut oder richtig ist. Neulich hat einer gesagt, dass er auswandern möchte, am liebsten nach Madagaskar. Doch das ginge auch nicht, weil, die ließen unsereinen nicht mehr an Land wegen der Pest an Bord, der schwarzen, verstehst du, hat er gesagt. Also fahren wir nicht nach Madagaskar. Nina und ich schon gar nicht. Wir hocken am Frühstückstisch in der Küche. Könnte gemütlich sein, wenn die Welt aus nichts anderem bestünde als aus Frühstück in der Küche. Urgemütlich. Vielleicht.
So sitzen wir jeden Morgen. Nina liest die beknackte Zeitung von der ersten bis zur letzten Seite, fast alles. Und sie fängt immer mit der ersten Seite an. Wenn ich Zeitung lese, dann von hinten nach vorn. Ist eine komische Angewohnheit, mache ich aber schon ewig so. Hinten ist Sport.
Seit ein paar Monaten lese ich auch den Anzeigenteil, sehr gründlich. Der war früher nie so umfangreich. Ich lese nicht den Teil, in dem die Arbeitsuchenden inserieren. Ich suche selber einen Job. Job, sagt man jetzt. Früher hieß das Arbeit. Ich denk’ mir, das ist nicht nur ein anderes Wort. Einen Job macht man, weil man das Geld benötigt. Arbeit, na, du verstehst schon, Arbeit ist irgendwie ein Stück Leben, möcht’ ich mal sprechen.
Junger, dynamischer Maler, 36 Jahre, umfangreiche Berufserfahrung, zuletzt tätig an der Erdgasleitung Sojus, früher „Drushba-Trasse”; gute Russischkenntnisse, wenig Stasi-Kontakte ... Leck mich am Arsch, Marie.
Die haben uns verscheißert. Vater, die Scheune brennt! Die haben uns so gründlich verscheißert, dass man nur noch heulen könnte oder um sich schlagen, falls es nützen würde. Und das Schlimme an der Sache ist, dass wir es gewusst haben mussten, wenn wir ihr Gedöns nicht so gern gehört hätten, weil es, wenn es so gewesen wäre, wie die uns immer erzählt haben, schön gewesen wäre. Oder nicht?
Zum Beispiel: Freundschaft zur Sowjetunion. Drushba. Von der Sowjetunion lernen ... Naja, das habe ich gesehen, gründlich im unergründlichen real existierenden Schlamm von Berjozka. Aber Nina. Wie ging das Gedicht im Russischbuch? „Nina, Nina, tam kartina. Eto traktor i motor.”
Nina ist nicht bloß Drushba, Nina ist Ljubow, Liebe, Golubtschik moi, mein Täubchen. Nina liest deutsche Zeitung, weil sie deutsch lernen will; sie will eine richtige Deutsche werden in diesem richtigen Deutschland. Bloß nicht zurück, nasad, nie wieder Berjozka, in den Schlamm, grjas, das halbe Dorf fast blind vom Samogon, dem Selbstgebrannten. Und dieses Magasin, in dem das Fleisch neben dem Motorenöl liegt! Wenn es Fleisch gibt. Aber wann gibt es das schon?
Die Bettler auf dem Rynok, dem Markt. Dieses beschissene Grün, sofern überhaupt Farbe an den windschiefen Zäunen ist. Diese gottverdammte, dreckige, russische Armut! Und diese traurigen Lieder, wenn sie besoffen genug sind vom Feiern, weil jemand geheiratet hat oder gestorben ist oder geboren wurde.
Sie feiern so schön. Das können die wirklich. Mann, wenn ich an unsere Hochzeit denke! Ich konnte erst nach einer Woche wieder feste Nahrung zu mir nehmen. Aber es war schön. Vater, die Scheune brennt, es war ja so schön ...
Stoi, Oleg, nix mit Nostalgie. Nostalgie! Und schon gar nicht Ostalgie. Konjez, aus, finish. Nie wieder Russland oder Ukraine. Da verstehe ich Nina.
Auf der Baustelle, bei uns im Lager, das war etwas anderes. Das war immerhin noch irgendwie Deutschland. Wir haben damals schon Deutschland gesagt, wenn wir besoffen genug waren. Oder wir haben gesagt: Heimat. „In der Heimat, in der Heimat, da gibt’s ein Wiedersehn!” - Ist so ein Lied, das kennst du auch.
Stefan Macher, der Natschalnik, hat mal versucht, uns das Lied auszureden. Hätten die Nazis gesungen, hier, damals. Die Nazis, hat er gesagt, um klar zu machen, dass es nicht wir waren, DDR, du verstehen? Irgendeiner hat ihn damals gefragt, ob die Faschisten nach dem Krieg alle Bundesrepublik geworden sind und wir, also die guten Deutschen des Widerstands, DDR. Oder hat er Osten gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass Stefan getobt hat, was selten vorkam, von wegen, was für Jugendfreunde uns neuerdings an die Trasse geschickt würden.
Und da hat ein anderer das wunderschöne Lied angestimmt „Unsre Barrikade ist die Tasse! ” - Die Tasse, was „Hoch die Tassen!“ meinte, nicht die Trasse, wie es natürlich richtig heißt. Na, das Gefeixe! Und Stefan ist rausgegangen.
In der Heimat, haben wir gesagt, weil wir mit dem Kürzel DDR nicht viel am Hut hatten. Wer nennt sein Vaterland schon mit der Abkürzung. Ob die Amis USA sagen oder nicht doch Iowa, New York, California. Und die Russen können SU nicht mehr sagen oder USSR, Union Sowjetskich Sozialistitscheskich Respublikach, weil es die Union der Sowjetischen Sozialistischen Republiken nicht mehr gibt. Es gibt ja auch keine DDR mehr. Wir sind jetzt Deutschland. Und ich bin arbeitslos.
Nina legt plötzlich die Zeitung auf den Tisch, vorsichtig, und blickt mich erstaunt an. „Stefan Macher. Deinen Stefan Macher, Oleg. Den haben sie umgebracht. Es steht in der Zeitung.“
Ich spüre, wie mir das Blut aus dem Kopf weicht. „Stefan?”, sage ich mit kratziger Stimme. „Stefan Macher? Doch nicht unseren Natschalnik von Berjozka? Zeig mal her!”
Ich reiße die Zeitung zu mir herüber, stoße dabei fast ihr Teeglas um, finde den Artikel sofort und lese halblaut vor: „Bau-Unternehmer Stefan Macher tot aufgefunden. Wie wir erst jetzt erfuhren, wurde am vergangenen Mittwoch der Bau-Unternehmer Stefan Macher (57) tot in seinem Büro aufgefunden. Nach Aussagen der Polizei dürfte es sich um einen Raubüberfall gehandelt haben. Vermutlich sind die/der Einbrecher von ihrem späteren Opfer überrascht worden, als sie den Tresor aufbrachen und ausraubten. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Stefan Macher hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Er galt als einer der erfolgreichsten Unternehmer in den neuen Bundesländern und hatte auch gute internationale Kontakte vor allem in die osteuropäischen Staaten aufgebaut.”
Ich falte das Blatt sehr ordentlich zusammen, was sonst nicht meine Art ist, aber ich brauche Zeit zum Nachdenken. Und dann fällt mir nichts Geistreicheres ein, als zu sagen: „Stefan Macher. Nu is’ er totgeblieben.”
Nina hat Sinn für Pietät. Sie lässt ihr angebissenes Brot liegen. Sie nimmt auch nicht die Zeitung, um weiterzulesen. Sie kriegt diese traurigen russischen Augen, diese Baikal-See-Augen, wie ich einmal gesagt habe, und es fehlt nur noch, dass sie anhebt: „Herrlicher Baikal, du heiliges Meer ...” Das soll Stalins Lieblingslied gewesen sein. Nina ist ein Seelchen. Sie sagt: „Er war ein guter Mensch.”
Ich will widersprechen, weil ich denke, dass ich ihn besser gekannt habe. Doch ich sage etwas anderes: „Ich war neulich bei ihm”, sage ich, „wegen Arbeit und so. Er hatte nichts für mich. Er hat gesagt, dass das jetzt eine verdammt harte Zeit ist, in der jeder sehen muss, wo er bleibt." Ich sage nicht, was er noch gesagt hat, dass es wahrscheinlich das Beste wäre, wenn ich versuchen würde, wieder einen Job in der Sojus zu finden. Ich weiß gar nicht, wie dem das Wort Sojus über die Lippen kommen konnte, so pikfein wie der aussah. Ich kannte ihn ja meistens hemdsärmelig, manchmal sogar im Blauhemd trotz seiner gut fünfzig Jahre damals. „Freund der Jugend“, hat er sich genannt. Aber als der „Sojus” sagte, schien mir, dass das Wort aus einem anderen Kopf käme.
Er hat nämlich gesagt: „Du solltest deine Nina und das Kind nehmen, in die nächste Maschine steigen und zurückfliegen in die Sojus. Das hier ist kein Land mehr für dich, Oleg”, hat er gesagt. Wirklich: Oleg. Und den Satz hätte ich ihm fast geglaubt, wenn dieser feine Anzug nicht gewesen wäre und das glatte Gesicht. Siehst du, den Trassenschnauzer, das fällt mir erst jetzt ein, den hat er sich stylen lassen. An der Trasse wuchs uns das Kraut fröhlich aus der Larve, ihm auch. Er hat ihn sich auf elegant trimmen lassen. Stefan Macher, erfolgreicher Bau-Unternehmer, vormals Genosse, jetzt Herr Macher, hat keinen Job für mich; ich solle zurück in die Sojus mit meiner Nina, als ob ich nicht in dieses Land gehöre, in sein Land, Deutschland. Naply wat na eto! - habe ich gesagt. Spuck drauf! Das haben wir uns so angewöhnt, immer mal ein paar Brocken Trassenrussisch dazwischengemumpelt. Naply wat na eto.
Nina - als ob sie meine Gedanken lesen kann -, Nina sagt plötzlich: „Aber wir gehen nicht zurück, Oleg? Wir bleiben hier, ja? Du wirst Arbeit finden, Oleg. Du bist fleißig. Du bist tüchtig. Es geht uns nicht schlecht.” Und leise fügt sie an: „Nasad chodu net.” Es gibt kein Zurück.
Nein, denke ich, es gibt kein Zurück. Aber gibt es noch ein Vorwärts für mich?
Mir fallen schon den ganzen Tag diese blöden Lieder ein. „Du hast ja ein Ziel vor den Augen.” Mir ist, als wäre ich die Zielscheibe, auf die geschossen wird, während ich dieses Lied aus mir herausgröle. Die Zielscheibe singt das Gewehr an, als wäre es umgekehrt mit dem Schießen. Dabei sehe ich doch, wie der Zeigefinger den Hahn spannt, ganz langsam. Gleich knallt es, pass mal auf. Diese unendlich beschissene Melodie dieses unendlich beschissenen Liedes. „Damit du weißt, was du machen sollst.” Das ist vielleicht ein blödes Gefühl. Jetzt krümmt sich der Zeigefinger durch. So-jus! - schreit einer, als befehle er: Feu-er! Jetzt weiß ich, wie er das gemeint hat. „Damit du einmal besser leben wirst!” Haha.
„Ich muss raus”, sage ich zu Nina. „Ich muss an die frische Luft, sonst ersticke ich.”
Und sie begreift, dass ich allein gehen möchte. Sie denkt, es ist wegen Stefan Macher. Gutes Mädchen, die Nina, aber manchmal geht sie mir mit ihrer slawischen Seele mächtig auf die Ketten.
Was war der Grund? Warum habe ich mich vor sechs Jahren an die Trasse gemeldet? Man muss höllisch aufpassen, wenn man sich erinnern möchte, wie das einmal gewesen ist. Weil, wenn man nachdenkt, wie das damals war, man im Unterbewusstsein mitdenkt, was inzwischen alles gewesen ist. Und dann denkt einer, was er damals gedacht hat, fälscht gewissermaßen den Gehirnpass, um in das Land Eswareinmal zu kommen, und glaubt das ganze Gemenge von Damals und Inzwischen und Jetzt, möchte auch noch eine möglichst gute Rolle dabei spielen. Wer ist so ehrlich gegen sich selbst, bis es wehtut? Ich denke mir mal, dass kein Mensch in der Lage ist, sich an Gewesenes so zu erinnern, dass es in seinem Oberstübchen noch einmal exakt abläuft, wie es tatsächlich war. Die Sache mit dem Fluss, in den man nicht zweimal steigen kann, weil inzwischen eine ganze Menge Wasser dahingeflossen ist.
Möglicherweise geht es beim Erinnern gar nicht so sehr darum, das Gewesene noch einmal zutage zu fördern, als vielmehr, auf Kommendes vorbereitet zu sein. Das ist so, als wenn du in irgendeiner beknackten Lage nicht wusstest, was du antworten sollst, aber hinterher, ja, hinterher weißt du es. Und das erzählst du den Kumpels oder so, was du am liebsten gesagt hättest, aber du sagst nicht, dass es dir erst hinterher eingefallen ist. Du erzählst es einmal, zweimal, dreimal. Später erzählen andere, was du gesagt hast. Es ist aber nur das, was du gern gesagt hättest, worauf du bloß nicht gekommen bist. Und irgendwann weißt du es nicht mehr anders. Dann hast du es gesagt, nicht: hättest du gern. Soll mir mal einer erzählen, wieso das dermaßen kompliziert ist in der menschlichen Rübe.
Warum bin ich an die Trasse gegangen? Ich denke, weil ich mit fast dreißig Lenzen das Gefühl hatte: das kann es doch nicht gewesen sein. Und weil ich aus diesem Käfig heraus wollte. Nicht ganz vogelfrei, aber vielleicht in einen etwas größeren Käfig. War es das?
Oder weil ich in den hohlen Reden von Drushba doch noch ein paar interessante Töne mithörte, die ich vielleicht nur deshalb gehört habe, weil mir die Sache zu hohl klang und ich die schwachsinnige Hoffnung hatte, es möchte möglicherweise vielleicht eventuell doch etwas dran sein, weil es, wenn es so gewesen wäre, etwas Schönes gewesen wäre - oder nicht?
Oder ich behaupte heute, es hätte mir zu hohl geklungen, während es in Wirklichkeit meine Überzeugung gewesen ist, eingesogen mit der Muttermilch; denn Mama war eine gute Genossin, leider so früh gestorben, dass ich ihr nicht mehr sagen konnte, wie sehr ich vor Leuten, wie sie es sind, den Hut ziehe, obwohl ich ansonsten mit dem ganzen Brimborium nichts am Hut haben wollte. Aber ich lasse mir auch nicht einreden, es sei nur Brimborium gewesen, von Leuten, die sich nicht vorstellen können, dass es mehr war, weil sie es nicht wollen. Weil sie vielleicht selber aus nichts anderem als lächerlicher Hohlheit bestehen, nur eine andere Form von Brimborium, verstehen?
Es kann auch andere, sehr einfache Gründe gehabt haben: Geld. Auf einen Schlag das doppelte Gehalt, dazu Goldrubel; denn von den neun Rubel Tagegeld, die wir zu Hause außer dem regulären Lohn aufs Konto gezahlt bekamen, konnten wir täglich drei Rubelchen auf ein Genex-Konto klingeln lassen. Das war zwar noch nicht das richtige Westgeld, mit dem man, wenn man hatte, in Forum-Schecks umgerubelt, in jedem Intershop einkaufen konnte, aber der Katalog für die speziellen Geschäfte enthielt schon Sachen, die man normalerweise nicht bekam im Konsum oder so. Und dann: Vorzeitig eine Neubauwohnung, schneller ein Auto, bessere Gehaltsgruppe nach Abschluss des Einsatzes. Und alles diese Dinger. Das war es auch.
Alles zusammen und von allem etwas. Und, gib’s doch zu, Oleg, es hat dich mächtig gekitzelt, dass dir dieser Mensch aus der Kreisleitung, dieser Stefan Macher, gesagt hat, sie würden sich die Leute natürlich genau ansehen, die sie in die Sojus schicken. Sie nähmen nicht jeden, hat er gesagt. „Aber einen wie dich”, hat er gesagt, „den wüsste ich ganz gern an meiner Seite.”
Der Mann hat mir imponiert. Das war mein Problem mit Männern, die zu meines Vaters Generation gehörten, dass ich, wenn sie diesen väterlichen Ton anschlugen, eine seltsame Wärme spürte. Ich weiß nicht, wer mein Vater ist. Möglicherweise wusste es Mama auch nicht. Ich bin zu den Weltfestspielen in Berlin passiert oder so eine zentrale FDJ-Kiste. Da ging es wohl fröhlich zu. Mama war ein hübsches Mädchen. Und ein Kind von Traurigkeit ist sie gewiss nie gewesen, auch nicht mit ihrem dicken Bauch die Monate danach. Ich kann nicht wirklich sagen, dass mir der Vater gefehlt hat, denn ich hatte gar keinen verloren, den ich hätte vermissen können. Aber ich weiß, bei diesem Stefan Macher hatte ich später so ein Gefühl zwischen Liebe und Hass. Liebe, weil ich endlich so etwas wie einen Papa hatte - und Hass, weil er eben nicht mein Papa war.
Oleg, was geht in deinem Kopfe los? Was ist in Bewegung geraten? Wenn du so weitermachst, drehst du eines Tages noch durch und wirst meschugge. susmasschedschij, verrückt. Oder - bist du es schon? Nach allem, was passiert ist: ja. Du hast einen Sprung in der Schüssel, Oleg. Du nennst dich schon gar nicht mehr mit deinem richtigen Namen. Du tickst falsch, Otto Lehmann. Das werden sie dir zugutehalten müssen.
Es war ein Montag, der erste Montag im September vor sieben Jahren. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich an dem Tag wieder zur Arbeit gegangen bin. Ich hatte Urlaub gemacht, Camping, Mecklenburger Seenplatte. Ich kam früh in die Firma, hatte noch nicht den richtigen Bock auf Maloche, klar, nach so einem Urlaub, und da fing mich Kalle, unser Brigadier, gleich an der Tür ab, ehe ich mich umziehen konnte. Er machte auch nicht viel Federlesens, kaum dass er mich begrüßte. „Du sollst”, sagte er mit einem fragenden Unterton, „in die erste Etage kommen. Hast du was ausgefressen bei den Fischköpfen in Mecklenburg oder so?”
„Erste Etage“ war eine Umschreibung für Generaldirektor des Baukombinats. Man sagte Erste Etage oder GD.
Ich kann mich nicht erinnern, dass mal einer Generaldirektor gesagt hat. Das war etwas für die Zeitung. Was sollte ich in der ersten Etage? Ich hatte keine Ahnung, aber sofort ein flaues Gefühl. Gehe nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst, dachte ich. Denke ich mir, dass ich es gedacht habe. Ich erinnere mich aber vor allem des dummen Gesichts von Kalle, der stets Gefahr witterte, wenn einer zu den Oberen gerufen wurden, ohne dass die Oberen ihm, Kalle, FDJ-nik und Brigadier, gesagt hatten, worum es ging. Und ich sagte ihm sinngemäß, dass es wohl darum gehe, weil ich doch Brigadier werden soll. Und das hat ihn mächtig getroffen, denn Kalle war gern unser Brigadier. Und noch lieber FDJ-Sekretär im Meisterbereich.
Nein, dachte ich, sie werden dich wieder belegen, dass du deinen Meister machen sollst, wozu ich aber keine Lust hatte. Ich meine, wer war denn schon so bescheuert, freiwillig Meister zu machen, weil doch jeder wusste, dass er weniger verdienen würde als seine Leute direkt auf dem Bau. Und dass er für jeden Scheiß verantwortlich gemacht wurde. Und dass er in die Partei eintreten musste, meistens jedenfalls. Und dass er von Lehrgang zu Lehrgang hechtete. Ich frage dich, was hat Malermeistern mit Marxismus-Leninismus zu tun? Und Geschichte der Arbeiterbewegung oder dialektischer und historischer Materialismus oder dieser ganze Schnulli?
Andererseits, dachte ich mir, schon auf dem Weg in die erste Etage, der GD wird sich wegen meines Meisterbriefs keinen Kopf machen. Der hat andere Sachen zu erledigen.
Deswegen will er mich doch nicht sehen, wo ich gerade aus dem Urlaub gekommen bin. Und das flaue Gefühl im Magen nahm zu. Es konnte nur etwas Unangenehmes sein. Und da war er wieder, dieser Schreck, der mir seither in den Knochen sitzt, wenn ich irgendwohin bestellt werde, wohin man mich sonst nicht ruft, eine höhere Instanz, um mir etwas persönlich mitzuteilen, was nicht irgendein Aktentaschenträger mitzuteilen hat, sondern jemand mit Einfluss, ein Höhergestellter. Wie ich damals direkt von der Baustelle weggeholt wurde, mit überhöhter Geschwindigkeit ins Krankenhaus, direkt zum Chefarzt, der mir mitzuteilen hatte, dass Mutter bei einem schweren Verkehrsunfall gestorben war. Ich kriege diesen Druck nie mehr los.
Ich klopfte an die Tür zum Vorzimmer und wartete. Erst beim zweiten Klopfen ertönte ein „Herein!’' Die Sekretärin der Sekretärin, oder wie man die sommersprossige Tippse zu nennen hat, sah nur kurz auf, machte ein Zeichen mit der rechten Hand Richtung Tür zum Nebenraum.
Ich klopfte und ging, als mir die Sommersprossige auffordernd zunickte, in den Raum. Da saß aber nicht der GD, wie ich gedacht hatte, sondern die richtige Sekretärin. Und die nickte mir auch freundlich zu, drückte eine Taste ihrer Wechselsprechanlage. „Der Jugendfreund aus der Malerbrigade”, sagte sie. Sie nannte nicht meinen Namen, das weiß ich noch. Und ich dachte damals, daran erinnere ich mich auch ziemlich genau: Scheiße. Ich dachte wirklich Scheiße, weil ich mir sagte, wenn man nicht einmal mehr deinen Namen wissen will, wenn du nur noch „der Jugendfreund aus der Malerbrigade” bist, dann kann es eigentlich bloß politisch sein.
Ich hab’ mal gelesen, dass einer, wenn er aus großer Höhe abstürzt, sein ganzes Leben wie einen Film ablaufen sieht, natürlich in ungeheurer Geschwindigkeit, Zeitraffer gewissermaßen. Das soll erzählt worden sein von Leuten, die so einen Sturz überlebt haben.