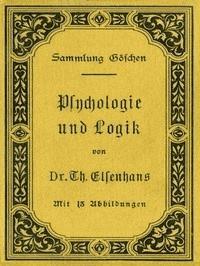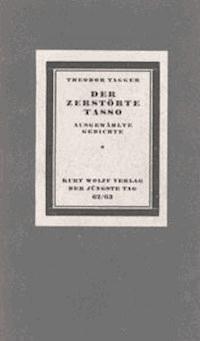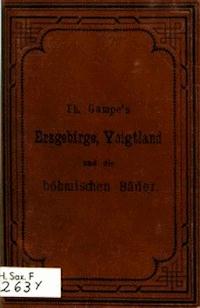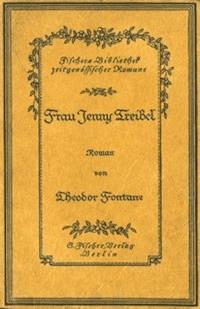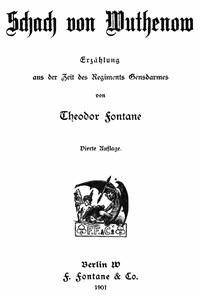Der Vampyr, oder: Die Todtenbraut. Erster Theil. Ein Roman nach neugriechischen Volkssagen E-Book
Theodor, Hildebrand
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Ähnliche
DerVampyr,oder:Die Todtenbraut.
Ein Romannach neugriechischen Volkssagen.
VonTheodor Hildebrand.
Erster Theil.
Leipzig, 1828.bei Christian Ernst Kollmann.
DerVampyr,oder:Die Todtenbraut.
Erstes Kapitel.
Ein unglückliches, aber unverdientes Schicksal zwang den russischen Obersten Alfred Lobenthal, im Jahr 1818 seinen Abschied zu nehmen. Er begab sich nach Berlin, seinem Geburtsorte, wo er gern sein Leben beschlossen haben würde; aber sein Verhängniß hatte es anders über ihn bestimmt. Nach einem kaum halbjährigen Aufenthalte in dieser prächtigen Königsstadt trat Alfred eines Morgens tief bekümmert in das Zimmer seiner Gemahlin und kündigte ihr an, daß eine gebieterische Nothwendigkeit ihn zwinge, Berlin zu verlassen und in einer entfernten Gegend einen einsamen Aufenthaltsort zu suchen, wo sie in Ruhe und Frieden leben könnten.
Helene, die Gemahlin des Obersten, erschrak über diese Neuigkeit, aber sie verlor den Muth nicht. Sie liebte ihren Gatten zärtlich, und ward eben so von ihm wieder geliebt; den übrigen Theil ihres Glücks machten ihre Kinder aus, und wo sie sich auch befinden mochte, so war sie zufrieden, wenn sie nur von ihren Lieben nicht getrennt wurde; die Augenblicke der Muße, die ihr die Pflichten als Mutter und Hausfrau noch übrig ließen, drohten nirgends, ihr Langeweile zu machen, weil Musik und Malerei diesen Feind der Ruhe von ihr verscheuchen konnten. Daher war sie auch eben nicht betrübt, als sie die unerwartete Neuigkeit erfuhr; kaum fragte sie ihren Gatten nach der Ursach dieses plötzlichen Entschlusses. Nur das wünschte sie zu wissen, ob vielleicht seine politischen Meinungen abermals Alfred’s Sicherheit in Gefahr setzten. Nachdem sie hierüber beruhigt worden, und erfahren hatte, daß der Bankerott eines bedeutenden Handelshauses ihn um einen großen Theil seines Vermögens bringe, weßhalb es nothwendig sei, einige Jahre in der größten Zurückgezogenheit zu leben: umarmte sie ihren Gatten voll Zärtlichkeit und versicherte ihn, daß sie ohne Mühe das Geräusch der Hauptstadt mit der Einsamkeit des Landlebens vertauschen würde.
Der Oberst betrieb seine Abreise mit der größten Eilfertigkeit. Er wollte nicht einmal den Verkauf seines prächtigen Mobiliar’s abwarten, sondern bat einen Freund, dieses Geschäft an seiner Stelle zu übernehmen; und schon am folgenden Tage nach der Mittheilung seines Entschlusses an seine Frau reisete er mit ihr und seinen Kindern, nur von einem einzigen Bedienten begleitet, ab, ohne von seinen Bekannten und Verwandten Abschied genommen zu haben.
Sobald Alfred das Thor hinter sich hatte, schien er gleichsam von einer großen Last befreit zu sein. Seine Blicke, die unruhig hier und dort umherirrten, so lange er sich in der Stadt sahe, nahmen plötzlich den Ausdruck der Ruhe an, als er sich im Freien befand; er schien jetzt freier athmen zu können, und seiner Frau lebhaft die Hand drückend, rief er aus: „Endlich haben wir die Stadt im Rücken! O, wie verhaßt ist sie mir, wie lange dauerte mir die Zeit, bis der Wagen zum Thore hinausfuhr!“
— Ist es möglich, lieber Alfred, erwiederte seine Frau, daß du so sprechen kannst? Ist denn Berlin nicht mehr deine Geburtsstadt? Hat sie allen Reiz für dich verloren, da du doch sonst immer mit Entzücken von ihr sprachst? Ist sie nicht mehr dieselbe Stadt, und kann sie dir deßhalb mißfallen, weil sich unsere Lage geändert hat? —
„Ja, ich gestehe es, antwortete der Oberst, was mich sonst entzückte, mag ich jetzt kaum mit Augen sehen. Ich fühle, daß es mir unmöglich sein würde, nur noch einen Tag länger in Berlin zu bleiben.“
— Nun, so sei doch jetzt zufrieden, da wir diese dir so verhaßte Stadt schon im Rücken haben. Möchtest du in einer andern deine Ruhe wiederfinden, und alle unangenehmen Erinnerungen vergessen! —
„Von welcher Stadt sprichst du denn, mein Kind?“
— Nun, von derjenigen, in welcher wir künftig wohnen werden. Wir befinden uns auf der Straße nach Potsdam; willst du vielleicht nach Dresden, nach Leipzig, oder noch weiter? —
„Ach, liebe Helene, sagte der Oberst verlegen, es wird mir schwer, dich ganz mit dem Opfer bekannt zu machen, das du mir bringen sollst. Denkst du, ich verlasse Berlin, um in einer andern Stadt zu wohnen? Ach nein, in meiner Lage gefällt mir nur die Einsamkeit! Liebe Helene! wirst du dich nicht über meinen grausamen, Entschluß beklagen? Ich will eine abgelegene ländliche Wohnung suchen, wo nichts ....“
Eine plötzliche Röthe überzog bei diesen Worten die schönen männlichen Gesichtszüge des Obersten; er hielt mitten in seiner Rede inne, und sahe Helenen mit einem unbeschreiblichen Blicke an, in welchem indessen die schmerzhaftesten Empfindungen nicht zu verkennen waren.
Helene würde sich vielleicht hierüber beunruhigt haben, wenn sie geglaubt hätte, daß geheime Ursachen dem Schmerze ihres Gatten zum Grunde lägen. Allein sie wußte, wie sehr ihm der Verlust eines Theils seines Vermögens, bloß aus Liebe zu ihr und ihren Kindern, zu Herzen ging; sie kannte seine Zärtlichkeit für sie, und fürchtete, daß es ihn bekümmern möchte, sie mitten aus den Vergnügungen der großen Welt in die Einsamkeit des Landlebens zu versetzen. Ohne daher weiter über Alfreds Betragen nachzudenken, hielt sie sich bloß an den Schein, und sagte, ihrem Gatten die Hand drückend:
„Beruhige dich, lieber Alfred; mir ist wenig daran gelegen, welchen Winkel der Erde ich bewohne, wenn ich nur mit dir und meinen Kindern bin. Meine Pinsel und Farben sind hier in diesem Kästchen, meine Harfe wird mir nachgesandt: was könnte mir nun noch zu meinem Glücke fehlen?“
— Wie, theure Helene, du fürchtest dich nicht vor dem einsamen Landleben? —
„Es würde der Fall sein, wenn ich von den drei mir theuren Wesen entfernt wäre; mit ihnen ist meine Zufriedenheit stets vollkommen.“
— O, von welcher Unruhe befreist du mich; denn ich glaube, daß du aufrichtig sprichst! Wohlan, so gestehe ich dir, daß nur die Einsamkeit und Zurückgezogenheit meinem jetzigen Zustande anpassend ist, daß ich der Entfernung von allem Geräusche des Lebens bedarf. Ich will also einen Zufluchtsort aufzufinden suchen, der nicht so nahe bei einer Stadt liegt, daß man uns belästigen wird, der aber auch nicht allzuweit entfernt ist, um aller Annehmlichkeiten der Städte entbehren zu müssen, wozu insbesondere auch die Hülfe der Arzneikunst gehört, wenn die Gesundheit Wilhelms und Juliens (die Namen ihrer beiden Kinder) derselben bedürfen möchten. — —
„Nun, Alfred, und wo denkst du diesen Zufluchtsort zu finden?“
— In Böhmen, nicht weit von Prag. —
„Es scheint mir aber, daß du bei allen deinen früheren Reisen noch nie in dieser Gegend gewesen bist. Hast du dort vielleicht Bekanntschaften, und kennst du schon den Ort unseres künftigen Aufenthalts?“
— Nein, durchaus nicht; ich überlasse Alles dem Zufalle, und gerade, weil ich in Böhmen völlig unbekannt bin, reise ich dorthin. Ich hoffe, daß so meine Spur völlig verloren gehen wird, daß ich dort keiner Verfolgung ausgesetzt sein werde ... denn der Anblick der Menschen ist mir jetzt verhaßt. Ach, könnte ich die Vergangenheit aus meinem Gedächtnisse verwischen! Theure Helene, wie sehr wünschte ich, nur für dich gelebt zu haben! —
Diese zärtlichen Worte, die ihrer Natur nach Helenen nur angenehm sein konnten, brachten indessen in ihrem Herzen eine gerade entgegengesetzte Empfindung hervor. Der Ton, mit welchem ihr Gemahl sie ausgesprochen hatte, schien einen bittern Vorwurf gegen sie selbst anzudeuten, und seine Physiognomie sagte dabei mehr als seine Worte. Helene liebte ihren Mann noch, wie in den ersten Tagen ihrer Ehe; bis jetzt hatte sich in ihrem Herzen noch nie eine eifersüchtige Empfindung geregt, weil Alfreds Betragen sie überzeugte, daß sie allein in seinen Gedanken herrschte; aber diese Ruhe konnte von einem Augenblick zum andern getrübt werden. Helene hatte bis jetzt noch nie ernstlich über das Leben ihres Mannes nachgedacht, das er vor der Bekanntschaft mit ihr geführt haben könnte; sie wußte, daß ein junger, hübscher Offizier nicht anders als eine Menge verliebter Abentheuer gehabt haben konnte; aber sie glaubte, daß Alfred nicht Zeit gehabt hatte, sich Gefühlen hinzugeben, die nur dann erst gefährlich werden, wenn sie lange dauern. In dieser Hinsicht war also Helene frei von Unruhe; indessen stieg ihr doch jetzt der unglückliche Gedanke auf, daß wohl eine ältere Liebes-Intrigue ihren guten Theil an der so plötzlichen Reise, die einer übereilten Flucht glich, haben könnte.
Wie auch die Gedanken Helenens in dieser Hinsicht gewesen sein mochten, so hütete sie sich doch wohl, sie laut werden zu lassen; sie suchte vielmehr, sie zu unterdrücken, indem sie ein gleichgültiges Gespräch anfing. Hierbei kamen ihr die Fragen ihrer Kinder zu Hülfe, und Alfred, der sich über ihr unschuldiges Geschwätz freuete, suchte ihre Neugierde zu befriedigen. Der Oberst bemerkte indessen, daß die Miene seiner Gemahlin ernster und nachdenkender geworden war; da er diesen Anschein von Kummer nur ihrer Abreise von Berlin zuschrieb, so gab er sich alle Mühe, sie durch seine Zärtlichkeit wieder aufzuheitern, was ihm auch so gut gelang, daß Helene, von seiner Liebe zu ihr gerührt, alle ihre leeren Muthmaßungen bei Seite warf, und sich ganz dem Glücke überließ, mit ihrem Gatten und ihren Kindern leben zu können.
Zweites Kapitel.
Kaum war die Familie in Prag angekommen, so verlor der Oberst auch keinen Augenblick mehr, die einsame Wohnung ausfindig zu machen, nach welcher er sich so herzlich sehnte. Er wendete sich an einen Kommissionär, um zu erfahren, ob er irgend eine ländliche Wohnung, entfernt von allen großen Straßen, aber doch nicht zu weit von der Stadt entlegen, miethen oder kaufen könnte; und der Zufall entsprach hierbei völlig seinen Wünschen. Der Eigenthümer des Schlosses R...., in einer romantisch schönen und fruchtbaren Gegend, ungefähr zwei Stunden von Prag, bewohnte dieses uralte Gebäude nicht; vergebens hatte er schon seit längerer Zeit Liebhaber des Landlebens gesucht, aber bis jetzt noch keinen Miether finden können; daher ging er auch leicht in die Bedingungen ein, die ihm der Oberst Lobenthal machte, und der, kaum unterrichtet, daß das Schloß zu vermiethen sei, dahin geeilt war, um es zu besichtigen. Entzückt von seiner Lage, die ganz so war, wie er sie wünschte, errichtete Alfred sogleich einen Miethsvertrag in gehöriger Form, und begab sich mit seiner Familie nach seiner neuen Wohnung. Die nöthigen Möbel, einfach aber bequem, nicht prächtig, aber geschmackvoll, hatte er in der Stadt gekauft, und ließ sie unter Aufsicht eines alten Unteroffiziers von seinem Regiment nachkommen. Dieser, Namens Werner, ebenfalls ein Deutscher, ein tapferer Soldat, war schon früher in Rußland mit einer kleinen Pension verabschiedet worden; allein aus Anhänglichkeit an seinen Obersten, der ihm einst in einer Schlacht das Leben gerettet hatte, wollte er schlechterdings das Schicksal desselben theilen, und er nahm bei ihm weniger die Stelle eines Bedienten, als eines treuen und völlig ergebenen Freundes ein. Eine Köchin und ein Hausmädchen, beide in Prag in Dienst genommen, machten das Hauswesen des Obersten vollständig; denn Helene und ihr Gemahl hatten auf allen Luxus verzichtet, weil er durchaus keinen Reiz mehr für sie gewährte.
Die ersten Tage nach ihrer Ankunft im Schlosse R.... verflossen unter Beschäftigungen, die gewöhnlich mit der Veränderung des Wohnsitzes verbunden sind. Die Arbeiter waren in jener Gegend selten zu haben, oder ungeschickt, und die ganze innere Einrichtung beruhte daher auf des Obersten und Werners Thätigkeit. Sie leimten die Tapeten an, hingen die Spiegel auf, stellten die Möbel an ihren Ort, schlugen die Betten auf, u. s. w. und ihre Hände, nur gewohnt, die Waffen zu führen, wußten sich äußerst geschickt der Werkzeuge friedlicher Arbeiter zu bedienen.
Auch Helene war ihrerseits nicht müßig; die Wäsche, die Küche, die Speisekammer gaben ihr vollauf zu thun; sie vernachlässigte nichts, und indem die beiden Gatten so mit einander arbeiteten, verschönerten sie ihre Zeit durch die Ergießungen ihrer Zärtlichkeit und durch die Glückseligkeit eines vollkommnern gegenseitigen Vertrauens. Doch mitten unter diesen leichten Arbeiten verdunkelte oft eine plötzliche Erinnerung die heitere Stirn des Obersten; ein unwillkührliches Erbeben, das er sogleich wieder zu unterdrücken suchte, bewies, daß ihn ein geheimer Kummer drücken müsse, und mehr als einmal mußte Helene ihr Gesicht abwenden, um ihrem Gatten nicht noch mehr Unruhe zu verursachen, wenn er sähe, daß sie seinetwegen ebenfalls bekümmert sei.
Oefters schien Alfred wieder völlig heiter zu sein; die Gegenwart seiner Kinder machte ihm Vergnügen, und sehr häufig nahm er an ihren unschuldigen Spielen Theil; bald beschäftigte er sich mit seiner Flöte, bald durchstrich er, von einem Jagdhunde begleitet, die zahlreichen umliegenden Thäler und Berge. Hier aber, von dickem Gebüsch umgeben, setzte er sich oft am Fuße einer Eiche nieder, und überließ sich seinen Träumereien, welche dann mehrere Stunden lang dauerten. Erst die einbrechende Abenddämmerung, oder einige vorübergehende Landleute weckten ihn aus seinem fast bewußtlosen Zustande; er schlug sich dann heftig vor die Stirn, und eilte schnellen Schrittes nach dem Schlosse zurück.
Hätte Helene nur Geschmack für die Vergnügungen der großen Welt gehabt, so würde sie sich in ihrem jetzigen Aufenthalte äußerst unglücklich gefühlt haben. An Gesellschaft war hier wenig zu denken; die in der Nähe wohnenden Herrschaften kamen nur im Sommer auf’s Land, und sechs Monate lang im Jahre würde es Niemand von ihnen gewagt haben, sich zwischen die Berge und Felsen zu begeben, die im Winter fast gänzlich unzugänglich waren. Wir haben aber schon gesagt, daß Helene in sich selbst vortreffliche Hülfsmittel zum Zeitvertreib fand. Wenn das Hauswesen ihre Thätigkeit nicht in Anspruch nahm, so vergnügte sie sich durch Musik, Malerei und das Lesen der besten Werke unserer schönen Literatur, oder sie fand hinreichenden Genuß in der Gesellschaft ihres Mannes und ihrer Kinder.
Ein ganzes Jahr verging, ohne daß irgend eine außerordentliche Begebenheit eine Abwechselung in dem stillen und einförmigen Leben der Familie Lobenthal hervorgebracht hätte. Je mehr die Zeit verfloß, desto mehr erlangte der Oberst seine Ruhe wieder, und keine unangenehme Erinnerung schien ihn mehr zu belästigen. Helene, die ihren Gatten sehr genau beobachtet hatte, freute sich heimlich darüber. Nur selten war Alfred jetzt vom Schlosse abwesend; er ging nicht mehr so häufig, wie im Anfange, auf die Jagd, sondern war fast immer bei seiner Frau und seinen Kindern, mit deren Erziehung er sich beschäftigte; zum Zeitvertreib ließ er sich auch die Verschönerung des Schloßgartens angelegen sein, den er mit mehreren seltenen und schönen Blumen bereichert hatte.
Auch der Winter war an diesem einsamen und abgelegenen Orte für Alfred und Helenen nicht ohne allen Reiz, denn sie verstanden, sich selbst genug zu sein. Wenn der häufig fallende Regen die Wege in der Umgegend so verdorben hatte, daß es völlig unmöglich war, spazieren zu gehen, so diente der weite Saal des Schlosses zum gymnastischen Tummelplatz, wo Vater und Kinder sich für die körperliche Ausbildung der letztern heilsamen Leibesübungen überließen. Ohne Unterlaß hallte dann von den langen und hohen leeren Wänden ein lautes und herzliches Gelächter wieder. Den Stunden des Vergnügens folgte ein lehrreicher Unterricht; die Abende verflossen unter angenehmen Erzählungen, womit Helene ihre beiden kleinen aufmerksamen Zuhörer in Erstaunen setzte, und voll Entzücken betrachtete dann Alfred dieses Gemälde der häuslichen Glückseligkeit. Man achtete nicht der Stürme, des Schnees und Regens, der gegen die Fenster prasselte, und nach und nach verschwand jede Erinnerung an eine bittere Vergangenheit.
Auch der nächste Frühling verfloß in dieser angenehmen Ruhe. Um die Mitte des Monats Juli erhielt aber der Oberst einen Brief, der ihn mit neuem Kummer erfüllte. Er hatte eine Schwester, die in Stettin an einen königlichen Beamten verheirathet war. Gegenseitiges Unrecht unter den beiden Gatten, die beide noch jung und vielleicht Sklaven ihrer Leidenschaften waren, hatte schon mehrere unangenehme Auftritte unter ihnen herbeigeführt, die sich noch täglich vervielfältigten. Ein gemeinschaftlicher Freund dieser beiden Unglücklichen, der einen öffentlichen Ausbruch ihrer Uneinigkeiten fürchtete, hielt es für seine Pflicht, den Obersten von dem, was vorging, zu benachrichtigen. Er forderte ihn auf, keine Zeit zu verlieren, und nach Stettin zu eilen, weil, wie er glaubte, seine Gegenwart allein im Stande wäre, die beiden Gatten auf die Dauer wieder mit einander zu versöhnen.
Dem Obersten kam diese unangenehme Mittheilung sehr ungelegen. Es schien ihm zu hart, sich aus dem Schooße seiner glücklichen Familie entfernen zu sollen, um wieder in die Welt zurückzukehren, deren verhaßtem Geräusch er nun schon entgangen war. Zwar machte ihm sein Herz Vorwürfe wegen seiner Gleichgültigkeit gegen seine junge Schwester, für die er die Stelle eines Vaters zu vertreten hatte; er fühlte, wie nützlich ihr sein guter Rath sein könnte, wodurch er vielleicht im Stande wäre, sie vor dem Abgrunde des Unglücks zu bewahren, dem sie unbedachtsam entgegen zu eilen schien; allein von der andern Seite sollte er sich von seiner zärtlichen Gattin, von seinen Kindern auf unbestimmte Zeit entfernen; das Opfer war ihm zu groß. Er wußte lange nicht, was er thun sollte; ehe er indessen einen Entschluß faßte, suchte er durch schriftliche Ermahnungen auf seine Schwester einzuwirken. Solche Vorstellungen konnten aber da kein Gehör finden, wo heftige Leidenschaften laut ihre Stimmen erhoben; die beiden Gatten klagten einander gegenseitig in den Antworten an, die sie ihrem Schwager zukommen ließen, und dachten nicht daran, sich wieder auszusöhnen. Endlich gedieh ihre Uneinigkeit auf einen solchen Punkt, daß Alfreds Schwester keinen Anstand nahm, das Haus ihres Mannes zu verlassen, und sich nach dem Landgute einer ihrer Freundinnen zurückzuziehen.
Drittes Kapitel.
A