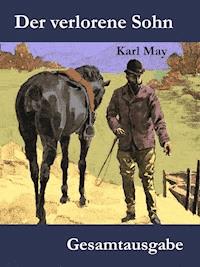
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karl Mays Kolportageromane
- Sprache: Deutsch
»Der verlorne Sohn oder Der Fürst des Elends« war der dritte Kolpor-tageroman, den Karl May für den Dresdener Verleger H. G. Münchmeyer schrieb. Der Krininalroman mit einem Umfang von insgesamt 2411 Seiten erschien erstmals von August 1884 bis Juli 1886, eingeteilt in 101 Lieferungshefte. Der hier vorliegendeText entspricht unverändert der im Münchmeyer Verlag erschienenen Erstausgabe des Romans. Der Roman erzählt die Geschichte des Förstersohns Gustav Brandt, der des Doppelmordes an seinem Gönner, dem Baron Otto von Helfenstein, und dem Verlobten von dessen Tochter Alma angeklagt ist. Brandt wird zum Tode verurteilt, später begnadigt, kann aber fliehen. Reich geworden kehrt er zwanzig Jahre später als geheimnisvoller „Fürst des Elends“ in seine Heimat zurück. Dort nimmt er den Kampf gegen den wahren Mörder von damals auf, den ominösen "Hauptmann", der in der Umgebung von Dresden (der sog. Residenzstadt des Romans) noch immer sein verbrecherisches Unwesen treibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 4021
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel Ein Doppelmord
2. Kapitel Das Opfer des Wüstlings
3. Kapitel Der Kampf um die Liebe
4. Kapitel Schlagende Wetter
5. Kapitel Ein Magdalenenhändler
6. Kapitel Eine Ballettkönigin
7. Kapitel Eine Tau-ma
8. Kapitel Am Spieltische
9. Kapitel Falschmünzer
10. Kapitel Krachende Stammbäume
11. Kapitel Gottes Strafgericht
12. Kapitel Ende gut, Alles gut!
Impressum
1. Kapitel Ein Doppelmord
Es war ein reizendes kleines Damenboudoir, in welchem das fröhliche Lallen eines Kindermundes eine Damenstimme beantwortete, deren zärtlich kosende Worte von einem wunderbar weichen und herzigen Wohlklang waren. Die drei Fenster des Zimmers eröffneten einen Ausblick auf den Wald, welcher ringsum das Schloß umgab mit seinen dichten Föhren, aus deren Dunkel hier und da eine bereits herbstlich gefärbte Eiche oder Buche hervorblickte.
An dem mittleren Fenster bildeten mehrere sorgsam gepflegte Efeustöcke eine allerliebste Laube, deren Ranken ein anmutiges, herziges Bild umrahmten. Dort saß nämlich eine junge Dame, in ihrem Schoße das kleine, liebliche Wesen, mit dem sie jenes rührende, wohlklingende Zwiegespräch hielt.
War sie die Mutter des Kindes? Die Zärtlichkeit, welche aus ihren schönen, blauen Augen strahlte und ihr reizendes Gesichtchen durchgeistigte, hätte leicht als bejahende Antwort gelten können; aber dieses Gesichtchen hatte so mädchenhafte Züge und einen solchen Ausdruck von Kindlichkeit und Unberührtheit, daß sich dieses Ja sofort in das Gegenteil verwandeln mußte. Von dem wunderbar schön und rein modellierten Kopfe dieser Dame wallte ein Haar hernieder, dessen goldenes, sonniges Blond ganz dieselbe Bewunderung verdiente, wie der seltene Reichtum und die ungewöhnliche Länge desselben.
Zuweilen gelang es dem kleinen, lebhaft zappelnden Knaben, mit den noch ungeübten Fingerchen eine Strähne dieses Haares zu erfassen. Dann jauchzte er laut auf vor Glück und sie drückte ihn fröhlich lachend an sich und gab ihm die süßesten Kosenamen. Sie sprach zu ihm, als ob er sie verstehen könne, und wenn er zufällig einen Laut von sich gab, welcher von der regen, liebevollen Phantasie für eine Antwort genommen werden konnte, dann belohnte sie dieses eingebildete Verdienst mit ungezählten Küssen ihrer schönen, frischen Lippen, deren sattes, volles Rot kaum von der Farbenpracht einer im Aufbrechen begriffenen Granate erreicht werden konnte.
Da wurde die Portiere zurückgezogen, und die Zofe erschien. »Gnädige Baronesse,« meldete sie, »Förster Brandt läßt anfragen, ob es ihm erlaubt ist, einzutreten.«
»Gewiß, gewiß!« antwortete die Gefragte. »Er weiß ja, daß er mir zu jeder Zeit willkommen ist.«
»Und sodann ist ein Paket angekommen. Es trägt das Postzeichen der Residenz. Vielleicht enthält es die erwartete Seidenrobe. Gestatten Sie mir vielleicht, es hereinzubringen?«
»Ja; aber vorher will ich den Förster empfangen, liebe Ella. Hier, trage das Brüderchen ins Kinderzimmer! Der kleine Schelm würde doch nur stören, wenn ich nachher das Kleid anprobe.«
Sie erhob sich, trat aus der Fensterlaube hervor und reichte der Zofe den Knaben hin.
In dieser Körperstellung kam ihre fast königlich zu nennende Gestalt zur vollen Geltung. Die Augen der Zofe blieben einen Augenblick lang an derselben haften und wendeten sich dann schnell und mit einem versteckten Aufblitzen hinweg. Es war, als ob sie sich bemühen müsse, eine neidische Regung zu verbergen. Sie ergriff das Kind und verließ das Zimmer.
Draußen stand der Förster, eine nicht zu hohe, aber kräftige und muskulöse Gestalt. Sein Gesicht war von den Unbilden des Wetters gegerbt und gebräunt und zeigte jene treuen ehrlichen Züge, welche Leute seines Standes häufig eigen zu sein pflegen. »Treten Sie ein,« sagte die Zofe und zwar in einem Tone, der gar nicht annehmen ließ, daß dieser Mann ihre Sympathie besitze.
Der Förster zog die Brauen in die Höhe, ließ ein leises, schalkhaftes Lächeln sehen und antwortete: »Jüngferchen, Jüngferchen! Sie verraten ganz das Zeug zum Kommandieren. Wer möchte da wohl gern Freier sein.«
Er trat bei der Baronesse ein, die Zofe aber tat, als habe sie seine Bemerkung gar nicht gehört und begab sich mit dem Knaben nach dem angegebenen Zimmer.
Sie hatte dasselbe noch nicht erreicht, als sich eine Tür öffnete und ein Herr aus derselben trat. Er war mittelhoch und schlank gebaut und mochte vielleicht achtundzwanzig Jahre zählen. Sein Gesicht konnte nicht unschön genannt werden, doch war für dasselbe auch nicht leicht eine große Sympathie zu empfinden. Es trug bereits die Spuren der Schnellebigkeit und leidenschaftlicher Erregungen. Als er die Zofe erblickte, blieb er, ihr in den Weg tretend, stehen.
»Ah, wie prächtig Ihnen so ein Knabe steht,« sagte er halblaut, als ob er sich fürchte, anderweit gehört zu werden, und in jenem vertraulichen Tone, welchen höher gestellte Herren hübschen Dienerinnen gegenüber zuweilen anzuschlagen pflegen. »Ich möchte Sie als Mama sehen!«
»Und ich Sie als Papa!« antwortete sie, halb schnippisch, halb kokett. »Jedenfalls würden Sie sich dazu besser als zum Cousin eignen.«
Es mußte in ihren Worten oder in ihrem Tone etwas liegen, was ihn frappierte, denn er trat einen halben Schritt zurück und fragte: »Wie meinen Sie das, Sie schöne, rätselhafte Teufelin?«
»Nun, fragen Sie sich selbst, ob Sie so gern der Cousin dieses kleinen Vetters hier sind! Oder sind Sie etwa so sehr enthusiasmiert für ihn?«
»Schlange! Das sollen Sie mir bezahlen!«
Er streckte den Arm aus, um ihn um ihre Hüften zu legen; sie aber entschlüpfte ihm mit einer allerdings schlangenhaften Bewegung. »Habe ich nicht Recht?« raunte sie ihm noch zu. »Ich denke, wir kennen uns!«
Dann eilte sie weiter und verschwand hinter der Tür des Kinderzimmers.
»Ein famoses Frauenzimmer,« flüsterte er, leise mit der Zunge schnalzend. »Üppig, schön, feurig und klug, aber leider fast ein wenig zu klug. Sie hat einen angeborenen Scharfsinn, der unter Umständen gefährlich werden kann. Es ist nicht gut, sie zur Feindin zu haben. Woher weiß sie doch nur, daß mir dieser fatale Junge ein Dorn im Auge ist? Ich habe mir ja nicht das Geringste merken lassen, obgleich mich dieses nachgeborene Vetterchen um die erhoffte Erbschaft bringt.«
Er stieg höchst nachdenklich die Freitreppe, welche nach dem Schloßhofe führte, hinab.
Der Förster war in das Zimmer der Baronesse getreten. Sie kam ihm freundlich entgegen, reichte ihm die Hand und fragte: »Sie bringen mir Antwort aus dem Forsthause, Papa Brandt?«
»Ja, gnädiges Fräulein. Meine Frau läßt sagen, daß sie kommen wird. Das versteht sich ja ganz von selbst!«
»Das freut mich sehr. Ich brauche die gute Mama sehr notwendig. Der König kommt mit Gefolge; viele andere Gäste sind zur Jagd geladen, so muß ich also alle verfügbaren Hände aufbieten. Sie waren bei meinem Papa?«
»Ja. Ich habe die letzten Anweisungen des gnädigen Herrn Barons betreffs des Jagdarrangements erhalten. Wir bieten den hohen Gästen zu Ehren alles auf, was wir vermögen. Ein Gast aber wird kommen, welcher mir lieber ist, als alle diese vornehmen Herren.« Er zwinkerte dabei vertraulich listig mit den Augen, als ob es sich um ein angenehmes Geheimnis handle.
»Lieber als diese alle? Wer mag das sein?« fragte sie.
»Hm! Eigentlich sollte ich es nicht verraten, aber die Freude macht mir das Schweigen zur Unmöglichkeit. Da, lesen Sie, gnädiges Fräulein!«
Er zog einen Brief aus der Tasche, den er ihr gab.
Sie hatte kaum einen Blick auf die Unterschrift geworfen, so flog das Rot der Freude über ihre Wangen. »Gustav!« rief sie. »Ah, Gustav kommt! Wie schön das ist! Wir haben uns so sehr lange nicht gesehen!«
»Und ich ihn noch viel länger nicht!«
»Ja; ich habe in der Residenz mit ihm gesprochen. Es ist zum Besuche, daß er kommt?«
»Nein. Bitte, lesen Sie!«
Sie wendete den Brief hin und her. Über ihr schönes Gesicht flog es beinahe wie eine kleine Verlegenheit, doch überwand sie dieselbe schnell.
»Was von Gustav kommt, darf nicht so flüchtig abgetan werden, lieber Papa Brandt,« sagte sie. »Wollen Sie mir den Brief nicht hier lassen? Ich bin jetzt anderweit so sehr in Anspruch genommen.«
Man sah es dem guten Manne an, daß ihn der Wunsch des schönen Mädchens ganz glücklich machte. »Ja, gern, sehr gern!« antwortete er. »Behalten Sie ihn hier, gnädiges Fräulein. Und da Sie so beschäftigt sind, will ich sogleich die Flucht ergreifen.«
»Doch nicht, ohne daß ich Ihnen vorher einen Gruß an die gute Mama Brandt mitgebe. Sie wird sich freuen, Gustav wieder zu sehen.«
Sie reichte ihm die Hand entgegen, die er zwischen die seine nahm, als ob sich diese Vertraulichkeit ganz von selbst verstehe. Und so war es auch. Sie hatte, von einer schwächlichen Mutter geboren, als Kind an der Brust der Försterin gelegen, und war somit die Milchschwester des Förstersohnes geworden, dessen Brief sie jetzt in den Händen hielt. Nach langer, langer Zeit, vor noch nicht ganz einem Jahre, war dann das kleine Brüderchen nachgekommen, doch hatte leider die Mutter, die Baronin von Helfenstein, die Geburt desselben mit dem Leben bezahlen müssen.
Kaum hatte sich der Förster entfernt, so eilte die Baronesse an das Fenster. Aus den Augen, welche auf dem Briefe ruhten, brach ein Blick des Glückes, so froh und hell wie ein warmer Sonnenstrahl. »Gustav, Gustav kommt!« flüsterte sie. »Wie herrlich! Er ist der einzige, der mich versteht, er und seine guten Eltern! Papa ist so ernst und seit Mamas Tode so verschlossen, und die anderen – ah, fast scheint es mir, als ob es nicht gar viele Menschen gebe, die man lieben darf!«
Sie öffnete den Brief und las ihn. Von Zeile zu Zeile erhöhte sich der glückliche Ausdruck ihres Gesichtes. »Ja, ja,« sagte sie dann zu sich. »Das stand zu erwarten. Er ist reich, sehr reich begabt und wird schnell Karriere machen. Er schreibt so bescheiden, aber man kennt ja seinen Wert!«
War es schwesterliche Freude oder war es etwas noch anderes – sie gab sich darüber keine Rechenschaft, aber ganz unwillkürlich hob sich ihre Hand mit dem Briefe, und ihre Lippen berührten die Stelle desselben, auf welcher sich die Unterschrift befand. Aber fast ganz in demselben Augenblicke senkte sich die Hand blitzschnell wieder herab: Die Zofe war eingetreten, einen Karton in den Händen tragend. Sie hatte den Kuß gesehen, tat jedoch so, als ob sie nichts bemerkt habe.
»Hier ist das Paket, gnädiges Fräulein,« sagte sie. »Darf ich öffnen?«
»Ja, tue es,« antwortete die Baronesse.
Sie hatte sich, dem Könige zu Ehren, welcher morgen zur Jagd erwartet wurde, aus der Residenz eine prachtvolle Robe verschrieben, welche jetzt dem Karton entnommen wurde. Die Blicke der Zofe hingen bewundernd an dem schweren Seidenstoffe und dem reichen Ausputze des Kleides, und als sie das letztere nun der Herrin zur Probe anlegen mußte, fand sie, daß sie ihrer ganzen Selbstbeherrschung bedurfte, um nicht den Neid bemerken zu lassen, der jetzt ihre Seele erfüllte. Dann, als die letzte Hand angelegt war, rief sie im Tone aufrichtiger Freude: »Wie herrlich! Wie köstlich! Das gnädige Fräulein können sich mit den Prinzessinnen aller königlichen und kaiserlichen Höfe messen. Dieses Kleid sitzt zum Entzücken schön. Seine Majestät werden die gnädige Baronesse Alma von Helfenstein reizend und bewundernswert finden!«
»Doch leider dich nicht auch!«
Diese Worte erklangen von der Portiere her. Dort stand der Baron Otto von Helfenstein, welcher, von beiden unbemerkt, eingetreten und die Worte der Zofe vernommen hatte. Seine Antwort hatte einen unfreundlichen, beinahe harten Klang. Er gab der Zofe einen Wink, sich zu entfernen und trat dann, als sie gehorcht hatte, näher. Jetzt erst wurde sein ernstes Gesicht freundlicher.
»Es ist wahr, liebe Alma,« sagte er »diese Robe kleidet dich ausgezeichnet. Aber diese Ella lobt zu überschwenglich. Sie hat mir nie gefallen. Sie hat so ein aalglattes, übergeschmeidiges Wesen, und ich kann mich für solche Charaktere nicht erwärmen. Ich glaube, sie ist falsch und heuchelt. Doch nicht, um dir dies zu sagen, komme ich zu dir, sondern aus einem anderen Grunde.«
Es geschah selten, außerordentlich selten, daß der Baron einmal die Gemächer seiner Tochter betrat. Geschah es ja einmal, so gab es ganz gewiß etwas sehr Wichtiges zu verhandeln. Daß dies jetzt auch der Fall sei, war ihm anzusehen.
Er schritt nach einem Fauteuil, nahm bedächtig darauf Platz und musterte dann die Gestalt Almas, welche in Erwartung des kommenden leicht an dem Damenschreibtische lehnend stand.
»Ich muß wirklich sagen, daß deine Figur eine tadellose ist,« meinte er, ihr zufrieden zunickend. »Man könnte vielleicht sagen, daß du eine Schönheit bist. Du brauchst da nicht zu erröten. Es ist ein Unterschied, ob ein Vater oder ein schmachtender Seladon diese Worte sagt. Ein Mädchen soll sich schmücken, soll aber auch wissen, für wen es sich schmückt. Hast du dir diese Frage vielleicht schon aufrichtig vorgelegt?«
Trotz der soeben gehörten Ermahnung des Vaters trat eine erneute Glut auf die Wangen des reizenden Mädchens. Was wollte, was beabsichtigte er? Wozu und warum diese eigentümliche Frage?
»Nun, magst du mir nicht antworten?« fuhr er fort.
»Aber Papa, ich verstehe dich nicht,« sagte sie, indem sie sich bestrebte, ihr inneres Gleichgewicht zu behalten.
»Täusche dich nicht selbst. Ich bin überzeugt, daß du mich verstehst!«
»Nun, verstehe ich dich recht, so meinst du, ob es eine bestimmte Person gibt, für welche ich mich schmücken möchte?«
»Ja, das meine ich allerdings.«
»Es gibt keine solche.«
»Das ist mir in gewisser Beziehung lieb, denn es erleichtert mir die Mitteilung, welche ich dir zu machen beabsichtige. Du bist ein verständiges Mädchen; ich habe nie bemerkt, daß du zu Phantastereien hinneigst. Du wirst ganz meiner Ansicht sein, daß unser bevorzugter Stand Rücksichten fordert, welche wir ihm nicht verweigern dürfen. Es kann vorkommen, daß diese Rücksichten mit unserem Herzen, mit unseren Sympathien in Konflikt kommen; aber wir sind dennoch gezwungen, ihnen Rechnung zu tragen.«
Er hielt einen Augenblick inne, wie um zu sehen, welchen Eindruck seine Worte auf die Tochter hervorgebracht hätten. Sie stand still vor ihm; ihre Augen ruhten fragend auf seinem Gesichte. Sie war um einen Schatten bleicher geworden, aber sie sagte nichts. Darum fuhr er fort: »Weißt du bereits, daß ich den Hauptmann von Hellenbach geladen habe?«
»Sein Name stand mit auf der Liste der Gäste.«
»Nun, ich verfolge mit ihm einen ganz besonderen Zweck, der für dich von allergrößtem Interesse ist. Sein Vater war mein intimster Freund, mein liebster Kamerad. Als er starb, machte er mich zum Vormund seines Sohnes und legte mir das Schicksal dieses letzteren an das Herz. Was hältst du von dem Hauptmanne?«
»Er ist kein Genie, aber ein Ehrenmann.«
»Ich sehe zu meiner Freude, daß du ihn richtig beurteilst. Genies pflegen die Ihrigen selten glücklich zu machen; ein Ehrenmann aber ist stets und vor allen Dingen darauf bedacht, seine beruflichen und familiären Pflichten zu erfüllen. Der Hauptmann ist dein Verlobter seit langer Zeit!«
Jetzt machte Alma eine Bewegung größter Überraschung. Ein einziger Augenblick hatte genügt, alles Blut aus ihren Wangen zu treiben. »Mein – Ver - lobter?« fragte sie beinahe stammelnd.
»Ja. Ich habe das seinem sterbenden Vater in die Hand versprochen. Du, als brave und verständige Tochter, wirst mir die Erfüllung meines Wortes nicht erschweren. Oder hättest du etwas gegen Hellenbach?«
»Nein,« antwortete sie, noch immer unter dem Eindrucke eines Schreckes, den sie zu verbergen suchte. »Ich habe nichts für und nichts gegen ihn.«
»Das ist die richtige Stimmung. Standesehen geht man kühl ein. Es ist das eine der wohlberechtigten Eigenschaften unseres Standes. Ich freue mich, daß du meine Eröffnung ohne alle Leidenschaftlichkeit entgegennimmst. Deine Antwort ist natürlich eine zustimmende, denn diese Verbindung erfüllt alle Ansprüche, welche man auf beiden Seiten vernünftigerweise zu machen berechtigt ist.«
Jetzt hatte Alma ihre Fassung vollständig wiedererlangt. Sie kannte ihren Vater. Er selbst hatte eine Konvenienzheirat eingegangen und mit ihrer Mutter in Eintracht, doch auch nicht in übermäßigem Glücke gelebt. Er trennte sich schwer von einem Plane; offener Widerstand erhitzte ihn. Im gegenwärtigen Falle war es am geratensten, äußerlich kühl zu bleiben und über das Weitere in aller Ruhe nachzudenken. Es war ihr, als hätte sie ein Schlag getroffen, ein Schlag ins tiefste Leben hinein, da hinein, wo bisher ein Geheimnis geruht hatte, dessen Lösung ihr noch niemals nahegelegt worden war. Sie verbarg das Gefühl eines plötzlichen Schmerzes, welches so schreckhaft über sie gekommen war, und fragte in möglichst gleichgültigem Tone: »Hat der Hauptmann davon gewußt?«
»Längst.«
»Und er hielt es nicht für der Mühe wert, mir eine Andeutung zu machen oder mich merken zu lassen, daß er ein nicht ganz gewöhnliches Interesse für mich hegt?«
»Wozu? Du warst ihm ebenso sicher wie er dir. Er ist ein stiller, überlegsamer Charakter und kein Brausekopf. Er weiß, daß ihr vortrefflich zusammenpaßt und hat ruhig abgewartet. Nun die Zeit gekommen ist, wird er mit dir sprechen. Er trifft bereits heute hier ein, und wie ich ihn kenne, kannst du dann sofort seine Eröffnung erwarten.«
Es legte sich ein beinahe bitteres Lächeln um ihren schönen Mund; ihre Finger zuckten krampfhaft in den seidenen Falten des Kleides, und ihr Busen hob sich unter einem tiefen Seufzer, den sie nicht zu unterdrücken vermochte. »Habt ihr beide nicht ein wenig unvorsichtig gehandelt, lieber Vater?« fragte sie. »Ich wußte nichts von eurem Plane. Wie nun, wenn ein anderer unterdessen meine Sympathie gewonnen hätte?«
»Sympathie, Zuneigung, Liebe – pah! Eine Baronesse von Helfenstein kennt ihren Rang und weiß ihn auch gegen solche menschliche Schwachheiten zu behaupten. Mir genügt die Überzeugung, daß ich mit dir zufrieden sein werde!«
Er war ein guter, freundlicher und splendider Vater, aber vor allen Dingen Edelmann. Die Standesrücksicht stand ihm wenigstens ebenso hoch wie die Sorge um das Wohl der Seinigen. Alma war wohl zwanzig Jahre lang sein einziges Kind gewesen, und er hatte ihr während dieser Zeit möglichst jeden Wunsch erfüllt. Nun aber verlangte er auch, daß sie sich heute seiner Verordnung füge. Er liebte sie, aber Robert, das nachgeborene Söhnchen, stand als Stammhalter seiner Sorge dennoch näher als sie. Darum befand sich das Kinderzimmer in unmittelbarer Nähe seines eigenen Kabinetts, und darum nahm er jetzt den Gehorsam seiner Tochter als etwas ganz Selbstverständliches an. Er sprach noch einen kurzen, nicht mehr als freundlichen Gruß aus und entfernte sich dann.
Alma blieb allein zurück. Sie brauchte sich nicht mehr zu beherrschen.
Der Ausdruck kalter Gleichgültigkeit wich aus ihrem Gesichte, und ihre Züge sprachen nun unverhohlen den Schreck aus, welcher sie bei der Eröffnung des Vaters ergriffen hatte. »Hellenbachs Braut!« flüsterte sie, indem sie sich leise schüttelte. »Und das so ganz plötzlich, so unvorbereitet! Man hat es nicht einmal für nötig befunden, es mich während dieser langen Zeit wissen zu lassen! Man hat über mich verfügt so eigenmächtig, wie man über die Besitzveränderung eines Pferdes bestimmt. Soll ich mich fügen? Kann ich mich fügen? Kann ich mit gutem Gewissen die Frau eines Mannes werden, dessen Glück mir nicht mehr am Herzen liegt, wie dasjenige eines jeden anderen Menschen?«
Sie trat an den Tisch und öffnete ein Album. Unter den darin befindlichen Fotografien befand sich auch diejenige Hellenbachs. Sie betrachtete dieselbe. »Nicht schön und nicht häßlich, nicht einmal interessant. Er ist ein Offizier gewöhnlicher Begabung, der seine Pflicht tut und in dreißig Jahren sich als Oberst pensionieren lassen wird. An diese unbefriedigende Existenz soll ich gefesselt sein! Was aber kann ich dagegen tun? Oh, Mutter, Mutter, lebtest du noch! An deinem Herzen würde ich nicht umsonst nach Rat und Trost verlangen. Diese kalte Selbstverständlichkeit des Vaters ist weit schlimmer, als wenn er hart und grausam wäre. Ich habe einen Vater, und dennoch bin ich einsam. Mein Herz ist ohne Schutz und Fürsprecher, und gleichwohl ist es ganz allein das Herz, welches über Glück und Unglück zu bestimmen hat.«
Ihr feucht gewordenes Auge war auf das Album gerichtet, in welchem ihre Hand planlos weiterblätterte. Da plötzlich belebte sich ihr Blick. Sie hatte ein Bild aufgeschlagen, welches wie eine stumme und doch beredte Antwort auf ihre Klage ihr entgegenblickte. Es war die Fotografie eines Jünglings mit schönen, hochinteressanten, geistreichen Zügen. Seine großen, dunklen Augen sprachen ebensowohl von einer tief empfindenden Seele wie von einer eigenartig ausgeprägten und hoch ausgebildeten Intelligenz. Das Auge des Beschauers war gezwungen, bei diesem Kopfe zu verweilen.
»Gustav!« sagte sie. »Bruder Gustav! Welch ein ganz, ganz anderes ist dieses Porträt! Er, der arme Försterssohn, hat ganz die Prärogative einer fürstlichen Abstammung.«
Je länger ihr Auge auf dem Bilde verweilte, desto inniger und liebevoller wurde der Blick des schönen Mädchens.
»Wenn er Hellenbach wäre!« flüsterte sie.
Sie blickte schnell um sich, als ob sie befürchtete, von jemand gehört worden zu sein. Sie hatte da einen Gedanken ausgesprochen, welcher zwar als leise, unbestimmte Ahnung in ihrem Herzen gelegen hatte, aber niemals zum greifbaren Ausdruck gekommen war. Und fortgerissen von dieser augenblicklichen Empfindung zog sie das Album empor und drückte einen Kuß auf die Fotografie. »Er kommt; er kommt ja! Bei ihm werde ich den besten Rat erlangen. Hier aber ist es mir zu eng; hier wird mir's bange: ich muß hinaus aus dem Zimmer!«
Sie legte, als gelte es dem Ersticken zu entrinnen, in schneller Hast die Seidenrobe ab und griff zu einem anderen Gewande.
Als die Zofe Ella vorhin durch den Wink des Barons aufgefordert worden war, das Zimmer zu verlassen, hatte sie geahnt, daß die Unterredung zwischen Vater und Tochter eine wichtige sein werde. Darum war sie auf den Gedanken gekommen, draußen zu lauschen, und – sie hatte alles gehört. Als sie bemerkte, daß der Baron gehen werde, hatte sie sich schleunigst entfernt. Jetzt kehrte sie zurück und beeilte sich, ihrer Herrin beim Umkleiden zu helfen.
»Ich promeniere nach dem Tannenstein,« sagte Alma, als sie fertig war. »Man wird mich jetzt wohl nicht bedürfen.«
Sie ging, und das Auge der Zofe folgte ihr, bis sie durch das Tor geschritten war.
»Da ist sie fort, die Braut Hellenbachs, die Schöne, die Unvergleichliche!« murmelte sie. »Sie sah nicht sehr glücklich aus! Und da das Album aufgeschlagen! Ah, das Bildnis Brandts! Sie hat ihn mit Hellenbach verglichen; sie liebt ihn!«
Die dunklen Augen der Zofe leuchteten in einem tückischen Lichte. »Und da,« fuhr sie fort, »ein Brief! Sie hat vergessen, ihn einzuschließen. Von wem mag er wohl sein?«
Sie nahm das Papier, öffnete es und las:
»Meine lieben Eltern!
Ihr wißt genau, in welcher Weise bei Euch da oben an der Grenze die Wilderei und Pascherei betrieben wird. Die Schmuggler ziehen in förmlichen bewaffneten Karawanen herüber und hinüber und liefern den Grenzern geradezu Gefechte. Man vermutet, daß sie eine feste Organisation und ein wirkliches Oberhaupt besitzen. Eine Eingabe des Herrn Barons von Helfenstein, in welcher er um außerordentliche Hilfe bittet, hat der Behörde vollends die Augen geöffnet. Man wird Militär detachieren und hat außerdem beschlossen, einen gewandten Polizeibeamten zu senden, der die heimliche Aufgabe zu lösen hat, den Verbrechern das Handwerk zu legen. Und denkt Euch mein Entzücken: Die Wahl ist auf mich gefallen. Ich habe schleunigst abzureisen und sende Euch kurz vor dem Einpacken diese Zeilen, um Euch von meiner Ankunft zu benachrichtigen. Wenn Ihr sie erhaltet, bin ich bereits unterwegs.
In herzlicher Liebe Euer glücklicher Gustav.«
Die Zofe legte den Brief zusammen und dann wieder an seine vorige Stelle. Es blitzte wie Schadenfreude über ihr Gesicht. »Wie gut, daß dieser Brief in meine Hände fiel!« flüsterte sie. »Ich muß meinen Bruder warnen. Dann mag Brandt sehen, ob er einen Pascher fängt!«
Jetzt fiel ihr Auge auf die neue Robe, welche Alma wieder abgelegt hatte. »Welch ein herrliches Kleid!« sagte sie zu sich selbst. »Warum bin nicht ich als die Tochter eines reichen Freiherrn geboren! Welch eine Figur würde ich in diesem Kleide geben! Oder bin ich etwa weniger hübsch, wie diese Alma? Noch gestern erst sagte der Cousin, daß ich nicht nur hübscher, sondern sogar viel, viel schöner sei, als sie. Sie ist nach dem Tannensteine, und vor zwei Stunden kann sie nicht zurück sein. Wie wäre es, wenn ich einmal anprobierte? Ich muß sehen, ob ich es verstehen würde, mich in einer solchen Toilette zu bewegen.« Sie war eine volle, hohe Brünette von nicht viel über zwanzig Jahren. Sie hatte sehr recht, sich für eine Schönheit zu halten. Ihr dunkelwelliges Haar, ihre feurigen Augen, ihr etwas scharf gebogenes Näschen, der ein wenig breite, kräftig gezeichnete Mund, das alles harmonierte mit der Energie, welche sich in ihren Bewegungen aussprach. Dieses Mädchen mußte einen festen Willen besitzen.
Der so schnell gefaßte Entschluß wurde schleunigst ausgeführt. Sie legte das einfache, schwarze Kleid, welches sie trug, ab und griff dann zur Seidenrobe. Dabei fiel ihr Blick in den hohen Pfeilerspiegel. Sie blieb unwillkürlich mit ausgestrecktem Arme stehen. Ihr Auge leuchtete auf, und um ihre Lippen spielte ein stolzes, selbstgefälliges Lächeln. Sie warf den Kopf wie herausfordernd zurück und sagte: »Das, ja, das ist die richtige Stellung, um beurteilen zu können, ob ich häßlich bin! Ich bin schön, schöner als tausend andere! Dieser kleine und doch kräftige Fuß, dieses volle Bein, die Rundung der Hüften, diese Büste, dieser Arm! Wahrhaftig, ich kann unmöglich wünschen, schöner zu sein! Und wozu und für wen besitze ich diese Schönheit? Um die Frau irgendeines Koches, Kammerdieners oder Leibjägers zu werden? Kann ein solcher Mensch beurteilen, welchen Schatz er in mir besitzt?« Sie schüttelte trotzig den Kopf und zog die Brauen zusammen.
»Wer von der Natur so bevorzugt worden ist wie ich, der muß mit seinen Vorzügen zu rechnen verstehen. Dieser Herr Cousin Franz von Helfenstein ist so dumm, zu glauben, daß er seine reiche Cousine bekommen werde! Er sollte mich sehen, so wie ich hier stehe! Und dann erst im Seidenkleide! Ziehen wir es also einmal an!«
Das Kleid schmiegte sich ganz vortrefflich um die vollen Formen der Zofe. Die Taille war tief ausgeschnitten; sie schloß auf den Achseln in Spitzenbouquets, ohne in Ärmel überzugehen. Nun zog das Mädchen die Nadeln aus ihrem Haar, so daß dasselbe reich und schwer über ihren Nacken herabfiel. »Da ist die Hofdame fertig!« sagte sie. »Kein Graf brauchte sich zu schämen, an meiner Seite zu sitzen! Sehen wir einmal, wie sich die Schleppe legt!«
Sie schritt langsam auf und ab. Der schwere, seidene Stoff rauschte über den Teppich dahin. Daher kam es wohl, daß die Zofe ein leichtes Klopfen überhörte. Die Portieren wurden hinter ihr auseinander geschlagen, ohne daß sie es bemerkte, und der Cousin Franz von Helfenstein, mit dem sie vorhin auf dem Korridore gesprochen hatte, trat ein. Als er das Mädchen erblickte, machte er eine Bewegung der Überraschung und rief aus: »Donnerwetter! Ella! Ich glaubte, Cousine Alma hier zu treffen!«
Sie stieß einen Schrei aus und fuhr erschrocken herum. »Mein Gott! Herr Baron!« rief sie. »Ich habe vergessen, das Vorzimmer zuzuriegeln!«
»Das ist allerdings eine ganz bedeutende Vergeßlichkeit! Stände Cousinchen hier an meiner Stelle, sie würde wohl weniger nachsichtig sein als ich!«
Er war nähergetreten und betrachtete sie mit verschlingenden Blicken. In seinen Augen flackerte es eigentümlich auf, nicht hell und rein, sondern trüb und unbestimmt, wie Irrlichter über die schmutzige Fläche eines Sumpfes tanzen.
»Ich wollte – wollte –,« stotterte sie in größter Verlegenheit.
»Sie wollten einmal dieses Kleid anlegen, um zu sehen, ob ich wirklich recht hatte, als ich gestern behauptete, daß Sie viel schöner seien als Alma. Nicht wahr?«
Sie erglühte bis tief in den Nacken herab. Um seine Lippen her spielte ein faunisches Lächeln. Er ergriff mit der Linken ihre Hand, strich ihr mit der Rechten in grob sinnlicher Liebkosung über den nackten Arm und sagte: »Liebe Ella, Sie können immerhin eingestehen, daß Sie schön sind; auch ich sehe es ja. Lassen Sie mich Ihnen meine Huldigung darbringen, so wie Sie es verdienen.«
Er zog sie an seine Brust. Sie sträubte sich leise, aber keineswegs ernstlich, und dabei flüsterte sie: »Herr Baron, Sie lieben ja doch eine andere.«
»Eine andere? Hm! Meinen Sie etwa, daß man nur diejenige schön finden und küssen darf, welche man liebt?«
»Ja. Ich meine, daß man treu sein muß.«
»Das bin ich ja. Ich bin der Schönheit treu; denn ich huldige ihr und bete sie an da, wo ich sie nur immer finde. Komm, du prächtiges Kind! Ich will dir zeigen, wie ich dich bewundere und anbete.«
Er ließ sich auf einen Sessel nieder, zog sie auf seinen Schoß, legte die Arme fest um sie und küßte sie, ohne daß sie sich Mühe gab, ihm einen ernsten Widerstand zu leisten. Er war wie berauscht von dem Anblicke so vieler Reize; sie aber duldete seine feurigen Umarmungen mehr aus Berechnung als aus einem anderen Grunde.
»Nicht so ungestüm, Herr Baron! Solche Liebkosungen darf ich nur von dem entgegennehmen, welcher einst mein Mann sein wird.«
»Dein Mann? Oh, das wäre herrlich! Ich wollte, daß du mein Weibchen sein könntest. Dann könnten wir Liebe schlürfen und trinken, ohne befürchten zu müssen, überrascht zu werden.«
»Das ist wahr,« antwortete sie, indem sie eine Bewegung machte, von ihm loszukommen. »Das gnädige Fräulein kann aller Augenblicke zurückkehren. Bitte, lassen Sie mich!«
»Nicht so schnell! Ich muß mir vorher erst ein Dutzend Küsse nehmen!«
»So machen Sie schnell,« antwortete sie, indem sie ihm den Mund entgegenhielt.
»Oh, das genügt noch nicht! Ich will zu den Küssen auch noch das Versprechen, dich heute abend ungestört wiedersehen zu dürfen.«
»Das ist unbescheiden, Herr Baron.«
»Die Liebe ist niemals bescheiden! Wäre sie es, so wäre sie ja keine Liebe zu nennen. Also bitte, bitte, liebe Ella!«
Er zog ihr Gesicht zu sich heran, bohrte seinen flammenden Blick tief in ihre Augen, küßte sie glühend viele, viele Male und sah sie dann erwartungsvoll an.
Sie tat, als ob sie dieser Zärtlichkeit nachgeben müsse.
»Wo?« fragte sie.
»Im Garten.«
»Und wann?«
»Wenn alles zur Ruhe ist! Das wird ungefähr um Mitternacht sein. Wirst du kommen, mein liebes, reizendes Mädchen?«
Sie schüttelte zögernd den Kopf und antwortete: »Ich möchte wohl, denn mein Herz treibt mich dazu; aber –«
»Dein Herz treibt dich dazu?« fiel er ihr schnell in die Rede. »Ist das wahr? Du liebst mich also, Ella?«
Es gelang ihr, wie in mädchenhafter Scham zu erröten. Dann antwortete sie, die Hand unter einem tiefen Seufzer an ihr Herz legend: »Fast glaube ich es, Herr Baron. Und das ist schlimm, denn diese Liebe wird ja auf alle Fälle eine unglückliche sein.«
Da drückte er sie mit aller Kraft, so daß ihr fast der Atem verging, an sich und sagte: »Sie wird ganz im Gegenteile eine sehr glückliche sein. Die Liebe ist da, um genossen zu werden, und wer sie genießt, dem bringt sie Glück. Wirst du kommen, mein Leben?«
»Ich will versuchen, ob ich es kann.«
»Das genügt nicht. Ich brauche ein festes Wort: Ja oder Nein?«
»Nun gut, ja.«
Sie erhob sich von seinem Schoße. Auch er stand von dem Sessel auf, richtete noch einen verzehrenden Blick auf sie und fragte: »Du läßt mich aber nicht vergebens warten? Wo ist die Cousine?«
»Nach dem Tannensteine.«
»Ganz allein?«
»Ja.«
»Welche Unvorsichtigkeit! Jetzt, wo die Pascher und Wilderer hier in so verwegener Weise ihr Wesen treiben, sollte eine Dame selbst am hellen Tage sich nicht nach einem so abgelegenen Orte wagen.«
Sie warf den Mund auf und bemerkte: »Herr Baron scheinen sehr besorgt um das gnädige Fräulein zu sein!«
»Pah!« antwortete er nachlässig. »Sie ist ja meine Cousine! Oder meinst du etwa gar, daß ich verliebt in sie bin?«
»Das wohl weniger; aber eine gute Partie ist sie jedenfalls, und der Herr Baron verstehen ja, zu berechnen.«
Er fühlte sich betroffen. Es war nun heute bereits das zweite Mal, daß sie ein Verständnis für seine innersten Gedanken und Pläne zeigte.
»Du irrst!« sagte er. »Hier hast du dich verrechnet!«
»Desto besser für Sie, gnädiger Herr!«
»Wieso?«
»Weil Sie niemals auf Erhörung rechnen können. Das gnädige Fräulein liebt bereits, und zwar mit großer Innigkeit.«
»Ah! Wen?«
»Diesen da.« Sie zeigte auf das noch immer offen liegende Album.
Der Baron warf einen Blick auf das Bild und sagte im Tone unangenehmster Überraschung: »Brandt? Ihn liebt sie?«
»Ja. Sie küßt sogar seine Briefe.«
»Alle Teufel! Das sollte ihr Vater wissen!«
»Jetzt würde der wohl nur darüber lächeln. Er hat seine Vorkehrungen sehr gut getroffen. Die Baronesse ist verlobt.«
Bei diesem Worte wich der Baron zurück, als ob er ein unheimliches Wunder vor sich erblickt hätte. »Verlobt?« rief er aus.
»Ja. Ich war Zeuge der Verhandlung.«
»Mit wem denn?«
»Mit dem Hauptmanne von Hellenbach.«
Da wurde der Baron leichenblaß. Man hörte seine Zähne knirschend auf einander treffen, und dann stieß er hervor: »Dieser! Der! Der Hellenbach! Ah! Der mag sich sehr in acht nehmen.«
»Ja, es ist nicht um die Baronesse, sondern um die Baronie zu tun!«
Sie sagte das, als ob es sich um etwas ganz und gar Gewöhnliches und Unverfängliches handele, und doch sah er ihr ganz erschrocken in das Gesicht. »Wie meinst du das?« fragte er. »Was willst du damit sagen?«
»O nichts, als daß Sie gerade jetzt recht Unangenehmes erfahren. Erst die Geburt dieses kleinen Stammhalters und nun die Verlobung Ihrer Cousine mit diesem Hellenbach, der übrigens noch heute hier eintreffen wird.«
Über diese letztere Bemerkung vergaß er ganz den ersten Teil ihrer Rede. »Donnerwetter! Heute noch?« rief er.
»Der gnädige Herr sagte es zum Fräulein.«
»Hole der Teufel diesen verdammten Hellenbach! Doch, fort mit ihm! Also du kommst heute um Mitternacht in den Garten?«
»Gewiß, gnädiger Herr.«
»So lebe wohl bis dahin!«
Er umarmte und küßte sie; dann entfernte er sich.
Eben als er draußen an der Freitreppe vorüber wollte, kam ein Herr dieselbe heraufgestiegen. Dieser war älter als Helfenstein. Er ging in einfachem Zivil, doch war ihm der Offizier leicht anzusehen. Dieser neue Ankömmling blieb, als er den Baron erblickte, stehen.
Sein Gesicht war eisig kalt, und nur in seinem Auge flackerte es eigentümlich auf, als er fragte: »Franz von Helfenstein? Ah! Was tun Sie hier?«
Der Cousin des Schloßbesitzers konnte nicht verbergen, daß er sich verlegen fühlte. »Vergessen Sie vielleicht, Herr Hauptmann, daß ich hier bei Verwandten bin?« antwortete er.
»Nein, das vergesse ich nicht. Aber, haben Sie denn keine Ahnung davon, daß ich eingeladen bin?«
»Nein.«
»Gut! So lassen Sie uns sofort unser Arrangement treffen. Sie ahnen wohl, an welche Angelegenheit ich jetzt denke?«
»Ich glaube, es vermuten zu können. Aber wir dürften wohl einen anderen Ort und eine andere Stunde wählen!«
»Ort und Zeit sind die rechten. Wo ich Sie treffe, da rede ich mit Ihnen, also gegenwärtig hier. Wir befanden uns im Bade. Wir trafen uns beim Spiele. Sie baten mich um zweitausend Gulden auf vierundzwanzig Stunden und Ehrenwort. Des anderen Tages waren Sie verschwunden, ohne mich bezahlt zu haben. Und weshalb? Weil es bekannt geworden war, daß Sie ein Schurke sind, welcher es versteht, dem Glücke –«
»Herr von Hellenbach!« rief der Baron.
Er war bleich geworden wie eine Leiche. Sein Ton sollte ein drohender sein, doch machte er einen ganz entgegengesetzten Eindruck.
Hellenbach zuckte die Achsel und sagte: »Schreien Sie nicht so laut! Ich habe mit Ihnen zu sprechen, und was ich Ihnen zu sagen habe, werde ich Ihnen unter allen Umständen mitteilen, selbst wenn Sie die sämtliche Dienerschaft herbei schreien sollten! Also, fahren wir fort: – weil Sie es verstanden hatten, dem Glücke des Spieles durch gewisse Manipulationen nachzuhelfen. Jetzt treffe ich hier ein, und der erste, welcher mir begegnet, sind Sie. Ihr Cousin ist ein Ehrenmann und mein Freund; auch habe ich noch einen anderweiten Grund, Ärgernis von ihm fern zu halten. Darum habe ich bisher gegen ihn über Sie geschwiegen. Aber an einem und demselben Orte kann ich mit einem Manne, der kein Ehrenwort mehr hat, nicht bleiben. Natürlich bin ich es nicht, der weichen wird, sondern Sie werden es sein. Aus Rücksicht auf Ihren Herrn Cousin will ich Ihnen noch eine Gnadenfrist geben. Zahlen Sie mir binnen jetzt und vierundzwanzig Stunden, also bis morgen um dieselbe Tageszeit, die zweitausend Gulden, so soll kein Mensch von dieser Angelegenheit erfahren. Sie dürfen dann abreisen, ohne von mir blamiert zu werden; denn von Ihrem Hierbleiben ist auch in diesem günstigen Falle keine Rede. Zahlen Sie aber nicht, so decke ich Ihre Ehrlosigkeit vor allen anwesenden Jagdgästen auf!«
Das war eine lange, scharfe Rede. Der Baron hatte sie mit keinem Worte, mit keiner Silbe unterbrochen. Er schien überhaupt die Fähigkeit der Sprache für den Augenblick verloren zu haben. Desto beredter aber waren seine Züge. Auf seinem Gesichte kamen und gingen alle Arten negativer Empfindungen. Scham, Zorn, Furcht und Mut wechselten miteinander ab. Jedenfalls kannte er den Hauptmann. Er wußte, daß derselbe die Wahrheit gesprochen habe und daß so einem eisenfesten, ehrenwerten Charakter nicht ein Jota abzuringen sei. Er hätte ihn am liebsten massakriert; aber er wußte auch sehr genau, daß ihn nur die äußerste Selbstbeherrschung retten könne. Er zwang also seinen Grimm zurück und sagte, indem seine Stimme allerdings vor innerer Aufregung bebte: »Sie können sich denken, daß ich gegen Ihre Anschuldigungen und die Bedingungen, welche Sie mir stellen, kein Wort der Entgegnung habe. Die Angelegenheit wird bis morgen geordnet sein; nur bedinge ich mir Ihr Ehrenwort, daß kein Mensch etwas von der Sache weiß oder bis morgen zu der angegebenen Zeit von ihr erfahren wird.«
»Sie haben das Ehrenwort. Adieu!«
Nach diesen unter einem verächtlichen Achselzucken gesprochenen Worten drehte sich der Hauptmann ab. Er gehörte zu denjenigen Charakteren, welche alles Falsche unerbittlich hassen und verfolgen, weil an ihnen selbst kein Falsch ist.
Franz von Helfenstein hatte in sein Zimmer zurückkehren wollen; die Begegnung mit Hellenbach aber gab seinen Schritten eine ganz andere, neue Richtung.
Er stieg die Freitreppe hinab und verließ das Jagdschloß, um seiner Erregung im kühlen Walde Herr zu werden. Er sann und sann, um zu einem Resultate zu kommen. Endlich blieb er stehen und sagte, mit der geballten Faust nach dem Schlosse zurückdrohend: »Einen Schurken hat er mich genannt, einen ehrlosen Menschen! Hölle, Tod und Teufel, das wird gerächt, fürchterlich gerächt! Ich muß ihn bezahlen, aber woher das Geld nehmen? Der Cousin hilft mir nicht mehr aus der Not. Ich verlangte heute früh lumpige fünfhundert Gulden von ihm, und er verweigerte sie mir, weil er nicht länger Tropfen ins Meer tragen wolle. Wie würde er erstaunen, wenn ich jetzt zweitausend verlangte! Er hat Geld, massenhaft Geld! Ihm ist ja alles zugefallen, die ganze Herrschaft, während wir anderen mit einer elenden Kleinigkeit abgefunden wurden. Wäre er tot, und hätte er diesen Knaben nicht, so hätte Alma einige Hunderttausende zu erwarten, und das andere wäre alles, alles mein! Könnte man doch dem Schicksale nachhelfen! Hm! Gibt es denn gar keine Möglichkeit? Sie soll Hellenbach heiraten, und das muß ich hintertreiben. Sie liebt ihn keinesfalls. Ha! Ist es denn nicht möglich, daß ich ihr lieber wäre als er? Dann wäre mir geholfen! Welch ein Streich! Sie kann sich nicht glücklich fühlen; ich erlöse sie von diesem Hellenbach, indem ich sie für mich erobere; ich trete als ihr Retter auf. Ich bin überzeugt, daß ihr mein Antrag hoch willkommen ist. Zwar soll sie diesem widerwärtigen Brandt gut sein; aber das ist ja gar nicht zu rechnen. Die Baronesse Alma von Helfenstein und ein Polizeibeamter! Pah! Das ist eine Liebelei, die ich vergeben kann, da ja auch ich den Freuden der Liebe nicht abgeneigt bin. Sie ist auf dem Tannenstein. Also hin zu ihr!«
Er wendete sich dem letztgenannten Orte zu.
Der Hauptmann von Hellenbach hatte sich direkt zum Besitzer des Schlosses begeben wollen, um seine Ankunft zu melden; da aber war die Zofe Ella aus der Tür getreten. Sie hatte grüßend an ihm vorüber gewollt; er aber hielt sie durch eine Handbewegung an und fragte: »Ist das gnädige Fräulein zu sprechen?«
»Nein. Sie ist ausgegangen.«
»Wohin?«
»Nach dem Tannensteine.«
»Aber der Herr Baron ist disponibel?«
Da fuhr ihr ein Gedanke durch den Kopf. Wie nun, wenn sie ihrer Herrin den verhaßten Verlobten sofort auf den Hals hetzte? Alma war gegangen, um sich innere Ruhe zu holen; es mußte ihr äußerst unangenehm sein, dem aufgezwungenen Bräutigam zu begegnen. Darum antwortete Ella auf Hellenbachs Frage: »Ich glaube kaum. Der Herr Baron sind jetzt noch von den Dispositionen für die Jagd außerordentlich in Anspruch genommen. Aber das gnädige Fräulein würde sich gewiß freuen, Ihnen auf dem Tannensteine zu begegnen. Es ist so einsam dort, und die Gegend ist seit einiger Zeit fast unsicher zu nennen.«
»Ah! Wirklich? Hm! Ich erinnere mich des Tannensteines. Ich werde ihn finden, Sie haben recht. Ich darf den Baron nicht stören.«
Er ging. Es war keine glühende Leidenschaft, welche er bisher für Alma gefühlt hatte. Sie war schön, reich und von reinem alten Adel. Die Verbindung war eine vorteilhafte zu nennen. So hatte er sich gesagt. Aber als er nun durch den Wald ging, um das schöne Mädchen aufzusuchen und mit demselben von dieser Verbindung zu sprechen, da wurde es ihm denn doch recht eigentümlich zu Mute. Es war ihm, als sei Alma bereits ein Stück von ihm selbst geworden, ein Teil seines eigenen Wesens, auf den er unmöglich verzichten könne. Er ahnte es nicht; aber er trug doch eine tiefe Liebe zu dem herrlichen Mädchen in seinem Herzen.
Bei einem früheren Besuche hatte er den Tannenstein kennengelernt. Er hatte jetzt geglaubt, den Weg leicht finden zu können, aber er mußte bald einsehen, daß er in die Irre gegangen sei. Er mußte seine Richtung ändern, und so dauerte es ziemlich lange Zeit, ehe er sein Ziel erreichte.
Unterdessen hatte auch die Zofe Ella das Schloß verlassen. Sie wollte ihr Vorhaben ausführen und ihren Bruder vor Gustav Brandt warnen.
Gar nicht weit von dem Jagdschlosse Hirschenau lag das kleine Dörfchen Helfenstein, in welchem ihr Bruder wohnte. Er war der gegenwärtige Anführer der Schmuggler. Ella wußte das, hütete sich aber natürlich, es zu verraten. Sie fand ihn daheim und erzählte ihm, was in dem Briefe Brandts gestanden hatte. Er lachte höhnisch und sagte: »Deine Warnung ist überflüssig; ich bin bereits unterrichtet. Wir haben in der Residenz unsere Spione, welche uns gut bedienen, weil sie gut bezahlt werden. Daß Brandt kommen wird, habe ich ebenso genau gewußt, wie daß man uns auch Militär senden wird. Brandt ist ein junger Kerl aber trotzdem ein gescheiter Kopf. Er hat sich bereits vielfach ausgezeichnet und steht in Ansehen bei seinen Vorgesetzten. Er wird sehr schnell Karriere machen; aber er soll sich hüten, mit uns anzubinden. Sie senden gerade ihn, weil er hier geboren ist und alle Schliche kennt; aber mir ist er doch nicht gewachsen. Wenn er mir unbequem wird, hat es mit ihm ein Ende.«
Sie erschrak. Brandt war eine Zeitlang heimlich ihr Abgott gewesen; sie liebte ihn eigentlich noch; er aber hatte alle ihre Bemühungen, ihn in ihre Netze zu ziehen, siegreich abgeschlagen. Jetzt drohte ihm Gefahr. »Du willst ihn töten?« fragte sie.
»Das wird sich finden. Ich habe bei meinen Paschern eine eiserne Disziplin eingeführt. Sogar von der Todesstrafe mache ich Gebrauch. Einen Feind, der unsere Sicherheit bedroht, werde ich natürlich noch weniger schonen als einen meiner Untergebenen. Übrigens werden wir wohl nicht so leicht miteinander in Kollision geraten. Ich beabsichtige in unseren Unternehmungen eine längere Pause eintreten zu lassen, bis das Militär wieder zurückgezogen worden ist. Heute abend wird der letzte Coup ausgeführt, der aber auch ein ganz bedeutender ist. Es handelt sich um viele, viele Tausende, welche wir verdienen. Dann mag Brandt kommen. Er wird hier sitzen und keine Spur eines Paschers finden. Übrigens bin ich auch aus einem anderen Grunde zu einer längeren Pause gezwungen. Ich habe unter meinen Leuten einige Kerls, denen ich nicht traue. Ich mußte den Bruder des einen erschießen lassen; der Grund ist Nebensache; nun glaube ich gar, daß ich selbst nicht mehr meines Lebens sicher bin.«
»Du bist zu hart, zu streng gewesen. Man darf die Saiten nicht zu stark anspannen, sonst reißen sie.«
»Unsinn! Bei dem Volke, welches ich kommandiere, muß Strenge sein. Jetzt lebe wohl! Ich habe wichtigeres zu tun, als hier zu plaudern.«
Sie ging. Es gab so vieles zu denken und zu überlegen; so geschah es, daß sie von dem geraden Wege nach dem Schlosse abkam. Und als sie das bemerkte, bog sie noch nicht in bessere Richtung ein. Sie hatte eine nachsichtige Herrin, es kam gar nicht darauf an, ob sie eine Stunde früher oder später zurückkehrte.
So folgte sie dem Waldwege, den sie nun einmal eingeschlagen hatte. Baron Franz von Helfenstein war es besonders, welcher ihr zu denken gab. Sie war eine wohlhabende Bauerstochter und nur deshalb in den Dienst der Baronesse Alma getreten, weil das herrschaftliche Leben ihr besser gefiel, als das Wohnen und Verkümmern im einsamen Gebirgsdorfe. Sie wußte, daß sie schön war; sie hatte gesehen, welche Macht die Schönheit besitzt, und sie wollte emporsteigen. Wie nun, wenn dieser Cousin Franz von Helfenstein auf irgendeine Weise, durch Liebe oder Zwang, vermocht werden könnte, ihr die Hand zu geben? Dann war sie Baronin, allerdings nicht reich, aber – hm, konnte nicht der kleine Robert sterben?
Es waren wunderliche, vielleicht sogar gefährliche Gedanken, mit denen sie sich beschäftigte. Sie achtete gar nicht mehr auf ihre Umgebung, bis sie rasche Schritte vor sich vernahm. Sie blickte auf und zuckte zusammen. Vor ihr stand ein junger Mann, ganz in grau gekleidet, mit einem ledernen Ränzchen auf dem Rücken und einem Knotenstocke in der Hand. Hätte er anstatt des breitkrämpigen Hutes eine farbige Mütze auf dem Kopfe gehabt, so wäre er sehr leicht für einen wandernden Musensohn zu nehmen gewesen.
Sie erkannte ihn sofort; sie waren ja in demselben Orte geboren und erzogen. Sie nannten sich sogar »du«. Es war Gustav Brandt, der erwartete Polizeibeamte aus der Residenz. Da er Almas Milchbruder war, hatte der Baron, ihr Vater, ihn studieren lassen, eine Unterstützung, welche auf sehr fruchtbaren Boden gefallen war. Sein Gesicht glich ganz der Fotografie in Almas Album. Er war bereits jetzt höchst interessant und versprach, ein schöner Mann zu werden.
Ella war bis zum Nacken herab errötet, als sie ihn erblickte.
»Gustav!« entfuhr es ihr unwillkürlich.
Sie streckte ihm beide Hände entgegen, wie man einen lieben, vertrauten Freund begrüßt; er aber gab ihr kühl nur die Rechte.
»Du hier? Mitten im Walde?« fragte er.
»Du ebenso!« antwortete sie. »Wer uns hier erblickt, muß denken, wir haben ein Stelldichein verabredet.«
»Wer das denkt, kann nicht viel Geist besitzen.«
»Nicht? Nun, wäre denn ein Stelldichein zwischen uns beiden etwas so ganz und gar Unmögliches oder Unnatürliches?«
Es war die alte, heimliche Liebe über sie gekommen. In ihren dunklen Augen loderte eine leidenschaftliche Glut. Am liebsten hätte sie sich an die Brust des jungen Mannes geworfen. Er wußte das und sah es auch.
»Das sind müßige Fragen,« antwortete er.
»Für den einen wohl, aber nicht für den andern. Du freilich wirst deine Augen niemals auf ein Dorfmädchen werfen. Du willst höher hinaus. Du wirst dir einmal eine Prinzessin suchen.«
Ihr Ton war bei diesen Worten etwas höhnisch gewesen. Er schüttelte mit überlegenem Lächeln den Kopf und antwortete: »Ich kann jetzt nicht an Liebe denken, nach einer Prinzessin strebe ich nicht. Ich weiß nur so viel, daß diejenige, welcher meine Liebe gehören soll, sittlich rein sein und ein gutes Herz besitzen muß.«
»Ah! Meinst du nicht, daß ich ein gutes Herz besitze?«
»Nein,« antwortete er gleichmütig.
»Und sittlich rein –?«
»Bist du auch nicht.«
Da flammte ihr Auge ihm zornig entgegen.
»Wie kannst du das behaupten?« herrschte sie ihn an.
»Ich weiß es, Ella. Es ist schade um die Reichtümer, welche dir von der Natur verliehen worden sind. Sie waren bestimmt, dich und andere glücklich zu machen, du aber wirst diesen Zweck verfehlen. Lebe wohl!«
Er schritt an ihr vorüber.
»Gustav! Brandt!« rief sie ihm nach. »Ah! Ich weiß, wo die sittlich Reine ist! Gehe hinauf zum Tannenstein; dort wirst du sie jetzt mit ihrem Bräutigam finden!«
Sie setzte ihren Weg rasch fort, innerlich voller Wut und Rachgier für die Zurückweisung, die ihr abermals von ihm geworden war.
Er hatte ihren letzten Ruf vernommen. Er hatte eigentlich nach dem Forsthause zu den Eltern gewollt. Jetzt aber fragte er sich: »Die sittlich Reine? Auf dem Tannenstein? Sollte da Alma gemeint sein? Und mit ihrem Bräutigam?«
Das letzte Wort ging ihm wie der Schlag einer elektrischen Batterie durch den Körper. Es war ja das etwas, an dessen Möglichkeit er noch nicht gedacht hatte.
»Alma einen Bräutigam? Herrgott, ich gehe nach dem Tannensteine!«
Er wich vom Wege ab und eilte mitten in den Wald hinein.
Der Tannenstein war eine mit Bäumen und Sträuchern bestandene steile Felsenhöhe, welche von den Bewohnern der Umgegend gern besucht wurde, weil von seiner Kuppe aus sich ein weiter Umblick in das Niederland eröffnete. Vor dem Auge dehnten sich da in scheinbarer Endlosigkeit die grün bewaldeten Bergeskuppen wie plötzlich erstarrte Meereswogen in weite Ferne hin. Es war, als stehe man am Strande der See und blicke hinaus auf den unendlichen Ozean. Rund um den Aussichtspunkt war ein starkes Geländer angebracht, damit kein Unglück geschehe. An diesem Geländer hatte Gustav Brandt oft verwegene Turnkünste geübt, wobei Alma mancher Schrei der Angst entfahren war. Rechts führte der Weg langsam abfallend nach Schloß Hirschenau, während links ein höchst steiler Pfad zur Tiefe ging nach einer wilden, langen und schmalen Schlucht, welche die Tannenschlucht genannt wurde.
Auf diese Schlucht schritt Brandt jetzt zu, um dann von ihr aus die beinahe senkrecht ansteigende Höhe zu erklimmen. Der weiche Waldesboden machte seine Schritte beinahe unhörbar. So kam es, daß ihm ein menschlicher Laut auffiel, der ihm sonst entgangen wäre. Er hatte ein unterdrücktes Husten gehört. Wer sein Husten unterdrückt, beabsichtigt, nicht bemerkt zu werden, hat also Heimlichkeiten vor. Das sagte sich Brandt als Polizist sogleich. Hier gab es also jemand, der verborgen bleiben wollte.
Er schlich nach der Gegend hin, in welcher das Husten erklungen war. Da, fast wäre er mit dem Manne zusammengestoßen – er hatte um einen Strauch kriechen wollen, hinter welchem ein ihm fremder Mann saß. Der Platz war so gewählt, daß man von ihm aus einen Teil der Schlucht überblicken konnte.
Gustav wich natürlich sofort zurück; er war nicht bemerkt worden. Indem er über den Grund der Anwesenheit dieses Mannes nachdachte, ertönte in nicht allzu großer Ferne ein halblauter, kurzer Pfiff, welcher von dem Manne erwidert wurde, und eine Minute später kam ein zweiter Mensch langsam aus der Schlucht herbei geklettert.
»Verdammte Langeweile!« sagte er. »Wenn man doch nur wenigstens rauchen dürfte!«
»Der Geruch kann uns verraten!«
»Und nun bis zum Anbruche des Abends hier aushalten.«
»Was ist's weiter? Ist's denn gar zu schwer? Wir führen heute um Mitternacht unsere Waren hier durch die Schlucht, und um zu erfahren, ob die Grenzer vielleicht ihr Augenmerk auf diesen Ort gerichtet haben, müssen wir ihn bewachen. Das ist keine Riesenarbeit. Übrigens ist es für lange Zeit das letzte Geschäft, welches wir machen.«
»Und vielleicht auch das einträglichste, welches jemals unternommen worden ist.«
»Gewiß! Wenn es nur gelingt.«
»Warum nicht. Drei ohne Pakete, aber mit Gewehren voran, dann die Träger und dann wieder drei mit Gewehren. Es muß gelingen. Dann gibt es Ferien, weil man uns diesen Brandt auf den Hals schickt. Dieser Kerl ist erst ein halber Mann, soll aber den Teufel im Leibe haben.«
»Kennst du ihn?«
»Nein, aber gehört habe ich von ihm. Er soll ein geborenes Polizeigenie sein und eine Nase besitzen, wie selten einer. Der Baron von Helfenstein hat ihn mit seiner Tochter erziehen und dann die Juristerei studieren lassen. Na, uns wird er keinen Schaden machen, da wir ja Pause haben. Übrigens hast du doch nicht vergessen, was wir ausgemacht haben von wegen –«
Er hielt inne. Der andere nickte zustimmend.
»Ja, ja. Wenn der heutige Coup mißlingt, dann ist ihm sein Brot gebacken. Alle waren gegen die Tannenschlucht; er aber bleibt bei seinem Willen. Werden wir gepackt, so bekommt er eine Kugel – ganz besonders meines Bruders wegen, den er in das Gras hat beißen lassen.«
Brandt verstand diese letzteren Worte nicht vollständig. Er konnte auch gar nicht wissen, daß Ellas Bruder gemeint war, der Anführer der Schmuggler.
Er hatte genug gehört; er konnte sehr leicht bemerkt werden und entschloß sich daher, sich lieber zurückzuziehen. Noch nicht einmal in Helfenstein und bei den Eltern angekommen, sah er sich bereits von einem ganz bedeutenden Schmugglerunternehmen unterrichtet. Das war ein Glück! Er hatte gehört, daß man einigermaßen Respekt vor ihm hatte, und nun bot sich ihm die Gelegenheit, das Vertrauen, welches ihm seine Vorgesetzten erwiesen hatten, gleich am ersten Tage zu rechtfertigen. Er wollte erst den Tannenstein ersteigen, um zu sehen, was Ella eigentlich gemeint habe, und dann aber schleunigst die geeigneten Maßregeln zur Habhaftwerdung der heutigen Konterbande ergreifen.
Er klimmte die steile Höhe mit Leichtigkeit empor. Er war als Knabe diesen nicht ungefährlichen Pfad viele hundert Male empor gestiegen. Er erreichte die Plattform und stand bereits im Begriff, durch das hier befindliche Wildkirschengebüsch sich nach der andern Seite zu drängen, wo die Aussicht eine freiere war, als er plötzlich in dieser Bewegung inne hielt.
»Ah, das ist sie!« flüsterte er. »Das ist Alma! O Gott, wie schön, wie schön sie geworden ist!«
Sein Auge war mit entzücktem Ausdrucke auf die Gestalt des schönen Mädchens gerichtet, welches da vorn an der Balustrade lehnte. Gibt es schon von Künstlerhänden gefertigte Bilder reizender Frauen, von denen man den Blick fast nur mit Gewalt abzuwenden vermag, wie viel mehr muß das Auge gefesselt sein von einem Meisterstücke des Schöpfungswerkes. Und Alma war ein solches Meisterwerk. Wenn der Mann ein Bild der göttlichen Allmacht und das Weib ein Bild der geistigen Liebe sein soll, so war das herrliche Wesen, welches hier von dieser Höhe in die Tiefe niederschaute, eine ganz unvergleichliche Inkarnation des Gedankens einer Liebe, welche die Bestimmung hat, die Erde mit der Seligkeit des Himmels zu begnadigen.
Zwar vermag die Feder des Dichters manches und vieles zu schildern, was der Pinsel des Malers und der Meißel des Bildhauers nicht wiederzugeben vermögen; aber die Schönheit Almas zu beschreiben, das wäre eine Unmöglichkeit. Die Vorzüge der Zirkassierin, der Hindu, der Perserin, der Europäerin, des Fellahweibes waren hier in einer Person zu einem harmonischen Ganzen vereinigt, dessen einzelne Schönheiten zu klassifizieren geradezu Vermessenheit gewesen wäre. In ein weißes Gewand gekleidet, über welches die langen, dichten, goldblonden Locken sinnbetörend niederfluteten, glich dieses Mädchen einer jener Feen- oder Engelsgestalten, von denen uns unsere Märchen erzählen, und welche uns die Phantasie nur im Traume hervorzuzaubern vermag. Dieses helle, metallisch schimmernde Haar, die reine, unschuldsvolle Stirn, das große azurblaue Auge, dessen Himmel keine Sonne zu besitzen, sondern selbst Sonne zu sein schien, dieser Teint, vom Schöpfer aus Schnee und Morgenrot komponiert – das alles war so hell, so lichtreich, als habe die Sonne eine ihrer Bewohnerinnen herniedergesandt, um zu offenbaren, warum sie leuchtet.
»Ja, sie ist es noch,« lispelte Gustav Brandt, »was sie früher war, wie ich sie immer nannte: ein warmer, reiner, goldener Sonnenstrahl!«
Und doch bemerkte er, daß es trüb auf ihrem schönen Angesichte lag, gar nicht wie ein Sinnen der Zufriedenheit und des Glückes. War es wahr, daß sie einen Bräutigam hatte? Und war es gerade dieser Umstand, welcher sie so traurig stimmte? Fast schien es ihm, als ob sie geweint habe.
Er hielt das Auge lange und forschend auf sie gerichtet. Sie war noch die alte und doch zugleich eine andere, eine ganz andere, so daß Gustav zögerte, sich ihr bemerklich zu machen. So lieb, gut und mild, ganz wie früher, war sie doch jetzt von einer Hoheit umflossen, welche jede unerlaubte Annäherung zur Sünde zu erklären schien. Und doch stand gerade in diesem Augenblicke eine solche Annäherung bevor. Es wurden Schritte hörbar. Als Alma sich langsam umdrehte und den Nahenden erblickte, umdüsterte sich ihr Angesicht noch mehr. Franz von Helfenstein, ihr Cousin, war es, welcher kam.
Brandt ahnte, was kommen werde. Er wollte sich kein Wort entgehen lassen. Wer weiß, in welcher Gefahr sich das schöne, liebe Mädchen befand. Darum beschloß er, sich den beiden unbemerkt noch mehr zu nähern. Da ihm aber Stock und Ränzchen dabei hinderlich waren, legte er beides ab. Dann duckte er sich zwischen die Büsche nieder und kroch so weit vorwärts, als möglich war, ohne bemerkt zu werden.
»Du hier?« fragte Franz, sich überrascht stellend. »Wie kannst du dich so tief in den Wald wagen, Alma! Du darfst den Paschern und Wilderern nicht trauen, nachdem dein Vater ihre Rache herausgefordert hat.«
»Du wagst ja ganz dasselbe,« entgegnete sie kalt.
»Das ist etwas ganz anderes. Übrigens ist es gut, daß ich dich treffe. So kann ich dir sagen, daß soeben Hellenbach, dieser Schurke, angekommen ist.«
»Schurke?« fragte sie erstaunt. »Hellenbach ist ein Ehrenmann!«
»Ein Ehrenmann,« lachte er, »der aber dich mir rauben will!«
Er trat an sie heran, um den Arm um sie zu legen.
Sie wich zurück.
»Wie kommst du mir vor?« fragte sie, ihn streng anblickend.
»Das fragst du noch? Ich hörte, daß du mit Hellenbach verlobt bist, und doch bin ich es, der dich tausendmal mehr liebt als er. Ich kann ohne dich nicht leben.«
»Halt!« rief sie ihm entgegen, da er sich ihr wieder nähern wollte. »Ich werde nie Hellenbachs Frau werden; deine Liebe aber verbitte ich mir!«
Er wurde bleich. Seine Augen schienen ihre Gestalt verzehren zu wollen. »Warum?« stieß er erregt hervor.
»Das sage du dir selbst! Laß mich allein!«
»Allein?« rief er. »Nie, niemals! Du sollst vielmehr bei mir sein und mit mir für das ganze Leben. Ich liebe dich, und du bist mein!«
Er umschlang sie jetzt wirklich und zog sie an sich. Sein Mund suchte ihre Lippen. Sie sträubte sich aus allen Kräften und rief: »Laß mich frei, Elender! Ich verachte dich!«
»Schön! Aber dennoch wirst du mein Weib,« antwortete er. »Ich werde dich zu zwingen wissen!«
»Womit?« fragte hinter ihm eine Stimme.
Alma hatte sich in seiner kräftigen Umarmung kaum mehr zu regen vermocht. Jetzt fuhr er herum. Brandt stand vor ihm.
»Ah!« rief Franz von Helfenstein. »Der Polizeispion! Er soll Zeuge sein, daß ich seine Milchschwester küsse! Passe auf, Försterbube!«
Er wollte seine Worte wahr machen, fühlte sich aber in demselben Augenblick bei der Brust gepackt und von Alma losgerissen.
»Mensch, wollen Sie fort – oder hier hinunter?« fragte Brandt.
Der Baron sah den drohenden Abgrund, auf welchen Gustav deutete; wußte, daß er dem Polizisten an Kraft nicht gewachsen sei.
»Gut!« stieß er knirschend hervor. »Bleibt ihr allein! Wir rechnen ab!«
Er tat so, als ob er gehe, kehrte aber hinter den Büschen zurück, um sie zu belauschen. Dort erblickte er Brandts Ränzchen. Einer augenblicklichen Eingebung zufolge öffnete er dasselbe. Es enthielt unter anderem auch ein Rasieretui mit zwei scharf geschliffenen Messern. Sein Gesicht nahm unter einem diabolischen Gedanken einen triumphierenden Ausdruck an. Er steckte das eine der Messer zu sich und verschloß das Ränzchen.
Dann hörte er Alma sagen: »Welch ein Glück, daß du dazwischen kamst, mein lieber Gustav. Ich muß dich für diese Errettung mit einem Kusse belohnen.« Sie hielt ihm ihre rosigen, schwellenden Lippen entgegen, und er küßte sie.
In diesem Augenblick erschien von der Seite des Schlosses her – der Hauptmann von Hellenbach. Er war Zeuge des Kusses und rief: »Alle Teufel, was geht hier vor! Welcher freche Mensch wagt einen solchen Angriff gegen meine Braut! Zurück, Elender!«
Er holte aus und traf Brandt mit der Faust, erhielt aber sofort einen Gegenhieb, so daß er zur Erde stürzte. Er wollte sich aufraffen und wieder auf Brandt werfen; dieser aber erfaßte ihn, hielt ihn mit überlegener Kraft gepackt und sagte: »Herr Hauptmann, ich bin der Bruder der gnädigen Baronesse. Soll ich einen Offizier mit Ohrfeigen traktieren? Gehen Sie! Ich werde die Dame heimgeleiten und stehe Ihnen dann zur Verfügung!«
Hellenbach war blutrot im Gesicht, zwang sich aber zur Ruhe und sagte: »Gut! Ich eile, den Baron zu benachrichtigen. Sie aber werden mir blutige Satisfaktion geben müssen!«
Franz von Helfenstein sah ihn forteilen.
»Ah, nun muß auch ich fort!« murmelte er. »Jetzt weiß ich, was ich tue. Ich werde mich rächen und glanzvoll siegen. Morgen habe ich Geld!«
Brandt geleitete Alma nach dem Schlosse. Noch aber hatten sie dasselbe nicht erreicht, so kam ihnen der Hauptmann mit Almas Vater entgegen. Dieser letztere befand sich sichtlich in zornigster Aufregung.
»Mir deinen Arm!« rief er seiner Tochter zu. »Und Sie, Herr Brandt, sind ein Undankbarer, der nicht wert ist, daß man ihn anblickt. Sie werden das Schloß niemals wieder betreten!«
Alma wollte den Milchbruder in Schutz nehmen, mußte aber schweigen. Brandt wußte, was er dem Baron verdankte; er beherrschte sich also und sagte mit möglichst ruhiger Stimme: »Herr Baron, Sie werden bald einsehen, daß Sie mir unrecht tun. Ich habe mir nicht das mindeste vorzuwerfen. Adieu!«
Er ging, um seine Eltern zu begrüßen und dann die Vorbereitungen für den Überfall der Schmuggler zu treffen.
Dieser gelang vollständig. Es gab zwar bei der nächtlichen Finsternis und dem Terrain der Tannenschlucht einen harten Kampf; doch die Grenzer siegten.
Die beiden Schmuggler, welche heut von Brandt belauscht worden waren, hatten nebeneinander gekämpft; als sie sahen, daß alles verloren sei, rief der eine dem anderen zu: »Fort! Der Helfensteiner ist schuld! Ihm die versprochene Kugel!«
Sie stürmten in den Wald hinein. Sie hatten ihren Anführer gemeint, der im Dorf Helfenstein wohnte. Sie lauerten ihn am Forstwege ab und schossen ihn dort nieder. Brandt hatte ihren Ruf vernommen und glaubte, daß der Baron von Helfenstein gemeint sei. Um ihn zu warnen, eilte er geraden Weges vom Kampfplatze nach dem Schlosse, wo man noch munter war, da man das Schießen gehört hatte. Ohne sich anmelden zu lassen, suchte er den Baron auf, den er noch wach fand.
»Herr Baron,« sagte er; »soeben haben wir die Schmuggler besiegt. Zwei von ihnen wollen Sie erschießen. Ich melde Ihnen das, damit Sie Ihre Maßregeln treffen und sich vor einem Überfall schützen.«
Nach diesen Worten eilte er fort; an der Zofe Ella und andern Dienstpersonen vorüber, denen er begegnete. Vom Kampfe war sein Anzug blutig geworden, was sie deutlich bemerkten.
Aus dem zwischen Baron Franz und Ella verabredeten Stelldichein war nichts geworden, da das Schießen alle Bewohner des Schlosses wach gehalten hatte. Ella hatte Brandt, als er an ihr vorüber eilte, gefragt, was er wolle und er hatte geantwortet, daß der Herr Baron es bereits wisse. Sie machte sich einen Behelf, bei ihrem Herrn einzutreten, und fand diesen schreibend am Tische sitzen. Auf dem Rückwege traf sie den Cousin, welcher auch keine Ruhe zu haben schien. Er war am Abende noch einmal bei seinem Verwandten gewesen, um zu versuchen, einiges Geld zu erhalten, hatte aber eine streng abweisende Antwort erhalten. Seine Aufregung, seine Rachsucht hatten ihn hin und her getrieben, bis er jetzt auf die Zofe stieß.
»Verdammt!« sagte er. »Jetzt sind wir um unsere Schäferstunde gekommen. Dieser Brandt konnte sein Schießen lassen. Vielleicht findet sich eine Kugel, die so klug ist, ihn selbst zu treffen!«
»Oh, er lebt; er war soeben hier,« antwortete sie.
»Hier? Nachdem ihm das Schloß verboten wurde, wie ich erfuhr? Was wollte er?«
»Er kam vom gnädigen Herrn, war ganz voller Blut und schien es sehr eilig zu haben.«
Er hustete, als ob er eine innere Erregung zu verbergen habe, und sagte: »Das ist sehr verdächtig! Na, meinetwegen! Gute Nacht, Ella!«
Er gab ihr einen Kuß und ging. Er kam ihr so sonderbar vor; sie beschloß, ihn zu beobachten. Sie war doch schlauer als er. Sie ließ ihre Türe nur angelehnt und sah später, daß er sein Zimmer verließ, sich vorsichtig umsah und dann sich zu seinem Verwandten begab. Nach einer Weile trat er dort wieder heraus, verschloß die Tür und zog den Schlüssel ab. Ohne Ahnung, daß er bemerkt worden sei, begab er sich in sein Zimmer. Ella hingegen trat in das ihre zurück und verschloß dasselbe.
»Es ist etwas geschehen!« dachte sie. »Aber was? Pah! Heute geht es mich nichts an, aber morgen! Ist es das, was ich denke, so bin ich Herrin der Situation und werde – Baronesse von Helfenstein!«
Sie legte sich zwar schlafen, wurde aber von der stürmischen Bewegung ihres Innern verhindert, zur Ruhe zu kommen.
Die Nacht verging, und der Morgen tagte. Im Schlosse gab es mehrere, die nicht geschlafen hatten. Auch Alma war unter ihnen. Sie wußte, daß Gustav sich an dem Kampfe beteiligt habe; sie vermutete, daß er mit den Grenzern den Kampfplatz während der Nacht besetzt habe. Sie mußte wissen, ob er lebe. Darum warf sie einen Mantel um und eilte in ihrer Besorgnis nach der Tannenschlucht. Sie empfand in ihrem Herzen ein heißes Wogen und Wallen, über welches sie sich noch keine klare Rechenschaft gab.
Auch der Hauptmann von Hellenbach war bereits munter. Er sah Alma über den Schloßhof gehen. »Wahrhaftig, da spaziert sie fort!« zürnte er. »Und wohin? Jedenfalls zu dem geliebten Milchbruder. Ich werde ihr folgen, um zu beobachten, was geschieht.«
Und als er das Schloß verließ, stand der Baron droben an seinem Fenster und brummte zufrieden vor sich hin: »Da ging sie, und da geht er. Beim Förstersohne treffen sie sich, und da geht der Spektakel los. Ob ich dabei vielleicht etwas profitieren kann? Ich werde es versuchen. Mich soll übrigens verlangen, was sie sagen, wenn sie den Alten tot finden.«
Auch er begab sich auf den Weg, welcher nach der Tannenschlucht führte. Dort lagen noch die Zeugen des Kampfes, einige Leichen und Schwerverwundete und die erbeuteten Pakete, bewacht von den siegreichen Grenzaufsehern. Man mußte alles liegen lassen, bis die Gerichtspersonen, nach denen bereits geschickt worden war, gekommen waren, um den Sachbefund aufzunehmen.
Gustav hatte gestern eine weite Fußtour gemacht und des Nachts nicht geschlafen. Er wollte bei der Ankunft der gerichtlichen Kommission zugegen sein und ging daher nicht nach dem Forsthause, wo er bequemer hätte ruhen können. Er blieb in der Tannenschlucht, zog sich jedoch ein wenig seitwärts in den Wald hinein, um sich in das weiche Moos hinzustrecken. Seine Doppelbüchse lehnte an dem Baume neben ihm; die beiden Läufe waren natürlich geladen.
Indem er so da lag und mit dem Schlafe kämpfte, war es ihm, als ob er das leichte Trippeln von Frauenfüßchen vernehme. Er erhob sich und tat einige Schritte nach dem Wege hin, welcher hier vorüberführte. Man denke sich seine Freude, als er Alma erblickte, welche soeben vorbei wollte. »Wohin will mein Sonnenstrahl?« fragte er, indem er zwischen den Bäumen hervortrat.
Sie eilte sofort auf ihn zu und gab ihm die Hand.
»Ich mußte sehen, ob du noch lebst, mein lieber Gustav,« sagte sie. »Wie? Dein Rock ist voller Blut. Bist du verwundet?«
»Nein. Ich wollte einen angeschossenen Pascher, welcher fliehen wollte, festhalten und habe mich dabei beschmutzt. Im Schlosse ist doch kein Unglück passiert?«
»Nein. Was sollte denn geschehen sein?«
»Zwei Pascher wollten deinen Papa durch das Fenster erschießen.«
»Mein Gott!« rief sie erschrocken. »Ich habe noch gar nicht mit dem Vater gesprochen; er war noch nicht wach. Ich horchte an seiner Tür und fand alles still. Himmel, wenn er tot wäre!«
»Hast du Schüsse im Schlosse gehört?«
»Nein.«





























