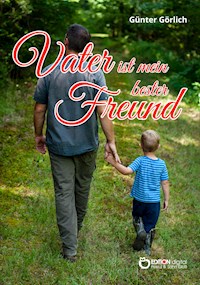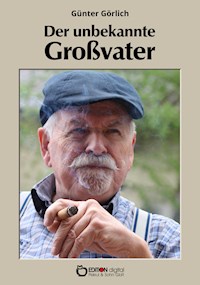7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist schon 54 und inzwischen schon fast selbst ein historisches Stück. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass es darin um einen gewissen Wilhelm Buchholz geht, den Opa von Marina, die ihre Ferien bei Oma verbringt. Dort begegnet sie André wieder, mit dem sie sich eigentlich schreiben wollte. Gemeinsam müssen sie einen Kriminalfall klären. Denn, wie es schon im Titel dieses für Leserinnen und Leser ab 11 Jahren geschriebenen Kinderbuches angedeutet ist, denn ein Schiffskompass ist plötzlich verschwunden. Dieser Kompass hat direkt mit Wilhelm Buchholz zu tun, wie Marina André erklärt: „Mein Opa war Matrose. Im November neunzehnhundertachtzehn hat er in Kiel gegen die Offiziere gekämpft. Später ist er nach Berlin gekommen. Oma sagt, er wollte, dass auch in Berlin die Revolution siegte. Er ist aber dann von den Feinden erschossen worden. Genau am Weihnachtsabend hat ihn eine Kugel getroffen. Das musst du dir mal vorstellen, am vierundzwanzigsten Dezember.“ Dieses Ereignis war schon zum Erscheinen des im selben Jahr beim Preisausschreiben für Kinder- und Jugendliteratur des Ministeriums für Kultur der DDR 1968 mit einem Preis ausgezeichneten Buches ein halbes Jahrhundert her und jetzt mehr als 100 Jahre. Noch einmal Marina: „Mein Opa hat den Kompass neunzehnhundertachtzehn aus Kiel mitgebracht. Es ist ein Kompass vom Kreuzer ,Prinz Karl‘. Auf dem Ding war mein Opa Maschinist. Von Oma weiß ich’s. Die Matrosen haben die Kaiseroffiziere verjagt und die rote Fahne hochgezogen. Im Theater hab ich mal die ,Matrosen von Cattaro‘ gesehen. Da war das auch so, bloß im Mittelmeer.“ Rückblende 1918: Novemberwetter im Hafen von Kiel. Dunkel und schmutzig das Wasser. Die grauen Kriegsschiffe Seiner Majestät wiegen sich träge in der schwachen Dünung. Zerstörer mit flachen, dicken Schornsteinen, bullige Räumboote, graue Kreuzer mit drohenden Panzertürmen. Darüber graue, tief hängende Wolken. Wilhelm, der ehemals kaiserliche Matrose, der jetzt eine rote Binde um seinen Arm trägt, steht neben einem Hilfskompass. Die Nadel pendelt nur ganz schwach. Wilhelm hat gefunden, was er suchte. Mit dem Kappmesser montiert er den Kompass ab. Genau dieser Kompass sollte jetzt den Matrosen eines Schiffes der Volksmarine geschenkt werden, das nach Wilhelm Buchholz benannt werden wird - dem roten Matrosen. Wer aber könnte dieses historische Stück gestohlen haben? André und Marina stellen eine Liste von Verdächtigen auf und beginnen mit ihren eifrigen Nachforschungen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Günter Görlich
Der verschwundene Schiffskompass
ISBN 978-3-96521-679-2 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 1968 in Der Kinderbuchverlag Berlin.
Dieses Buch wurde beim Preisausschreiben für Kinder- und Jugendliteratur des Ministeriums für Kultur der DDR 1968 mit einem Preis ausgezeichnet.
Für Leser von 11 Jahren an.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Die Wette
Als nun André bei Onkel Paul und Tante Lisa zu Abend aß, neigte sich der 4. Juli seinem Ende entgegen. Elf Tage nur noch. Ein Tatarenkäppchen war zu gewinnen, ein Finnmesser zu verlieren. „Ich geh noch ein bisschen raus“, sagte André.
Weil er seinen Gurt über der Lederhose ein Loch weiter machte, war Tante Lisa zufrieden und sagte: „In dem Alter hat man eben keine Ruhe auf dem Hintern. Unsereiner würde sich nach so einer Reise langstrecken.“
„Unsereiner“, sagte Onkel Paul und seufzte.
„Hier hast du deine Schlüssel. Aber komm nicht zu spät“, sagte Tante Lisa.
Es war nicht weit bis zum Tor der Laubenkolonie „Heimaterde“. Für den flinken André nur ein Katzensprung. Auf der Straße noch probierte er ihren Erkennungspfiff. Einmal lang und gellend, zweimal kurz. André hatte im vergangenen Jahr nicht wenig üben müssen, bis er diesen Pfiff beherrschte.
Passanten auf der Straße sahen sich verwundert um.
Rennt so ein langer Kerl und pfeift, dass einem die Ohren schmerzen.
Als André an das grüne, frisch gestrichene Holztor kam, lief er langsam. Mit einem Blick nahm er die Bank wahr, gleich neben dem Tor und der Anzeigetafel der Laubenkolonie. Hier konnte man gut sitzen, die Straße beobachten, die Autos und Straßenbahnen. Das war auch im vergangenen Jahr ihre Bank.
Für Liebespärchen, hatte Marina kichernd gesagt, sei die Bank sowieso nicht geeignet, weil genau darüber eine Lampe baumelt und überhaupt zu viele Leute hier vorbeikämen. Es war der Weg aller Siedler zur Straßenbahn.
André betrat zögernd den breiten, sauberen Schlackenweg. Da entdeckte er die beiden Wolgawagen. Sie standen dicht am Zaun hintereinander. Der vorderste bleckte sein breites Kühlermaul André entgegen.
Die Autos parkten am Zaun der Buchholzparzelle. André ging zögernd näher heran.
Er erkannte die feste Wohnlaube der Großmutter Buchholz, hinter der gutgeschnittenen Hecke. Auf dem Dach thronte ein schwarzer Wetterhahn, wenn ein launischer Wind blies, drehte er sich knarrend.
Am Gartentisch vor der kleinen Veranda saßen zwei Matrosen. Ihre weißen Mützen hatten sie auf den Tisch gelegt, und sie tranken aus hohen Gläsern. Sicherlich Apfelmost. Großmutter Buchholz konnte ihn genauso gut keltern wie Tante Lisa.
Die Matrosen unterhielten sich und rauchten.
André starrte über den Zaun. Wie kamen Matrosen in Großmutter Buchholz’ Garten?
Der Junge hatte sich so aufgestellt, dass er nicht gesehen werden konnte. Nach einer Weile trat Marina aus der Veranda. André stellte sich auf die Zehenspitzen. Marina sah so aus wie im vergangenen Sommer: das Gesicht braun gebrannt, schwarz die Haare, weiß die Bluse, und an den Beinen trug sie die verwaschene Niethose. Aber im vergangenen Jahr reichte die Hose noch bis zu den Knöcheln. Jetzt ging sie gerade bis zu den Waden. Marina brachte den Matrosen eine Karaffe Apfelmost. Sie goss die Gläser voll, und die Matrosen lachten.
André hinter der Hecke konnte nicht verstehen, worüber sie sprachen. Er hörte Marina lachen, und so hatte er sie noch nie lachen gehört.
Weil die Sonne schon tief stand und wie ein feuriger Ball aussah, wirkte das Bild vor der Veranda sehr farbig.
André pfiff nicht. Es waren doch Gäste bei Buchholz’. Aber er hätte brennend gern das Rätsel der beiden Autos und der Matrosen im Garten gelöst.
André schlich noch ein paarmal an die Hecke, lief um das Laubengelände und hoffte stets, wenn er am Tor auftauchte, die Wolgaautos vor dem Zaun wären verschwunden.
Das letzte Mal wählte er einen langen Weg, und weil es schon dunkel war, sah er im ersten Augenblick nicht die schwarzen Autos auf dem Schlackenweg. André dachte, sie wären nun endlich abgefahren, und wollte schon die Finger zum Pfiff zwischen die Lippen schieben, dann sah er, dass er sich getäuscht hatte. Die Autos standen noch da, die weißen Blusen der Matrosen leuchteten, ihre Stimmen waren zu hören, und aus den geöffneten Fenstern der Wohnlaube drang fröhliches Lachen.
Da lief der Junge langsam zum Häuschen von Onkel und Tante zurück. Im kleinen Zimmer unterm Dach lag er auf dem Bett, das dem jüngsten Sohn des Hauses gehörte, der aber schon über ein Jahr bei der Armee diente.
André fand lange keinen Schlaf. Die Autos und die Matrosen gingen ihm nicht aus dem Kopf.
Er war traurig, dass er nicht gepfiffen hatte. Einmal lang und gellend – dann zweimal kurz.
André erinnerte sich an den Sommer im vergangenen Jahr, als er Marina zum ersten Mal gesehen. Sie war durch die Straße geradelt, in der Tante Lisas und Onkel Pauls Haus stand, bei denen André seine Ferien verbrachte. Er saß auf einer Sandkiste für die Winterstreuung, und genau davor sprang die Kette von Marinas Fahrrad. Das Mädchen mühte sich vergeblich, den Schaden zu beheben. André hatte geholfen. So waren sie Freunde geworden, und als André bald darauf nach Hause fuhr, versprachen sie sich zu schreiben.
Das Versprechen vergaßen sie aber, vielleicht hatte jeder gewartet, dass der andere damit anfing.
Im Winter trafen sie sich unvermutet wieder. Das war bei den Pioniermeisterschaften im verschneiten Wald bei Oberhof. André stand am Zielort der Langläufer im tiefen Schnee. In einer Läuferin erkannte er Marina. Sie kam erschöpft an und taumelte, als ihr die Freunde von den Brettern halfen. André wagte nicht, zu ihr hinzugehen, zu viele bemühten sich um sie, und den aufgeregten Gesichtern war anzusehen, dass sie ihrer Marina einen guten Platz errechnet hatten.
„Was guckst du denn so?“, sagte neben ihm Hugo. „Das sind Berliner.“
Hugo aus Andrés Schule war schon in der 8. Klasse.
„Die dort drüben kenn ich, die mit der weißen Pudelmütze“, sagte André.
Hugo pfiff durch die Zähne.
„Hübscher Käfer“, bemerkte er, „und die kennst du?“
„Ehrenwort.“
„Geh doch mal hin“, stichelte Hugo, „stehst hier und starrst dir die Augen aus dem Kopf.“
„Ich geh schon noch hin“, sagte André.
In diesem Augenblick warfen die Berliner ihre Langläuferin in die Luft und fingen sie wieder auf. Marinas weiße Pudelmütze fiel in den Schnee. Es wurde gerufen: Berlin ist immer auf dem Kien. Berlin ist immer auf dem Kien.
Auf der Anzeigetafel las André den Namen Marina Buchholz und dass sie an zweiter Stelle stand.
„Jetzt musst du aber hin“, sagte Hugo.
André schwieg und rührte sich nicht vom Fleck.
„Du kennst sie ja gar nicht“, sagte Hugo höhnisch.
André lief hinüber und hob die Mütze auf. Als er vor Marina stand, sah sie ihn ungläubig an.
„Bist du nicht André?“
„Wer soll ich sonst sein. Hier hast du deine Pudelmütze. Sie lag im Schnee.“
„Ich hab den zweiten Platz. Stell dir das vor, den zweiten Platz hab ich.“
„Ich gratulier dir auch“, sagte André.
Eine große Frau hüllte Marina in eine Wolldecke.
„Jetzt aber Schluss“, schalt sie, „du brauchst deine Kräfte. Eine Erkältung könnte dir gerade noch fehlen.“
Sie führte Marina fort. André blieb allein zurück, und ihm war komisch zumute.
Hugo schlug ihm auf die Schulter.
„Na, hat sie dir wenigstens die Mütze abgenommen? Hat sie auch danke schön gesagt?“
„In diesem Jahr fahr ich noch nach Berlin. In den Ferien. Da seh ich sie jeden Tag.“
„Von weitem“, höhnte Hugo, „wie heute.“
André schrie: „Ich schick dir eine Karte, aus dem Tierpark, mit Stempel. Da steht mein Name drauf und auch ihrer. Wetten?“ Hugo sah André nachdenklich an.
„Gut“, sagte er, „ich wette um mein Tatarenkäppchen. Du weißt, mein Vater hat es aus Moskau mitgebracht. Du schaffst das nicht mit der Karte.“
André sagte: „Einverstanden. Ich wette um mein Finnmesser.“ Hugo staunte. Das Finnmesser war viel begehrt. Es hatte eine reichverzierte Lederscheide.
Sie gaben sich die Hände und schlugen sie auseinander.
Die Wette war gültig.
Den Termin für die Postkarte mit dem Tierparkstempel hatten sie noch festgelegt.
Der 15. Juli. Datum des Poststempels zählt …
Weil André spät eingeschlafen war, wachte er am nächsten Morgen erst auf, als ihm die Sonne ins Gesicht schien. Onkel Paul und Tante Lisa waren schon zur Arbeit gegangen. André schlang sein Frühstück hinunter. Er hatte noch eine Schrippe in der Hand, als er das Tor zur „Heimaterde“ aufstieß. Der Morgenhimmel war dunstig, und der Tag versprach heiß zu werden. Auf dem Schlackenweg parkten keine Autos mehr.
André brauchte nicht zu pfeifen.
Marina saß am Tisch vor der Veranda.
„Hallo, Marina“, rief André über den Zaun hinweg.
Sie sah auf und schien nachzudenken. Marina kam an den Zaun und stützte die Arme auf die niedrige Tür. André dachte, dass sie überrascht sein müsste. Er hatte sich ihre Überraschung in den letzten Wochen oft ausgemalt.
Marina schien mit ihren Gedanken ganz woanders zu sein. Sie sagte, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt: „Tag, André.“
„Gestern bin ich angekommen“, sagte der Junge.
Marina nickte.
Plötzlich sagte sie traurig: „Bei uns hat jemand eingebrochen. Stell dir das vor, André. Bei meiner Oma hat jemand gestohlen.“
Was kann ein alter Kompass schon wert sein …
Marina zog André in eine schmale Kammer hinein. Der Junge musste sich erst an das Dämmerlicht gewöhnen. Vor dem winzigen Fenster wuchs ein dicht belaubter Pflaumenbaum. André duckte sich unwillkürlich, weil die Deckenbalken niedrig waren. In der Kammer stand ein breites Holzbett, das Bett der Großmutter.
„Hier war er an der Wand festgemacht“, sagte Marina aufgeregt, „über vierzig Jahre hat er hier gehangen!“
Sie wies auf einen hellen kreisrunden Fleck an der Tapete.
„Was ist denn eigentlich weg?“, fragte André.
Marina sah ihn verwundert an.
„Das hab ich dir noch nicht gesagt?“
„Nein“, sagte André, „du bist ja so aufgeregt.“
Marina pochte an den hellen Fleck an der Wand.
„Der Kompass ist weg. Der Schiffskompass“, erzählte Marina. „Oma ist’s heute früh eingefallen, sie könnte den Kompass doch den Matrosen schenken. Ein feiner Einfall, hab ich gleich gedacht. Oma wollte den Kompass holen, und da war er nicht mehr da. Oma, musst du wissen, sieht schon etwas schlecht. Sie hat mich gleich gerufen und zu mir gesagt: ,Marina, ich find den Kompass nicht mehr. Bin ich denn schon so verdreht?‘ Ich lachte und sagte: ,Oma, der hängt doch in der Ecke. Guck mal richtig nach.‘ – ,Er ist aber weg‘, sagte Oma. Ich merkte, dass ihre Stimme ganz zittrig ist, und bin schnell zu ihr hingelaufen. Ich guckte und rieb mir die Augen und guckte noch mal. Aber der Kompass hing nicht mehr an der Wand. Ich fragte: ,Oma, hast du ihn vielleicht abgenommen?‘ Aber Oma schüttelte nur den Kopf.“
André hatte mit steigender Verwunderung zugehört. Dann stieß er seine Hände in die Taschen.
„Ich versteh immer Bahnhof. Was war los? Ein Kompass ist weg?“ Marina sagte empört: „Klar, ein Kompass. Einer von einem Kriegsschiff. Hier war er festgemacht.“
André sagte: „Du musst mir das der Reihe nach erzählen. Matrosen waren da, denen will deine Oma den Kompass schenken. Das hab ich verstanden. Aber warum will deine Oma den Matrosen einen Kompass schenken? Was hat deine Oma überhaupt mit Matrosen zu tun? Was brauchen die einen Kompass, der vierzig Jahre alt ist? Die haben doch ganz andere Dinger auf ihren Pötten. Ich weiß da Bescheid.“ Das Mädchen boxte André an den Arm. Er war darüber froh, das war endlich die ihm vertraute Marina.
„Sei nicht böse, André“, sagte sie, „komm in den Garten. Ich erzähl dir’s der Reihe nach. Bloß dass hier was weggekommen ist, will mir nicht in den Kopf. Bei meiner Oma ist noch nie was gestohlen worden.“
Sie verließen die niedrige Kammer. Im großen Wohnzimmer bewunderte André den breiten Kachelofen. Man konnte ahnen, wie viel Wärme er im Winter ausstrahlte. Und André hatte sehr viel übrig für Bratäpfel.
Im Garten setzte sich André an den Tisch, an dem gestern Abend die Matrosen gesessen hatten. Marina sprang noch einmal in das Haus zurück und brachte die Karaffe mit Apfelmost und zwei hohe Gläser. Sie goss ein und steckte dabei ein wenig die Zungenspitze heraus, so eifrig war sie bemüht, keinen Tropfen danebenzuschütten. Der Junge dachte, so hat sie auch gestern die Matrosen bewirtet. Nun enthüllte sich hoffentlich bald das Geheimnis der Wolgaautos.
Aber er wird nicht sagen, dass er hinter der Hecke gelauert und sich nicht getraut hatte zu pfeifen.
Marina saß ihm gegenüber. Sie hockte nur so auf der Stuhlkante. Marina hob das Glas mit Apfelmost und sagte: „Prost, André!“ Der Junge sagte verwirrt: „Prost.“
Sie hatte ihn nun wahrgenommen, das wusste er jetzt, und er glaubte, dass ihm nachträglich die Überraschung gelungen war.
„Wo bist du denn damals geblieben, in Oberhof?“, fragte Marina. André hatte sein Glas bereits geleert. – Und nicht, weil er großen Durst hatte!
„Deine Freunde haben dich so schnell weggeschleppt. Deine Trainerin hat dich ja ganz scharf bewacht.“
„Das ist wahr. Sie ist beim Wettkampf streng. Muss sie ja auch. Aber ich hab dich noch gesucht.“
„Ich hab dich auch gesucht“, sagte der Junge und trank die Neige aus dem Glas.
„Du hast aber einen Durst“, sagte das Mädchen und goss wieder ein.
„Ja, gestern gab’s Fisch“, erfand André. Dann forderte er energisch: „Nun erzähl mal!“
Marina holte Luft.
„Wenn wir wenigstens wüssten, hat meine Oma gesagt, wann der Dieb gestohlen hat. Hat er von draußen reingelangt? Der muss aber lange Arme haben. Ich hab mich mal draußen hingestellt …“ André unterbrach streng: „Du kannst nicht vernünftig berichten. So wird kein Mensch daraus schlau. Es ist ja eine kriminelle Sache. Ich werde dich einfach verhören. Ich war mal bei einem Vortrag eines Kriminalpolizisten. Interessante Sache.“
Marina sagte ergeben: „Na gut, verhör mich. Was bin ich denn überhaupt, wenn du mich verhörst?“
„Na, ein Zeuge.“
„Zeuge? Wie kann ich Zeuge sein? Ich war ja nicht dabei, als der Dieb hier herumstrolchte.“
André meinte ungeduldig: „Das ist ja auch nicht so wörtlich zu nehmen. Zeugen sind Personen, die Licht in eine dunkle Angelegenheit bringen können. So eine Person bist du doch.“
Marina lachte leise.
„Eine Person. Was für Ausdrücke du hast.“
„Das heißt eben so. Ich hab’s nicht erfunden.“
„Na, fang schon an, Kriminalkommissar.“
André blickte finster. In dieser Beziehung hatte sich Marina überhaupt nicht geändert.
„Muss der Kommissar beim Verhör so böse gucken?“
„Wenn man nachdenkt, sieht man nicht gerade fröhlich aus“, wies André sie zurecht.
„Also, Frage Nummer eins: Was haben Matrosen bei euch zu suchen?“
Marina zappelte schon wieder auf ihrem Stuhl umher.
„Du, das ist ein tolles Ding. Kriegt doch Oma vor drei Wochen einen Brief. So ein langes Kuvert. Anschrift mit Schreibmaschine geschrieben …“
„Zur Sache“, sagte André.
„Was?“
„Zur Sache sollst du reden, nicht soviel abschweifen.“
„Das ist doch zur Sache“, sagte Marina eingeschnappt.
„Also red weiter, da hat also deine Oma einen Brief erhalten …“
„Sind Kriminalkommissare eigentlich immer ungeduldig?“, fragte das Mädchen.
„Ich bin doch nicht ungeduldig“, wehrte André ab, „aber bei der Aufklärung einer Tat muss man sich konzentrieren.“
„Also gut“, seufzte Marina, „der Brief kam von der Volksmarine. Sie schrieben, dass sie einem neuen Schiff einen Namen geben wollen, und es soll wie mein Opa heißen!“
„Was für einen Namen?“
„Wilhelm Buchholz. So hieß mein Opa.“
André hielt es nicht mehr auf dem Stuhl. Misstrauisch sah er auf Marina herab.
Was hatte sie im Sinn? Wollte sie ihn verkohlen? Aber die Matrosen gestern Abend? André hatte sie mit eigenen Augen gesehen.
„Wieso soll ein Schiff der Volksmarine nach deinem Opa genannt werden?“
Marina wollte wieder empört auffahren, doch dann besann sie sich, dass sie ja verhört wurde und zu antworten hatte. Und woher sollte André das wissen.
„Mein Opa war Matrose. Im November neunzehnhundertachtzehn hat er in Kiel gegen die Offiziere gekämpft. Später ist er nach Berlin gekommen. Oma sagt, er wollte, dass auch in Berlin die Revolution siegte. Er ist aber dann von den Feinden erschossen worden. Genau am Weihnachtsabend hat ihn eine Kugel getroffen. Das musst du dir mal vorstellen, am vierundzwanzigsten Dezember.“
„Kriminalkommissar“ André hatte fast seine Aufgabe vergessen. Aufgeregt lief er vor dem Tisch auf und ab. So einen Großvater hatte die Marina. Als er starb, musste er noch ein junger Mann gewesen sein. André erinnerte sich an alles, was er über diese Zeit gehört und gelesen hatte, an Filme und Bücher. Und auf einmal saß vor ihm Marina und erzählte, ohne mit der Wimper zu zucken, von ihrem Großvater, der dabei gewesen war.
André besann sich auf seine Rolle als „Kriminalkommissar“ und sagte: „Wie viel ist denn ein Schiffskompass wert?“
„Oh“, sagte Marina, „das ist es ja. Er ist viel wert. Und es ist nicht zu bezahlen, was er wert ist.“
„Ein alter Schiffskompass“, sagte André zweifelnd, „was kann er schon einbringen? Fünfzig Mark vielleicht?“
„Oma hat gesagt, ein paar Mark kriegt man schon dafür. Seltenheitswert. Es gibt ja Leute, die sammeln alles Mögliche. Warum nicht altes Zeug von der Seefahrt. Aber darum geht’s nicht. Mein Opa hat den Kompass neunzehnhundertachtzehn aus Kiel mitgebracht. Es ist ein Kompass vom Kreuzer ,Prinz Karl‘. Auf dem Ding war mein Opa Maschinist. Von Oma weiß ich’s. Die Matrosen haben die Kaiseroffiziere verjagt und die rote Fahne hochgezogen. Im Theater hab ich mal die ,Matrosen von Cattaro‘ gesehen. Da war das auch so, bloß im Mittelmeer.“
Marina holte Luft und dachte nach.
André hatte sich wieder hingesetzt. Kein Wort wollte er sich entgehen lassen.
Marina erzählte die Geschichte vom Kompass, und André vergaß den Garten und auch, dass Sommer war …
Damals in Kiel …
Novemberwetter im Hafen von Kiel. Dunkel und schmutzig das Wasser. Die grauen Kriegsschiffe Seiner Majestät wiegen sich träge in der schwachen Dünung. Zerstörer mit flachen, dicken Schornsteinen, bullige Räumboote, graue Kreuzer mit drohenden Panzertürmen. Darüber graue, tief hängende Wolken.
An der Reling Seiner Majestät Schiff „Prinz Karl“ lehnt Wilhelm Buchholz. Den dicken Kragen seiner Matrosenjoppe hat er hochgeschlagen. Ihn fröstelt trotzdem. Wilhelm Buchholz ist einer der letzten auf dem eisernen Sarg, und er wird auch bald das Fallreep hinabsteigen. Nur die blanken Knöpfe mit dem Kaiseradler verraten noch, dass Wilhelm Buchholz bis vor ein paar Tagen bei der kaiserlichen Marine diente. Die rote Binde um seinen Arm erzählt, dass er dabei war, als die Hochseeflotte des Kaisers abmusterte, weil die Matrosen nicht mehr sterben wollten. Wilhelm Buchholz schaut über den toten Hafen, die verlassenen Kriegsschiffe und zählt die Schornsteine, aus denen kein Rauch mehr quillt.
Feuer aus den Kesseln, das war das Kommando. Auf „Prinz Karl“ hatte er es gegeben.
Wilhelm denkt an seine Frau Anna in Berlin und an seinen kleinen Sohn Erich. Er hat ihn noch nicht gesehen, denn er ist erst vor einem halben Jahr geboren. Wilhelm versucht, sich den kleinen Erich vorzustellen. Was hat er für Augen? So blaue wie Anna? Irgendjemand hat mal erzählt, dass die Augenfarbe bei Babys nicht zu bestimmen ist. Das geht erst später. Bald sehe ich die kleine Krabbe, denkt Wilhelm.
Dem einsamen Matrosen Wilhelm Buchholz ist warm geworden bei den Gedanken an seine Frau und den Jungen. Da kommt ihm die Idee, etwas mitzunehmen für die Frau und den Jungen, eine Erinnerung an die Tage hier in Kiel, als sie die Matrosenschinder und Kriegsbesessenen von den Schiffen jagten. Wilhelm schaut sich um.
Eine Kanone kann er nicht in den Seesack stecken. Ein Rettungsboot ist auch kein Spielzeug. Auf so einem eisernen Kasten gibt’s nichts, was hübsch und niedlich ist. In diesem Moment hört Wilhelm schleichende Schritte. Das kann nur auf der Kommandobrücke sein. Aber wer ist dort oben? Auf dem Kommandostand hat keiner etwas zu suchen: Beschluss des revolutionären Matrosenrats! Hatten kaisertreue Offiziere nicht schon hier und dort versucht, der Revolution zu schaden?
Wilhelm lauscht. Hat er sich getäuscht? Aber da hört er wieder die leisen Schritte, Gummisohlen auf Eisenbelag. Wilhelm zieht sein Kappmesser unter der Joppe hervor und entert die Treppe zum Kommandostab hoch. Unterwegs zieht er seine Joppe aus. Sie hindert ihn nur, denn er hat sich nicht getäuscht. Auf der Kommandobrücke ist eine Gestalt zu sehen. Sie bewegt sich vorsichtig auf den Flaggenmast zu. Die rote Fahne schlappt in der feuchten Luft. Wilhelm bewegt sich rascher vorwärts, versucht jedoch, in Deckung zu bleiben. Dann stürmt Wilhelm in großen Sätzen auf die Brücke.
Die rote Fahne sinkt langsam am Mast herab. Wilhelm springt die Gestalt an und reißt sie zu Boden. Beim Fallen erkennt er einen Offiziersmantel, und er sieht in das schreckverzerrte Gesicht des ehemaligen Zweiten. Der wütende Offizier versucht, aus der Manteltasche eine Pistole herauszuziehen.
Wilhelm reißt ihn am Mantel hoch und schlägt ihm die Pistole aus der Hand. Die Waffe knallt gegen die eiserne Brückenwandung. Der Offizier richtet sich langsam auf. Hasserfüllt starrt er den Matrosen an. Auf seinem Offiziersmantel sind keine Rangabzeichen. Er klopft den Schmutz von seinem Mantel, als gäbe es nichts Wichtigeres für ihn in diesem Augenblick. „Zieh die Flagge hoch!“, sagt Wilhelm heiser vor Zorn. Der Offizier macht keine Anstalten. Verächtlich blickt er Wilhelm an.
„Ihr Lumpen, diesen Fetzen nennt ihr Flagge?“
Plötzlich reißt der Offizier aus seinem Mantel die alte Kriegsflagge des Kaisers.
Er brüllt außer sich vor Wut.
„Die gehört auf den Mast. Der habt ihr geschworen. Ihr alle … Besinnt euch darauf. Besinnt euch rechtzeitig. Sonst …“
Wilhelm ist jetzt sehr ruhig. Er tritt an den Offizier heran und reißt ihm die Kaiserflagge aus der Hand. Er zerfetzt sie mit dem Kappmesser und wirft sie zu Boden.
„Unter diesem Dreckfetzen sind Tausende zu den Fischen gefahren. Für wen? Der Skagerrak liegt voll von unseren Kameraden. Aus mit diesem Fetzen. Aus mit dir. Zu Ende der verfluchte Spuk.“
Wilhelm springt zur Seite und hebt blitzschnell die Pistole auf. Er entsichert sie und tritt auf den Offizier zu.
Dessen Wut ist verflogen. Er ist bleich im Gesicht. Wilhelm sagt leise, aber scharf: „Zieh die Flagge hoch. Los! Zieh die rote Fahne hoch.“ Und die rote Fahne steigt wieder am Flaggenmast empor. Der Offizier schwitzt.
Wilhelm schießt in die Luft. Dreimal. Die Schüsse hallen dumpf in der schweren Luft. Die Schiffswache poltert hastig die Eisenstiegen hoch. Karabiner im Anschlag. Wilhelm übergibt der Wache den Offizier, die Pistole und den zerfetzten Lappen des Kaisers. Einer der Matrosen sagt: „Sie haben’s noch nicht aufgegeben. Sie werden uns noch zu schaffen machen. Und wir haben das Gesindel geschont. In Russland haben sie es anders gemacht. Für solche gab’s dort keine Gnade.“
Er stößt den Offizier vor sich her zur Treppe.
Ein anderer sagt: „Du kennst die Beschlüsse, Robert. Keine übereilten Handlungen.“
Wilhelm ist allein auf der Brücke zurückgeblieben. Er wischt sich den Schweiß vom Gesicht. Noch einmal prüft er die Befestigung der Flagge am Mast. Dann geht sein Blick über die Brücke. Von hier aus wurden die Kommandos gegeben.
„Volle Fahrt voraus. Klar zum Gefecht.“
Und dann drehten sich die ungefügen Panzertürme gegen den Feind. Wer war der Feind? Auch solche Matrosen wie Wilhelm fuhren drüben. Vielleicht ein Schlossergeselle aus der Stadt London. Im grünlichgrauen Wasser des Skagerrak, tief unten auf dem Grund, konnten sie dann einander begegnen, der Schlosser aus Berlin und der aus der Stadt London – als Tote.
Bei diesem Gedanken gerät Wilhelm wieder in Zorn. Und wäre jetzt der Offizier noch auf der Brücke gewesen, wer weiß. Vielleicht hätte er ihm die Rechnung von Skagerrak präsentiert.
In dem Augenblick bemerkt Wilhelm, dass er neben einem Hilfskompass steht. Die Nadel pendelt nur ganz schwach. Wilhelm hat das gefunden, was er suchte. Mit dem Kappmesser montiert er den Kompass ab.
Er hält ihn in der Hand. Nun schlägt die Nadel wild aus. Mit dem scharfen Kappmesser ritzt Wilhelm Buchholz in das Metall der Rückseite: – Kiel. November 1918. – Und die Bezeichnung: SMS „Prinz Karl“ – kratzt er aus. Dann verlässt er schwerfällig die Kommandobrücke …
Der Kompass muss wieder her
„Der Seesack war ganz schön schwer, hat meine Oma erzählt, als Opa eines Tages ihn in die Wohnung wuchtete. Brot und Konserven hatte er auch mitgebracht. Und ganz zuletzt holte er den Kompass raus. Oma hat vielleicht Augen gemacht. Kannst du dir ja vorstellen. Noch ein paar Konserven wären ihr lieber gewesen. Aber dann hat Opa ihr alles erzählt. Und da hat sie’s schon verstanden.“
André hatte vom Zuhören eine kühle Nasenspitze bekommen. Sein Gesicht aber glühte.
„Was dein Opa da eingeritzt hat, das konnte man heute noch lesen?“
„Na, was denkst du denn. Mit einem spitzen, scharfen Messer richtig eingeritzt, das hält doch ewig.“
André seufzte. Ja, der Kompass hat einen Wert, der nicht mit Geld zu bezahlen ist.
„Was seufzt du denn so?“, fragte Marina.
„Ich denk an den Kompass. Der muss doch wieder her. So ein Stück. Das ist doch … das ist doch Geschichte. Der kann doch nicht irgendwo vergammeln.“
André war wieder aufgesprungen. Die Hände hatte er in die Taschen gestoßen.
„Der Kompass gehört auf das neue Schiff. Klar. Auf die Kommandobrücke muss er. Wir müssen ihn finden.“
Marina saß ganz still am Tisch. Sie sah zu dem Jungen auf und bewunderte ihn in diesem Augenblick sehr.
Doch man kann nicht länger als ein paar Minuten so sitzen und bewundern. Dann meldet sich wieder der Verstand.
„Er ist weg. Gestohlen. Wir wissen nicht mal, wann das war. Es kann gestern passiert sein. Aber vielleicht auch schon vor drei Wochen“, sagte Marina mutlos.
„Und die Polizei?“, fragte André.
Marina winkte ab.
„Was soll die Polizei? Was können wir denn sagen. Das sagt meine Oma auch. Er ist weg. Und was noch?“
„Ja“, sagte André, „keine Spuren. Nichts. Was soll man da schon machen.“
Nun saßen die beiden wieder schweigend am Tisch. Die Sonne war höher geklettert und heizte tüchtig ein.
„Wollen wir ins Freibad?“, fragte Marina.
„Das wär schon was“, meinte André.
Aber er rührte sich nicht von seinem Platz, und auch Marina machte keine Anstalten aufzustehen.
An der Wäscheleine hing ein roter Badeanzug.
„Deine Oma ist traurig, was?“, fragte André.
„So ein Lump, der den Kompass gestohlen hat. Was hat er davon?“ André stützte seinen Kopf in beide Hände und beugte sich vor.
„Und wenn wir nachforschen?“
Hoffnung zeigte sich im Gesicht des Mädchens, aber nur ganz kurz. „Was sollen wir schon ausrichten, André …“
Der Junge aber sagte eifrig: „Du kennst doch alle Leute hier. Stell dir vor, wir finden eine Spur. Man kann doch nicht wissen.“
André lebte schon in der Welt abenteuerlicher Spurensuche und Verbrecherjagd. – Er sieht, wie er jemand verfolgt. Er lauert hinter Büschen. Und irgendwo ist der alte Kompass verborgen. Dann hält er ihn in der Hand und sucht die Inschrift. Marinas Oma überreicht er das kostbare Stück. Oma Buchholz kann nicht sprechen, so freut sie sich. Marina steht neben ihm und sagt: „Der André hat nicht aufgegeben.“ Und André wird eingeladen, als das neue Schiff der Volksmarine den Namen „Wilhelm Buchholz“ bekommt. Oma Buchholz muss die Sektflasche werfen, das kennt André, denn er war schon zweimal dabei, und er wird dem Kommandanten den Kompass übergeben. Natürlich wird er zu einer kurzen Ausfahrt eingeladen. Natürlich werden Marina und er auf der Kommandobrücke stehen. Zu der alten Geschichte des Kompasses wird die neue erzählt werden …
Und die ist auch aufregend. –
„Hast du Hunger?“, fragte Marina.
André sah verwirrt zu ihr hinüber.
Marina lachte. „Wo bist du denn mit deinen Gedanken? Oma hat Kirschkuchen gebacken. Ich kann dir sagen, so kann nur Oma backen. Ich hab die Kerne rausgemacht.“
„Na, hol ihn schon her“, sagte André.
Ihm war zwar nicht nach einem zweiten Frühstück zumute, aber auf dem Riesenteller, den Marina auf den Tisch stellte, lagen bald nur noch ein paar Krümel.
„Gehen wir ins Bad?“, fragte André.
Marina nahm den Badeanzug von der Leine. André schaute zu ihr hinüber. Sie ist dünner geworden, dachte er. Oder kommt mir das bloß so vor, weil sie gewachsen ist.
„Ich muss auf Oma warten. Sie holt ihre Rente“, sagte Marina, „wir können aber schon vorgehen, ans Tor.“
„Die Bank steht ja noch“, sagte André.
„Ja, dort sitz ich gern. Da ist immer was zu sehen.“
Auf dem Schlackenweg entdeckte André wieder die dicken Reifenspuren der Wolgawagen.
Marina lief voraus und schwenkte mit dem roten Badeanzug. Er hob sich deutlich von der blauen Niethose ab.
André dachte an den Schiffskompass.
Auf der grüngestrichenen Bank neben dem Tor zur Laubenkolonie „Heimaterde“ sagte André: „Wir können ja mal überlegen, wer so in Frage kommt als Dieb.“
Marina baumelte mit den Beinen. Sie starrte auf die ausgetrocknete Erde, als könnte sie dort des Rätsels Lösung erfahren.
„Wir müssen also jemand verdächtigen“, sagte sie kleinlaut.
André sah sie von der Seite an. So ist sie nun. Erst aufregen, eine tolle Geschichte erzählen, und jetzt …
„Was heißt verdächtigen“, sagte er aufgebracht, „wir müssen überlegen. Ganz kalt. Was meinst du, wenn das die Polizei nicht täte, würde sie überhaupt nichts aufklären. Willst du nun eigentlich, dass die Sache aufgeklärt wird?“
Eine Straßenbahn kreischte in der Kurve. Marina spähte hinüber zur Haltestelle. Großmutter stieg aber nicht aus.
„Du hast ja recht, André“, sagte sie versöhnlich, „überlegen können wir mal.“
André senkte die Stimme. „Wen kennst du nun, der so in Frage kommt?“
Der Kreis der Verdächtigen
Die Bank war geduldig. Man konnte gut darauf sitzen und nachdenken. Die Bank lag immer im Schatten, sogar in der Mittagszeit. Marina war schon ganz blass von der Suche nach Verdächtigen. Sie murmelte manchmal was vor sich hin, brach wieder ab und schüttelte den Kopf.