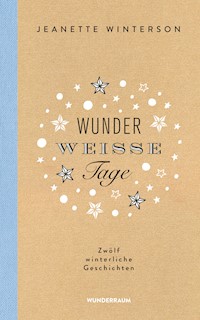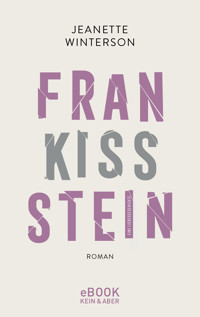5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Blinde Eifersucht und zerstörerischer Zorn – doch die Zeit heilt alle Wunden
Der Londoner Investmentbanker Leo verdächtigt seine schwangere Frau MiMi, ihn mit seinem Jugendfreund Xeno zu betrügen. In rasender Eifersucht und blind gegenüber allen gegenteiligen Beweisen verstößt er MiMi und seine neugeborene Tochter Perdita. Durch einen glücklichen Zufall findet der Barpianist Shep das Baby und nimmt es mit nach Hause. Jahre später verliebt sich das Mädchen in einen jungen Mann – Xenos einzigen Sohn. Zusammen machen sie sich auf, das Rätsel ihrer Herkunft zu lösen und alte Wunden zu heilen, damit der Bann der Vergangenheit endlich gebrochen wird.
Jeanette Winterson spielt souverän mit Figuren und Handlung aus Shakespeares "Das Wintermärchen" und erzählt eine verblüffend moderne Geschichte über rasende Eifersucht, blinden Selbsthass und die tiefe Sehnsucht in uns, die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch:Der Londoner Investmentbanker Leo verdächtigt seine schwangere Frau MiMi, ihn mit seinem Jugendfreund Xeno zu betrügen. In rasender Eifersucht und blind gegenüber allen gegenteiligen Beweisen verstößt er MiMi und seine neugeborene Tochter Perdita. Durch einen glücklichen Zufall findet der Barpianist Shep das Baby und nimmt es mit nach Hause. Jahre später verliebt sich das Mädchen in einen jungen Mann – Xenos einzigen Sohn. Zusammen machen sie sich auf, das Rätsel ihrer Herkunft zu lösen und alte Wunden zu heilen, damit der Bann der Vergangenheit endlich gebrochen wird.
Jeanette Winterson spielt souverän mit Figuren und Handlung aus Shakespeares Das Wintermärchen und erzählt eine verblüffend moderne Geschichte über rasende Eifersucht, blinden Selbsthass und die tiefe Sehnsucht in uns, die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen.Über die Autorin: Jeanette Winterson, geboren 1959, hat bereits zahlreiche Romane sowie Sach- und Kinderbücher veröffentlicht. Sie gilt als eine der profiliertesten Autorinnen und Feministinnen Großbritanniens. Sie wuchs in Manchester auf, wo ihre Adoptiveltern der Pfingstbewegung angehörten und sie streng erzogen. Über diese Erfahrung schrieb Winterson in ihrem ersten Roman Orangen sind nicht die einzige Frucht und 27 Jahre später in Warum glücklich statt einfach nur normal?. Beide Bücher wurden zu Bestsellern.
Shakespeares Das Wintermärchen erzählt die Geschichte des Findelkindes Perdita. »Wir alle haben Texte, die wir wie Glücksbringer in uns tragen und die uns tragen. Seit Jahren kreist meine Arbeit immer wieder um dieses Stück.« Nun erzählt Winterson ihre eigene Version von Shakespeares Klassiker.
Jeanette Winterson
Der weite Raum der Zeit
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Schwenk
Knaus
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Gap of Time« bei Hogarth, einem Imprint der Penguin Random House Group, LondonDieser Roman ist Teil der Reihe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Die Verlagsgruppe Random House weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.1. Auflage
© der Originalausgabe Jeanette Winterson 2015
© der deutschsprachigen Ausgabe 2016 beim Albrecht Knaus Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagmotiv: shutterstock/hvoya
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-8135-0673-0
www.knaus-verlag.de
Das Original
Die Cover-Version
Eins
Feuchtes Mondgestirn
Spinne im Becher
Venus-Lustgestirn
Ist das nichts?
Dorn, Stacheln, Nesseln, Wespenstich
Zielscheibe Ihres Albtraums ist mein Leben
Federn für jeden Wind
Als Fremdkörper in die Fremde
Krähn und Geier, Bärn und Wölfe
Pause
Zwei
Kleine Stibitzereien
Der Tag der Feier
Denn das entwirrt beizeit’ die Zeit
Pause
Drei
Geister, die umgehen
Es wär’ mir ohne ihre Liebe ein Nichts
Hier in der Stadt
Wenn dies Magie ist …
Musik, erweck sie
Epilog
Danksagung
Für Ruth Rendell 1930 – 2015
Past fifty, we learn with surprise and a sense
of suicidal absolution
that what we intended and failed
could never have happened –
and must be done better.
Robert Lowell, For Sheridan
Das Original
Der Ort Das Stück beginnt in Sizilien, einer von Shakespeares zahlreichen imaginären Inseln.
Die Zeit Erfunden.
Die Geschichte Polixenes, König von Böhmen, hält sich seit neun Monaten bei seinem Jugendfreund Leontes auf, dem König von Sizilien. Polixenes will nach Hause. Vergeblich versucht Leontes, ihn zum Bleiben zu bewegen. Als auch Leontes’ schwangere Frau Hermione ihn bittet, willigt Polixenes ein, noch etwas zu bleiben. Leontes jedoch glaubt, dass Polixenes und Hermione eine Affäre haben und das Kind, das bald zur Welt kommen wird, von Polixenes ist. Er ruft seinen Diener Camillo und befiehlt ihm, Polixenes zu vergiften. Doch der warnt Polixenes vor dem Anschlag, und die beiden fliehen.
Außer sich vor Wut beschuldigt Leontes seine Frau öffentlich der Untreue. Taub gegen die Proteste des ganzen Hofs, insbesondere der Edelfrau Paulina, die ihm als Einzige die Stirn bietet, wirft er Hermione ins Gefängnis. Leontes erträgt es nicht, dass niemand seinen wahnwitzigen, abscheulichen Anschuldigungen gegen Hermione Glauben schenkt. Um nicht als Tyrann zu gelten, schickt er Boten los, die das Orakel von Delphi befragen sollen.
Unterdessen bringt Hermione eine Tochter zur Welt. Leontes erklärt das Kind zum Bastard und verfügt seinen Tod. In der Hoffnung, Leontes doch noch zu besänftigen, zeigt ihm Paulina das Kind, aber er droht damit, es eigenhändig totzuschlagen. Weil sich Paulina jedoch nicht einschüchtern lässt, erlaubt er schließlich, das Kind an einen fernen Ort zu bringen und dort seinem Schicksal zu überlassen. Paulinas Ehemann Antigonus wird damit beauftragt.
Als Antigonus fort ist, stellt Leontes Hermione vor Gericht und demütigt sie vor dem Hof. Je wütender er sie traktiert, desto standhafter und würdevoller weist sie seine irren Diffamierungen zurück.
Der Orakelspruch aus Delphi platzt in den Scheinprozess hinein: Das Orakel verkündet, dass Leontes ein eifersüchtiger Tyrann ist, dass Hermione, Polixenes wie auch das Baby unschuldig sind und Leontes keine Erben haben wird, bis sich das verlorene Kind wiederfindet.
Schäumend vor Wut weist Leontes den Orakelspruch zurück. In diesem Moment stürzt ein Bote mit der Nachricht herein, dass der junge Mamillius, Leontes einziger Sohn, tot ist. Hermione bricht zusammen. Leontes zeigt Reue. Es ist zu spät. Die Königin ist tot.
Der Ort Böhmen, heute Teil der Tschechischen Republik. Eine Küste hat das Land nie gehabt.
Die ZeitErfunden.
Die Geschichte Antigonus lässt die kleine Perdita mit Geld und Beweisen ihrer Herkunft an der Küste Böhmens zurück und will noch vor dem nahenden Sturm die Heimreise antreten. Doch sein Schiff kentert. Antigonus wird mit der berühmtesten Regieanweisung der Welt getötet: Rennt ab, von einem Bären verfolgt.
Unterdessen wird Perdita von einem armen Schäfer und Hansnarr, seinem etwas einfältigen Sohn, gefunden. Sie erbarmen sich des Babys und ziehen es groß wie ihr eigenes Kind.
Der Ort Böhmen.
Die Zeit 16 Jahre später.
Die Geschichte Prinz Florizel, der Sohn von Polixenes, hat sich in Perdita, die vermeintliche Tochter des Schäfers, verliebt.
Schauplatz ist das Schafschurfest. Das Geld, das der Schäfer und sein Sohn Hansnarr bei Perdita fanden, hat die beiden reich gemacht.
Florizel gibt vor, kein reicher Prinz, sondern ein Mann des Volkes zu sein. Er macht Perdita einen Heiratsantrag und bittet zwei ältere, fremde Männer, Zeugen der Verlobung zu sein.
Wie sich herausstellt, handelt es sich bei den Fremden um seinen Vater Polixenes und Camillo, beide verkleidet.
Während sich Perdita und Florizel ihre Liebe erklären, spielt der Gauner Autolycus auf dem Fest den Unterhalter und belügt und beklaut dabei, wen er kann. Er ist Shakespeares liebenswertester Bösewicht – witzig, sprunghaft, nicht kleinzukriegen und letztlich auch das überraschende Mittel zum Happy End …
Während Hansnarr seine Freundinnen Mopsa und Dorcas unterhält und sich der Schäfer am Glück des jungen Paars erfreut, reißt sich Polixenes plötzlich die Verkleidung vom Leib und lässt dem Zorn auf seinen Sohn freien Lauf.
Er stürmt davon und verbietet Florizel, Perdita je wiederzusehen. Camillo wittert die Chance, endlich heimzukehren. Er bietet Florizel und Perdita an, sie nach Sizilien zu bringen. Sie willigen ein und fliehen.
Der Schäfer, Hansnarr und Autolycus folgen ihnen.
Der Ort Sizilien.
Die Zeit Aufgehoben.
Die Geschichte Florizel und Perdita treffen am Hof von Leontes ein. Der findet kurzzeitig Gefallen an Perdita. Doch dann tauchen der Schäfer und Hansnarr mit den Beweisen ihrer Herkunft auf, und Leontes erkennt, dass sie seine Tochter ist.
Polixenes, der die Flüchtenden heimlich verfolgt hat, versöhnt sich mit Leontes und Florizel. Das Ende ist in Sicht. Paulina lädt alle in ihr Haus ein, um ihnen eine Statue von Hermione zu zeigen. Die Statue ist so lebensecht, dass Leontes sie küssen will, doch Paulina hält ihn davon ab und lässt Hermione stattdessen vom Sockel herabsteigen.
Das Ende des Stückes stürzt alle Figuren ohne Erklärung, Vorwarnung oder psychologische Interpretation in ein neues Leben. Was sie daraus machen, ist dem »weiten Raum der Zeit« überlassen.
Die Cover-Version
Eins
Feuchtes Mondgestirn
Seltsames habe ich heute Nacht gesehen.
Ich war auf dem Heimweg, die Nacht heiß und schwül, wie immer um diese Jahreszeit, so heiß und so schwül, dass die Haut glänzt und kein Hemd trocken bleibt. Ich hatte Klavier gespielt in der Bar, und weil keiner gehen wollte, war ich später dran, als mir eigentlich lieb ist. Mein Sohn hatte gesagt, er würde mit dem Auto vorbeikommen. Doch er kam nicht.
Ich war auf dem Heimweg, so um zwei Uhr, mit einer kalten Flasche Bier, die langsam warm wurde in meiner Hand. Trinken ist auf der Straße verboten, ich weiß, aber zum Teufel damit, wenn man neun Stunden am Stück gearbeitet hat – an der Bar Schnaps ausschenken, solange es ruhig ist, und Klavier spielen, wenn’s voller wird. Bei Livemusik trinken die Leute mehr, heißt es, und das stimmt.
Ich war auf dem Heimweg, als der Himmel aufplatzte und der Regen runterkam wie Eis. Es war Eis, Hagelkörner so groß wie Golfbälle und so hart wie Gummi. Auf der Straße lag die ganze Hitze des Tages, der Woche, des Monats, des Sommers. Als die Hagelkörner auf den Boden schlugen, war das, als würden Eiswürfel in eine Friteuse gekippt. Als würde das Gewitter von der Straße hochkommen und nicht vom Himmel herab. Ich rannte im prasselnden Kugelhagel von Eingang zu Eingang, sah im zischenden Dampf meine Füße nicht mehr. Erst auf den Stufen zur Kirche stand ich über der wilden Gischt, ein oder zwei Minuten lang. Ich war durchnässt. In meiner Hosentasche klebten die Geldscheine aneinander, und an meinem Schädel die Haare. Ich wischte mir den Regen aus den Augen, Regentränen. Seit einem Jahr ist meine Frau jetzt tot. Sich unterstellen war nutzlos. Warum also nicht gleich nach Hause.
Ich nahm die Abkürzung. Gern nehme ich die nicht, wegen der Babyklappe.
Vor einem Jahr hat das Krankenhaus sie eingerichtet. Wenn ich meine Frau besucht habe, konnte ich Tag für Tag den Arbeitern zusehen. Konnte sehen, wie sie die Betonschale gossen, die Stahlkiste darin fixierten, das abgedichtete Fenster einpassten, die Kabel für Wärme, Licht und das Signal legten. Einer der Arbeiter wollte das alles nicht, hielt es für falsch, für unmoralisch, denke ich. Für ein Zeichen der Zeit. Aber die Zeit hat so viele Zeichen, wenn wir sie alle läsen, würden wir an gebrochenem Herzen sterben.
Die Babyklappe ist sicher und warm. Wenn das Baby drin und die Klappe zu ist, klingelt es im Krankenhaus, und es dauert nicht lange, bis eine Schwester kommt, gerade so lange, dass die Mutter gehen kann – die nächste Straßenecke ist ganz nah. Und fort ist die Frau.
Einmal war ich Zeuge. Ich rannte ihr nach. »Hallo, Sie!«, rief ich. Sie drehte sich um. Sah mich an. Was folgte, war eine jener Sekunden, die eine ganze Welt in sich tragen; dann war die Sekunde vorbei und die Frau weg.
Ich kehrte um. Die Babyklappe war leer. Einige Tage später starb meine Frau, seitdem meide ich diesen Weg.
Die Babyklappen haben eine Geschichte. Hat nicht jede Erzählung eine Geschichte? Du glaubst, du lebst in der Gegenwart, dabei steht die Vergangenheit hinter dir wie ein Schatten.
Ich habe ein bisschen nachgeforscht. In Europa gab es Babyklappen bereits im Mittelalter, wann auch immer das war. Drehlade hieß das damals: ein Fensterkasten in einem Männer- oder Frauenkloster, in den man ein Baby legen und hoffen durfte, Gott werde sich seiner annehmen.
Man konnte es auch eingemummt im Wald zurücklassen, damit Hunde und Wölfe es großzogen. Ohne Namen, aber mit einem Hinweis auf den Beginn der Geschichte.
Ein Auto rauscht zu schnell an mir vorbei. Aus dem Rinnstein spritzt Wasser hoch, als wäre ich nicht schon nass genug. Arschloch. Der Wagen bremst – es ist Clo, mein Sohn. Ich steige ein. Er gibt mir ein Handtuch, und ich trockne mein Gesicht, dankbar und plötzlich wie erschlagen.
Mit laufendem Radio fahren wir ein paar Häuserblocks weit. Berichte über Wetterkapriolen, Supermond, Riesenwellen auf dem Meer. Der Fluss über die Ufer getreten. Unternehmen Sie keine Reisen, bleiben Sie im Haus. Es ist nicht der Wirbelsturm Katrina, aber auch keine Ausgehnacht. Die Reifen der geparkten Autos stehen bis zur Hälfte im Wasser.
Und dann sehen wir es.
Vor uns ist ein schwarzer 6er-BMW frontal in eine Wand gekracht. Beide Türen stehen offen. Von hinten hat eine kleine, klapprige Blechkiste den BMW gerammt, und zwei Kapuzentypen schlagen gerade einen Mann zusammen. Mein Sohn drückt voll auf die Hupe, »Scheisse Scheisse Scheisse!«, schreit er und hält mit offenem Fenster auf die Gruppe zu. Unser Wagen kommt ins Schleudern, als einer der Männer auf uns schießt und den Vorderreifen trifft. Mein Sohn reißt das Steuer herum, wir prallen gegen den Bordstein. Die Typen springen in den BMW und rasen, an der Hauswand entlangschrammend, davon. Dabei hat sich der andere Wagen quer über die Straße geschoben. Auf dem Boden der zusammengeschlagene Mann. Er trägt einen feinen Anzug, ist so um die sechzig. Er blutet. Der Regen spült ihm das Blut aus dem Gesicht. Er sagt etwas. Ich knie neben ihm nieder. Seine Augen sind geöffnet. Er ist tot.
Mein Sohn blickt mich an, ich bin sein Vater, was tun? In weiter Ferne, auf einem anderen Planeten, gehen Martinshörner an.
»Fass ihn nicht an«, sage ich. »Setz den Wagen zurück.«
»Wir sollten auf die Bullen warten.«
Ich schüttle den Kopf.
Mit geplatztem Reifen rumpeln wir um die Ecke und rollen langsam die Straße entlang, die am Krankenhaus vorbeiführt. Aus der Ambulanzeinfahrt kommt ein Krankenwagen.
»Ich muss den Reifen wechseln.«
»Fahr auf den Krankenhaus-Parkplatz.«
»Wir sollten den Bullen sagen, was wir gesehen haben.«
»Er ist tot.«
Mein Sohn hält an und steigt aus, um das Werkzeug zu holen. Ich bleibe sitzen, nass und regungslos auf dem durchweichten Beifahrersitz. Die Lichter des Krankenhauses bohren sich durch die Scheibe; ich hasse dieses Krankenhaus. Nach dem Tod meiner Frau saß ich genauso hier, in diesem Auto. Starrte wie blind durch die Windschutzscheibe. Der ganze Tag verging, und dann war Nacht, und nichts war anders geworden, weil alles anders war.
Ich steige aus. Mein Sohn hat schon den Ersatzreifen aus dem Kofferraum hergerollt. Er bockt den Wagen auf, und zu zweit ziehen wir das kaputte Rad herunter. Als ich das aufgeplatzte Gummi betaste, finde ich die Kugel. Wir können ja einiges gebrauchen, aber das hier nicht. An der Bordsteinkante versenke ich sie in den Tiefen eines Gullys.
Und in diesem Moment sehe ich es: das Licht.
In der Babyklappe ist Licht.
Irgendwie spüre ich, dass alles zusammenhängt – der BMW, der klapprige Kleinwagen, der Tote, das Baby.
Denn da ist ein Baby.
Ich gehe auf die Klappe zu, mein Körper bewegt sich in Zeitlupe. Das Kind schläft, den Daumen im Mund. Noch ist niemand gekommen. Warum ist noch niemand gekommen?
Ohne es zu begreifen, begreife ich, dass das Montiereisen in meiner Hand liegt. Ohne mich zu bewegen, bewege ich den Arm, um die Klappe aufzustemmen. Es geht ganz leicht. Ich hebe das Baby hoch, und es ist so hell und schwerelos wie ein Stern.
Bleib bei mir Herr! Der Abend bricht herein.
Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein.
Wo fänd ich Trost, wärst du, mein Gott, nicht hier?
Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir!
An diesem Morgen füllte eine große Gemeinde die Kirche. An die zweitausend waren wir. Das Hochwasser hatte niemanden am Kommen gehindert. »Auch mächtge Wasser können die Liebe nicht löschen; auch Ströme schwemmen sie nicht weg«, sagte der Pfarrer.
Das ist aus dem Hohelied Salomos. Wir sangen, so gut wir konnten.
Unsere Kirche, die Church of God’s Delivery, war erst nur ein Schuppen, aus dem Schuppen wurde ein Haus, aus dem Haus eine kleine Stadt. Weitestgehend schwarz. Ein paar Weiße. Weißen fällt es schwerer, an etwas zu glauben, an das man nur glauben kann. Sie verbeißen sich in Details wie die Schöpfung in sieben Tagen oder die Auferstehung. Mir ist das alles egal. Falls es doch keinen Gott gibt, bin ich auch nicht schlimmer dran, wenn ich mal tot bin. Eben tot. Und wenn es einen Gott gibt, dann … okay, ich weiß, welche Frage jetzt kommt: Wo steckt er dann, dieser Gott?
Ich weiß nicht, wo Gott steckt, aber ich vermute, Gott weiß, wo ich stecke. Gott arbeitet mit der ersten globalen App der Welt. Suche Shep.
Das bin ich, Shep.
Ich lebe friedlich mit meinem Sohn Clo zusammen. Der ist zwanzig und hier geboren. Seine Mutter kam aus Kanada und ihre Eltern aus Indien. Ich selbst bin wohl auf einem Sklavenschiff hergekommen – okay, nicht ich, aber meine DNA, da steckt immer noch Afrika drin. New Bohemia, wo wir jetzt sind, war früher eine französische Kolonie. Zuckerplantagen, große Kolonialhäuser, Schönheit und Grauen Seite an Seite. Die schmiedeeisernen Geländer, die die Touristen so lieben. Die kleinen, rosa, gelb und blau gestrichenen Gebäude aus dem achtzehnten Jahrhundert. Die Holzfassaden mit ihren großen, gewölbten Schaufenstern. Die Gassen mit ihren dunklen Eingängen, die zu den Liebesdamen führen.
Und dann der Fluss. So weit und ausladend wie früher die Zukunft. Und die Musik: Immer singt irgendwo eine Frau, spielt ein alter Mann Banjo. Es können auch nur zwei Maracas sein, die das Mädchen an der Kasse hin und her bewegt. Oder eine Geige, die an die Mutter erinnert, oder eine Melodie, die den Wunsch weckt zu vergessen. Ist Erinnerung nicht immer ein schmerzhafter Streit mit der Vergangenheit?
Ich habe gelesen, dass sich der Körper alle sieben Jahre selbst erneuert, jede einzelne Zelle. Sogar Knochen erneuern sich. Warum erinnern wir uns überhaupt an Dinge, die längst vergangen sind? Wozu die Narben und Kränkungen? Ich liebe dich. Ich vermisse dich. Du bist tot.
»Shep! Shep?« Das war der Pfarrer. Ja, alles in Ordnung, danke. Ja, was für eine Nacht gestern. Gottes Gericht über die millionenfachen Verbrechen der Menschheit. Ob der Pfarrer das glaubt? Nein. Er glaubt an die Erderwärmung. Gott muss uns nicht bestrafen, das regeln wir schon selbst. Und deshalb brauchen wir Vergebung. Vergebung ist ein Wort wie ein Tiger: Es gibt Bilder von ihm, und seine Existenz ist eindeutig bewiesen, doch nur wenige von uns haben wirklich aus der Nähe Bekanntschaft mit diesem wilden Tier gemacht.
Ich kann mir nicht verzeihen, was ich getan habe …
Eines Abends, es war schon tiefste, finstere Nacht – so finster wie das, was ich tat –, habe ich meine Frau in ihrem Krankenhausbett erstickt. Sie war schwach. Ich bin stark. Sie wurde künstlich beatmet. Ich nahm ihr die Sauerstoffmaske vom Gesicht, legte ihr die Hände über Nase und Mund, bat Jesus, sie zu holen. Und das tat er.
Der Monitor piepte, ich wusste, sie würden bald da sein. Was mit mir passieren würde, war mir egal. Doch niemand kam, ich selbst musste schließlich jemanden holen – das Krankenhaus hatte nicht genug Pflegekräfte für die vielen Patienten. Sie konnten es niemandem mit Gewissheit anlasten, obwohl sie, da bin ich mir ziemlich sicher, wussten, dass ich es gewesen war. Wir legten ein Laken über meine Frau, und als sich der Arzt schließlich blicken ließ, schrieb er »Atemversagen«.
Ich bereue es nicht, doch verzeihen kann ich es mir nicht. Ich habe das Richtige getan, doch es war falsch.
»Sie haben aus dem richtigen Grund das Falsche getan«, hat der Pfarrer gesagt. Aber da sind wir uneins. Es klingt vielleicht wie Wortklauberei, aber es macht einen großen Unterschied. Er hält es für falsch, ein Leben zu nehmen, und in seinen Augen habe ich es nur getan, um dem Leiden meiner Frau ein Ende zu bereiten. Ich glaube, dass es richtig war, dieses Leben zu nehmen. Wir waren verheiratet, ein Fleisch. Doch ich habe es aus dem falschen Grund genommen. Nicht um dem Leiden meiner Frau ein Ende zu bereiten, sondern meinem.
»Hören Sie auf zu grübeln, Shep«, hat der Pfarrer gesagt.
Nach der Kirche ging ich nach Hause. Mein Sohn sah fern. Das Baby war wach, blickte mit großen Augen ganz still zur Decke, auf die durch die Jalousien ein Streifenmuster aus Licht und Schatten fiel. Ich nahm es hoch, ging wieder nach draußen und dann weiter Richtung Krankenhaus. Das Baby war warm und leicht. Leichter als mein Sohn nach der Geburt. Meine Frau und ich waren damals gerade erst nach New Bohemia gezogen. Wir glaubten an alles – die Welt, die Zukunft, Gott, den Frieden, die Liebe und vor allem an uns.
Als ich mit dem Baby im Arm die Straße entlangging, verlor ich mich im weiten Raum der Zeit, in dem alle Zeiten eins werden. Mein Körper richtete sich auf, meine Schritte verlangsamten sich. Ich war ein junger Mann, verheiratet mit einem schönen Mädchen, und plötzlich waren wir Eltern. »Du musst das Köpfchen halten«, sagte sie, als ich ihn trug, sein Leben in meiner Hand.
In der Woche nach seiner Geburt kamen wir nicht aus dem Bett. Wir schliefen und aßen, das Baby zwischen uns. Die ganze Woche mussten wir ihn immerzu anschauen. Wir hatten ihn gemacht. Ohne Qualifikationen oder Fortbildungen, ohne College-Diplome oder Forschungsdollars hatten wir einen Menschen gemacht. Was ist das für eine verrückte, unbekümmerte Welt, in der wir Menschen machen können?
Geh nicht.
»Entschuldigung, was haben Sie gesagt?«
»Tut mir leid, ich habe wohl mit offenen Augen geträumt.«
»Ein schönes Baby haben Sie da.«
»Danke.«
Die Frau ging weiter. Und mir wurde klar, dass ich mit einem schlafenden Baby im Arm mitten auf einer belebten Straße stand und Selbstgespräche führte. Aber ich führte keine Selbstgespräche. Ich sprach mit dir. Ich spreche immer noch mit dir. Ständig. Geh nicht.
Genau das meinte ich eben, von wegen Erinnerung. Meine Frau existiert nicht mehr. Es gibt sie nicht. Ihr Personalausweis wurde annulliert. Ihr Bankkonto geschlossen. Jemand anders trägt ihre Kleider. Doch mein Kopf ist voll von ihr. Wenn sie nie gelebt hätte und mein Kopf voll von ihr wäre, würde man mich wegen Wahnvorstellungen wegsperren. Aber so bin ich in Trauer.
Trauer heißt also, mit jemandem leben, der nicht da ist.
Wo bist du?
Ein knatterndes Motorrad. Autos mit laufendem Radio, die Scheiben heruntergelassen. Kinder auf Skateboards. Ein bellender Hund. Ein Lieferwagen, der entladen wurde. Auf dem Bürgersteig zwei zankende Frauen. Überall Leute mit Handy. Auf einer Kiste ein Typ, Alles muss raus!, schrie er.
Habe ich nichts dagegen. Nehmt ruhig alles weg. Die Autos, die Menschen, die Waren. Alles weg, bis auf den Dreck unter meinen Füßen und den Himmel über mir. Auch die Geräusche, alles ausschalten, Bild löschen. Nichts mehr zwischen uns. Ob ich dich dann am Ende des Tages sehen werde, wie du mir entgegenkommst? So wie du mir früher entgegenkamst und ich dir, todmüde, nach der Arbeit? Ein Blick, und wir sahen uns, erst von Weitem, dann nah? Deine Energie, endlich wieder in Menschengestalt. Die atomare Form deiner Liebe.
»Es ist nichts«, sagte sie, als sie wusste, dass sie sterben würde.
Nichts? Dann ist der Himmel nichts, die Erde nichts, dein Körper nichts, und wenn wir uns lieben, ist das nichts …
Sie schüttelte den Kopf. »Der Tod ist das Unwichtigste in meinem Leben. Was wird schon groß anders sein? Ich werde nicht hier sein.«
»Ich werde hier sein.«
»Das ist das Grausame«, sagte sie. »Wenn ich für dich meinen Tod leben könnte, würde ich es tun.«
Räumungsverkauf! Alles muss raus!
Ist schon alles raus.
Ich erreichte die Straße, in der das Krankenhaus steht. Da, die Babyklappe. Genau in diesem Moment wachte die Kleine in meinen Armen auf und bewegte sich. Wir sahen uns an, ihre unsteten blauen Augen fanden meinen dunklen Blick. Sie hob ein Händchen, klein wie eine Blume, und berührte die rauen Stoppeln in meinem Gesicht.
Zwischen mir und der anderen Straßenseite fuhren Autos hin und her. Anonyme Welt, immer in Bewegung. Da standen wir, das Baby und ich, und es kam mir vor, als wüsste es, dass eine Entscheidung zu treffen war.
Oder nicht? Die wichtigen Dinge passieren zufällig, geplant wird nur der Rest.
Ich ging um den Block, wollte nachdenken, doch meine Beine gingen heimwärts, und manchmal muss man einfach akzeptieren, dass das Herz weiß, was zu tun ist.
Als ich nach Hause kam, sah mein Sohn gerade die Nachrichten. Aktuelle Informationen zum Sturm der letzten Nacht, dazu die Kommentare Betroffener. Die üblichen Regierungsvertreter sagten die üblichen Dinge. Dann noch ein Aufruf, Zeugen gesucht. Der Tote. Der Mann hieß Anthony Gonzales, Mexikaner. Reisepass bei der Leiche gefunden. Raubüberfall, Totschlag. Nichts Ungewöhnliches in dieser Stadt.
Aber etwas war doch ungewöhnlich. Er hatte ein Baby zurückgelassen.
»Das weißt du nicht, Dad.«
»Ich weiß, was ich weiß.«
»Wir sollten es den Bullen sagen.«
Wie komme ich an einen Sohn, der den Bullen vertraut? Mein Sohn vertraut jedem, ich mache mir Sorgen um ihn. Ich schüttelte den Kopf. Er zeigte auf das Baby.
»Wenn du die Bullen nicht anrufst, was machst du dann mit ihr?«
»Behalten.«
Erschrocken sah er mich an. Ungläubig. Ich konnte doch kein Neugeborenes behalten, das war gesetzwidrig. Aber mir war das egal. Hilf dem, der hilflos ist. Konnte ich nicht derjenige sein?
Ich habe sie gefüttert und gewickelt. Auf dem Heimweg habe ich gekauft, was ich brauchte. Wenn meine Frau noch lebte, würde sie dasselbe tun. Wir würden es gemeinsam tun.
Es ist so, als hätte ich für das Leben, das ich genommen habe, ein neues bekommen. Für mich fühlt es sich wie Vergebung an.
Neben dem Kind lag ein Aktenkoffer – Vorbereitung auf eine Karriere als Geschäftsfrau? Der Koffer war abgeschlossen. Wenn möglich, werden wir die Eltern ausfindig machen, erklärte ich meinem Sohn. Und so öffneten wir den Koffer.
Clo machte ein Gesicht wie ein schlechter Schauspieler in einer Billig-Sitcom: hervorquellende Augen, runtergeklappte Kinnlade.
»Allmächtiger!«, sagte er. »Ist das Zeug echt?«
Banknoten, akkurat gebündelt wie Requisiten eines Gangsterfilms. Fünfzig Päckchen, jedes zehntausend Dollar.
Unter den Banknoten lag ein Säckchen aus weichem Samt. Diamanten, eine Halskette. Keine bloßen Diamantsplitter, sondern üppig geschliffene Steine, so groß wie das Herz einer Frau und so zeitlos und tief wie der Blick in eine Kristallkugel.
Unter den Diamanten ein Notenblatt, ein von Hand geschriebenes Lied. Oben der Titel. Perdita.
So hieß sie also. Die Verlorene.
»Du bist ein gemachter Mann«, sagte Clo. »Wenn du nicht in den Knast gehst.«
»Sie gehört jetzt zu uns, Clo. Sie ist deine Schwester. Und ich bin ihr Vater.«
»Was machst du mit dem Geld?«
Wir zogen in ein anderes Viertel, wo uns niemand kannte. Ich verkaufte meine Wohnung und nahm das Geld und das aus dem Koffer, um eine Pianobar namens Fleece zu kaufen. Es war ein Mafialaden, und die mussten raus, sodass sie die Kohle gern nahmen. Ohne zu fragen. Die Diamanten deponierte ich bis zu ihrem achtzehnten Geburtstag auf ihren Namen in einem Banksafe.
Das Lied habe ich gespielt und ihr beigebracht. Sie sang, bevor sie sprechen konnte.
Ich lernte, ihr ein Vater und eine Mutter zu sein. Sie fragte nach ihrer Mutter, und ich sagte ihr, was ich wusste. Ich habe ihr immer die Wahrheit gesagt, jedenfalls genug davon. Und weil wir schwarz sind und sie weiß, ist ihr klar, dass sie ein Findelkind ist.
Irgendwo muss die Geschichte beginnen.
Spinne im Becher
Es war einmal ein Mann, der wohnte in einem Flughafen.
Leo und sein Sohn Milo blickten durch das Panoramafenster in Leos Londoner Büro auf den City Airport und die Themsemündung. Milo sah gern den Flugzeugen beim Starten zu. Er war neun und kannte alle Abflug- und Ankunftszeiten auswendig. An einer Bürowand hing eine Tafel mit den Flugstrecken, an die der Airport angebunden war: arterienrote Linien einer Körperkarte der Welt.
»Wird der Mann vielleicht per Steckbrief gesucht?«, fragte Leo.
»Wieso Brief? Dem schreibt keiner«, sagte Milo. »Der ist weggelaufen und ganz allein. Darum wohnt er im Flughafen.«
Worauf Leo ihm erklärte, was ein Steckbrief war: »Es bedeutet, dass die Polizei hinter ihm her ist.«
Darüber dachte Milo nach. Er war dabei, für die Schule eine Geschichte zu schreiben. Im ersten Satz sollte schon der ganze Rest enthalten sein, hatte die Lehrerin gesagt – wie in einem Märchen, das mit Ein König hatte drei Söhne oder Es war einmal ein Riese, der liebte eine Prinzessin anfängt.
»Der ist kein Mörder«, überlegte Milo. »Aber der hat kein Zuhause.«
»Warum nicht?«, fragte Leo.
»Er ist arm.«
»Vielleicht sollte er dann mehr arbeiten«, sagte Leo. »Dann könnte er sich, anstatt im Flughafen zu wohnen, ein Flugticket leisten. Da, guck mal: British Airways über Shannon nach New York City.«
Vor ihren Augen hob das Flugzeug ab wie ein bizarrer Vogel.