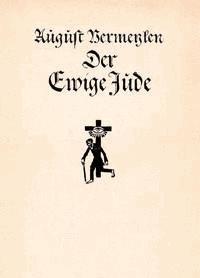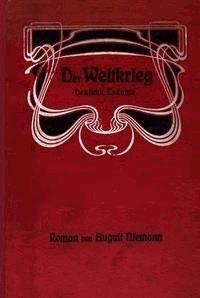
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Ähnliche
Der Weltkrieg
Druck von W. Vobach & Co. Berlin N. 4.
Der Weltkrieg
Deutsche Träume
Roman
von
August Niemann
Berlin-Leipzig
Verlag von W. Vobach & Co.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Uebersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Nachdruck wird gerichtlich verfolgt.Copyright 1904 by W. Vobach & Co.
In meiner Erinnerung taucht der britische Oberst auf, der mir in Kalkutta sagte: Dreimal bin ich hierher nach Indien kommandiert worden. Vor fünfundzwanzig Jahren als Leutnant: — damals standen die Russen fünfzehnhundert Meilen von der indischen Grenze entfernt. Dann als Kapitän vor zehn Jahren: — und damals standen die Russen nur noch fünfhundert Meilen entfernt. Vor einem Jahre als Oberstleutnant: — die Russen stehen unmittelbar vor den Pässen, die nach Indien führen.
Die Weltkarte entfaltet sich vor meinen Blicken.
Alle Meere durchpflügt von den Kielen britischer Kriegsschiffe, alle Küsten besetzt mit Kohlenstationen und Festungen der britischen Weltmacht. Die Herrschaft über den Erdkreis ist bei England, und England will sie behalten, es kann nicht dulden, daß der russische Koloß Leben und Bewegung aus dem Meere trinkt.
„Ohne Englands Erlaubnis darf keine Kanone auf dem Meere abgefeuert werden,“ sagte einst William Pitt, Englands größter Staatsmann.
Seit langen Jahren wächst England empor durch den Zwiespalt der kontinentalen Mächte unter sich. Fast alle Kriege seit Jahrhunderten sind zum Vorteil Englands geführt, fast alle von England angestiftet worden. Nur als der Genius Bismarcks über Deutschland wachte, besann der deutsche Michel sich auf seine Kraft und kriegte für sich selbst.
Soll es dahin kommen, daß Deutschland Luft und Licht und das tägliche Brot nur noch der Gnade Englands verdankt? Oder lebt noch die alte Kraft in Michels Armen?
Werden die drei Mächte, die im Vertrage von Schimonoseki nach dem Siege Japans über China zusammenstanden, um Englands Pläne zu vereiteln, werden Deutschland, Frankreich und Rußland noch länger müßig bleiben, oder werden sie sich zu gemeinsamem Handeln die Hände reichen?
Im Geiste sehe ich die Heere und Flotten Deutschlands, Frankreichs und Rußlands sich in Bewegung setzen gegen den allgemeinen Feind, der mit Polypenarmen die Weltkugel umklammert. Befreiung aus seinen erstickenden Schlingen bringt für ganz Europa der eherne Ansturm der alliierten drei Mächte. Die Zukunft trägt den großen Krieg in ihrem Schoße.
Es ist keine Geschichte aus der Vergangenheit, die ich in den folgenden Blättern schildere. Es ist das Bild, wie es sich klar vor meiner Seele entrollte, als mir der Inhalt der ersten Depesche des Statthalters Alexejew an den Zaren bekannt wurde. Und gleichzeitig tauchte wie ein Blitz in mir die Erinnerung an das Telegramm auf, das Kaiser Wilhelm II. nach Jamesons Einfall an die Buren sandte, jenes Telegramm, das im Herzen der ganzen deutschen Nation ein so nachhaltiges Echo gefunden hat. Ich schaue in die Zukunft und erinnere mich der Pflichten und Aufgaben unsers deutschen Volkes. Meine Träume, die Träume eines Deutschen, zeigen mir den Krieg und Sieg der drei verbündeten großen Nationen, Deutschland, Frankreich, Rußland, und eine neue Verteilung des Besitzes der Erde als Endziel dieses gewaltigen Weltkrieges.
Der Verfasser.
I.
Eine glänzende Versammlung hoher Würdenträger und Militärs war es, die sich im kaiserlichen Winterpalast zu St. Petersburg zusammenfand. Von den einflußreichen Persönlichkeiten, die durch ihre amtliche Stellung oder durch ihre persönlichen Beziehungen zum Herrscherhause berufen waren, beratend und bestimmend auf die Geschicke des Zarenreiches einzuwirken, fehlte kaum eine einzige. Aber es konnte kein festlicher Anlaß sein, der sie hier zusammen führte; denn in allen Mienen war der Ausdruck tiefen Ernstes, der sich hier und da bis zu banger Sorge steigerte. Und die in leisem Flüsterton geführten Gespräche bewegten sich um sehr bedeutsame Dinge.
Die breiten Flügeltüren gegenüber dem lebensgroßen Bilde des regierenden Zaren wurden weit geöffnet, und unter lautloser Stille der Versammelten betrat der greise Präsident des Reichsrats, der Großoheim des Zaren, Großfürst Michael, den Saal. Zwei andere Mitglieder des Kaiserhauses, die Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch und Alexis Alexandrowitsch, die Brüder des verstorbenen Herrschers, befanden sich in seiner Begleitung.
Huldvoll erwiderten die Prinzen die tiefen Verbeugungen der Anwesenden. Auf einen Wink des Großfürsten Michael gruppierte man sich um den langen, mit grünem Tuch überzogenen Konferenztisch inmitten des säulengetragenen Saales. Noch herrschte tiefe, ehrfurchtsvolle Stille; aber auf ein Zeichen des Präsidenten erhob sich nunmehr der Staatssekretär Witte, Vorsitzender des Minister-Komitees, um, gegen die Großfürsten gewendet, zu beginnen:
„Kaiserliche Hoheiten und verehrte Herren! Eure Kaiserliche Hoheit haben zu einer dringenden Beratung befohlen und mich mit dem Auftrage betraut, deren Ursachen und Zweck darzulegen. Wir alle wissen, daß Seine Majestät, der Kaiser, unser erhabener Herr und Gebieter, die Erhaltung des Weltfriedens als das höchste Ziel seiner Politik bezeichnet hat. Die christliche Idee, daß die Menschheit eine Herde unter einem Hirten sein soll, hat in unserm erlauchten Herrscher ihren ersten und vornehmsten Vertreter auf Erden gefunden. Die Liga für den Weltfrieden ist das eigenste Werk Seiner Majestät, und wenn wir berufen worden sind, um unsere untertänigsten Vorschläge zur Beseitigung der dem Vaterlande in diesem Augenblick drohenden Gefahr dem Allerhöchsten Herrn zu unterbreiten, so dürfen unsere Beratungen immer nur von jenem Geiste erfüllt sein, der dem christlichen Gebot der Menschenliebe entspricht.“
Unterbrechend erhob Großfürst Michael die Hand.
„Alexander Nikolajewitsch,“ wandte er sich an den Protokollführer, „vergiß nicht, diesen Satz wörtlich niederzuschreiben.“
Der Staatssekretär machte eine kurze Pause, um dann mit etwas erhobener Stimme und nachdrücklicherem Ton fortzufahren:
„Es bedarf keiner besonderen Beteuerung, daß bei solcher hochsinnigen Denkungsart unseres höchsten Herrn ein Bruch des Weltfriedens niemals von uns ausgehen konnte. Ein heiliges Besitztum aber, das wir von niemandem antasten lassen dürfen, ist die nationale Ehre, und der Angriff, den Japan im fernen Osten auf uns unternommen hat, zwang uns zu ihrer Verteidigung das Schwert in die Hand. In der ganzen Welt kann es keinen gerecht und billig denkenden Menschen geben, der um dieses uns aufgezwungenen Krieges willen einen Vorwurf gegen uns erheben dürfte. Aber es ist in der gegenwärtigen Gefahr für uns ein Gebot der Selbsterhaltung, zu erwägen, ob Japan in Wahrheit der einzige und der eigentliche Feind ist, gegen den wir uns zu verteidigen haben. Und es liegen triftige Gründe vor, die uns dahin führen müssen, diese Frage zu verneinen. Die Regierung Seiner Majestät ist überzeugt, daß wir den japanischen Angriff lediglich der lange währenden und in ihrer heimlichen Wühlarbeit nimmer ruhenden Feindschaft Englands zu danken haben. Unablässig ist England von jeher darauf bedacht gewesen, uns zur Erlangung eigenen Vorteils zu schaden. Bei allen unseren Bestrebungen, das Wohl des Reiches zu fördern und die Völker glücklich zu machen, sind wir von jeher auf den Widerstand Englands gestoßen. Vom chinesischen Meere aus durch ganz Asien hindurch bis zur baltischen See legt England uns Schwierigkeiten in den Weg, um uns der Früchte unserer Kulturarbeit zu berauben. Niemand von uns ist darüber im Zweifel, daß Japan in Wahrheit die Sache Englands führt. Aber auch überall, wo sonst auf dem Erdball unsere Interessen in Frage stehen, stoßen wir auf die offenen oder versteckten Feindseligkeiten Englands. Die von ihm erregten und mit den verwerflichsten Mitteln begünstigten Wirren in den Balkanländern und in der Türkei haben einzig den Zweck, uns mit Oesterreich und Deutschland zu verfeinden. Und nirgends treten die eigentlichen Ziele Britanniens deutlicher zu Tage, als in Mittelasien. Mit unsäglichen Mühen und den größten Opfern an Gut und Blut haben weise Regenten die öden, von halbwilden Völkern bewohnten Landstrecken zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meere und östlich von diesem bis zur chinesischen Grenze und an den Himalaja der russischen Kultur zugänglich gemacht. Nie aber haben wir einen Schritt nach Osten oder Süden tun können, ohne englischem Widerspruch oder englischen Intriguen zu begegnen. Jetzt stehen wir nahe der Grenze des britischen Ostindien und unmittelbar an der Grenze Persiens und Afghanistans. Wir haben freundschaftliche Beziehungen zu den Herrschern dieser beiden Reiche geschaffen, pflegen einen eifrigen Handelsverkehr mit ihren Völkern, unterstützen ihre industriellen Unternehmungen und sind vor keinen Opfern zurückgeschreckt, um diese Länder den Segnungen der Kultur zugänglich zu machen. Aber auf Schritt und Tritt sucht England unsere Tätigkeit zu hemmen. Britisches Gold und britische Hetzereien waren es, die in Afghanistan zeitweilig eine kriegerische Stellung gegen uns hervorzurufen vermochten. Einmal endlich müssen wir uns die Frage vorlegen, wie lange wir solchem Beginnen untätig zusehen dürfen. Rußland muß sich den Weg zum Meere frei machen. Viele Millionen rüstiger Arme bebauen die heilige Erde unseres Vaterlandes. Wir verfügen über unermeßliche Schätze an Getreide, Holz und an allen Produkten der Landwirtschaft. Aber wir können nur mit einem geringfügigen Bruchteil dieses uns vom Himmel beschiedenen Segens auf den Weltmarkt gelangen, weil wir von allen Seiten eingeschlossen und eingeengt sind, solange uns der Weg zum Meere versperrt bleibt. Unsere mittelasiatischen Provinzen ersticken aus Mangel an Seeluft. Das weiß England sehr gut, und darum ist all sein Verlangen darauf gerichtet, uns das Meer zu verschließen. Mit einer durch nichts berechtigten Anmaßung erklärt es den persischen Golf für seine Domäne und möchte das ganze indische Meer, gleich Indien selbst, für sein Eigentum gehalten wissen. Diesem Uebermut sollte endlich ein gebieterisches ‚Halt‘ zugerufen werden, wenn unser geliebtes Vaterland nicht in die Gefahr geraten soll, unübersehbaren Schaden zu erleiden. Nicht wir sind es, die den Kampf suchen, sondern man zwingt ihn uns auf. Ueber die Mittel aber, mit denen er zu führen wäre, wenn England sich aus freien Stücken zu einer Erfüllung unserer berechtigten Forderungen nicht versteht, würde uns am besten Seine Exzellenz der Herr Kriegsminister Auskunft zu geben vermögen.“
Er verbeugte sich abermals gegen die Großfürsten und ließ sich in seinen Sessel nieder; die hohe stattliche Gestalt des Kriegsministers Kuropatkin war es, die sich jetzt auf einen Wink des Präsidenten erhob und Antwort gab.
„Zwanzig Jahre habe ich in Mittelasien gedient, und ich beurteile unsere Lage an der Südgrenze aus eigener Anschauung. Für einen Krieg gegen England ist Afghanistan zunächst der entscheidende Schauplatz. Drei wichtige Pässe führen aus Afghanistan nach Indien hinein: der Kaiberpaß, der Bolanpaß und das Kuramtal. Als die Engländer im November des Jahres 1878 in Afghanistan einmarschierten, gingen sie in drei Kolonnen von Peschawar, von Kohat und von Quetta aus auf Kabul, Gasna und Kandahar. Diese drei Wege sind auch uns vorgezeichnet. Die öffentliche Meinung hält sie für die allein möglichen. Es würde zu weit führen, wenn ich meine strategische Ansicht über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser Annahme hier entwickeln wollte. Genug: wir werden den Weg nach Indien finden. Habib Ullah Khan würde sein sechzigtausend Mann starkes Afghanenheer zu uns stoßen lassen, sobald wir in sein Land einrückten. Allerdings ist er ein Bundesgenosse von zweifelhafter Zuverlässigkeit; denn er würde wahrscheinlich ebenso bereitwillig mit den Engländern gehen, wenn diese zuerst mit einer Macht, die ihm hinlänglich imponierte, in seinem Lande erschienen. Aber es hindert uns nichts, die ersten zu sein. Unsere Eisenbahn führt bis Merw, 120 Kilometer von Herat, und von dieser Zentralstelle bis zur Grenze Afghanistans. Mit unserer transkaspischen Bahn können wir die kaukasischen Armeekorps und die Truppen des Generalgouvernements Turkestan an die afghanische Grenze bringen. Ich mache mich anheischig, innerhalb vier Wochen nach der Kriegserklärung eine ausreichende Feldarmee in Afghanistan um Herat herum konzentriert zu haben. Unserer ersten Armee aber kann ein unablässiger Strom von Regimentern und Batterien folgen. Die Reserven des russischen Heeres sind unerschöpflich, und wir stellen, wenn es sein muß, vier Millionen Soldaten und mehr als eine halbe Million Pferde ins Feld. Ich möchte aber bezweifeln, daß England uns in Afghanistan entgegentreten wird. Die englischen Generäle würden jedenfalls nicht sehr klug daran tun, Indien zu verlassen. Würden sie in Afghanistan geschlagen, so kämen sicherlich nur schwache Trümmer ihres Heeres nach Indien zurück. Die Afghanen würden eine fliehende englische Armee erbarmungslos vernichten, wie sie es schon einmal getan haben. Wir aber, wenn sich, was Gott verhüten möge, das Kriegsglück anfänglich gegen uns wendete, hätten immer noch einen Rückweg nach Turkestan offen, auf dem man uns schwerlich folgen würde, und wir könnten den Angriff jederzeit erneuern. Wird die englische Armee geschlagen, so ist Indien für Großbritannien verloren. Denn die Engländer stehen in Indien wie in Feindesland; sie finden als Unterliegende keinen Rückhalt im indischen Volke. Von den eingeborenen Fürsten, deren Selbständigkeit sie brutal vernichtet haben, würden sie in dem Augenblick, da ihre Macht zusammenbricht, auf allen Seiten angegriffen werden. Uns aber würde man als Befreier von einem unerträglichen Joch mit offenen Armen empfangen. Die anglo-indische Armee sieht auf dem Papier viel gefährlicher aus, als in der Wirklichkeit, sie zählt angeblich 200000 Mann; aber nur ein Drittel davon sind englische Soldaten, während sich der Rest aus Eingeborenen zusammensetzt. Und diese Armee besteht überdies aus vier Korps, die über das ganze große Gebiet Indiens verteilt sind. Eine Feldarmee, die an der Grenze oder jenseits der Grenze verwendet werden sollte, müßte erst aus diesen vier Korps herausgezogen und neu organisiert werden. Sie könnte höchstens 60000 Mann stark sein, weil das Land um der Unzuverlässigkeit der Bevölkerung willen nicht von Garnisonen entblößt werden darf. Ich möchte nach all diesem meiner Ueberzeugung dahin Ausdruck geben, daß der Krieg in Indien selbst geführt werden muß und daß Gott uns den Sieg verleihen wird.“
Die in energischem und zuversichtlichem Ton vorgebrachten Ausführungen des Generals hatten ersichtlich einen tiefen Eindruck auf die Hörer gemacht. Aber die Rücksicht auf die Anwesenheit der Großfürsten verhinderte jede laute Kundgebung. Der greise Präsident reichte dem Kriegsminister die Hand. Dann erteilte er dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten das Wort.
„Es unterliegt für mich keinem Zweifel,“ sagte der Diplomat, „daß die soeben von Seiner Exzellenz dem Herrn Kriegsminister entwickelten strategischen Ansichten einer eingehenden Sachkenntnis und richtigen Würdigung der Verhältnisse entsprungen sind, und ich bin gewiß, daß die sieggewohnten Truppen Seiner Majestät des Zaren im Falle eines Krieges bald in der Ebene des Indus stehen werden. Auch ist es durchaus meine Ueberzeugung, daß Rußland am besten tun würde, die Offensive zu ergreifen, sobald sich einmal die Unhaltbarkeit des gegenwärtigen Verhältnisses zu England erwiesen hat. Aber wer mit Großbritannien Krieg führt, darf nicht mit einem Kriegsschauplatz rechnen. Wir müßten im Gegenteil auf Angriffe der verschiedensten Art gefaßt sein, zunächst wohl auf einen Angriff auf unsere Finanzen, unsern Kredit, worüber Exzellenz Witte uns bessere Aufschlüsse geben könnte als ich. Die englische Bank und die mit ihr verbündeten großen Bankhäuser würden diesen Finanzkrieg ungesäumt eröffnen. Weiter würde sich schwerlich noch ein unter russischer Flagge segelndes Schiff auf offenem Meere zeigen dürfen, und unser internationaler Handel würde bis zur Niederwerfung des Gegners völlig unterbunden sein. Bedeutsamer aber als Erwägungen dieser Art muß für uns die Frage nach dem Verhalten der anderen Großmächte sein. Wer wird für uns und wer wird gegen uns sein? Englands politische Kunst hat sich seit der Zeit Oliver Cromwells hauptsächlich in der geschickten Ausnutzung der kontinentalen Mächte offenbart. Es ist keine Uebertreibung, zu sagen, daß Englands Kriege vornehmlich mit kontinentalen Heeren geführt worden sind. Das ist keine Herabsetzung der Kriegstüchtigkeit Englands. Wo immer die englische Flotte und englische Armeen auf dem Kriegsschauplatze erschienen sind, hat sich die Energie, die Zähigkeit und Tapferkeit ihrer Offiziere, ihrer Seeleute und Soldaten stets im glänzendsten Lichte gezeigt. Die Tradition der englischen Truppen, die einst Frankreich unter Führung des Schwarzen Prinzen und Heinrichs V. siegreich durchzogen, ist in den Kriegen gegen Frankreich im 18. Jahrhundert und gegen Napoleon lebendig geblieben. Ungleich größere Erfolge aber als durch diese eigenen Waffentaten hat England dadurch errungen, daß es fremde Völker für sich kämpfen ließ und auf dem Kontinent die Truppen Oesterreichs, Frankreichs, Deutschlands und Rußlands gegeneinander führte. Seit zweihundert Jahren sind überhaupt sehr wenig Kriege ohne Englands Zutun und ohne Nutzen für England geführt worden. Diese wenigen Ausnahmen sind die nur zum Vorteile und zum Ruhme des eigenen Volkes geführten Kriege Bismarcks, der darum auch der bestgehaßte Mann der Engländer war. Während das europäische Festland von inneren Kriegen zerrissen wurde, die Englands Staatskunst angeschürt, hat Großbritannien seinen ungeheuren Kolonialbesitz erworben. Uns selbst hat England in Feldzüge verwickelt, die lediglich seinen Vorteil bildeten. Ich erinnere nur an den blutigen, opfervollen Krieg von 1877/78 und an den verhängnisvollen Frieden von San Stefano, wo Englands Intriguen uns um den Lohn unserer Siege über den Halbmond brachten. Ich erinnere weiter an den Krimkrieg, wo eine kleine englische und eine große französische Armee uns zum Vorteil Englands bekriegten. Daß jetzt hinter unseren japanischen Angreifern wiederum nur England steht, ist von den Vorrednern bereits betont worden. Unsere Gegner haben eben nicht die mindeste Veranlassung, von ihrer so gut bewährten Politik abzugehen, und die Aufgabe der unsrigen mußte es deshalb sein, uns der Bundesgenossenschaft oder wo dies durch die Umstände ausgeschlossen war, wenigstens der wohlwollenden Neutralität der übrigen kontinentalen Großmächte für den Fall eines Krieges gegen England zu versichern. Was zunächst unseren Alliierten, die französische Republik, betrifft, so war eine befriedigende Lösung der Aufgabe schon durch die bestehenden Verträge gesichert. Immerhin verpflichten dieselben die französische Regierung nicht, uns für den Fall eines Krieges, der in den Augen kurzsichtiger Beobachter vielleicht als ein von uns heraufbeschworener Angriffskrieg erscheinen wird, seine militärische Unterstützung zu gewähren. Wir haben deshalb durch unsern Botschafter Verhandlungen mit Mr. Delcassé, dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten Frankreichs, und mit dem Präsidenten selbst führen lassen. Es gereicht mir zur besonderen Genugtuung, Ihnen das Ergebnis dieser Verhandlungen in folgender, heute eingetroffener Depesche unseres Botschafters vorlegen zu dürfen. Dieselbe lautet in der Hauptsache wie folgt: „Ich beeile mich, Eurer Exzellenz mitzuteilen, daß mir von seiten des Herrn Delcassé namens der französischen Regierung die bindende Zusage erteilt worden ist, Frankreich werde England sofort den Krieg erklären, wenn Seine Majestät der Zar seine Armeen gegen Indien marschieren ließe.“ Ueber die Erwägungen, von denen die französische Regierung zu diesem Beschlusse geführt worden sei, sprach sich Mr. Delcassé in unserer heutigen Unterredung ungefähr dahin aus: „Schon Napoleon hat vor mehr als 100 Jahren mit genialem Scharfblick erkannt, daß England der eigentliche Feind aller kontinentalen Völker ist und daß der europäische Kontinent keine andere Politik verfolgen sollte, als die der gemeinsamen Abwehr dieses großen Seeräubers. Der grandiose Plan Napoleons war die Vereinigung Frankreichs mit Spanien, Italien, Oesterreich, Deutschland und Rußland, um dem System der Ausbeutung von seiten Englands entgegenzutreten. Und er würde diesen Plan wahrscheinlich durchgeführt haben, wenn nicht Rücksichten der inneren Politik den Zaren Alexander I. trotz seiner Verehrung für das Genie Napoleons zum Widerstande gegen seine Absichten bestimmt hätten. Die Folgen der Niederlage Napoleons haben sich in dem gewaltigen Anwachsen der englischen Macht während der letzten 100 Jahre deutlich genug gezeigt. Darum sollte man die gegenwärtige politische Konstellation, die der vom Jahre 1804 in vielen Stücken sehr ähnlich ist, dazu benützen, den Plan Napoleons wieder zu beleben. Rußland hat an einer Niederwerfung Englands allerdings das nächste und dringendste Interesse; denn es gleicht einem Riesen, dem Hände und Füße gebunden sind, so lange Großbritannien alle Meere und alle wichtigen Küstenstriche beherrscht. Aber auch Frankreich ist in seiner natürlichen Entwickelung gehemmt. Seine blühenden Kolonien in Amerika und im Atlantischen Ozean wurden ihm im 18. Jahrhundert durch England entrissen. Aus seinen Niederlassungen in Ostindien wurde es durch diesen übermächtigen Gegner verdrängt, und — was vom französischen Volke vielleicht am schmerzlichsten empfunden wird — Aegypten, das der große Napoleon mit dem Blute seiner Soldaten für Frankreich erkaufte, wurde ihm durch englisches Gold und englische Intriguen genommen. Der von dem Franzosen Lesseps erbaute Suezkanal ist im Besitz der Engländer. Er erleichtert ihnen den Verkehr mit Indien und sichert ihnen die Weltherrschaft. Frankreich wird also für seine Bundesgenossenschaft gewisse Forderungen stellen — Bedingungen, die so loyal und billig sind, daß ihre Annahme von seiten des alliierten Rußland von vornherein keinem Zweifel unterliegen kann. Frankreich verlangt, daß ihm seine Erwerbungen in Tonking, Kochinchina, Kambodscha, Annam und Laos garantiert werden, daß Rußland ihm behilflich sei, Aegypten zu erwerben, und daß es sich verpflichte, die französische Politik in Tunis und im übrigen Afrika zu unterstützen.“ Nach den mir gewordenen Instruktionen glaubte ich, Monsieur Delcassé die Annahme dieser Bedingungen zusichern zu dürfen. Auf meine Frage, ob ein Krieg gegen England in Frankreich populär sein würde, erhielt ich die Antwort: ‚Das französische Volk wird zu jedem Opfer bereit sein, wenn wir Faschoda zu unserer Parole machen.‘ Niemals hat sich der britische Uebermut brutaler und beleidigender geoffenbart als in diesem Falle. Unser braver Marchand war mit einer überlegenen Mannschaft am Platze, und Frankreich befand sich in seinem guten Recht. Aber die bloße Aufforderung eines englischen Offiziers, dem keine andere Macht als die moralische der englischen Fahne zur Seite stand, zwang uns unter den damaligen politischen Verhältnissen, unsere begründeten Ansprüche aufzugeben und den tapferen Führer zurückzurufen. Wie das Volk diese Niederlage aufnahm, haben wir deutlich genug gesehen. Die Pariser begrüßten Marchand jubelnd, wie einen Nationalhelden, und die französische Regierung rechnete allen Ernstes mit der Möglichkeit einer Revolution. Jetzt könnten wir Revanche nehmen für die Demütigung, die wir damals aus vielleicht allzugroßer Vorsicht über uns ergehen ließen. Schreiben wir den Namen Faschoda auf die Trikolore, und es wird keinen waffenfähigen Mann in ganz Frankreich geben, der uns nicht mit Begeisterung folgte. Es schien mir ratsam, mich zu vergewissern, ob die Regierung oder die von ihr inspirierte Presse dem Volke vielleicht auch die Wiedererwerbung Elsaß-Lothringens als Preis eines siegreichen Krieges verheißen würde. Aber der Minister verneinte mit aller Entschiedenheit. ‚Die Frage Elsaß-Lothringen muß gänzlich aus dem Spiele bleiben, sobald wir uns anschicken, Realpolitik zu treiben,‘ erklärte er. ‚Nichts könnte verhängnisvoller sein, als die Erregung einer Mißstimmung in Deutschland. Denn der deutsche Kaiser ist das Zünglein an der Wage, auf der die Geschicke der Welt gewogen werden.‘ Daß England von ihm, den es nicht als einen Deutschen, sondern als einen Engländer ansieht, keine Feindseligkeiten zu befürchten habe, ist eine feststehende Ueberzeugung bei unsern Nachbarn jenseits des Kanals. Und diese Zuversicht ist eine der stärksten Stützen des britischen Uebermuts. Die immer wiederholten Versicherungen des deutschen Kaisers, daß er den Frieden und nichts als den Frieden wolle, scheinen ja die Richtigkeit dieser Auffassung zu bestätigen. Aber ich bin gewiß, daß Kaiser Wilhelms Friedensliebe da eine Grenze hat, wo das Wohl und die Sicherheit Deutschlands ernstlich in Frage stehen. Er ist trotz seines impulsiven Temperaments nicht der Herrscher, der sich von jeder Aeußerung der Volksstimme beeinflussen und von jeder aufrauschenden Strömung zu entscheidenden Handlungen treiben ließe. Aber er ist weitblickend genug, eine wirkliche Gefahr rechtzeitig zu erkennen und ihr mit der ganzen Wucht seiner Persönlichkeit entgegenzutreten. Ich halte darum die Hoffnung, ihn als Alliierten zu gewinnen, nicht für eine Utopie, und ich hoffe, daß die russische Diplomatie sich mit der unsrigen vereinigen werde, dieses Bündnis zustande zu bringen. Ein Krieg gegen England ohne die Unterstützung Deutschlands würde immerhin ein bedenkliches Unternehmen bleiben. Wir sind ja bereit, uns um unserer Freundschaft für Rußland und um unserer nationalen Ehre willen darauf einzulassen, aber wir würden uns einen sicheren Erfolg nur von einem geschlossenen Zusammengehen aller kontinentalen Großmächte versprechen können.“
Mochte auch die Tatsache des mit Frankreich für den Fall eines Krieges gegen England abgeschlossenen Schutz- und Trutzbündnisses den meisten der hier Versammelten nicht mehr unbekannt gewesen sein, so war die Vorlesung der Depesche, der man in atemloser Spannung gefolgt war, doch unverkennbar von tiefer Wirkung. Ihre Bekanntgabe ließ keinen Zweifel mehr, daß man an höchster Stelle zu diesem Kriege entschlossen sei, und wenn auch keine laute Kundgebung des Beifalls erfolgte, ging es doch wie ein Aufatmen der Erleichterung durch die illustre Versammlung, und deutlich war auf fast allen Gesichtern die freudigste Genugtuung zu lesen.
Einer nur blickte mit finster zusammengezogenen Brauen wie in ernster Mißbilligung drein — und dieser Eine galt seit Jahrzehnten für den einflußreichsten Mann in Rußland — für eine Macht, die schon oft alle Pläne der leitenden Staatsmänner durchkreuzt und mit unbeugsamer Energie ihren Willen durchgesetzt hatte.
Das war der vielgehaßte und noch mehr gefürchtete greise Pobjedonoszew, der Oberprokurator des heiligen Synod.
Seine düstere Miene und sein Kopfschütteln waren dem präsidierenden Großfürsten nicht entgangen. Und er hielt es offenbar für seine Pflicht, dem durch die Gunst dreier Zaren fast allmächtig gewordenen Manne Gelegenheit zur Aeußerung seiner abweichenden Meinung zu geben.
Auf seinen Wink erhob sich der Oberprokurator und sagte unter lautloser Stille der Versammelten:
„Es kann nicht meine Aufgabe sein, mich über die Möglichkeit oder die Aussichten eines Bündnisses mit Deutschland zu äußern. Denn ich kenne ebensowenig wie einer der hier Anwesenden die Absichten und Pläne des deutschen Kaisers. Wilhelm II. ist die große Sphinx unserer Zeit. Er spricht viel, und seine Reden machen den Eindruck vollster Offenherzigkeit. Wer aber mag erraten, was sich hinter ihnen verbirgt? Daß er sich ein bestimmtes Programm für sein Lebenswerk gesetzt hat, und daß er der Mann ist, es durchzuführen, gleichviel, ob die öffentliche Meinung für ihn oder gegen ihn sei, scheint mir gewiß. Bildet die Niederwerfung Englands einen Teil dieses Programms, so dürfte die Hoffnung des französischen Ministers ja in der Tat keine Utopie sein, vorausgesetzt, daß Kaiser Wilhelm den gegenwärtigen Zeitpunkt für den geeigneten hält, der Welt seine letzten Ziele zu offenbaren. Die Aufgabe unseres diplomatischen Vertreters am Berliner Hofe würde es sein, sich darüber zu informieren. Aber eine andere Frage wäre es, ob Rußland eines Bündnisses mit Deutschland oder mit der westlichen Macht, die vorhin hier genannt worden ist, überhaupt bedarf. Und meine Anschauung der Dinge führt mich dahin, diese Frage zu verneinen. Rußland ist zur Zeit in Europa der letzte und einzige Hort des absolutistischen Prinzips. Und wenn ein von Gottes Gnade zu dem höchsten und verantwortlichsten aller irdischen Aemter berufener Herrscher stark genug bleiben soll, den Geist der Unbotmäßigkeit und der Unmoral niederzuwerfen, der sich hier und da unter dem Einfluß fremder staatsfeindlicher Elemente in unserem geliebten Vaterlande regen will, so müssen wir vor allem darauf bedacht sein, das Gift der sogenannten liberalen Ideen, des Unglaubens und des Atheismus, mit dem es von Westen her verseucht werden soll, von unserem Volke fernzuhalten. Wie wir vor einem Jahrhundert den mächtigen Heerführer der Revolution niedergeworfen haben, so werden wir auch heute über unsern Feind triumphieren — wir ganz allein! Laßt unsere Heere in Persien, Afghanistan und Indien einmarschieren und durch ganz Asien die Herrschaft des wahren Glaubens zum Siege führen. Aber hütet unser heiliges Rußland vor der Ansteckung durch das Gift jenes ketzerischen Geistes, der ihm ein schlimmerer Feind werden würde, als es ihm je eine auswärtige Macht sein kann.“
Er setzte sich, und sekundenlang herrschte eine tiefe Stille. Der Großfürst machte ein ernstes Gesicht und wechselte ein paar geflüsterte Worte mit seinen beiden Neffen.
Dann sagte er: „Von all den Herren, die uns hier ihre Ansichten vorgetragen haben, ist die Kriegserklärung an England als eine zwar tief beklagenswerte aber den Umständen nach unabweisbare Notwendigkeit bezeichnet worden. Ehe ich aber Seiner Majestät, unserem erhabenen Herrn, diese Anschauung als die der hier Versammelten unterbreite, richte ich an Sie, meine Herren, die Frage, ob unter Ihnen jemand ist, der eine abweichende Meinung vertritt. Ich würde ihn bitten, sich zum Worte zu melden.“
Er wartete eine kleine Weile, aber niemand leistete der Aufforderung Folge. Da erhob er sich aus seinem Sessel und gab durch ein kurzes Wort des Dankes und durch eine leichte Verneigung gegen die ebenfalls aufgestandenen Würdenträger kund, daß er die Sitzung, die für die Geschicke der Welt von entscheidender Bedeutung gewesen war, als geschlossen betrachte.
II.
Es war zu Chanidigot im britischen Ostindien. — Der blendenden Helligkeit des heißen Tages war unvermittelt, fast ohne Dämmerungsübergang, die abendliche Dunkelheit gefolgt und mit ihr eine erquickende Kühle, die alles Lebendige aufatmen ließ.
In dem weiten Camp, das dem englischen Lancerregiment als Lagerplatz diente, war es mit dem Sinken der Sonne lebendig geworden. Die Soldaten, frei von der Last des Dienstes, vergnügten sich je nach Laune und Temperament mit Spiel, Gesang und fröhlichem Zechen. Auch in dem großen Zelt, das als Offiziersmesse benutzt wurde, ging es lebhaft her. Das gemeinsame Mahl war vorüber, und ein Teil der Herren hatte sich nach täglicher Gewohnheit zum Kartenspiel niedergesetzt. Aber die Unterhaltung war hier weniger harmlos als draußen bei den gemeinen Soldaten. Denn man begnügte sich nicht mit einem unschuldigen Whist, sondern spielte bei ziemlich hohen Einsätzen das in Amerika und teilweise auch in England beliebte Poker, bei dem lediglich der Zufall und eine gewisse schauspielerische Geschicklichkeit der Teilnehmer den Ausschlag gibt. Zumeist allerdings waren es die jüngeren Herren, die diesen abendlichen Nervenkitzel in dem eintönigen Lagerleben als unentbehrlich betrachteten. Die älteren saßen mit ihren kurzen Pfeifen und ihrem Whisky und Sodawasser plaudernd an den abseits stehenden Tischen. Auch ein Herr in bürgerlicher Kleidung war unter ihnen. Die zuvorkommende Höflichkeit, mit der man ihn behandelte, ließ vermuten, daß er nicht dem Offizierkorps des Regiments angehörte, sondern nur dessen Gast war. Der Klang seines Namens — man redete ihn mit Mr. Heideck an — würde seine deutsche Abstammung verraten haben, auch wenn sie sich nicht schon in seiner äußeren Erscheinung kundgegeben hätte. Er war von nur mittelgroßer Gestalt, aber von athletischem Körperbau. Seine straffe, soldatische Haltung und die elastische Leichtigkeit seiner Bewegungen waren unzweideutige Kennzeichen einer vortrefflichen Gesundheit und einer nicht geringen körperlichen Kraft. Für den Engländer aber kann der Fremde kaum eine bessere Empfehlung mitbringen als diese. Und vielleicht war es vor allem seine imponierende Erscheinung gewesen, die im Verein mit seinem liebenswürdigen, durchaus gentlemanmäßigen Auftreten diesem blondbärtigen jungen Deutschen mit dem scharf geschnittenen, energischen Gesicht und den treuherzig blickenden, blauen Augen so schnell Zutritt in die sonst sehr exklusiven Offizierskreise verschafft hatte.
Seinem Stande nach mochte er ja nach der Auffassung einiger dieser Herren nicht gerade in ihre Gesellschaft gehören. Denn man wußte, daß er zu geschäftlichen Zwecken für ein großes Hamburger Handelshaus reiste. Sein Oheim, der Chef dieses Hauses, befaßte sich mit dem Import von Indigo. Und da der Maharadjah von Chanidigot sehr ausgedehnte Indigo-Plantagen besaß, hielt die geschäftliche Verhandlung mit dem Fürsten den jungen Heideck nun schon seit vierzehn Tagen hier fest. Es war ihm gelungen, während dieser Zeit die lebhaften Sympathien namentlich der älteren britischen Offiziere zu gewinnen. In den indischen Garnisonen ist jeder Europäer willkommen, man zog Heideck auch zu denjenigen geselligen Veranstaltungen hinzu, an denen die Damen des Regiments teilnahmen.
Die Einladung zum Spiel hatte er indessen jedesmal mit höflicher Bestimmtheit abgelehnt, und auch heute machte er dabei nur den unbeteiligten, wenig interessierten Zuschauer.
Jetzt öffnete sich die Tür des Zeltes, und sporenklirrend, in sehr selbstbewußter, fast hochmütiger Haltung trat ein hochgewachsener, aber auffallend hagerer Offizier in den Kreis der Kameraden. Er war im Dienstanzuge und sprach zu einem der Herren, der ihn als Kapitän Irwin begrüßt hatte, davon, daß er einen zur Inspizierung eines Außenpostens unternommenen anstrengenden Ritt hinter sich habe. Von einer der aufwartenden Ordonnanzen ließ er sich einen erfrischenden Trunk, das beliebte Gemisch aus Whisky und Sodawasser, bringen. Dann näherte er sich dem Tische der Spieler.
„Ist hier noch Raum für einen kleinen Kerl?“ fragte er. Und bereitwillig machte man ihm Platz.
Eine Weile ging es bei der Pokerpartie in der bisherigen ruhigen Weise fort. Plötzlich aber mußte etwas Außergewöhnliches eingetreten sein. Denn man sah, daß die Herren bis auf Kapitän Irwin und einen der Mitspieler ihre Karten niederlegten, und man hörte die unangenehm scharfklingende Stimme Irwins.
„Sie sind ein alter Fuchs, Kapitän Mc. Gregor! Aber ich kenne Ihre Tricks und falle nicht mehr darauf hinein. Noch einmal also: sechshundert Rupien!“
Wer die Gesetze des Poker kennt, weiß, daß es bei diesem Spiel, worin gewissen Kartenkombinationen der Gewinn zufällt, nicht für unehrenhaft, sondern im Gegenteil für eine besondere Feinheit gilt, die Mitspieler durch kleine, komödiantische Kniffe über den Wert der beim Austeilen erhaltenen Karten zu täuschen. Der Name ‚Bluff‘, den man diesem Hazardspiel beigelegt hat, verrät ja schon, daß jeder nach Kräften versuchen muß, seinen Gegner zu verblüffen.
Dem Kameraden Mc. Gregor gegenüber aber schien es Irwin diesmal nicht recht zu gelingen. Denn der Kapitän erwiderte mit großer Ruhe:
„Sechshundertfünfzig. Aber ich rate Ihnen, Irwin, sie nicht zu halten.“
„Siebenhundert.“
„Siebenhundertfünfzig!“
„Tausend!“ rief Irwin mit dröhnender Stimme und lehnte sich mit einem siegesgewissen Lächeln in seinen Stuhl zurück.
„Ueberlegen Sie, was Sie tun,“ sagte Mc. Gregor. „Ich habe Sie gewarnt.“
„Eine bequeme Manier, siebenhundertfünfzig Rupien einzustreichen. Ich wiederhole: Tausend Rupien.“
„Tausendundfünfzig!“
„Zweitausend!“
Alle im Zelt anwesenden Herren hatten sich erhoben und umstanden die beiden Spieler, die, ihre Karten verdeckt in der Hand haltend, einander mit scharfen Blicken betrachteten. Hermann Heideck, der hinter Irwin getreten war, sah an der Rechten des Kapitäns einen wundervollen Brillanten funkeln. Aber an dem Tanzen der bunten Strahlen, die von diesem Stein ausgingen, sah er auch, wie die Finger des Spielers bebten.
Kapitän Mc. Gregor wandte sich an seine Umgebung.
„Ich rufe die Herren zu Zeugen an, daß ich den Kameraden schon bei sechshundert gewarnt habe.“
„Wozu bedarf es da einer Warnung?“ fiel Irwin fast heftig ein. „Bin ich denn ein Knabe? Halten Sie die zweitausend, Mc. Gregor, oder halten Sie sie nicht?“
„Nun denn, da Sie es nicht anders wollen: dreitausend.“
„Fünftausend!“
„Fünftausendfünfhundert.“
„Zehntausend.“
Jetzt legte einer der höheren Offiziere, der Major Robertson, seine Hand leicht auf die Schulter des tollkühnen Spielers.
„Das ist zuviel, Irwin! Ich mische mich nicht gern in solche Dinge, und da Sie nicht von meinem Regiment sind, kann ich nicht dienstlich, sondern nur kameradschaftlich mit Ihnen reden. Aber mir scheint, daß Sie sich in Verlegenheit befinden würden, wenn Sie verlören.“
Unwillig fuhr der Angeredete auf.
„Was wollen Sie damit sagen, Herr Major? Wenn Ihre Worte einen Zweifel an meiner Zahlungsfähigkeit ausdrücken sollen, — —“
„Nun, nun — ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Sie müssen ja schließlich am besten wissen, was Sie verantworten können.“
Und mit trotziger Miene wiederholte Irwin:
„Zehntausend also! Ich erwarte Ihre Antwort, Mc. Gregor.“
Der Gegner blieb unverändert ruhig.
„Zehntausendfünfhundert.“
„Zwanzigtausend!“
„Sind Sie denn betrunken, Irwin?“ flüsterte von der anderen Seite her der junge Leutnant Temple dem Kapitän ins Ohr. Der aber streifte ihn mit einem zornfunkelnden Blick.
„Nicht mehr als Sie. Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe!“
„Einundzwanzigtausend,“ klang es gelassen von der gegenüberliegenden Seite des Tisches.
Eine kurze, erwartungsvolle Pause folgte. Kapitän Irwin kaute nervös an seinem kleinen, dunklen Schnurrbart. Dann aber reckte er seine hagere Gestalt und rief:
„Fünfzigtausend.“
Noch einmal glaubte der Major, Halt gebieten zu müssen.
„Ich erhebe Einspruch!“ sagte er. „Es ist bisher Regel bei uns gewesen, daß der Pool nicht um mehr als tausend Rupien auf einmal erhöht werden darf. Diese Regel ist längst überschritten.“
Ein häßliches, rauhes Lachen kam von Irwins Lippen.
„Es scheint, daß Sie die Absicht haben, mich zu retten, Herr Major! Aber ich brauche durchaus keinen Retter. Wenn ich verliere, werde ich zahlen. Und ich begreife nicht, weshalb sich die Herren in meinem Interesse die Köpfe zerbrechen.“
Der Major, der einsehen mußte, daß er hier mit allem guten Willen nichts auszurichten vermochte, zuckte die Achseln. Leutnant Temple aber vermeinte, einen guten Einfall zu haben. Mit einer anscheinend unbeabsichtigten, ungestümen Bewegung stieß er gegen den leichten Feldtisch, daß Aschenbecher, Flaschen, Gläser und Karten zu Boden fielen. Aber es war nichts damit gewonnen, denn die beiden hielten ihr Spiel fest in der Hand und ließen sich durch den Zwischenfall nicht einen Augenblick aus der Fassung bringen.
„Einundfünfzig,“ sagte Mc. Gregor.
„Sechzig.“
„Einundsechzig.“
„Siebzig.“
„Einundsiebzig.“
„Achtzig.“
„Einundachtzig.“
„Ein Lakh!“ schrie Irwin, der jetzt vor Aufregung kreidebleich geworden war.
„Wirklich?“ fragte Mc. Gregor gleichmütig. „Das ist ein schönes Gebot. Ein Lakh also — nach dem heutigen Kurse sechstausendfünfhundert Pfund Sterling. Sie werden ein reicher Mann sein, Irwin, wenn Sie gewinnen. Zeigen Sie doch, was Sie in der Hand haben.“
Mit zitternden Fingern, doch mit triumphierender Miene deckte der Kapitän seine Karten auf.
„Straight flush!“ sagte er heiser.
„Ja, das ist ein starkes Spiel,“ erwiderte der andere lächelnd. „Aber sagen Sie doch, welches ist Ihre höchste Karte?“
„Der König, wie Sie sehen.“
„Schade! Ich habe nämlich auch straight flush. Aber bei mir steht das Aß an der Spitze.“
Langsam, eine nach der anderen, legte er seine Karten auf den Tisch: Coeuraß, Coeurkönig, Coeurdame, Coeurbube, Coeurzehn. Wie ein einziger Ausruf der Verwunderung kam es von den Lippen der Umstehenden. Keiner hatte je das Zusammentreffen einer so merkwürdigen Kartenkombination erlebt.
Kapitän Irwin saß für einen Moment regungslos, die flackernden Augen starr auf die Karten seines Gegners geheftet. Dann plötzlich sprang er mit einem wilden Lachen auf und verließ mit klirrenden Schritten das Zelt.
„Dieser Verlust bedeutet für Irwin eine Katastrophe,“ sagte der Major sehr ernst. „Er ist außer stande, eine solche Summe zu zahlen.“
„Mit Hülfe seiner Frau könnte er es wohl,“ meinte ein anderer, „aber es würde sie so ziemlich den ganzen Rest ihres Vermögens kosten.“
„Ich nehme die Herren zu Zeugen, daß es nicht meine Schuld ist,“ erklärte Mc. Gregor, der einen gewissen Vorwurf in den Mienen seiner Umgebung zu lesen glaubte. Man stimmte ihm zu. Aber Leutnant Temple, der einzige unter allen Anwesenden, den eine gewisse oberflächliche Freundschaft mit Irwin verband, bemerkte:
„Irgend jemand wird ihm nachgehen müssen, damit er in der ersten Aufregung nicht eine Torheit begeht.“
Er wandte sich schon zum Gehen, aber ein Zuruf Mc. Gregors hielt ihn zurück.
„Es würde keinen Zweck haben, Temple, wenn Sie ihm nicht zugleich etwas Beruhigendes sagen können. Und es gibt meines Erachtens da nur einen einzigen Ausweg. Man müßte ihm einreden, die Sache hätte nur ein Spaß sein sollen und die Karten wären vorher geordnet gewesen.“
Der Leutnant kehrte zum Tische zurück.
„Die Erfindung dieses Auskunftsmittels gereicht Ihnen zur Ehre, Herr Kapitän! Aber ich zweifle, daß jemand von uns den Mut haben würde, ihm mit solcher Lüge zu kommen.“
Das Schweigen der anderen schien diesen Zweifel zu bestätigen. Da ertönte die markige Stimme des deutschen Gastes:
„Wollen Sie mich mit dieser Mission betrauen, meine Herren? Ich kenne den Kapitän Irwin zwar nur flüchtig, und ich hätte keinen Anlaß, mich in seine Angelegenheiten zu mischen; aber ich höre, daß es das Vermögen seiner Gattin ist, das hier auf dem Spiel steht. Und da ich Mrs. Irwin für eine sehr verehrungswürdige Dame halte, würde ich gern das meinige dazu beitragen, sie vor einem so schweren Verlust zu bewahren.“
Mc. Gregor reichte ihm die Hand.
„Sie würden mich zu Dank verpflichten, Mr. Heideck, wenn es Ihnen gelänge. Aber ich rate Ihnen, keine Zeit zu verlieren.“
Rasch verließ Heideck das Zelt. Und als er in die köstliche, mondhelle Nacht hinaustrat, sah er in der Entfernung von zwanzig Schritten Kapitän Irwin neben seinem Pferde. Der Bursche hielt das Tier am Zügel, Kapitän Irwin aber machte sich am Sattel zu schaffen. Während Heideck näher kam, sah er den Soldaten sich entfernen und gewahrte, daß Irwin einen Revolver in der Hand hielt.
Mit raschem Griff hatte er das Handgelenk des Offiziers erfaßt.
„Einen Augenblick, Kapitän Irwin.“
Dieser schrak zusammen, drehte sich um und blickte wütend auf Heideck.
„Ich bitte um Entschuldigung,“ sagte der Deutsche. „Aber Sie befinden sich im Irrtum, Herr Kapitän. Das Spiel gilt nicht. Man hat sich einen Scherz mit Ihnen erlaubt. Die Karten sind vorher arrangiert worden.“
Irwin erwiderte nichts, aber er pfiff nach seinem Burschen und ging, noch immer ohne mit Heideck zu sprechen, in das Zelt zurück, den Revolver in der Hand. Heideck folgte ihm.
Beide Herren traten an den Spieltisch, und Irwin wandte sich an Mc. Gregor. „Also das Spiel ist arrangiert gewesen?“ fragte er.
„Zur Lehre für Sie, Irwin, der Sie immer wie toll und töricht darauf losgehen und sich einbilden, ein guter Spieler zu sein, während Sie gar nicht das kalte Blut dazu haben.“
„Nun,“ sagte Irwin, „das ist eine Geschichte, die ich als Beispiel kameradschaftlicher Gesinnung in allen Garnisonen Indiens herumbringen werde, damit ein jeder sich hütet, der einmal hierherkommt und verführt werden sollte, ein Spiel zu machen. Eine solche niederträchtige Geschichte habe ich noch nicht erlebt, aber es ist mir allerdings eine Lehre, daß man nur mit ehrlichen Leuten — —“
„Ah, Kapitän Irwin,“ sagte Mc. Gregor, sich hoch aufrichtend, indem er den Beleidiger mit einem vernichtenden Blick seiner großen blauen Augen fixierte, „an Ihre junge Frau sollten Sie lieber denken, die Sie in Armut gestürzt hätten, wenn dies Spiel kein Scherz war.“
Irwin taumelte zurück, der Revolver entfiel seiner Hand.
„Was?“ kreischte er, „was ist das? So ist es kein Scherz gewesen? So habe ich das Geld wirklich verloren? O, ihr — ihr — Aber für wen haltet ihr mich? Seid gewiß, ich werde bezahlen!“ „Aber,“ rief er, sich besinnend, „ich möchte doch wohl wissen, was nun Wahrheit ist. Euch alle frage ich und nenne euch Schurken und Lügner, wenn ihr nicht die Wahrheit sagt: hat man wirklich einen Spaß mit mir getrieben oder ist das Spiel ein ehrliches Spiel gewesen?“
„Kapitän Irwin,“ entgegnete der Major, ihm entgegentretend, „ich sage Ihnen als Aeltester im Namen der Kameraden, daß Ihr Benehmen unverzeihlich wäre, wenn nicht eine Art von Tollheit Sie beherrschte. Dies ist ein ehrliches Spiel gewesen, und nur die Großmut des Kapitän Mc. Gregor war es, die — — —“
Irwin hörte den Schluß seiner Rede nicht mehr, denn mit einem wilden Fluch hatte er abermals das Zelt verlassen.
III.
Hermann Heideck wohnte in einem Dak Bungalo, einem jener von der Regierung unterhaltenen Gasthäuser, die dem Reisenden zwar Unterkunft aber weder Betten noch Verpflegung bieten. Als er aus dem Camp dahin zurückkehrte, stand sein indischer Diener Morar Gopal in der Tür, um den Herrn zu empfangen und teilte ihm mit, daß ein neuer Gast mit zwei Dienern angekommen wäre. Da dieses Dak Bungalo geräumiger war als die meisten anderen, so hatten die Neuangekommenen Platz, und Heideck brauchte nicht, wie sonst üblich, als älterer Gast dem später eingetroffenen zu weichen.
„Was für ein Landsmann ist der Herr?“ fragte er.
„Ein Engländer, Sahib!“
Heideck trat in sein Zimmer und ließ sich am Tische nieder, auf dem neben den beiden mattleuchtenden Kerzen eine Whiskyflasche, einige Flaschen Sodawasser und das Zigarettenkistchen standen. Er war nachdenklich und übel gelaunt. Die aufregende Szene in der Offiziersmesse war ihm persönlich nahe gegangen. Nicht um des Kapitän Irwin willen, der ihm seit dem ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft in hohem Maße unsympathisch gewesen war, sondern einzig wegen der schönen jungen Frau des leichtsinnigen Offiziers, an die er sich von ihren wiederholten gesellschaftlichen Begegnungen her gut genug erinnerte. Keine der anderen Offiziersdamen — und es waren sehr hübsche und liebenswürdige unter ihnen — hatte einen so tiefen und nachhaltigen Eindruck auf ihn gemacht, wie Mrs. Edith Irwin, deren persönlicher Liebreiz ihn in ebenso hohem Maße gefesselt hatte, wie ihre ungewöhnliche Klugheit ihn in Erstaunen setzte. Die Vorstellung, daß dieses anmutige Wesen mit unzerreißbaren Ketten an einen brutalen und ausschweifenden Menschen vom Schlage Irwins gefesselt war, und daß ihr Mann sie vielleicht eines Tages mit sich hinabriß in sein unausbleibliches Verderben, bereitete ihm eine schmerzhafte Empfindung. Er hätte so gern irgend etwas für die unglückliche junge Frau getan. Aber er mußte sich sagen, daß es dazu für ihn, den Fremden, der ihr nichts als eine oberflächliche Bekanntschaft war, keine Möglichkeit gab. Der Kapitän wäre vollkommen berechtigt gewesen, jede unberufene Einmischung als eine unerhörte Dreistigkeit zurückzuweisen. Und auf welche Art hätte er hier helfend eingreifen können?
Ein Lärm, der sich plötzlich im Nebenzimmer erhob, riß Heideck aus seinen unerfreulichen Grübeleien. Er hörte lautes Schelten und ein klatschendes Geräusch, wie wenn Peitschenhiebe auf einen nackten menschlichen Körper fallen. Eine Minute später wurde die Verbindungstür aufgerissen und ein nur mit Hüftschurz und Turban bekleideter Inder stürzte in das Zimmer, als ob er hier Schutz vor seinem Peiniger suchen wollte. Ein lang gewachsener, ganz in weißen Flanell gekleideter Europäer war ihm auf den Fersen und ließ unbarmherzig seine Reitgerte auf den bloßen Rücken des wehklagenden Mannes niedersausen. Die Anwesenheit Heidecks genierte ihn dabei offenbar nicht im mindesten.
Auf den ersten Blick hatte der junge Deutsche erkannt, daß sein Nachbar nicht, wie der Diener ihm gesagt hatte, ein Engländer sein konnte. Sein auffallend schmales, fein geschnittenes Gesicht, seine eigentümlich geschlitzten schwarzen Augen und sein weicher dunkler Bart hatten viel mehr von dem sarmatischen als von dem charakteristisch angelsächsischen Typus.
Der Mann gefiel ihm seinem Aeußeren nach nicht übel, sein Betragen aber konnte er unmöglich ruhig hinnehmen. Indem er zwischen ihn und den Mißhandelten trat, fragte er sehr energisch, was dieser Auftritt bedeuten solle.
Lachend ließ der andere den eben wieder zum Schlage erhobenen Arm sinken.
„Ich bitte um Entschuldigung, mein Herr,“ sagte er in fremdartig klingendem Englisch, „ein sehr guter Boy, aber er stiehlt wie ein Rabe und muß von Zeit zu Zeit seine Prügel haben. Ich weiß, daß er irgendwo an seinem Leibe die fünf Rupien versteckt haben muß, die mir heute wieder fehlen.“
Damit packte er, als hielte er die gegebene Auskunft für vollkommen ausreichend, seine Handlungsweise zu erklären, den braunen Burschen von neuem und riß ihm mit raschem Griffe den Turban vom Kopfe. Aus dem weißen, rotgesäumten Tuche rollten klirrend ein paar Silberstücke über die Steinplatten hin. Zugleich aber war auch ein größerer Gegenstand vor Heidecks Füße niedergefallen. Er hob ihn auf und hielt ein goldenes Zigarettenetui in der Hand, auf dessen Deckel ein Wappen mit einer Fürstenkrone eingraviert war. Als er es dem Fremden überreichte, verbeugte sich dieser dankend und entschuldigte sich wie ein Mann von der besten Gesellschaft. Der Inder aber nahm die Gelegenheit wahr, sich mit einigen affenartigen Sprüngen aus dem Staube zu machen.
Der Anblick des Wappens auf dem Zigarettenetui hatte in Heideck das Verlangen geweckt, diesen gewalttätigen Nachbar näher kennen zu lernen. Als hätte er die sonderbare Art seines Eintritts ganz vergessen, fragte er artig, ob er den ihm vom Zufall bescherten Hausgenossen zu einer Zigarre und einem Abendtrunk einladen dürfe.
Mit liebenswürdigster Bereitwilligkeit nahm der andere die Aufforderung an.
„Sie reisen auch in Geschäften, mein Herr?“ fragte Heideck. Und da er eine bejahende Antwort erhielt, fügte er hinzu:
„Wir wären also Kollegen. Sind Sie mit Ihren hiesigen Erfolgen zufrieden?“
„O, es könnte besser gehen. Man hat zuviel Konkurrenz!“
„Baumwolle?“
„Nein. Bronzewaren und Seide. Habe von Delhi auch wunderbare Goldarbeit mitgebracht.“
„Dann stammt Ihr Zigarettenetui vermutlich auch aus Delhi?“
Die geschlitzten Augen des anderen streiften ihn mit einem forschenden Blick.
„Mein Zigarettenetui? Nein! — Arbeiten Sie vielleicht in Fellen, Herr Kollege? Haben Sie Kaschmirziegen?“
„Ich habe alles. Mein Haus arbeitet in allem.“
„Sie kommen nicht von Kalkutta?“
„Nein, nicht von Kalkutta.“
„Schlechtes Wetter da. All mein Leder ist verdorben.“
„Ist es so feucht dort?“
„Dampfbad, sage ich Ihnen, veritables Dampfbad.“
Heideck war längst überzeugt, einen Russen vor sich zu haben. Aber um seiner Sache ganz sicher zu sein, machte er eine scherzhafte Bemerkung in russischer Sprache. Verwundert blickte sein neuer Bekannter auf.
„Sie sprechen russisch, mein Herr?“
„Ein wenig.“
„Sie sind aber kein Russe?“
„Nein, ich bin ein Deutscher, der sich während eines vorübergehenden Aufenthaltes in Rußland einige Sprachkenntnisse angeeignet hat. Wir Kaufleute kommen ja weit herum.“
Der Herr, der seiner Angabe nach in Seide und Bronzewaren reiste, war sichtlich erfreut, hier, wo er es gewiß am wenigsten erwartet hatte, die anheimelnden Laute seiner Muttersprache zu vernehmen. Und Heideck bemühte sich mit einem fast befremdlichen Eifer, ihn bei guter Laune zu erhalten. Er rief seinen Diener und befahl ihm, heißes Wasser zu bereiten.
„Es ist sehr kühl diese Nacht,“ wandte er sich an seinen Gast. „Ein Brandy mit heißem Wasser ist da nicht zu verachten.“
„Ah,“ sagte der Russe, „warten Sie einen Augenblick. Es ist besser, das Wasser wegzulassen und es durch etwas Schmackhafteres zu ersetzen.“
Er ging in sein Zimmer und kehrte alsbald mit einer Flasche Sherry und zwei Flaschen Champagner zurück.
„Ich werde mit Ihrer Erlaubnis hier in diesem Kessel einmal eine Bowle nach russischem Geschmack mischen. Zucker muß auch hinein. Dieser für englische Zungen berechnete Champagner ist so trocken, daß er gesüßt werden muß, um für unsereinen genießbar zu werden.“
Er goß die Flasche Kognak, die der Diener gebracht hatte, ebenso wie den Sherry zu dem Champagner und füllte die Gläser.
Nach deutscher Sitte stießen die beiden Herren mit einander an. Noch einmal betrachtete Heideck dabei aufmerksam seinen neuen Bekannten. Der lauernde Ausdruck, mit dem er die Augen des anderen auf sich gerichtet fühlte, machte ihn einen Moment stutzig. Sollte der Russe etwa die gleiche Absicht haben, wie er selbst, und ihm mit dem Sekt nur die Zunge lösen wollen? Jedenfalls war er jetzt auf seiner Hut.
„Darf ich Sie bitten, eine meiner Havannazigarren zu versuchen?“ fragte der Russe, indem er ihm sein Etui darreichte. „Die indischen Zigarren sind nicht schlecht und sehr billig. Die Beaconsfield ist meine Lieblingssorte. Hier und da muß man aber zur Abwechslung doch etwas anderes rauchen.“
Heideck nahm dankend an und es begann jetzt ein ziemlich scharfes Zechen, zu welchem der Russe das Tempo angab. Aber er war der Wirkung des ebenso wohlschmeckenden wie starken Getränkes offenbar viel weniger gewachsen, als der Deutsche. Von Minute zu Minute gesprächiger werdend, fing er bald an, seinen neuen Freund Brüderchen zu nennen und allerlei mehr oder weniger verfängliche Geschichten zu erzählen. Auch auf seine heimischen Familienverhältnisse kam er, durch einige geschickte Fragen Heidecks veranlaßt, zu sprechen. Er lachte über eine alte Tante, die ihr Haar mit Rosen zu schmücken pflege, um kahle Stellen zu verdecken, und fügte hinzu, daß diese Tante wegen ihrer unvergleichlichen Klatschgeschichten am Zarenhofe ganz besonders beliebt sei. Daß solche Familienbeziehungen bei einem Geschäftsreisenden etwas verwunderlich wären, kam ihm augenscheinlich nicht in den Sinn.
Im Verlauf der Unterhaltung erwähnte er auch, daß er vor nicht langer Zeit in China gewesen wäre.
„Wir sind zu langsam, Brüderchen, viel zu langsam,“ versicherte er, „mit fünfzigtausend Mann konnten wir uns alles nehmen, was wir haben wollten, und die Japaner hätten wir unsererseits schon längst angreifen sollen.“
„Sagen Sie doch,“ fragte Heideck anscheinend gleichgiltig, „wie stark ist denn eigentlich die Armee des General-Gouvernements Turkestan?“
Der Russe blickte auf, aber es geschah nicht, weil er sich auf die verlangte Antwort besann. Denn nachdem er langsam ein Glas Sodawasser ausgetrunken hatte, sagte er:
„Wenn du gut leben willst, Brüderchen, mußt du in die Mandschurei gehen. Lachse, sage ich dir — ah! Und kosten beinahe nichts. — Und hübsche Mädchen in Menge! Pelze aber kannst du kaufen — so gut wie umsonst. Was in Petersburg zehntausend Rubel kostet, hast du in China, da oben im Norden, für hundert.“
„Da haben Sie wohl schöne Pelze mitgebracht?“
„Pelze in Indien? Da würden sie im Handumdrehen von den Ameisen aufgefressen werden. Für meinen Gebrauch allerdings habe ich einen mitgebracht, der in Petersburg unter Brüdern fünftausend Rubel wert sein würde. Werde ihn später im Gebirge gut genug brauchen können. Er riecht eine Werst weit, so gut habe ich ihn eingepfeffert!“
Wieder gab es eine kleine Pause. Dann, indem er sein Gegenüber scharf ansah, sagte Heideck plötzlich:
„Sie sind Offizier!“
Ganz fassungslos starrte ihm der Russe ins Gesicht.
„Offenheit gegen Offenheit!“ erwiderte er nach längerem Besinnen. „Auch Sie sind Soldat, mein Herr?“
„Einem Kameraden brauche ich es nicht zu verschweigen. Hermann Heideck, Hauptmann vom preußischen Generalstabe.“
Der Russe erhob sich und machte eine sehr korrekte Verbeugung.
„Fürst Fedor Andrejewitsch Tschadschawadse, Hauptmann im Garderegiment Preobraschensky.“
Dann klangen aufs neue die Gläser zusammen.
„Auf gute Kameradschaft!“ hieß es hüben und drüben.
„Kamerad, ich will Ihnen etwas verraten,“ sagte der Russe. „General Iwanow ist im Anmarsch gegen die indische Grenze. Der Zar beschäftigt sich nicht mehr mit Theosophie, er will England den Krieg erklären.“
Heideck hätte gern noch mehr erfahren, doch der Fürst hatte der berauschenden Mischung wohl schon über seine Kräfte zugesprochen. Er fing an, leichtfertige französische Chansons zu singen, um dann plötzlich auf schwermütige russische Volkslieder überzugehen. An ein halbwegs vernünftiges Gespräch war in seiner gegenwärtigen Verfassung nicht mehr zu denken.
Heideck befand sich bereits in einiger Verlegenheit, was er mit seinem bezechten Gaste anfangen solle. Da wurde ihm eine neue Ueberraschung zu Teil. Die Tür zum Nebenzimmer öffnete sich und ein schöner, schlanker Bursche von höchstens achtzehn Jahren erschien auf der Schwelle.
Er war in eine Art phantastischer Pagentracht gekleidet, die in einem anderen Lande als dem farbenreichen, malerischen Indien wie eine Maskerade gewirkt haben würde. Der blaue, goldgestickte Kittel war mit einer rotseidenen Schärpe umgürtet und die weiten roten Beinkleider verschwanden an den Knieen in hohen, glänzenden Lackstiefeln, deren elegante Form die auffallende Kleinheit der schmalen Füße erkennen ließ. Ueppiges, goldschimmerndes Blondhaar fiel wellig fast bis auf die Schultern des knabenhaften Jünglings herab. Das schöne, längliche Gesicht war von rosigstem Incarnat. Aus den großen, blauen Augen aber blitzte die Energie eines starken Temperaments.
Sowie er des Eintretenden ansichtig geworden war, hatte der Fürst aufgehört zu singen.
„Ah, Georgij —“ stammelte er.
Ohne ein Wort zu sprechen, war der Page auf ihn zugetreten und hatte den plötzlich ganz Willenlosen vom Stuhle emporgezogen. Fürst Tschadschawadse schlang den Arm um seine Schultern und ließ sich hinausführen, ohne seinem deutschen Kameraden eine ‚Gute Nacht‘ zu wünschen.
Heideck zweifelte nicht einen Augenblick daran, daß dieser schlanke Page ein verkleidetes Mädchen wäre. Der schöne Wuchs und der seltsame Ausdruck ungebändigter Naturkraft in den wunderbar regelmäßigen Zügen waren unverkennbar Eigentümlichkeiten des cirkassischen Typus. Dieser angebliche Georgij war sicherlich eine Tochter der kaukasischen Berge, das Kind eines Bauern oder vielleicht eines Räubers, wie auch Tschadschawadse seinem Namen nach einem jener alten kaukasischen Fürstengeschlechter angehörte, die einst als echte Raubritter in dem von Rußland so schwer und so langsam unterworfenen Gebirgslande gehaust hatten.
IV.
Die Angabe des Hauptmanns Heideck, daß er für ein Hamburger Handelshaus reise, war nicht eigentlich eine Unwahrheit gewesen. In der Tat betrieb er die kaufmännischen Geschäfte, die ihm als Maske für den wirklichen Zweck seiner Reise dienten, mit größtem Ernst.
Er hatte von dem Chef des Großen Generalstabes den Auftrag erhalten, die militärischen Verhältnisse in Indien und die strategische Bedeutung der Nordwestgrenze zu studieren, und hierzu war ihm ein unbegrenzter Urlaub bewilligt worden.
Aber der General hatte ihm ausdrücklich erklärt:
„Sie reisen als Privatmann, und wenn Sie in irgend einen Konflikt mit den Engländern geraten sollten, würden wir in keiner Weise die Verantwortung für Ihre Taten und Erlebnisse übernehmen können. Sie erhalten einen Paß auf Ihren richtigen Namen, aber natürlich ohne Erwähnung Ihrer militärischen Eigenschaft. Daß wir Sie bei einer etwaigen Nachfrage nicht verleugnen werden, ist selbstverständlich. In einem gewissen Sinne aber reisen Sie auf eigene Gefahr. Ihr eigener Takt muß Ihnen Führer sein.“
Darauf hin hatte Heideck sich mit seinem Oheim in Verbindung gesetzt und von ihm die erforderlichen Briefe und Empfehlungen an indische Geschäftsfreunde erhalten. Er war von Bombay aus über Allahabad in die nördlichen Provinzen gereist und hatte die wichtigsten Garnisonen, Cawnpore, Lucknow, Delhi und Lahore besucht. Nach Erledigung seiner Geschäfte in Chanidigot gedachte er sich weiter nach Norden zu wenden und durch den Kaiberpaß nach Afghanistan zu gehen. Lediglich mit Rücksicht auf diesen Plan hatte er die nähere Bekanntschaft mit dem Russen gesucht. Er wurde sich klar darüber, daß dieser von seiner Regierung einen ähnlichen Auftrag erhalten hatte wie er selbst, und gewisse Andeutungen des Fürsten hatten ihn in der Vermutung bestärkt, daß er die nämliche Reiseroute zu wählen gedenke. So konnte es für den deutschen Offizier nur von Vorteil sein, wenn er sich dem russischen Kameraden anschloß, der ihm auf russischem Gebiet sicherlich wertvolle Empfehlungen zu verschaffen vermochte. —
Die gehaltvolle Bowle des Fürsten machte sich noch in einigen unangenehmen Nachwirkungen bemerkbar, als Heideck in der Frühe des nächsten Morgens erwachte. Aber das kalte Bad, das ihm Morar Gopal bereitet hatte, und eine Tasse Tee stellten ihn bald wieder her.
Es war ein indischer Frühlingsmorgen von strahlender Schönheit, in den er tiefaufatmend hinaustrat. Der Februar hatte hier im Tale des Indus unter dem 29° nördlicher Breite etwa die Temperatur des römischen Mai. In den Mittagsstunden pflegte die Quecksilbersäule des Fahrenheit-Thermometers auf hundert Grad zu steigen. Die Abende aber waren erquickend kühl und die Nächte mit ihren feuchten Nebeln zuweilen sogar empfindlich kalt.
Heideck hatte an diesem Morgen mit besonderer Sorgfalt Toilette gemacht, denn er war zu einer Besprechung mit dem Minister des Maharadjah geladen, um über das beabsichtigte Indigogeschäft mit ihm zu verhandeln.
Der Minister bewohnte ein Haus an der Weichbildgrenze der Stadt. Es war ein inmitten eines großen Gartens gelegenes einstöckiges Gebäude mit breiten, luftigen Veranden. Als Heideck eintraf, war die Treppe der Eingangshalle bereits von einer bunten Menge besetzt, die auf Audienz wartete. Ihm aber, als einem Vertreter der weißen Rasse, blieb diese lästige Unbequemlichkeit erspart. Der in weißen Musselin gekleidete und zum Zeichen seiner Würde mit einer breiten roten Schärpe umgürtete Pförtner führte ihn vielmehr gleich in das ganz europäisch ausgestattete Arbeitszimmer des Ministers.
Auch in seiner äußeren Erscheinung verriet der Würdenträger nur durch seine Hautfarbe und seinen Gesichtsschnitt den Inder. Kleidung und Manieren waren ganz die eines abendländischen Diplomaten. Er reichte Heideck die Hand und teilte ihm mit, daß Seine Hoheit selbst mit ihm über den Indigo verhandeln wolle.
„Der Preis, den Sie zahlen wollen, ist ungewöhnlich niedrig,“ fügte er in einem Tone leiser Mißbilligung hinzu.
Heideck aber war auf diesen Einwand offenbar vorbereitet gewesen.
„Exzellenz mögen darin recht haben, daß der gebotene Preis niedriger ist als in früheren Jahren. Aber er ist noch immer sehr hoch, wenn man die inzwischen eingetretenen Veränderungen des Marktes berücksichtigt. In Deutschland wird jetzt durch Anilin ein Ersatz geschaffen, der so billig ist, daß in absehbarer Zeit vermutlich überhaupt kein Indigo mehr gekauft werden wird. Wenn es mir gestattet ist, Seiner Hoheit einen Rat zu geben, so wäre es der, statt des Indigobaus künftig eine Industrie zu wählen.“
„Und welche hätten Sie dabei im Auge?“
„Am vorteilhaftesten würden mir oil-mills und cotton-mills erscheinen. Sie könnten der europäischen und japanischen Konkurrenz damit wirksam begegnen.“
Ein indischer Diener erstattete eine Meldung, und der Minister lud Heideck ein, sogleich mit ihm zum Maharadjah zu fahren. Sie bestiegen einen mit zwei schnellen turkestanischen Pferden bespannten offenen Wagen. Der gelb gekleidete Kutscher, der merkwürdige Aehnlichkeit mit einem geputzten Affen hatte, schnalzte mit der Zunge, und im Galopp ging es durch weit ausgedehnte Parkanlagen zum Schlosse, dessen weiße Marmorwände bald aus dem Grün der Palmen und Tamarinden hervorleuchteten.
Heideck mußte während der kurzen Fahrt an die zahllosen Kriegsstürme denken, die über diesen Boden dahingebraust waren, ehe die englische Herrschaft alle religiösen Kämpfe, alle blutigen Aufstände und alle Einfälle fremder Eroberer für immer unmöglich gemacht zu haben schien. Jetzt konnten hier, wo Alexander des Großen sieggewohnte Krieger gekämpft hatten, wo sich Mohammedaner und Hindus, Afghanen und Sonnenanbeter blutige Schlachten geliefert, Werke des Friedens geschaffen werden, die auf eine Dauer von Jahrhunderten berechnet waren. Es war ein Triumph der Zivilisation, dessen imponierendem Eindruck sich ein Kenner von Indiens geschichtlicher Vergangenheit kaum entziehen konnte.
Der Maharadjah von Chanidigot bekannte sich gleich dem größten Teil seiner Untertanen zum Islam, und schon die äußere Anlage seines Palastes ließ den mohammedanischen Fürsten erkennen. Abseits von dem Hauptgebäude, aber durch eine gedeckte Galerie mit ihm verbunden, lag der kleine Haremsflügel, dessen Inneres hinlänglich vor jedem fremden Blicke geschützt war. Hier wie dort offenbarte sich in der Ausschmückung des Palastes die verschwenderischste Pracht. Und Heideck dachte mitleidig an die armen Untertanen des Maharadjah, deren Sklavenarbeit die Mittel für diesen üppigen Luxus hatte liefern müssen.
Der Minister und sein Begleiter wurden nicht in die große Audienzhalle geführt, die nur für besondere feierliche Empfänge bestimmt war, sondern in eine Loggia des ersten Stockwerkes. Die von zierlichen Marmorsäulen getragene offene Seite derselben ging nach einem inneren Hofe hinaus, der mit seinem tropischen Pflanzenreichtum einen wahrhaft paradiesischen Anblick gewährte. Eine leise plätschernde Fontäne, die aus dem Marmorbassin in seiner Mitte emporstieg, warf ihren feinen Sprühregen bis zu der Loggia hinauf und verbreitete angenehme Kühle.
Eine gute Weile ließ ihn der Minister warten. Dann kehrte er zurück und forderte ihn durch ein stummes Zeichen auf, ihn zum Fürsten zu begleiten.