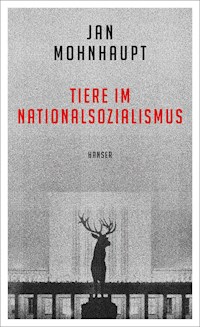Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als sich der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt befindet, nimmt auch das Wettrüsten im geteilten Berlin bizarre Formen an: West-Berlins Regierender Bürgermeister Willy Brandt besorgt dem Zoodirektor Heinz-Georg Klös neue Elefanten, damit der seinem Rivalen, dem Ost-Berliner Tierparkdirektor Heinrich Dathe, weiterhin die Stirn bieten kann. Denn wer mehr Elefanten besitzt, hat eine Schlacht gewonnen. Ob Brillenbär-Spende durch die Stasi, Schlagzeilen wie „Westesel gegen Ostschwein“ oder der Schlagabtausch der beiden charakterstarken Direktoren Heinrich Dathe und Heinz-Georg Klös – die beiden Berliner Zoos verraten vieles über das geteilte Deutschland. Mit großer Sympathie für Tier und Mensch erzählt Jan Mohnhaupt in seinem Buch erstmals ihre gemeinsame Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Anfang der sechziger Jahre befindet sich der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt. Im geteilten Berlin nimmt das Wettrüsten bizarre Formen an: West-Berlins Regierender Bürgermeister Willy Brandt besorgt dem Zoodirektor Heinz-Georg Klös neue Elefanten, damit der seinem Rivalen, dem Ost-Berliner Tierparkdirektor Heinrich Dathe, weiterhin die Stirn bieten kann. Denn wer mehr Elefanten besitzt, hat eine Schlacht gewonnen. Ob Brillenbär-Spende durch die Stasi, Staatsgäste im Zoo oder der Fluchtversuch eines Tierpflegers in einer Elchkiste – die beiden Berliner Zoos verraten vieles über das geteilte Deutschland. Mit großer Sympathie für Tier und Mensch erzählt Jan Mohnhaupt erstmals ihre gemeinsame Geschichte.
Hanser E-Book
Jan Mohnhaupt
Der Zoo der Anderen
Als die Stasi ihr Herz für Brillenbären entdeckte & Helmut Schmidt mit Pandas nachrüstete
Carl Hanser Verlag
Für Juliane
Inhalt
Prolog: Über Tiermenschen
Platzhirsche hinter Mauern
Der Zoo als politischer Ort
1 Krieg und Krokodilschwanzsuppe
Trümmerfrau mit Doktortitel
Schützengräben im Zoo
Kohlköpfe für »Knautschke«
Mobbing im Zoo
2 Tierparkfieber
Der Gegen-Zoo
Vom Vogelkundler zum Blockwart
Der alte Plan vom zweiten Zoo
Tiere auf der Bühne
Brillenbären von der Stasi
3 Der vierte Mann
Heinroths erzwungener Abschied
Der Elefant in der Schwebebahn
Deutschlands jüngster Zoodirektor
Junger Dachs
Westesel gegen Ostschwein
4 Panda und Prestige
Dathes Aufstieg
Hausherr ohne Heim
Ein eigenwilliger Stellvertreter
Zwischen Schicksal und Flugplan
Klare Verhältnisse
5 Jäger und Sammler
Das größte Tierhaus der Welt
Mit dem Elch in die Transportkiste
Rivale im eigenen Revier
Weißer Wal im grauen Rhein
Zwei Tapire gegen vier Tiger
6 Große Pläne, kleine Fische
Getrennte Gärten
Wilder Osten
Hier entsteht (k)ein Tapirhaus
Ein Traum in Grau
7 Eine Insel mit zwei Bären
Vom Antilopenmenschen zum Aquarianer
Goldene Zeiten im goldenen Käfig
Schmidts Staatsgeschenke
Ost-Steine für West-Berlin
Die Insel versinkt
8 Der Sturz des grauen Riesen
Gierige Geschenke
Auf dem Sprung
Adlers Abflug
Abschied von Dathe
Epilog: Alte Männer, neue Zeiten
Kein Mensch, kein Bär
Klös’ Schwinden
Was wurde aus …?
Danksagung
Bildnachweise
Quellenverzeichnis
Register
Prolog:Über Tiermenschen
Großstädter im allgemeinen und Berliner im besonderen lieben Tiere mehr als ihresgleichen.
Wolfgang Gewalt, im Interview mit der Zeit, 1966
Es gibt diese Anekdote aus den späten Achtzigern, jener Zeit, als sich die Welt auf ein Leben am Abgrund eingerichtet hatte. Als die Berliner Mauer noch mindestens hundert Jahre vor sich zu haben schien und der Zoo im Westen sowie der Tierpark im Osten nicht nur die beliebtesten Freizeiteinrichtungen, sondern auch die Statussymbole zweier Systeme waren: Die Stadt ist seit fast 30 Jahren geteilt, nur die beiden Zoodirektoren sind vereint – in inniger Abneigung gegeneinander. Ob es nun ein Rempler oder nur ein angedeuteter Schubser war und wer von beiden angefangen hat, lässt sich nicht mehr sagen, auf jeden Fall ging es wie so oft darum, wer den größten hat – in diesem Fall Elefanten.
Schauplatz ist der Zoo, wo Direktor Heinz-Georg Klös vor kurzem erst das Gehege seiner Elefanten vergrößert und aus diesem Anlass gleich ein paar neue Tiere gekauft hat, die er nun präsentiert. Klös ist ein leidenschaftlicher Tiersammler und sein Zoo der artenreichste der Welt. Er legt viel Wert darauf, mehr Elefanten als sein Gegenüber im Osten zu haben. Denn in der Zoo-Welt sind Elefanten Prestigeobjekte. Und mehr davon zu besitzen bedeutet für Klös, »eine Schlacht gewonnen« zu haben. Damit ist er nicht allein. Bereits in den sechziger Jahren soll ihm West-Berlins damaliger Bürgermeister Willy Brandt über den Kopf seines Finanzsenators hinweg das nötige Geld für weitere Elefanten besorgt haben, nur um dem Ost-Berliner Tierpark und dessen Direktor die Stirn bieten zu können. Zumindest ist das die Erinnerung von Klös.
Die Höflichkeit gebietet es, dass Heinrich Dathe, der Direktor des Ost-Berliner Tierparks, ebenfalls eingeladen ist. Doch dessen Anwesenheit bringt Klös einen ganz eigennützigen Vorteil – so kann er sichergehen, dass Dathe auch sieht, wie sehr er übertrumpft worden ist. Immerhin kämpft dieser drüben schon seit mehr als zehn Jahren gegen die Mühlen der Mangelwirtschaft für ein neues Elefantenhaus.
Dathe hält nicht allzu viel von Klös – fachlich nicht und menschlich schon gar nicht. Und der um 16 Jahre Ältere lässt den Jüngeren das durchaus spüren, mal unbewusst, mal bewusst – etwa wenn er sich bei einem Treffen in seinem Tierpark einen Spaß daraus macht, zum Essen »Klößchen« aufzutischen.
Nun bemängelt Dathe, dass die neuen Elefanten »doch ein bisschen mickrig« aussähen. Das kann Klös wiederum nicht auf sich sitzen lassen, so ergibt ein Wort das andere, bis schließlich die beiden älteren kleinen Herren – beide kaum größer als 1,70 Meter – anfangen, sich zwischen den grauen Riesen zu schubsen.
Platzhirsche hinter Mauern
Im Rückblick stellt sich die Frage, was die beiden Direktoren mehr entzweit hat – ihre Ähnlichkeiten oder ihre Unterschiede? Beide kamen in den fünfziger Jahren in das geteilte Berlin. Heinrich Dathe 1954 aus Leipzig, um in der Hauptstadt der DDR den modernsten und größten Tierpark der Welt zu erschaffen. Klös folgte drei Jahre später aus Osnabrück, um im Westteil dem ältesten Zoo Deutschlands zu neuem Glanz zu verhelfen. Der Tierpark und der Zoo wurden ihre Lebensaufgaben, und schon bald entwickelte sich eine angestrengte Konkurrenz zwischen den beiden Tiergärtnern. Der langjährige Leiter des Berliner Aquariums und spätere Zoodirektor Jürgen Lange hat das Verhältnis zwischen ihnen einmal so beschrieben: »Wenn der eine einen Zwergesel kauft, dann kauft der andere einen Riesenesel.«
Dathe war eine Art Volkserzieher, ein kleiner untersetzter Mann mit rundlichem Kopf und Hornbrille, dem schon früh die Haare ausgegangen waren. Die Glatze versuchte er zu kaschieren, indem er die Strähnen, die ihm noch geblieben waren, über die kahle Stelle oberhalb seiner Stirn kämmte. Seine sächsische Herkunft verbarg er gar nicht erst, wenn er von »Gagadus« und »Gamelen« sprach. Dathe war nicht nur in der Bevölkerung beliebt, sondern auch international hoch angesehen – wegen seiner Fachkenntnisse und weil er die zentrale Quarantänestation für Tiertransporte aus dem Ostblock ins westliche Europa besaß. Zudem gab er die Fachzeitschrift Der Zoologische Garten heraus. An ihm kam man kaum vorbei.
Auf Dathe gingen daher alle zu – alle wollten etwas von ihm. Auf der anderen Seite der Mauer leitete Klös zwar den reichsten und bedeutendsten Zoo der Bundesrepublik, der für seinen Tierbestand bewundert wurde. Aber der Persönlichkeit Dathes war er nicht gewachsen. Während Dathe scheinbar alles zuflog und leichtfiel, wirkte Klös stets bemüht und doch irgendwie gehemmt.
Klös versuchte dennoch, überall mitzumischen. Wenn er erfuhr, dass irgendeine neue Organisation gegründet werden sollte, begann er sich ins Spiel zu bringen.
Klös’ Nachteil war, dass er »nur« Tierarzt war – und die hatten es in der Welt der Zoodirektoren traditionell etwas schwerer als studierte Zoologen. Denn was heute nicht mehr unüblich ist, galt damals mitunter als ein gewisser Makel – auch in Dathes Augen. All das muss Klös noch mehr angestachelt haben. Andererseits war er ein glänzender Organisator und Manager, der Politikern und Wirtschaftsbossen das Geld förmlich aus der Tasche herausquatschen konnte. »Setz dich bei einem Festessen niemals neben Klös, sonst bist du ein Vermögen los«, hieß es damals in West-Berlin. Manch einer behauptete gar, Klös könne einem im Laufen die Socken ausziehen. So abgezockt war er, wenn es darum ging, Vorteile für seinen Zoo herauszuholen. Klös wollte die wirtschaftliche und politische Bedeutung seiner Einrichtung steigern und den Anschluss zur Bundesrepublik halten; so hatte er sich vorgenommen, dass jeder Bundespräsident mindestens einmal seinen Zoo besuchte. Er kriegte sie alle, selbst den Tiermuffel Gustav Heinemann. »Darauf kam es im Westen an«, sagt Lothar Dittrich, langjähriger Zoodirektor in Hannover und eng mit Heinrich Dathe befreundet. »Im Osten brauchte man das nicht so sehr.«
Für Dathe im Osten hingegen war es wichtig, Freiräume für sich und seinen Tierpark über die DDR hinaus zu schaffen. Da war es viel wert, wenn man mit den Männern im Rathaus und im Politbüro gut konnte – umso besser, wenn sie auch noch Tierfreunde waren wie Friedrich Ebert oder Günter Schabowski. »Dathe hätte nicht im Westen und Klös nicht im Osten funktioniert«, sagt Dittrich. »Sie waren zwei Platzhirsche – jeder für sich am richtigen Platz.« In der Welt des Anderen wären sie kläglich gescheitert.
Die Mauer war der Schutz zwischen ihren Revieren, in denen sie konkurrenzlos herrschten. Die Existenz des jeweils anderen Zoos war dabei die Daseinsberechtigung jedes einzelnen von ihnen. Nur unter den Umständen der deutschen Teilung und der besonderen Situation Berlins konnten sie sich so entwickeln und ihre Direktoren sich so entfalten. Beide Zoos waren Symbole ihrer Stadt und verkörperten das jeweilige System: Der »Zoo« war der Schatz der Insel West-Berlin, ein Arten-Sammelsurium, in dem an jeder Ecke die räumliche Enge der Mauerstadt spürbar wurde. Auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs war der »Tierpark« eine Idee von Großzügigkeit und Weite. Am Reißbrett geplant, aber nicht in einem Guss entstanden und nie vollendet. Die sozialistische Utopie als Provisorium.
Der politische und gesellschaftliche Einfluss, den die beiden Zoodirektoren in ihren Stadthälften besaßen, war wohl nur im geteilten Berlin des Kalten Krieges möglich, hing jedoch grundsätzlich mit der besonderen Beziehung der Berliner zu ihren Zoos zusammen. Denn die Berliner sind nicht tierlieb. Sie sind tierbesessen. In kaum einer Stadt haben es so viele Tiere zu Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gebracht wie hier. Egal, ob »Bobby«, der Gorilla, der Ende der zwanziger Jahre als Erster seiner Art in den Zoo kam, oder das Flusspferd »Knautschke«, das als eines von wenigen Tieren den Zweiten Weltkrieg überlebte. Oder »Knut«, der Eisbär, nach dessen Tod vor dem Haupteingang des Zoos beinah so viele Blumen, Beileidskarten und Plüschtiere lagen wie am Londoner Buckingham Palace nach dem Unfalltod von Prinzessin Diana.
Auge in Auge. Tierparkdirektor Heinrich Dathe (links) und sein West-Berliner Widerpart Heinz-Georg Klös bei einem Treffen in Friedrichsfelde 1984. Im Hintergrund (v.l.) Rudolf Reinhardt, Vogelkurator des Zoos, Falk Dathe, Reptilienkurator des Tierparks, und Hans Frädrich, lange Jahre der zweite Mann im Zoo hinter Klös.
Nach Ansicht der Historikerin Mieke Roscher, die an der Universität Kassel zu Mensch-Tier-Beziehungen forscht, hat »die Isolation Berlins dazu beigetragen, dass eigene kulturelle Merkmale besonders stark hervorgehoben wurden«. Zwar existieren international zahlreiche Zoos, in denen es ähnliche Tierpersönlichkeiten gibt, und meist sind es Innenstadtzoos. Aber im geteilten Berlin war dies besonders ausgeprägt, da hier die »Umgebenheit von Grenze überall spürbar war«, sagt Roscher. »Sowohl West- als auch Ost-Berlin waren in gewisser Weise selbst zwei Zoos.« Tiergärten waren – damals noch mehr als heute – Rückzugsorte, an denen den Besuchern ein Stück heile Welt geboten wurde. Doch innerhalb dieser vermeintlichen Paradiese herrschten starre Hierarchien. Und jene, die sie von innen kannten, sagen, dass es in einem Rathaus, Gericht oder Krankenhaus nicht strenger zugehe.
Der Zoo als politischer Ort
Obwohl Dathe und Klös das Spiel mit den großen Tieren in ihren Systemen jeweils bestens beherrschten, waren beide in gewisser Weise politisch naiv: So glaubte Dathe noch bis zum Ende der DDR, nie von der Stasi beobachtet worden zu sein. Und Klös hatte sich ähnlich unbedarft gezeigt, als er in den siebziger Jahren seinen Vorgänger Lutz Heck, einen alten Nazi und Duzfreund Hermann Görings, als Ehrenmitglied des deutschen Zooverbands vorschlug.
Politik interessierte sie dann, wenn sie für ihre Tiere relevant war. Dathe und Klös waren »Tiermenschen« – eine Beschreibung, die unter Zoo- und auch Zirkusleuten oft gewählt wird, wenn man ausdrücken will, dass jemand besser mit Tieren als mit Menschen umgehen kann.
Für Klös wie für Dathe galt: Zuerst kommt der Zoo, danach alles Andere, auch die eigene Familie. Genau genommen war der Zoo die Familie. Frau und Kinder waren nur ein Anhängsel. Es war eine Zeit, in der Zoodirektor nicht nur ein Beruf war, den man morgens beginnt und abends beendet, sondern eine Lebensaufgabe. Weder Klös noch Dathe kannten so etwas wie Feierabend. Nur Platz für wilde Tiere.
1 Krieg und Krokodilschwanzsuppe
Sie kommen heute nicht mehr. Früh am Abend ist Nebel aufgezogen, dichte Wolken verhüllen den Himmel über Berlin. Niemand rechnet an diesem 22. November 1943 noch mit Fliegeralarm – wie sollten die feindlichen Bomberpiloten bei diesem Wetter auch ihr Ziel finden? Im Zoologischen Garten ist es dunkel und ruhig, die Besucher sind längst gegangen, die Pforten geschlossen. In den vergangenen Monaten haben die Angriffe der britischen Luftwaffe auf Berlin zwar zugenommen, doch bis auf sechs Bombentreffer vor zwei Jahren ist der Zoo bislang glimpflich davongekommen.
Lutz Heck ist dennoch vorbereitet. Mehrfach hat der Direktor seine Belegschaft üben lassen, was zu tun ist, wenn der Zoo von Brandbomben getroffen wird. Auch für den Fall, dass Tiere ausbrechen, hat er vorgesorgt und zwei Elefantenbüchsen angeschafft, Kaliber elf Millimeter. In einigen anderen Zoos sind vorsorglich die Raubtiere erschossen worden, aber das hat Heck hier verhindern können.
Dabei haben ihm auch seine Kontakte in die höchsten politischen Ebenen geholfen. Heck, seit 1933 Förderndes Mitglied der SS und seit 1937 in der NSDAP, ist eng mit Deutschlands oberstem Jäger befreundet, Hermann Göring. Der zweite Mann im Dritten Reich hält auf seinem Landsitz Carinhall in der Schorfheide bei Berlin stets ein zahmes Löwenjunges, das ihm Heck aus dem Zoo mitbringt. Wenn die Raubkatze zu groß und gefährlich für den Privathaushalt geworden ist, lässt Heck sie wieder abholen und besorgt Göring prompt Nachschub.
Unter Zoologen ist Heck nicht unumstritten. Gemeinsam mit seinem Bruder Heinz, dem Direktor des Münchner Tierparks Hellabrunn, hat er das ausgerottete europäische Wildrind, den Ur, rückgezüchtet, indem er verschiedene Hausrinder so lange kreuzte, bis die Jungtiere irgendwann wieder der Wildform ähnlich sahen. Viele Kollegen kritisieren das als unwissenschaftlich und nennen die beiden Brüder daher abschätzig »Urmacher«. Doch Lutz Heck weiß, dass er seine Gegner schnell mundtot machen kann, indem er ihnen zur Not mit dem Reichsjägermeister droht. Denn Göring ist begeistert von den Zuchtprojekten, weil er sich davon neue, außergewöhnliche Jagdtrophäen verspricht. Zum Dank hat er Lutz Heck 1938 mit der Leitung der Abteilung Naturschutz im Reichsforstamt beauftragt und ihm am 20. April desselben Jahres – am Führergeburtstag – den Professorentitel verliehen. Darüber hinaus hat Göring ihm einige Jahre zuvor einen erheblichen Geländegewinn nördlich des Zoos ermöglicht, wo daraufhin der »Deutsche Zoo« entstanden ist: Von Birkhühnern über Biber bis zu Braunbären sind dort nur Tiere aus dem Reich zwischen Maas und Memel zu sehen. Eichen säumen die Gehege, und auf den Tierschildern prangen kleine Hakenkreuze.
Seit 1931 ist Heck Direktor des Berliner Zoos – und das ist nicht irgendein Zoo: 1844 gegründet, ist er der älteste Deutschlands und mit mehr als 4000 Tieren in 1400 Arten der artenreichste der Welt obendrein. Zudem ist er ein Aktienverein, dessen 4000 Anteile in der Berliner Bürgerschaft breit verteilt sind. Statt einer Gewinnauszahlung erhalten die Aktionäre und ihre Familien freien Eintritt. Der Zoo gehört also seinen Besuchern – zumindest denen, die sich eine Aktie leisten können oder eine solche vererbt bekommen haben.
Lutz Heck hat das Amt von seinem Vater übernommen. Geheimrat Ludwig Heck, der den Zoo erst berühmt gemacht hat, gab schon früher damit an, dass er bereits Nationalsozialist gewesen sei, bevor es diese Bezeichnung überhaupt gegeben habe. Sein Sohn führt den Zoo ganz im Sinne der nationalsozialistischen Vorgaben. Dies trifft zuerst die jüdischen Aktionäre; ab Juli 1938 haben sie ihre Anteile meist deutlich unter Wert an den Zoo verkaufen müssen, der sie wiederum teurer weiterverkauft hat. Seit Ende des Jahres 1938 dürfen sie den Zoo nicht mehr besuchen.
Heck hat zudem versucht, alle deutschen Zoos in seine Gewalt zu bringen. Das ist den Nazis jedoch zu viel der Ämterhäufung, sodass er damit nicht durchkommt. Die Nähe der Familie Heck zu den Nazis bringt allerdings auch den anderen deutschen Zoos Vorteile. Gerade in Kriegszeiten gibt es häufig Probleme mit der Futterversorgung, was Lutz Heck meist schnell auf dem kurzen Dienstweg beheben kann – anders noch als im Ersten Weltkrieg, als zahlreiche Zootiere verhungert sind. Vom Krieg profitiert zunächst aber vor allem sein eigener Zoo, indem Heck dort Zwangsarbeiter einsetzt und infolge des Russlandfeldzugs Tiere aus osteuropäischen Zoos übernimmt.
Doch um Expansion geht es im November 1943 nicht mehr. Der Krieg ist längst heimgekehrt. »Werden wir davonkommen?« – Diese Frage glaubt Heck aus den Blicken seiner Tierpfleger herauslesen zu können, wenn sie ihre Tiere ansehen. Vorsorglich hat er einen Teil des Bestandes – rund 750 Tiere in 250 Arten – in andere Zoos evakuieren lassen: Nach Frankfurt am Main ging ein Beutelteufel, eine Giraffe nach Wien, Knochenhechte aus dem Aquarium kamen nach Leipzig, Wildesel und Löwen nach Breslau. Als weitere Schutzmaßnahmen hat Heck auf dem Gelände des Zoos Stahlkästen mit Sehschlitzen in den Boden bauen und mit Erde abdecken lassen; wie übergroße Maulwurfshügel sehen sie aus. In diesen Unterständen sollen die Wärter bei Luftangriffen ausharren, bis die Gefahr vorübergezogen ist. Zudem entstand am Eingang Budapester Straße ein unterirdischer Luftschutzbunker.
Ein mulmiges Gefühl bereitet ihm »Gustav«. Wie eine mittelalterliche Trutzburg thront der Koloss aus Stahlbeton an der Nordwest-Grenze des Zoos. Der Flakbunker, wegen seiner Lage auch Zoo-Bunker genannt, ist eigentlich dazu gedacht, den Soldaten und der Zivilbevölkerung aus der Umgebung bei Luftangriffen Zuflucht zu bieten. Doch Heck fürchtet, dass er ein allzu leichtes Ziel für die britischen und amerikanischen Bomber sein und dadurch dem Zoo zum Verhängnis werden könnte. »Werden wir davonkommen?« – Das fragt sich Heck mittlerweile auch selbst.
Aber zumindest dieser Montag mitten im Krieg, so scheint es, wird ohne große Vorkommnisse zu Ende gehen. In einer Betriebswohnung am Rande des Zoos feiern einige Wärter den Geburtstag eines Kollegen mit ein paar Mollen Bier. Außerhalb der Zoomauern versuchen sich die Menschen auch an diesem Abend vom Kriegsalltag abzulenken. Viele strömen in die Volksoper an der Kantstraße; den Hinweis auf dem Programmplan zum Verhalten bei Fliegeralarm beachten sie nicht weiter. Andere gehen in eines der nahegelegenen Kinos, um dort »Münchhausen« zu schauen – einen dieser neuen Farbfilme, in dem Hans Albers auf einer Kanonenkugel durch die Luft fliegt – oder »Großstadtmelodie«. Später einmal wird es über diesen Film heißen, er sei der letzte, der das unzerstörte Berlin in seiner ganzen Pracht zeige. Aber das weiß an diesem nebligen Novemberabend 1943 um kurz nach sieben noch niemand.
In Trümmern. Die Bomben auf Berlin haben vom Aquarium kaum etwas übrig gelassen. Nur die Reste des Saurierreliefs an der Außenwand sind noch zu erahnen. Mithilfe einer Schuttrutsche wird das Gröbste aus der Ruine entfernt. Es soll noch fast ein Jahrzehnt dauern, bis das Gebäude wieder eröffnet wird.
Um fünf vor halb acht schrillt im Pförtnerhaus des Zoos das Telefon – ein Anruf aus der Luftwarnzentrale: »Starke Kampfverbände im Anflug von Hannover, Kurs Ost. Mehrere Wellen folgen.« Der Pförtner gibt die Nachricht sofort weiter. Wenige Minuten später sind alle Reviere im Zoo informiert. Die Wärter schicken ihre Frauen und Kinder in den benachbarten Zoo-Bunker, in dem auf fünf Etagen rund 20.000 Menschen Platz finden, und beziehen dann ihre Maulwurfshügel. »Wird nicht viel heute Nacht«, rufen sie sich noch zu, »bei dem nebligen Wetter – unmöglich!«
Eine halbe Stunde später haben die ersten Flugzeuge die Stadt erreicht. Weitere 20 Minuten später ist die erste Welle vorbei, 753 britische Bomber haben ihre Last von 2500 Tonnen Sprengstoff über Berlin abgeworfen. 21 Großbrände wüten in dieser Nacht im Zoo. Das Dach der Elefantenpagode ist eingestürzt und hat ein Breitmaulnashorn und sieben Elefanten erschlagen. Einer liegt unter einem Dachträger begraben. Wie zusammengerollte Matratzen hängen die Gedärme aus seinem Bauch heraus. Nur »Siam«, der Elefantenbulle, hat überlebt. Von den 2000 im Zoo verbliebenen Tieren sind 700 tot.
Mit rußgeschwärzten Gesichtern machen sich die übernächtigten Wärter samt einer Gruppe Kriegsgefangener tags darauf ans Aufräumen – sie löschen Brände und räumen die Trümmer weg, unter denen sie immer wieder verendete Tiere finden. Die nächste Nacht bringt erneut Angriffswellen, die Charlottenburg und das nahegelegene Hansaviertel innerhalb von zwei Stunden verwüsten.
Trümmerfrau mit Doktortitel
Nachdem die Angriffe vorüber sind, eilen die Pfleger und Angestellten des Zoos aus ihren Unterschlupfen und versuchen, die Brände zu löschen. Die Bomben haben zahlreiche Wasserleitungen zerstört, sodass an manchen Stellen das Löschwasser in Wannen und Eimern herbeigeschafft werden muss. Alle packen mit an. Auch Katharina Heinroth, die vor einem roten Ziegelbau, dem Flusspferdhaus, steht und versucht, mit einem mehr oder weniger intakten Schlauch das brennende Dach zu löschen. Neben ihr im Außengehege kreisen die Flusspferde nervös und mit weit aufgerissenen Augen durchs Becken. Darunter ist auch »Knautschke«, das sechs Monate alte Jungtier, das seiner Mutter nicht von der Seite weicht, während Heinroth weiterhin den Wasserstrahl Richtung Dach richtet. Wie lange sie braucht, bis der Brand gelöscht ist, weiß Katharina Heinroth nicht, irgendwann am frühen Morgen hat sie es endlich geschafft. Von den verkohlten Dachbalken tropft das Löschwasser auf die Flusspferde, die sich wieder einigermaßen beruhigt haben.
Katharina Heinroth, geboren 1897 in Breslau als Katharina Berger, ist die zweite Ehefrau des Aquariendirektors Oskar Heinroth. Beide sind bereits einmal geschieden, als sie 1932 bei ihm als Sekretärin anfängt und ihm beim Abtippen des Manuskripts zu seinem Buch Die Vögel Mitteleuropas behilflich ist. Auch wenn Oskar Heinroth das Aquarium mit aufgebaut und zu Weltruhm geführt hat, so ist er in erster Linie einer der angesehensten Ornithologen seiner Zeit. Über die Arbeit kommen sie sich bald näher, 1933 heiraten sie. Auf der Dachterrasse ihrer Wohnung über dem Aquarium halten sie Brieftauben und untersuchen zusammen deren Orientierungssinn. Katharina Heinroth hat zu dieser Zeit selbst bereits eine beachtliche Laufbahn vorzuweisen: Obwohl die Berufsaussichten schlecht waren, hatte sie 1919 angefangen, in Breslau Zoologie, Botanik, Paläontologie, Geologie und Geografie zu studieren. Auch privat lebte sie nicht gerade so, wie man es von einer jungen Frau erwartete. Vier Heiratsanträge, beinahe so viele wie Studienfächer, sammelte sie in dieser Zeit, ihr Doktorvater sorgte sich des Öfteren, dass sie bei ihrem »großen Männerverbrauch«, wie er es nannte, nicht mehr genügend Zeit fürs Studium fand. Doch nach vier Jahren schließlich erhielt sie – als erste Frau an der Breslauer Universität – die Doktorwürde in Zoologie mit der Auszeichnung »summa cum laude«. Danach forschte sie nachts auf eigene Faust an Bienen und Springschwänzen – wenige Millimeter großen Gliedertieren, die sich von verrottenden Pflanzenteilen ernähren – und verdiente tagsüber ihr Geld als Sekretärin, Bibliothekarin oder Assistentin. Mehr wurde einer Frau in dieser Zeit nicht zugetraut.
In der Berliner Bevölkerung machen bald Gerüchte die Runde, dass einige Tiere aus dem Zoo entflohen seien; Elefanten irrten über den Ku’damm, Löwen streunten um die Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, erzählt man sich. Ein Tiger soll es sogar bis zum Potsdamer Platz geschafft haben, wo er im zerbombten Café Josty ein Stück Bienenstich gefressen habe, an dem er dann verendet sei. Doch die Tiere, die das Inferno im Zoo überlebt haben, sind zu verängstigt, um zu fliehen, und kauern in den Ruinen. Auch die Geier und Adler fliegen nicht davon, sondern bleiben sitzen auf den Ästen ihrer zerschossenen Käfige, die keine mehr sind. Ein Tapir – ein tropischer Verwandter des Nashorns, der aber eher einem Schwein ähnelt – hat sich ganz nah ans Gehegegitter gedrückt, um sich an einem davorliegenden und noch schwelenden Kokshaufen zu wärmen. Am nächsten Morgen liegt am Eingang des Aquariums an der Budapester Straße ein Krokodil. Die Druckwellen der Explosionen haben es aus der Tropenhalle geschleudert. Sofern es danach überhaupt noch lebte, hat es der nächtliche Frost hinweggerafft. Da das Fleisch durch die Kälte noch frisch ist, gibt es in den folgenden Tagen Krokodilschwanzsuppe für die ausgehungerte Zoobelegschaft, die eine zusätzliche Fleischration in diesen Zeiten dankend annimmt.
Die Luftangriffe nehmen unterdessen weiter zu. Tagsüber bombardieren die US-Amerikaner Berlin, nachts die Briten. Zudem rückt die Rote Armee von Osten immer näher an die Reichshauptstadt heran.
Es geht bereits auf Ostern 1945 zu, als sich Oskar Heinroth langsam von einer Lungenentzündung erholt. Die langen Aufenthalte im kalten Luftschutzkeller haben dem 74 Jahre alten Aquariendirektor arg zugesetzt. Um wieder auf die Beine zu kommen, bekommt er Spritzen. Eine Krankenschwester trifft dabei aus Versehen einen Nerv, sodass sein rechtes Bein gelähmt wird. Katharina Heinroth, die ihren Mann bislang vor allem in seinen Forschungen unterstützt hat, versucht, ihn wieder gesund zu pflegen. Als sich bei ihm ein Hungerödem bildet, bittet sie Heck um eine tägliche Ration Ziegenmilch. Doch Nahrungsmittel sind knapp und Heinroths Taubenforschungen sind dem Zoodirektor nie recht gewesen. Ganz zu schweigen von dessen Kontakten zu jüdischen und regimekritischen Wissenschaftlern.
»Herr Heinroth hätte sich besser mal um seine eigentliche Aufgabe kümmern sollen, ums Aquarium«, sagt er in scharfem Ton. »Aber in Zukunft werde ich dafür sorgen, dass jedem sein Forschungsplan vorgeschrieben wird.«
So eine Ungeheuerlichkeit kann und will Heinroth sich nicht bieten lassen. Zurückhaltung ist ohnehin nie ihr Ding gewesen, und nun erst recht nicht, da ihr Mann mit dem Tod kämpft: »Dann können Sie alle künftigen Erfindungen in den Rauch schreiben«, entgegnet sie Heck. »Im Beamtentum ist noch nie etwas Geniales entstanden!«
Eine ganze Weile geht der Streit hin und her, bis Heck schließlich nachgibt und ihr die Sonderration für ihren Mann gewährt. »So lange habe ich mich noch mit niemandem auseinandergesetzt«, sagt er sichtlich beeindruckt. Widerspruch ist er nicht gewohnt, schon gar nicht von einer Frau.
Schützengräben im Zoo
Diese Zukunft, von der Lutz Heck gesprochen hat, das wird allmählich klar, wird es nicht geben. Einige Unbelehrbare, die noch an den Endsieg glauben, versuchen, die vorrückende Rote Armee vom Zoo-Bunker aus mit Flakgeschützen in Schach zu halten – der riesige Turm des Hochbunkers ist ein dankbares Ziel. Zahlreiche Geschosse, die auf ihn abgefeuert werden, explodieren im angrenzenden Zoo. Einige sowjetische Panzer haben sich bereits bis zu dessen Mauern durchgekämpft. Lutz Heck hat seine Frau und seine Söhne evakuieren lassen und in Richtung Westen geschickt. Auch Katharina Heinroth überlegt, sich und ihren Mann in Sicherheit zu bringen. Doch Oskar ist zu schwach, er kann nicht mehr laufen. Und selbst wenn er fliehen könnte, würde es ihm nicht in den Sinn kommen, den Zoo und vor allem sein Aquarium zu verlassen. Mehr als 30 Jahre lang hat er es geleitet, nun liegt es wie ausgehöhlt da. »Lass uns doch hierbleiben«, bittet er sie leise, »lieber möchte ich mit allem untergehen.«
In den letzten Apriltagen verläuft die Ostfront mitten durch den Zoo. Die verbliebenen Tierpfleger sind zum Volkssturm verdonnert worden und müssen auf dem Zoogelände Schützengräben ausheben. In den Gefechtspausen versorgen sie die wenigen Tiere, die noch am Leben sind.
Am späten Abend des 30. April 1945 deutet alles darauf hin, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Rote Armee den Zoo stürmen wird. Bevor es Gewissheit wird, setzt sich Lutz Heck ab. Er ahnt, was ihn erwartet; die Russen suchen ihn, weil er Tiere aus osteuropäischen Zoos beschlagnahmt haben soll. Zudem soll er eine Herde Wildpferde aus der Ukraine verschleppt haben.
Da es kaum noch intakte Fahrzeuge gibt, flieht Heck auf einem Fahrrad. Es gelingt ihm tatsächlich, aus dem belagerten Berlin herauszukommen und sich unbemerkt bis nach Leipzig durchzuschlagen. Sein Ziel ist der dortige Zoo und das Haus des Direktors Karl Max Schneider.
Schneider ist ziemlich verwundert, als er seine Tür öffnet und sieht, wer da vor seinem Haus steht. Ohne sich lange zu erklären, sagt Heck zu ihm: »Ich fordere Sie als Kollegen auf, mich eine Nacht bei sich aufzunehmen.«
Schneider, ein Mann von 58 Jahren, hat als Leutnant im Ersten Weltkrieg gedient und dabei seinen linken Unterschenkel verloren. Ein alter Sozialdemokrat, der erst 1938 auf Druck von oben in die NSDAP eingetreten ist. Mit skeptischem Blick mustert er den fünf Jahre jüngeren Heck von oben bis unten, greift dann langsam in seine Hosentasche und zieht einen Schlüsselbund heraus: »Hier ist der Schlüssel zu meiner Wohnung, aber ich werde die Nacht nicht mit Ihnen unter einem Dach verbringen. Wenn ich morgen um sechs Uhr wiederkomme, sind Sie weg.« Schneider geht fort, um bei Bekannten zu übernachten. Als er am nächsten Tag zurückkehrt, ist Heck verschwunden. Er wird es für längere Zeit bleiben.
Rings um den Berliner Zoo sind die Häuser zerbombt, Rauch liegt über der Stadt. Als das dumpfe Geräusch der Explosionen verstummt und der Qualm verzogen ist, sind auf dem Zoogelände nur noch Trümmer übrig. Wie stumme Wächter thronen zwei steinerne Elefanten am Eingang Budapester Straße. Das Portal ist zerstört, nur ein schmaler brüchiger First balanciert zwischen den beiden zerschossenen Säulen. Das Antilopenhaus, einst im maurischen Stil erbaut, ist nur mehr ein Schutthaufen, aus dem zwei Minarette und ein Schornstein herausragen. Die Maulwurfshügel sind schon lange verwaist. Ein junges Pferd sucht zwischen aufgeschütteten Ziegeln nach einem Hauch von Grün. Ein ausgemergelter Wolf blickt von seiner Freianlage hungrig herüber, zu schwach, um dem Pferd nachzujagen.
Nachdem sich Direktor Lutz Heck kurz vor dem drohenden Untergang abgesetzt hat, kümmert sich Katharina Heinroth im Luftschutzbunker des Zoos sowohl um ihren Mann, der mittlerweile im Sterben liegt, als auch um die übrigen verletzten Anwohner und Zooangestellten. Sie hat ein weißes Tuch mit einem roten Kreuz darauf an die Bunkertür gehängt und hofft, dass sie dadurch vor Kampfhandlungen verschont bleiben. Noch vom Krankenbett aus gibt Oskar ihr Anweisungen, wie sie Schusswunden behandeln und Verbände anlegen muss. Wenige Stunden später dringen die ersten Rotarmisten in den Zoo ein. Oskar Heinroth ist mit seinen Kräften am Ende und bittet seine Frau um einen letzten Gefallen. »Die Giftkapseln«, flüstert er, »hol sie mir bitte, ich will nicht mehr.« Doch die Kapseln befinden sich in einer Schublade in Oskars Arbeitszimmer in der zerstörten Wohnung. Wie soll sie da nun hingelangen? Überall wimmelt es von Soldaten, und außerdem will sie ihren Mann auf keinen Fall hier allein zurücklassen. Also versucht sie, ihn zu beruhigen: »Wir werden das schon irgendwie durchstehen«, sagt sie sanft zu ihm. Er seufzt nur enttäuscht.
Am nächsten Morgen treiben die Soldaten die Menschen aus dem Luftschutzkeller. Katharina Heinroth schleppt ihren schwerkranken Mann in einen ruhigen und trockenen Winkel im Untergeschoss des Aquariums. Doch auch hier bleiben sie nicht lange unbehelligt. Täglich ziehen wechselnde Trupps von Soldaten durch das zerstörte Gemäuer, auf der Suche nach Essbarem, Alkohol oder auch nur einer Gelegenheit, um den Deutschen zu zeigen, wer jetzt das Sagen hat. Männer, die nicht gehorchen, sich anbiedern oder versuchen, ihre Frauen zu beschützen, werden erschossen – die Frauen anschließend vergewaltigt. Mehrmals wechselt Heinroth mit ihrem Mann von einer Etage der Ruine in eine andere. Immer wieder werden sie aufgespürt. »Raboti, raboti!«, rufen die Soldaten, als sie Katharina Heinroth sehen; sie bekommt sofort zu spüren, dass es ihnen nicht ums Arbeiten geht. Die Männer halten sie fest und vergewaltigen sie.
Nach dem zweiten Mal schafft sie es endlich, ihren Mann aus dem Aquarium zu bringen. Da sie ihn kaum allein stützen kann, legt sie ihn in eine Schubkarre und macht sich auf die Suche nach einem Unterschlupf. Die meisten Keller in der Umgebung sind jedoch überfüllt, alle paar Tage müssen sie weiterziehen.
Erst nachdem die sowjetischen Truppen den Zoo verlassen haben, kehrt Katharina Heinroth dorthin zurück und richtet in ihrer alten Wohnung ein Zimmer notdürftig her. Dann holt sie ihren Mann mithilfe zweier Tierpfleger aus dem bisherigen Versteck zurück nach Hause.
Am 31. Mai 1945 stirbt Oskar Heinroth. Katharina Heinroth ist nun völlig auf sich allein gestellt. Aus zerbombten Türen lässt sie vom Zootischler einen Sarg zimmern und ihren Mann im Krematorium einäschern. Erst Wochen später, am 15. August, kann sie ihn auf dem Zoogelände beisetzen.
Irgendwie muss es dennoch weitergehen, und so erinnert sich Katharina Heinroth wieder an den Leitspruch ihres Breslauer Doktorvaters: »Tu was, dann wird dir besser.« Daran hat sie sich immer gehalten, und es hat ihr geholfen, über Schicksalsschläge und düstere Phasen in ihrem Leben hinwegzukommen. Mit der restlichen Belegschaft des Zoos macht sie sich daran, das Chaos zu beseitigen. Bei den Aufräumarbeiten finden sie 82 Leichen in den Trümmern und Gräben. Sie werden, wie die verendeten Tiere zuvor, in Massengräbern beerdigt.
Nur 91 Tiere haben den Krieg überlebt. Darunter sind ein Rentier, ein seltener Japanischer Schwarzschnabelstorch, ein Schuhschnabel – ein grau gefiederter, kranichgroßer Vogel aus den Nilsümpfen, dessen Schnabelform an einen Holzschuh erinnert – sowie der Elefantenbulle »Siam« und das junge Flusspferd »Knautschke«. In den letzten Kriegstagen haben Bomben das Außenbecken des Flusspferdhauses zerstört und seine Mutter dabei so schwer verletzt, dass sie verendet ist. Die Tierpfleger übergießen »Knautschke« mehrmals am Tag mit Wasser, damit seine Haut nicht austrocknet. Einige andere Tiere verschwinden bald darauf – mitgenommen und geschlachtet von hungrigen Berlinern. Die übrigen Tiere bekommen provisorische Gehege; der Schuhschnabel wird in einem der wenigen unbeschädigten Badezimmer des Zoos untergebracht. Mit der Giraffe »Rieke« aus Wien kehrt nur eines der während des Krieges evakuierten Tiere später nach Berlin zurück.
Nach Hecks Verschwinden ist der Zoo nun führungslos. Zuerst versucht der ehemalige Geschäftsdirektor Hans Ammon, die Leitung zu übernehmen, wird aber von einem früheren Chauffeur des Zoos als Parteimitglied enttarnt und vom Hof gejagt. Dieser Chauffeur wiederum hat sich von der sowjetischen Kommandantur als Leiter der Aufräumarbeiten einsetzen lassen und organisiert erst einmal 200 Trümmerfrauen. So kann der provisorisch hergerichtete Zoo bereits am 1. Juli 1945 wieder eröffnet werden. Einige Wochen später taucht jedoch ein weiterer Mann auf, ein ehemaliger Aushilfskellner des Zoorestaurants, der behauptet, mit der Führung des Zoos beauftragt worden zu sein. Da weder Telefon noch Post funktionieren, wissen die Besatzer nichts davon. Wochenlang schallen die Streitereien der beiden »Direktoren« durch den Zoo, die sich wie Gutsherren benehmen. Katharina Heinroth schicken sie zu den anderen Trümmerfrauen, allenfalls darf sie ein paar Gehegeschilder anfertigen.
Als die sowjetische Besatzungsmacht vom Führungschaos erfährt, beauftragt sie den neu gegründeten Großberliner Magistrat damit, endlich für klare Verhältnisse zu sorgen. Bald darauf erhält Katharina Heinroth vom Magistrat eine schriftliche Einladung, dass sie am 3. August ins Alte Stadthaus in der Parochialstraße kommen möge. Worum es geht, erfährt Heinroth aus dem Schreiben nicht.
Auch Werner Schröder hat Post vom Magistrat erhalten und sich am Morgen des 3. August auf den Weg gemacht, die acht Kilometer weite Strecke von seiner Wohnung in Berlin-Wilmersdorf nach Mitte zurückzulegen. Er soll sich in der Abteilung Volksbildung melden. Auch er wird über den Zweck der Einladung im Unklaren gelassen.
Werner Schröder hat bereits während seines Zoologie-Studiums mit Oskar Heinroth zu tun gehabt. Katharina Heinroth kennt er bisher jedoch noch nicht. An diesem Tag begegnen sie sich zum ersten Mal. Josef Naas, Leiter der Kulturabteilung beim Magistrat, teilt ihnen mit, dass Heinroth kommissarische Leiterin des Zoos und Werner Schröder Geschäftsführer und ihr Stellvertreter werden soll.
Dass sie diese Chance nur den besonderen Umständen dieser Zeit verdankt, ist Heinroth bewusst. Es gibt nicht genügend politisch unbelastete Männer für diesen Posten. Später einmal, wenn in ihrem Freundeskreis über ihre Ernennung zur Direktorin gesprochen wird, scherzt sie: »Die dachten bestimmt, ich sei Oskar, als sie mich ins Rathaus bestellt haben.«
Gemeinsam machen sich Katharina Heinroth und Werner Schröder an den Wiederaufbau des Zoologischen Gartens. Weil die Begrenzungsmauern immer noch zerstört sind, verläuft der Straßenverkehr anfangs mitten durch das Gelände. Nachts ziehen Banden plündernd hindurch. Mit Trillerpfeifen versuchen die Pfleger, sie zu vertreiben. Ein Silberfuchs, ein Wildschwein sowie ein Reh fallen ihnen dennoch zum Opfer.
Im ersten Jahr nach der Wiedereröffnung ist vom Aufbau kaum etwas zu sehen, zunächst einmal müssen das Kanalnetz und die Stromversorgung wieder in Betrieb genommen werden, zudem mangelt es an Futter. Auf den Brachflächen werden Gemüsebeete angelegt und Tabak angepflanzt, denn Zigaretten sind ein unverzichtbares Tauschmittel. Heinroth lässt außerdem erste Wegweiser anbringen, damit die Besucher im Wirrwarr der zerbombten Käfige und Gehege auch diejenigen finden, in denen überhaupt noch Tiere leben. Eines Tages erwischt sie einen Dieb, der versucht, Holzteile eines zerstörten Stalls mitgehen zu lassen. Als sie ihn zur Rede stellt, blafft der sie nur an: »Das ist mein gutes Recht als Zoo-Aktionär!«
Ende September 1945 wird sie offiziell zur Direktorin ernannt. Gut einen Monat später erkennt die Alliierte Kommandantur offiziell den kulturellen Wert des Zoos an. Damit ist er gerettet. Zumindest vorerst. Im Januar 1946 schreibt die Nachrichtenagentur Associated Press über den Zoo: »Nur noch etwa 200 Tiere sind es, die nun in den tristen Ruinen dieser einst so bunten und beliebten Einrichtung leben.«
Dabei ist es schon ein Fortschritt zum Vorjahr. Viele Berliner haben ihre Haustiere, vor allem Papageien, hierher gebracht, weil sie glauben, dass sie hier besser versorgt werden können. Geld, um neue Tiere anzuschaffen, ist keins da. Um wenigstens ein paar zu erwerben, werfen alle Mitarbeiter ihre Monatsgehälter zusammen. Von dem Geld kauft Heinroth Pinguine. Nebenbei bietet sie zudem eine Sprechstunde an, in der besorgte Tierhalter sie fragen können, wieso ihr Papagei sich die Federn ausrupft oder warum ihr Hund nicht auf sie hört.
Kohlköpfe für »Knautschke«
Ende August 1947 wird der Zoo erneut von Explosionen erschüttert. Britische Pioniere haben versucht, den nahegelegenen Zoo-Bunker zu sprengen. 20 Tonnen Sprengstoff wurden ins Gebäude gebracht. Zuvor mussten die mittlerweile 649 Tiere einzeln in Holzkisten gelockt und aus dem Zoo gebracht werden. Doch der Bunkerbau ist zu massiv, die Sprengung misslingt und muss im Jahr darauf wiederholt werden.
Vor ganz neue Probleme stellt die fast einjährige Blockade West-Berlins den Zoo: Die Westmächte haben im Juni 1948 die Währungsreform in ihren Sektoren umgesetzt, ohne die Sowjets einzubeziehen. Seit Jahren streiten sich die Besatzer über eine einheitliche deutsche Währung, und nun künden die Westmächte an, auch in den drei Westsektoren Berlins die neue D-Mark einzuführen. Die Sowjets reagieren prompt. In der Nacht auf den 24. Juni 1948 gehen im Westteil der Stadt die Lichter aus, die Stromzufuhr ist abgedreht, alle Straßen und Schifffahrtswege sind von der Roten Armee abgeriegelt. Die Insel Berlin, die von der Versorgung von außen abhängig ist, ist bis auf den Luftraum von der Außenwelt abgeschnitten. Über die Luftbrücke versorgen die Alliierten die zwei Millionen Einwohner mit Lebensmitteln.
Auch für den Zoo ändert sich einiges. Der neue britische Kommandant des Bezirks Tiergarten befiehlt Katharina Heinroth, was nun zu tun ist: alle Bäume fällen, auf den Freiflächen Spinat anpflanzen, alle Tiere abschaffen und stattdessen Hühnerkäfige errichten.
Heinroth ist geschockt, vor ihrem inneren Auge sieht sie schon die großen, bis zu 400 Jahre alten Eichen fallen. Aber vor allem würde das bedeuten, dass der Zoo schließen müsste. Und sie weiß, dass es beinah aussichtslos ist, einen einmal geschlossenen Zoo wieder zu eröffnen. Das Beispiel aus Düsseldorf ist ihr noch allzu präsent, wo der 1876 gegründete Zoologische Garten während des Zweiten Weltkrieges zunächst vorübergehend geschlossen wurde, seine Pforten aber nie wieder öffnete. Das will sie ihrem Zoo, Oskars Zoo, ersparen.
Heinroth versucht, Zeit zu schinden, und widersetzt sich dem Befehl. Stattdessen beschwert sie sich beim Hauptquartier der britischen Streitkräfte sowie beim Berliner Grünplanungsamt. Damit hat der Kommandant nicht gerechnet. Er lenkt ein und besucht Heinroth erneut im Zoo. Mit dabei hat er diesmal eine Karte, auf der der Baumbestand des Gartens eingezeichnet ist. Er bittet sie, diejenigen Bäume zu markieren, die unbedingt erhalten bleiben sollen. Ein großer Teil der Bäume ist im Krieg beschädigt worden, viele Baumkronen sind abgeschossen. Doch Katharina Heinroth markiert alle Bäume. Ohne Ausnahme. Nun versucht er, sie einzuschüchtern, und droht ihr mit dem Gesetz. Doch Heinroth bleibt hart. Sie hat sich schon mit ganz anderen Typen angelegt. Einige Zeit danach bekommt sie Besuch von einem Offizier aus dem Hauptquartier: »Vergessen Sie das mit den Bäumen«, sagt er nur. Kein einziger muss schließlich gefällt werden.
Frau der ersten Stunde. Zoodirektorin Katharina Heinroth, hier bei der Grundsteinlegung des neuen Flusspferdhauses im Mai 1956.
Auch für »Knautschke« geht es voran. Während der Blockade haben die Berliner ihren tierischen Star mit Kohlköpfen durchgefüttert, die sie sich vom Munde abgespart haben. Nun soll er Damenbesuch bekommen. Aus dem Osten. Denn nach dem Krieg sind Flusspferde selten in den europäischen Zoos. Katharina Heinroth besitzt »Knautschke«, und Leipzigs Zoodirektor Karl Max Schneider die Kühe »Grete« und »Olga«. Schneider und Heinroth tauschen schon seit längerem Tiere miteinander. Dass ihre beiden Zoos seit 1949 in zwei verschiedenen und verfeindeten Ländern liegen, hält sie nicht davon ab. Von politischen Grenzen lassen sie sich nicht aufhalten – schließlich geht es um viel mehr, die Arterhaltung! –, und so schicken sie die Tiere nun auf Hochzeitsreise. Das geschieht nach uralter Bauerntradition, die besagt: Die Kuh geht zum Bullen, das erste männliche Jungtier bekommt der Besitzer der Kuh.
Mehrfach reisen die Weibchen »Grete« und »Olga« per Güterzug nach West-Berlin, wo sie vorübergehend ins notdürftig wiederhergerichtete Flusspferdhaus einziehen. Das Haus ist nur ein Provisorium, notdürftig gedeckt. »Pinkelbude« nennen es die britischen Soldaten. Aber den Tieren reicht es.
Unterdessen versucht Schröder, die noch immer schlechte finanzielle Lage in den Griff zu bekommen. Der Zoo nimmt kaum genug Geld ein, um die Pfleger zu bezahlen und die Futterkosten zu decken. Irgendwie muss er Besucher in den Zoo locken. Er muss sich etwas einfallen lassen. Da erinnert er sich an seinen Lieblingssport. Schröder ist ein großer Boxfan, als Student war er sogar zweimal Deutscher Meister, und so organisiert er Box- und Ringkämpfe in einer kleinen Arena auf dem Gelände des Zoos. Außerdem lässt er Tiermessen veranstalten und schafft es, die Zirkus-Unternehmen »Astra« und »Busch-Aeros« für Vorstellungen auf einer Freifläche nahe des Antilopenhauses anzuwerben. Als weitere Einnahmequelle hat er sich überlegt, ein Oktoberfest zu veranstalten. Katharina Heinroth ist davon allerdings nicht begeistert:
»Was ist denn mit den ganzen Tieren? Diesen Lärm, diesen Rummel werden sie bestimmt nicht verkraften.«
Auch Schröder ist sich deswegen nicht sicher, aber er kennt die Zahlen des Zoos, und die sind erschreckend.
»Uns steht das Wasser bis zum Hals«, sagt er mit ernster Miene, und seine dunklen Augenränder tun ihr Übriges dazu. »Wir müssen es versuchen.«
Anfangs sind die Berliner wohl ein wenig verwirrt, als sie die neuen Werbeplakate des Zoos sehen. Darauf sind zwei Nilpferde gemalt, die sich breit grinsend mit zwei Bierkrügen zuprosten. Um den Hals tragen sie jeweils ein Lebkuchenherz. »Gretchen« steht auf dem einen, »Knautschke« auf dem anderen. Über beiden prangt in Schreibschrift: »Oktoberfest im Zoo«. Zwischen Rentieren, Papageien und Bären sollen bald also Schießbuden und Karussells stehen? Doch allzu lange dürften sie sich nicht gewundert haben, denn das Fest wird ein voller Erfolg. Mehr als eine halbe Million Besucher kommen in den vier Wochen und sichern dem Zoo erhebliche Zusatzeinnahmen und somit das Überleben. Anders als Heinroth es befürchtet hat, nehmen die Tiere von alledem kaum Notiz.
Familienangelegenheiten. Die Nilpferde »Knautschke« (rechts) und »Bulette« werden später Eltern einer blühenden Zuchtfamilie. Da stört es die Berliner Zoobesucher auch nicht, dass sie Vater und Tochter sind.
Auch die beiden Werbe-Ikonen haben sich davon nicht beeindrucken lassen. Im Mai 1950 kommt ein männliches Flusspferd zur Welt – »Schwabbel« –, das wie vereinbart nach Leipzig zieht. Im April 1952 wird mit »Bulette« eine neue Partnerin für »Knautschke« geboren. Dass es eine inzestuöse Verbindung ist, ist erst einmal egal. Flusspferde sind Publikumsmagneten und zu dieser Zeit rar, da darf man nicht allzu wählerisch sein.
In dieser Zeit erhält der Zoo auch eine weitere Attraktion; vier Jahre lang gab es hier keine Elefanten. 1947 war der alte Bulle »Siam«, der einzige Elefant, der die Bombenangriffe im Krieg überlebt hatte, gestorben. Aber ein Zoo ohne Elefanten, da ist Heinroth überzeugt, kann kein richtiger Zoo sein. Genug Geld, um einen neuen zu kaufen, hat sie aber auch nicht. Irgendwann liest sie in der Zeitung, dass Indiens Staatschef Pandit Nehru einem ausländischen Zoo einen jungen Elefanten geschenkt haben soll. Sofort nimmt sie Kontakt zum Schulradio des Rundfunks im Amerikanischen Sektor (RIAS) auf. Sie hofft, dass ihr Anliegen größere Erfolgschancen hat, wenn die Berliner Kinder einen Brief an Nehru schreiben, als wenn sie darum betteln würde. Heinroths Plan geht tatsächlich auf, und schon bald ist eine junge Elefantenkuh gefunden – »Dathri«, drei Jahre alt, 1,60 Meter groß, die bald in »Shanti« umgetauft wird.
Zunächst wohnt sie im sogenannten Einhuferhaus, einem reetgedeckten Fachwerkbau, neben Pferden und Zebras, weil es kein Elefantenhaus mehr gibt. Doch irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Wenn sie morgens auf die Anlage gelassen wird, ist sie so erschöpft, dass sie sich nur noch in den Sand wirft und den Tag verschläft. So hat Heinroth sich das nicht vorgestellt, die Leute kommen schließlich nicht in den Zoo, um dort dann einen Elefanten zu sehen, der immer nur herumliegt. »Shantis« Pfleger schiebt daraufhin eine Nachtwache nach der anderen, um herauszufinden, was den jungen Elefanten die ganze Nacht wachhält. Vielleicht eine Maus oder eines der anderen Tiere neben ihr im Stall? Aber er findet nichts.
Irgendwann fällt Katharina Heinroth das Foto wieder ein, das sie damals aus Bombay erhalten hat – war »Shanti« darauf nicht angekettet? Als sie es findet, ist sie erleichtert: Mit zwei Füßen ist der Elefant darauf an einen Baum gekettet. Das könnte die Lösung des Problems sein, hofft sie. Kaum dass »Shanti« nachts angekettet wird, schläft sie durch und tobt tagsüber herum.
Mobbing im Zoo
Nun, da der Zoo einigermaßen solide dasteht, kann Werner Schröder sich endlich um ein Projekt kümmern, das ihm seit Jahren am Herzen liegt – der Wiederaufbau des zerstörten Aquariums. Alles, was kriecht und schwimmt, ist Schröders große Leidenschaft. Schon als kleiner Junge hat er im Wilmersdorfer Fenn Frösche und Molche, Käfer und Fische gefangen und daheim in Einmachgläsern gehalten. Während seine Mutter das geduldig mit ansah, versuchte sein Vater, ihm die »Viecherei«, wie er das Hobby seines Sohnes nennt, auszutreiben, und schleppte ihn zu kaiserlichen Militärparaden. Ohne Erfolg.
Als Student ist Schröder oft im Aquarium gewesen und hat Reptilien aus Griechenland und Nordafrika von seinen Reisen mitgebracht. Nach dem Krieg hat er, wenn Dienstschluss war, oft in der verfallenen Ruine gestanden, in der mittlerweile Bäume wuchsen, und in den Abendhimmel geschaut.
Im September 1952, nach zwei Jahren Bauzeit, wird das Berliner Aquarium