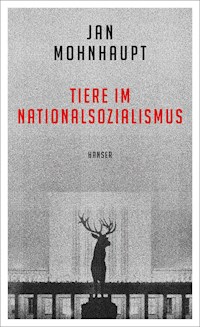
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Tiere in Alltag und Ideologie der Diktatur: Jan Mohnhaupt erzählt ein bisher vernachlässigtes Kapitel der NS-Geschichte.
Kartoffelkäfer als Kriegswaffe, Schweine zur „Volkserziehung“ – Tiere wurden von den Nazis vereinnahmt. Die Hundezucht diente ihnen als Vorbild für ihren Rassenwahn. Insekten waren Teil der Kriegsvorbereitung. Und der Hirsch sollte den Mythos vom „deutschen Wald“ stützen. In Tagebüchern, Fachzeitschriften, Schulfibeln und Propagandamaterial stößt Jan Mohnhaupt auf Tiere und ihre besondere Rolle im Nationalsozialismus. Im Stil einer historischen Reportage begibt er sich auf ihre Spuren, von den Pferden an der Ostfront bis zu den Katzen in deutschen Wohnzimmern. Er macht deutlich: Auch in diesem Ausschnitt der NS-Geschichte zeigt sich das nationalsozialistische Weltbild überraschend klar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Tiere in Alltag und Ideologie der Diktatur: Jan Mohnhaupt erzählt ein bisher vernachlässigtes Kapitel der NS-Geschichte. Kartoffelkäfer als Kriegswaffe, Schweine zur »Volkserziehung« — Tiere wurden von den Nazis vereinnahmt. Die Hundezucht diente ihnen als Vorbild für ihren Rassenwahn. Insekten waren Teil der Kriegsvorbereitung. Und der Hirsch sollte den Mythos vom »deutschen Wald« stützen. In Tagebüchern, Fachzeitschriften, Schulfibeln und Propagandamaterial stößt Jan Mohnhaupt auf Tiere und ihre besondere Rolle im Nationalsozialismus. Im Stil einer historischen Reportage begibt er sich auf ihre Spuren, von den Pferden an der Ostfront bis zu den Katzen in deutschen Wohnzimmern. Er macht deutlich: Auch in diesem Ausschnitt der NS-Geschichte zeigt sich das nationalsozialistische Weltbild überraschend klar.
Jan Mohnhaupt
Tiere im Nationalsozialismus
Carl Hanser Verlag
Meinen Großvätern Hans und Hans
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Fußnoten
Über Jan Mohnhaupt
Impressum
Inhalt
Prolog
: Die Welt hinter dem Draht
Von »Herrentieren« und »Menschentieren«
Auf den Spuren der Tiere
Grenzen ziehen
1
Blutsbande
Hitlers Hunde
Die Rasse des Rittmeisters
Todfeind und Totemtier
Fräulein Brauns Frondeurin
»Reißende Bestien«
2
Mahlverwandtschaften
Schweinereich
Das große Fettrüsten
Verbotenes Fleisch
3
Entlarvung
»Schulmaterial«
Kampf dem Kosmopoliten
Die Erschaffung eines Feindbildes
Jugendwahn
4
Morituri
Hassobjekt und »Herrentier«
Ein Leben am Rande
Der Reiz des Raubtiers
Katzen in Ketten
5
Raufbold
Beleibt und beliebt
Auf der Jagd nach einem Anführer
Der Oger von Rominten
Prunk und Stunk
Dem Ur auf der Spur
Unter deutschen Bäumen
Menschenjagd
Die Enden der Hirsche
6
Kesselfleisch
Über den Bug
Festgefahren und eingefroren
Fleischsuppe und Paprika
Das Pferd als Siedlungshelfer
Deutschland — Pferdeland
Epilog
: Die letzte Stunde der Hunde
Das totale Tier
Blondis Ende
Wolfszeit
Dank
Anmerkungen
Literatur
Zeitungs-, Zeitschriften- und Online-Artikel
Rundfunk- und Filmbeiträge
Zeitzeugeninterviews
Archive
Textnachweise für Mottos
Bildnachweise
Register
Prolog
Die Welt hinter dem Draht
Welche erstaunliche Hierarchie unter den Tieren!
Der Mensch sieht sie so, wie er sich ihre Eigenschaften gestohlen hat.
Elias Canetti, Die Provinz des Menschen
Mitten in Deutschland, am Nordhang eines Berges im Schatten von Buchen und Eichen, liegt ein Zoo. Nur ein sehr kleiner zwar, aber neben einem Goldfischteich, Affen und Volieren für Vögel beherbergt er sogar einen Bärenzwinger. Dieser misst etwa zehn mal fünfzehn Meter. Ringsherum stehen Bänke für die Männer, die hier ihre Mittagspause verbringen. Einige von ihnen necken die Affen, andere schauen zwei jungen Braunbären zu, die sich auf ihre Hinterbeine gestellt haben und sich mit erhobenen Vorderpranken durchs Gehege zu schieben versuchen. Karl Koch hat den kleinen Zoo errichten lassen, wie er in einem offiziellen Schreiben mitteilt, um seinen Mitarbeitern »Zerstreuung und Unterhaltung« zu bieten und »Tiere in ihrer Schönheit und Eigenart vorzuführen, die sie sonst in freier Wildbahn zu beobachten und kennen zu lernen kaum Gelegenheit haben«.1
Die Männer, die den Zoo errichtet haben, sind gleich nebenan, »hinter dem Draht«, wie Koch den drei Meter hohen und drei Kilometer langen Elektrozaun nennt. Dahinter erstreckt sich eine weite abschüssige Fläche. Im Sommer ist sie trocken und staubig, im Winter fegen eisige Winde über sie hinweg. Endlose Reihen von hölzernen Baracken stehen hier dicht an dicht.
Der »Zoologische Garten Buchenwald«, wie der kleine Tierpark offiziell heißt, und das gleichnamige Konzentrationslager liegen weniger als einen Steinwurf voneinander entfernt. Vom Krematorium bis zum Bärenzwinger sind es vielleicht zehn, höchstens fünfzehn Schritte. Der »Draht« dazwischen war einst die Grenze zwischen dem Buchenwald der Häftlinge und dem der Wachmänner, Aufseher und Zivilarbeiter. Er bildete die Grenze zwischen Mensch und Tier auf der einen und »Untermensch« auf der anderen Seite. Der »Draht« trennte Welten.
Nur wenig erinnert heute noch an den Zoo, den die SS1938 als »Freizeitbereich« direkt neben dem Lager errichten ließ. 1993 begann die Gedenkstätte Buchenwald damit, die Überreste freizulegen. Einige Grundmauern waren erhalten geblieben, darunter der Bärenzwinger, der die Zeiten unter Gestrüpp und Laub überdauert hatte. »Wir wollten den Zoo wieder sichtbar machen«, sagt Rikola-Gunnar Lüttgenau, der Sprecher der Gedenkstätte. Dies habe vor allem didaktische Gründe gehabt: »Es ist irritierend, sich vorzustellen, wie die Nazis mit ihren Kindern den Zoo besuchten und Tiere beobachteten, während nebenan Menschen starben. Weil man erkennt, dass ein Teil der eigenen Normalität, wie eben ein Zoo, auch zu einer Welt gehören kann, der man sich überhaupt nicht zugehörig fühlt.«
Wer heute die Gehegeruine besichtigt, um die niedrige Ziegelmauer und die Überreste des Kletterfelsens herumgeht, bekommt noch einen Eindruck von der unmittelbaren Nähe dieses einstigen Idylls zum KZ Buchenwald. Der Zoo diente offenbar als eine Art »spanische Wand«, die zwar nichts verbarg, aber den Bereich der Aufseher doch vom Lager der Häftlinge abschirmte. »Die SS hat es sich schön gemacht«, sagt Lüttgenau.
Die Forschungen zum Lagerzoo sind bislang recht dürftig, dennoch taucht er als Ort immer wieder auf, sowohl in historischen Darstellungen als auch in Zeitungsartikeln und in Aufzeichnungen früherer Häftlinge.2 Den Autor Jens Raschke inspirierte er 2014 außerdem zu einem Theaterstück für Kinder: »Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute«, lautet der Titel. Er bezieht sich auf eine Anekdote, die sich in einem Zeitzeugenbericht findet.3 Demnach soll, zumindest für kurze Zeit, ein Nashorn im Zoo von Buchenwald gelebt haben. Sabine Stein leitet das Archiv der Gedenkstätte und kennt diese Geschichte. Beweisen lässt sie sich jedoch nicht: »Ich habe immer wieder Überlebende, die zu Gedenkveranstaltungen hier zu Besuch waren, danach gefragt«, sagt Stein. »Aber an ein Nashorn konnte sich keiner erinnern.«
Während das Nashorn wohl eine Legende ist, war der Zoo von Buchenwald real und außerdem nicht der einzige seiner Art. Selbst im Vernichtungslager Treblinka gab es zur Zerstreuung für die Wachmannschaften einen Taubenschlag sowie Käfige mit Füchsen und anderen Wildtieren.4
Den Zoo von Buchenwald haben die Häftlinge bauen müssen. Die Tiere, die vor allem aus dem Leipziger Zoo stammten, hatte man von dem geringen Lohn angeschafft, den die Gefangenen für ihre Zwangsarbeit in den umliegenden Fabriken, Werkstätten und Steinbrüchen erhielten.5 Verletzten sich Tiere, wurde dies nicht selten den Häftlingen angehängt. Starb eines, mussten diese auch den Ersatz bezahlen, in Form einer »freiwilligen Umlage«.6
Die Posten als Tierpfleger waren begehrt, vor allem die beim Bärenzwinger, denn wer dort eingesetzt wurde, hatte stets Zugang zu Fleisch und Honig. Wer einmal dort gearbeitet hatte, wollte die Stelle nicht mehr hergeben. Auch Hans Bergmann war bereit, einiges dafür zu riskieren. Der jüdische Häftling schrieb im Oktober 1939 einen Brief an den Ersten Lagerleiter und bat diesen »gehorsamst« darum, wieder bei den Bären arbeiten zu dürfen, da der jetzige Pfleger mit den vier Tieren — darunter das trächtige Weibchen »Betty« — nicht allein fertigwerde, aber alles getan werden müsse, um ihre Jungen durchzubringen. Außerdem, notierte er, »hänge ich sehr an den Tieren und bin sicher überzeugt, in einigen Wochen zusammen mit dem Zigeuner die 4 Bären restlos in Apell (sic!) zu bringen und die Jungen gross zu ziehen«.7
Tatsächlich setzten die Wachmannschaften für die Arbeit mit den Bären bevorzugt Sinti und Roma ein, wie Sprecher Lüttgenau bestätigt. Die »Zigeuner« — so besagte es das damals gängige rassistische Klischee — verdingten sich als Artisten und Gaukler, die nicht selten auch Tanzbären zur Schau stellten. »Deshalb ging die SS offenbar davon aus, dass sie ›von Natur aus‹ besonders gut mit diesen Tieren umgehen konnten«, sagt Lüttgenau.
SSSS8
Die Bären von Buchenwald. Ansichtskarten wie diese vertrieb die SS auch im nahen Weimar.
Auch Ilse Koch, die Frau des Lagerkommandanten, spazierte oft mit ihren Kindern durch den kleinen Tierpark. Und stets führte sie ihr Weg am »Draht« entlang. Obwohl es ansonsten streng verboten war, dort zu fotografieren, finden sich Bilder im Familienalbum, die Karl Koch mit seinem Sohn Artwin beim Füttern und Streicheln der Tiere zeigen.9 Einige Jahre später sollte Ilse Koch vor einem amerikanischen Militärgericht stehen und behaupten, weder den Zaun noch das Lager dahinter bemerkt zu haben.10
Karl Koch war darauf bedacht, dass die Tiere nicht geärgert wurden, und verbat per Kommandanturbefehl »jegliches Füttern und Necken«.11 Wer den Tieren dennoch etwas antat, wer etwa über die Mauer zum Bärenfelsen kletterte oder sich auch nur an einen der Käfige lehnte, musste damit rechnen, bestraft zu werden. Das galt auch für die SS-Mannschaften. Den Tieren sollte es schließlich gut gehen. Die Bitte des Häftlings Bergmann dürfte ihm demnach einleuchtend vorgekommen sein, und so befürwortete er dessen Antrag, als Bärenpfleger eingesetzt zu werden. Neben seiner Unterschrift hinterließ er jedoch noch folgenden Vermerk: »Wenn ein Junges eingeht, hart bestrafen.«12
Von »Herrentieren« und »Menschentieren«
Allzu leicht ließe sich Karl Kochs Sorge um das Wohlergehen seiner Zootiere als verstörende Anekdote ohne weiteren Erkenntnisgewinn abtun — wäre sie nicht Teil einer systematischen Verschiebung der Grenzen, die ausgesuchte Tiere zu »Herrentieren« machte und Menschen willkürlich zu »Menschentieren« und »Untermenschen« degradierte. Für führende Nationalsozialisten stellten Tierschutz und Verbrechen gegen die Menschlichkeit keinen Widerspruch dar, im Gegenteil, sie fühlten sich sogar einer »moralischen Elite« zugehörig. Wie Heinrich Himmler, der in seiner Posener Rede im Jahr 1943 damit prahlte: »Ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur insoweit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Wir werden niemals roh und herzlos sein, wo es nicht sein muss: das ist klar. Wir Deutsche, die wir als einzige auf der Welt eine anständige Einstellung zum Tier haben, werden ja auch zu diesen Menschentieren eine anständige Einstellung einnehmen.«13
Und auch Rudolf Höß, der Lagerkommandant von Auschwitz, fühlte sich bemüßigt, die besondere Beziehung zu betonen, die ihn seit seiner Kindheit mit den Tieren verbunden habe. Besonders Pferde hatten es ihm angetan.14 Während seiner Zeit in Auschwitz suchte er meist dann ihre Nähe, wenn es ihm nicht mehr gelang, das tägliche Töten mit Pflichterfüllung und Gehorsam zu rechtfertigen: »Ich mußte den Vernichtungsvorgang, das Massenmorden weiter durchführen, weiter erleben, weiter kalt auch das innerlich zutiefst Aufwühlende mitansehen«, schrieb er in seinen Erinnerungen, die er nach dem Krieg während seiner Haftzeit in Polen verfasste. »Hatte mich irgendein Vorgang sehr erregt, so war es mir nicht möglich, nach Hause zu meiner Familie zu gehen. Ich setzte mich dann aufs Pferd und tobte so die schaurigen Bilder weg oder ich ging oft des Nachts durch die Pferdeställe und fand dort bei meinen Lieblingen Beruhigung.«15 Während Himmler die Tiere heranzog, um die moralische Überlegenheit des NS-Regimes zu demonstrieren, bemühte sich Höß, die Pferde als Beweis seines sensiblen, mitfühlenden Charakters erscheinen zu lassen. Am meisten bemitleidete er sich aber wohl selbst für das, was er alles hatte »mitansehen müssen«.
Die Geschichten von Kochs Sorge um die Zootiere, von Höß’ Flucht zu den Pferden und auch Hitlers oft erwähnte Schwäche für Schäferhunde gehören zur Legende vom modernen Tier- und Naturschutz der Nationalsozialisten, die sich zu einem gewissen Grad bis heute gehalten hat. Noch immer wird darauf verwiesen, dass Hitler bereits im ersten Jahr seiner Herrschaft ein neues Tierschutzgesetz erlassen habe, das international als fortschrittlich galt und in der Bundesrepublik bis 1972 weitgehend unverändert in Kraft blieb — ein Gesetz, durch das erstmals im Deutschen Reich Tiere »um ihrer selbst willen« geschützt werden sollten und das dem selbst ernannten Tierfreund Hitler sogar einen Orden in den USA einbrachte.16 Hermann Göring hatte in seiner Funktion als preußischer Ministerpräsident bereits zuvor gegen jede Form von Tierversuchen gewettert und den »Vivisektionisten« mit dem Konzentrationslager gedroht — eine der ersten öffentlichen Erwähnungen der KZs übrigens. In diesem Fall blieb es jedoch bei leeren Drohungen.17
All das widerspricht sich nur scheinbar. Denn der Tierschutz ist eng mit den Grundüberzeugungen der NS-Ideologie verknüpft. Maren Möhring zählt zu den wenigen Historikerinnen und Historikern, die sich bislang mit Tieren in der NS-Zeit beschäftigt haben. In einem Aufsatz hat sie detailliert untersucht, wie sich das Mensch-Tier-Verhältnis im nationalsozialistischen Deutschland verändert hat. Der auf den ersten Blick paradoxe Tierschutzgedanke der Nationalsozialisten, schreibt Möhring, lasse sich weder als reines Propagandamittel erklären, das letztlich »nicht ernst« gemeint gewesen sei, noch als ein vom übrigen NS-Gedankengut losgelöster positiver Aspekt. Er war vielmehr ein »integraler Bestandteil der Neuordnung der Gesellschaft auf völkisch-rassistischer Grundlage«.18 Oder anders ausgedrückt: Eine Ideologie, die den Wert von Leben daran bemisst, welchen »Nutzen« es der eigenen »Lebensgemeinschaft« bringt, unterscheidet nicht zwischen »Mensch« und »Tier«, sondern zwischen »nützlichem« und »lebensunwertem« Leben. Es entsprang demnach demselben ideologischen Geist, manche Tiere unter besonderen Schutz zu stellen und manche Menschen wiederum zu »Schädlingen« zu erklären und sie systematisch zu vernichten.
Das zeigt sich in besonders zugespitzter Weise einmal mehr in Buchenwald: Kommandant Karl Koch, der so sehr um das Wohl der Zootiere besorgt war, ließ Häftlinge zu seinem Vergnügen in den Bärenzwinger werfen, um zuzusehen, wie sie von den Tieren zerfleischt wurden.19 Leopold Reitter, ein Überlebender von Buchenwald, gab nach der Befreiung des Konzentrationslagers zu Protokoll: »Noch im Jahre 1944, als im Lager große Hungersnot herrschte, bekamen die Raubvögel, Bären und Affen täglich Fleisch, das selbstverständlich aus der Häftlingsküche genommen und so der Verpflegung der Häftlinge entzogen wurde.«20
Derartige Berichte gibt es in großer Zahl. Auch jenseits der Konzentrationslager tauchen Tiere in zahlreichen Tagebüchern, Erinnerungen, Briefen und Alltagsdokumenten auf. Dennoch traten sie in der Forschung zum Nationalsozialismus bislang höchstens als Statisten in Erscheinung. Obwohl Historiker seit den Achtzigerjahren unzählige Bereiche der »Alltagsgeschichte« erschlossen haben, von der Mode über den Sport bis hin zu Ernährung, Handwerk und Drogenkonsum in der NS-Zeit, ist von den Tieren im Nationalsozialismus bisher nur selten die Rede gewesen.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand, wie auch Mieke Roscher bestätigt, die an der Universität Kassel die derzeit einzige Professur für Human-Animal-Studies in Deutschland innehat: Die NS-Forschung, insbesondere die deutsche, habe nach wie vor Berührungsängste, »weil man befürchtet, dass der Fokus auf die Tiere zu einer Bagatellisierung der menschlichen Opfer führe«.21 Doch gerade weil die scheinbar »harmlose« Geschichte der Tiere sowohl mit dem Alltag als auch der Ideologie des Nationalsozialismus so eng verwoben war, ist sie so relevant. Denn sie zeigt nicht zuletzt, wie tief gefährliches Gedankengut selbst in ideologisch unverdächtigen Lebensbereichen verankert sein und die Gesellschaft prägen kann: Wer das Zusammenleben mit Hauskatzen in den Dreißiger- und Vierzigerjahren näher betrachtet, bekommt einen Einblick in deutsche Wohnzimmer — wird aber auch unvermittelt mit einer völkisch-rassistischen Weltsicht konfrontiert, die tief in den Alltag vorgedrungen war. Wer nach Insekten im Nationalsozialismus forscht, findet sich über kurz oder lang in den Klassenzimmern deutscher Schulen wieder — und kann nicht umhin, sich mit »schwarzer Pädagogik« und Sozialdarwinismus zu beschäftigen. Und wer herausfinden möchte, welche Rolle Hausschweine zu dieser Zeit spielten, stößt auf Werbeplakate der Lebensmittelindustrie, auf frühe Formen der Recyclingwirtschaft, aber ebenso auf verquere Auswüchse der NS-Ideologie. Die Geschichten der Tiere liegen quer zu vielen bekannten Themen der NS-Forschung und eröffnen dadurch eine oft andere, meist neue, aber niemals bagatellisierende Perspektive auf das Leben im Nationalsozialismus.
Auf den Spuren der Tiere
Nicht überall war der Terror offensichtlich. Vielerorts war der braune Alltag eher grau in grau. Doch in allen seinen Lebensbereichen waren Tiere von Bedeutung, wie die folgenden Kapitel zeigen. Jedes von ihnen nähert sich anhand einer Tierart einer anderen Facette des Nationalsozialismus. Mithilfe des Hundes und seines wilden Urahns, des Wolfes, werfen wir einen Blick auf die Rassenlehre, der zeigt, wie eng Alltag und Ideologie, Politik und »Wissenschaft« miteinander verzahnt waren. Anhand des Hausschweins können wir nicht nur die Bedeutung von Nutztieren in der NS-Zeit ablesen; seine Rolle als wichtigster Fett- und Fleischlieferant für die »Volksernährung« war gleichzeitig zentral für die Bemühungen der Nationalsozialisten, einen vom Ausland vollkommen unabhängigen Staat zu schaffen und die eigene »arische Urkultur« unter Beweis zu stellen. Welche ambivalenten Gefühle Haustiere hervorriefen, zeigt sich vor allem an der Hauskatze. Für die einen war sie ein »jüdisches Tier«, das sich nicht zähmen ließ. Die anderen priesen sie als Mäusejäger und »hygienischen Helfer der Volksgesundheit«. In diesem Kapitel begegnen wir verschiedenen Katzenhaltern, etwa dem Philologen Victor Klemperer, der in Dresden mit seiner Frau erst um das Leben ihres Katers Mujel bangte. Und bald um das eigene.
Auch in der Pädagogik und Erziehung der Dreißiger- und Vierzigerjahre waren Tiere prägend. Wie schon die Jüngsten auf Krieg und Kampf vorbereitet wurden, sehen wir am Beispiel von Seidenraupen und Kartoffelkäfern. Insekten, so lässt sich an Schul- und Kinderbüchern darlegen, wurden zudem genutzt, um den Kindern zu erklären, was — und vor allem wer — im nationalsozialistischen Sinne ein »Schädling«, »Schmarotzer« oder »Parasit« war.
Dabei gab es nicht die eine uniforme Ideologie des Nationalsozialismus. Wie willkürlich weltanschauliche Aspekte mal auf diese, mal auf jene Art miteinander kombiniert wurden, zeigt sich wiederum beispielhaft an der Haltung der Nationalsozialisten zur Jagd: Während Hitler die Jäger als »grüne Freimaurer« verspottete, konnte Reichsjägermeister Hermann Göring bekanntlich gar nicht genug von der Trophäenjagd bekommen. Im Zentrum dieses Kapitels steht der Rothirsch Raufbold, dessen Statue den Umschlag dieses Buches ziert. Einst Görings Trophäensucht zum Opfer gefallen, überdauerte Raufbolds in Bronze gegossenes Abbild die Zeiten und die zwölf Jahre des »Tausendjährigen Reiches« — ebenso wie das weltanschauliche Erbe Görings die Jägerschaft bis heute prägt.
Und schließlich darf ein Bereich nicht fehlen, wenn es um die Rolle der Tiere im Nationalsozialismus geht: Der Zweite Weltkrieg, vor allem der Ostfeldzug, wäre ohne Millionen von Pferden nicht möglich gewesen. Im letzten Kapitel begleiten wir den Trakehnerhengst Siegfried, der mit seinem Reiter im Sommer 1941 beim Überfall auf die Sowjetunion dabei war und auch dann noch weiter gen Osten zog, als Motoren und Maschinen in der Kälte des russischen Winters längst den Geist aufgegeben hatten. In diesem Kapitel zeigt sich, wie komplex die symbolische Bedeutung des Pferdes für das Weltbild der Nationalsozialisten war — und wie lang der Schatten ist, den dieses Symbol auch in der Bundesrepublik noch wirft.
Grenzen ziehen
In seinen Minima Moralia — Reflexionen aus dem beschädigten Leben, einer Sammlung von Aphorismen und kurzen Essays, schreibt Theodor W. Adorno, dass die »Entrüstung über begangene Grausamkeiten« umso geringer werde, »je unähnlicher die Betroffenen den normalen Lesern sind«. Daraus folgerte er: »Vielleicht ist der gesellschaftliche Schematismus der Wahrnehmung bei den Antisemiten so geartet, daß sie die Juden überhaupt nicht als Menschen sehen. Die stets wieder begegnende Aussage, Wilde, Schwarze, Japaner glichen Tieren, etwa Affen, enthält bereits den Schlüssel zum Pogrom. Über dessen Möglichkeit wird entschieden in dem Augenblick, in dem das Auge eines tödlich verwundeten Tiers den Menschen trifft. Der Trotz, mit dem er diesen Blick von sich schiebt — ›es ist ja bloß ein Tier‹ —, wiederholt sich in den Grausamkeiten an Menschen, in denen die Täter das ›nur ein Tier‹ immer wieder sich bestätigen müssen, weil sie es schon am Tier nie ganz glauben konnten.«22
Für Adorno spiegelte sich im Umgang mit den Tieren auch das Verhältnis des Menschen zu sich selbst wider. In diesem Sinne sind die Geschichte und die Geschichten der Tiere im Nationalsozialismus nicht nur Zeugnisse ihrer Zeit. Sie offenbaren auch das Menschen- und Weltbild, das diese Zeit hervorgebracht hat, und sind daher letztlich viel mehr als stumme Statisten.
1
Blutsbande
Ich habe meinem Schmerze einen Namen gegeben
und rufe ihn ›Hund‹.
Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft
Wie aus dem Nichts ist der Fremde aufgetaucht, so plötzlich, dass er ihn zunächst gar nicht wahrgenommen hat. Schließlich war er ganz damit beschäftigt, einer Ratte nachzujagen. Durch Gräben und unter Stacheldrahtverhauen hindurch hat er sie verfolgt. Irgendwie muss er dabei die Orientierung verloren haben und schließlich, ohne es zu merken, hinter die feindlichen Linien gelangt sein, wo mit einem Male dieser fremde Mann vor ihm steht. Als der nach ihm greift, beißt er zu, so fest er kann. Doch der Mann lässt nicht los und schleppt ihn fort, in einen dunklen Raum unter der Erde, wo die Luft feucht und kühl ist und es nach Mensch riecht.
Der Fremde ist ein 23-jähriger deutscher Gefreiter. Wie üblich ist er auch an diesem Tag im Frühjahr 1915 gerade auf dem Weg zu seiner Einheit, dem 16. Königlich Bayerischen Reserve-Infanterie-Regiment, das sein Lager im Keller des Schlosses von Fromelles in Nordfrankreich aufgeschlagen hat, nur wenige Kilometer hinter der Westfront. Der Soldat wundert sich über den kleinen Überläufer mit dem weißen Fell und dem schwarzen Fleck, der sich über dessen linkes Ohr und Auge erstreckt. Da der Hund aus Richtung der britischen Stellungen kam und einem englischen Foxterrier ähnelt, nennt der Soldat ihn Foxl.1
Im Quartier angekommen, versucht er Foxls Vertrauen mit Keksen und Schokolade zu gewinnen. Der junge Mann versteht nicht allzu viel von Hunden, sonst wüsste er, dass Schokolade für einen Hund Gift ist und gerade für solch einen kleinen schon in geringen Mengen tödlich sein kann. Der in der Kakaobohne enthaltene Stoff Theobromin löst bei Hunden eine Erhöhung des Blutdrucks aus und verengt die Blutgefäße, was zu Krämpfen, Herzrhythmusstörungen und letzten Endes zum Atemstillstand führen kann. Aber es herrscht Krieg, und die Schokolade, die die Soldaten in ihrem Proviant haben, ist von minderer Qualität, sodass sie — zum Glück für Foxl — kaum Kakao enthält. Der legt seine anfängliche Scheu bald ab. Allmählich gewöhnt er sich an den ruhigen Mann, der ihm beibringt, über Seile zu springen, Leitern hinauf- und wieder hinabzuklettern.
Der Soldat dient als Meldegänger; sein Auftrag ist es, Botschaften vom Regimentsstab nach vorne zu den Bataillonsstäben zu überbringen. »Etappenschwein« nennen die Soldaten an der Front einen wie ihn abfällig, da er sich meist im Rückraum der Schützengräben bewegt und so den feindlichen Kugeln und Granaten aus dem Weg gehen kann. Das kränkt und ärgert ihn so sehr, dass er sich in späteren Jahren stets als tapferen Frontkämpfer darstellen und alles daransetzen wird, jeden Zweifel an seinem Heldenmut zu beseitigen.
Mehrmals ist das Regiment bereits verlegt worden, und jedes Mal ist Foxl mitgekommen. Er ist mittlerweile eine Art Maskottchen, mit dem sich die Männer gerne fotografieren lassen. Wenn sein Soldat ausrückt, bleibt Foxl im Quartier angeleint zurück und harrt aus, bis dieser wieder zurückkehrt. Doch ab dem Herbst 1916 bleibt er länger als gewöhnlich fort.
Anfang Oktober haben die Soldaten Stellung zwischen den Städtchen Bapaume und Le Barque bezogen, rund 15 Kilometer nördlich der Somme. Seit Anfang Juli 1916 versuchen dort britische, französische und deutsche Einheiten einander in einer Abnutzungsschlacht zu zermürben. Als die Kämpfe viereinhalb Monate später enden, sind auf beiden Seiten insgesamt mehr als eine Million Soldaten gefallen. Es ist eine der verheerendsten Schlachten dieses Krieges. Foxls Soldat hat Glück und überlebt; bereits nach drei Tagen im Gefecht hat sich ein Granatsplitter in seinen linken Oberschenkel gebohrt, was ihm rund zwei Monate im Lazarett in Beelitz bei Berlin beschert.2
Nach seiner Rückkehr zur Truppe Anfang März 1917 berichten ihm seine Kameraden, dass der Hund auf niemanden gehört habe und sich kaum streicheln lassen wollte. Es erfüllt ihn mit Stolz, dass Foxl nur ihm folgt, denn außer diesem Hund gibt es niemanden, der das täte. Unter seinen Kameraden gilt der Mann als Einzelgänger, als Sonderling, der für ihre Zoten und Prahlereien nichts übrig hat und sich lieber hinter seiner Zeitung und seinen Zeichnungen verkriecht oder mit seinem Hund spielt. Foxl scheint das einzige Lebewesen zu sein, dem er zugeneigt ist.3
Für viele Soldaten, die in diesen Krieg gezogen sind, sind Hunde zu wichtigen Begleitern und engen Vertrauten geworden. Sei es, da sie als Erste riechen, wenn das Giftgas in die Gräben kriecht, und die Männer rechtzeitig warnen, sei es, indem sie Nachrichten an die vorderste Front bringen und Verwundete im Niemandsland zwischen den Linien aufspüren. Oder indem sie den Soldaten Trost spenden. Vielen erscheinen die Hunde wie Boten aus einer besseren Welt, die ihnen mehr Hoffnung vermitteln als all die aufmunternden Briefe aus der Heimat und Durchhalteparolen der Vorgesetzten.4 In einem Erlebnisbericht von der italienischen Front schreibt der K.-u.-k.-Soldat Robert Hohlbaum: »Uns hat in den Tagen, da die Welt wankte, ein liebes Hundebellen mehr gegeben, als die klügsten Worte der Menschen.«5
Auch unser junger Soldat kann sich nicht mehr vorstellen, ohne seinen Foxl zu sein. Eines Tages, wenn der Krieg vorbei und er noch am Leben sein sollte, will er eine Hündin für ihn besorgen. Doch noch sind sie irgendwo im Hinterland der Westfront und teilen sich Feldbett und Fraß. So vergehen zweieinhalb Jahre, in denen Foxl ihn auf seinem Marsch durch Nordfrankreich und Belgien begleitet. Hin und wieder jagt er zwar noch einer Ratte nach, kehrt aber am Ende stets zu ihm zurück. Bis zu jenem Tag im August 1917.
Das Regiment soll erneut verlegt werden, mit dem Zug geht es in Richtung Elsass, als Foxl plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist. Sofort hat der Soldat einen Verdacht. Kurz zuvor hat ihm ein Eisenbahner 200 Mark für den Hund geboten. Doch der Soldat hat entrüstet abgelehnt: »Und wenn Sie mir 200.000 geben, Sie kriegen ihn nicht!«
Er ist sich sicher, dass dieser »Schweinehund« ihn gestohlen hat. Doch ihm bleibt keine Zeit, nach Foxl zu suchen, seine Einheit hat sich bereits in Bewegung gesetzt, ein langer Fußmarsch steht bevor. Mit dem Gefühl, seinen treuesten Begleiter verloren zu haben und nichts dagegen tun zu können, setzt auch er sich in Bewegung und versucht, Foxl hinter sich zu lassen. Kein Opfer dieses Krieges geht ihm so nahe wie der Verlust seines Hundes.
Hitlers Hunde
Was aus Foxl geworden ist, wird Adolf Hitler nie erfahren. Er selbst wird, wie wir wissen, nach dem Krieg in seine Wahlheimat München zurückkehren, wo er sich nach einer kurzen Phase der politischen Orientierungslosigkeit radikalisiert und 1920 die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) in ihrer finalen Form mitbegründet. Nach dem gescheiterten Putschversuch gegen die bayerische Landesregierung im November 1923 landet er für einige Monate im Knast. Von seinen Gegnern unterschätzt und von willigen Helfern unterstützt, gelingt es ihm danach, so hoch aufzusteigen, dass ihm bald nicht mehr nur ein Hund, sondern fast ein ganzes Volk nachläuft.6
Ende Januar 1942 sitzt Adolf Hitler, wie er das so oft des Nachts tut, mit seinen Gefolgsleuten in seinem Führerhauptquartier »Wolfsschanze« im tiefsten Ostpreußen und erzählt vom Verlust seines ersten Hundes Foxl.7 Zu dieser Zeit werden die ersten Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion nach Deutschland verschleppt. Von den schätzungsweise rund fünf Millionen russischen Juden sind bereits 500.000 von sogenannten »Einsatzgruppen« des Reichssicherheitshauptamtes erschossen worden.8 Vor wenigen Tagen erst, am 20. Januar, haben sich 15 hochrangige Mitglieder verschiedener Regierungsämter und der SS zur Mittagszeit in einer Villa am Großen Wannsee im Südwesten Berlins getroffen, zu einer »Besprechung mit anschließendem Frühstück«, wie es in der Einladung hieß. Bevor es zum Essen ging, standen aber noch »mit der Endlösung der Judenfrage zusammenhängende Fragen« auf der Tagesordnung. Elf Millionen Menschen haben die NS-Bürokraten in ganz Europa erfasst.9 Der Massenmord an ihnen ist bereits in vollem Gange.
Auch wenn Hitler bei dieser Verabredung zum Völkermord nicht zugegen ist, ist er über alle Schritte stets bestens informiert und segnet das weitere Vorgehen ab.10 Dass die eingeleiteten Schritte zur Vertreibung und Ermordung der europäischen Juden ganz in seinem Sinne sind, daran lässt er keinen Zweifel: »Am besten, sie gehen nach Rußland. Ich habe kein Mitleid mit den Juden«, sagt er etwa eine Woche nach der Konferenz während einer weiteren nächtlichen Gesprächsrunde in der »Wolfsschanze«.11 Hier, in der vertrauten Atmosphäre seines Führerhauptquartiers, wo der Krieg noch fern ist und ihn niemand unterbricht, redet er am liebsten von seinen Befindlichkeiten, erzählt von Foxl, von Muck und Blondi und all den anderen Hunden, die er mal besessen hat.
Zahlreiche hatte er bereits, wie viele es am Ende sein werden, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, da sich die Quellen in diesem Fall widersprechen und Hitler zudem mehreren Hunden die gleichen Namen gibt — allein drei Rüden nennt er Wolf, drei Hündinnen Blondi. Zeitweilig besitzt er drei Hunde gleichzeitig, insgesamt sind es wohl 13 Tiere, mit einer Ausnahme allesamt Schäferhunde, die er von 1922 bis 1945 hält. Von den zahlreichen Hunden, die er darüber hinaus Parteimitgliedern und Weggefährten zu besonderen Anlässen schenkt, ganz zu schweigen.12
Hitler bezeichnet sich selbst als tierlieb, dennoch stellt sich die Frage, ob er tatsächlich ein Hundefreund im eigentlichen Sinne ist.13 »Hund« ist eines der häufigsten Schimpfworte, die er verwendet — ganz egal ob er sich während seiner nächtlichen Monologe in Rage redet oder seinen Feinden droht. Schon 1923 hat er imVölkischen Beobachter, der Parteizeitung der Nationalsozialisten, verkündet, er wolle »lieber ein toter Achill als ein lebender Hund« sein.14 Zudem ist »Hund« für ihn nicht gleich »Hund«. Auf Reinrassigkeit legt er besonderen Wert, auch wenn er manche Rassen grundsätzlich ablehnt. Bulldoggen und Boxer gefallen ihm nicht. Bei Dackeln, die ursprünglich gezüchtet wurden, um Dachse zu jagen und diese eigenständig bis in den Bau zu verfolgen, stört ihn gerade der rassetypische Charakterzug; sie sind ihm zu eigensinnig. Was Hitler hingegen schätzt, sind Hunde, die keinen zu starken eigenen Willen haben, die aufs Wort gehorchen und gefügig sind. Von allen Hunderassen hat es ihm der Deutsche Schäferhund besonders angetan.
Während die Nationalsozialisten Juden, Sinti und Roma zu »Untermenschen« und Menschen mit Behinderung zu »unwertem Leben« erklären, erheben sie einige Tiere zu »Herrentieren« — so auch den Hund.15 Alles, was nicht in ihr Wertebild passt, was in ihren Augen als »rassefremd«, »entartet« oder »krank« zu betrachten ist, versuchen sie auszumerzen.16 Wie stark sie sich dabei an der Tierzucht orientieren, zeigt sich wohl nirgends so deutlich wie im Fall des Deutschen Schäferhundes.17 Doch diese Entwicklung hat nicht erst in den Dreißigerjahren begonnen. Und um sie zu verstehen, lohnt sich ein Blick weit zurück in die Geschichte der Beziehung zwischen Mensch und Hund.
Die Rasse des Rittmeisters
Wann es genau war, ist unklar, aber irgendwann zwischen 40.000 und 15.000 Jahren vor unserer Zeit fanden Menschen und Wölfe zueinander. Vermutlich waren es die Abfälle und Essensreste der Menschen, die zuerst die weniger scheuen unter den Wölfen anlockten. Auch wenn es vereinzelt vorkam, dass Menschen verwaiste Wolfsjunge bei sich aufnahmen und großzogen, so ging der Impuls doch wahrscheinlich zuerst von den Wölfen aus.18 Da sowohl Wölfe als auch Menschen in engen Familienverbänden leben, fiel beiden die Anpassung an den jeweils anderen nicht allzu schwer. Aus den gezähmten Wölfen wurden im Laufe der Zeit Hunde und aus den einst umherziehenden Jägern sesshafte Siedler. Entsprechend alt sind einige Hunderassen: Die Ursprünge von Bernhardiner und Collie gehen bis ins Mittelalter zurück; der Portugiesische Wasserhund half bereits in der frühen Antike den Seeleuten an der Atlantikküste beim Fischfang.19
Im Gegensatz dazu ist der Deutsche Schäferhund geradezu blutjung und nicht einmal so alt wie sein fanatischer Verehrer. Erst im Jahre 1901, als der zwölfjährige Adolf Hitler noch die Realschule in Linz besuchte, legte ein gewisser Max von Stephanitz die Merkmale dieser Rasse erstmals fest, in seinem Werk Der Deutsche Schäferhund in Wort und Bild.
Auf den Hund gekommen war von Stephanitz selbst erst wenige Jahre zuvor durch einen Zufall. Er hatte sich zwar schon früh für Tiere interessiert und eigentlich Landwirt werden wollen, aber dann dem Wunsch seiner Mutter nachgegeben und eine Militärlaufbahn als Kavallerist eingeschlagen. Abgesehen von einem Papagei daheim waren die Armeepferde lange Zeit seine einzigen tierischen Kontakte bis zu jenem einschneidenden Erlebnis Mitte der 1890er-Jahre. Während einer Gefechtsübung beobachtete er einen Schäfer, der in der Rheinebene mithilfe von Hunden seine Herde zusammentrieb. Staunend sah von Stephanitz zu, wie der Hirte seine Hunde nur mit Fingerzeichen und Rufen lenkte. Das Zusammenspiel von Mensch und Tier erinnerte ihn an ein Manöver und faszinierte ihn so sehr, dass er daraufhin beschloss, sich den Schäferhunden zu widmen.20 Mehr noch, er wollte eine Hunderasse züchten, die die Tugenden des preußischen Soldaten in sich vereinte: Treue, Mut, Ausdauer, Fleiß und Gehorsam.21 Zudem sollte sie möglichst »wolfsähnlich« aussehen und damit dem nahekommen, was sich von Stephanitz und Zeitgenossen unter dem »germanischen Urhund« vorstellten.22
Um die Jahrhundertwende gab es in den verschiedenen Provinzen des Deutschen Reiches zwar mehrere Schläge*1 von Hütehunden, die sich jedoch in der Farbe ihres Fells, im Körperbau sowie ihrer Größe stark unterschieden und längst kein einheitliches Rassebild abgaben. Von Stephanitz war allerdings überzeugt, dass in all diesen Hunden die »Angehörigen einer allgemeinen, weit verbreiteten Rasse« steckten, deren Ursprünge seiner Meinung nach bis in die Bronzezeit zurückreichten.23 Indem er die richtigen Zuchttiere auswählte und alles »Krankhafte« aussortierte, hoffte er, diese Rasse wieder zum Vorschein zu bringen.24
Zu diesem Zweck kaufte von Stephanitz sich 1897 eine Hündin. Im Jahr darauf fand er bei einem Züchter in Frankfurt am Main einen großen, dreijährigen Rüden mit einer Rückenhöhe von gut 60 Zentimetern, der genau seinen Vorstellungen entsprach: »Mit kräftigen Knochen, schönen Linien und edel geformtem Kopf, das Gebäude trocken und sehnig, der ganze Hund ein Nerv«, schwärmte von Stephanitz und offenbarte in der Beschreibung des »Wesens« des Hundes sein für die Zeit so typisches Machtverständnis: »Wundervoll in seiner anschmiegenden Treue zum Herrn, allen anderen gegenüber eine rücksichtslose Herrennatur.«25
Um den vermeintlich auserwählten Vierbeinern standesgemäße Namen zu verleihen, nannte er die Hündin nach der nordischen Göttin der Liebe und Ehe, Freya, und den Rüden nach einem Helden der germanischen Sage, Horand. Als Zusatz bekamen sie noch den Namen seines oberbayrischen Gutshofes Grafrath angehängt — fertig war der Hundeadel.
Als von Stephanitz gut ein Jahr später im April 1899 den »Verein für Deutsche Schäferhunde« mitbegründete, erhielt Horand die Zuchtbuchnummer »1« und wurde zum Stammvater zahlreicher Generationen Deutscher Schäferhunde.26
Um ein einheitliches Aussehen zu erreichen, setzten von Stephanitz und seine Vereinskollegen vor allem auf zwei Schläge: kleine, gedrungene Tiere aus Thüringen und große, kräftige aus Württemberg.27 Von sogenannten »Luxushunden«, die nur des Aussehens wegen gezüchtet würden, hielt von Stephanitz nichts — der Deutsche Schäferhund sollte vor allem ein »Gebrauchshund« sein. Nicht alle Züchter folgten von Stephanitz’ Vorstellungen. Manche von ihnen kreuzten Schäferhunde mit Wölfen, um Krankheiten wie der Staupe vorzubeugen oder einen attraktiveren, »wolfsähnlicheren« Körperbau zu erreichen.28 Von Stephanitz lehnte das grundsätzlich ab, da es seiner Meinung nach »nur bissige und scheue Hunde« hervorbringe. Er berief sich dabei auf eine arg verkürzte und zugespitzte Aussage Charles Darwins, wonach das Kreuzen die »auszeichnenden Eigenschaften beider Elternrassen« auslösche und charakterlose Bastarde hervorbringe.29
Neben Darwin bezog sich von Stephanitz in seiner Arbeit vor allem auf den Zoologen und Mediziner Ernst Haeckel, der Darwins Vererbungstheorien als einer der Ersten auf den Menschen übertragen hatte und als Wegbereiter der sogenannten Eugenik galt.
Diesen Begriff hatte wiederum der britische Naturforscher Francis Galton — ein Cousin Darwins — 1883 geprägt. Galton meinte damit eine Verbesserung der menschlichen Erbanlagen durch gezielte und gelenkte Zucht. Er war überzeugt, dass Intelligenz ausschließlich erblich und nicht durch Umwelteinflüsse bedingt sei und deshalb auch die geistigen Unterschiede zwischen den »Menschenrassen« durch deren Erbanlagen vorgegeben seien.30 Um die Gesundheit des gesamten Volkes zu garantieren, sollte deshalb die Fortpflanzung gesunder, intelligenter Menschen gefördert werden, während die »kranker« und »niederer« Menschen zu unterbinden sei.31 Haeckel schloss daran an und bemühte zudem den Vergleich mit den antiken Spartanern, die ihre Schönheit, Kraft und geistige Energie seiner Überzeugung nach »der alten Sitte« verdankten, alle schwächlichen und behinderten Säuglinge sofort nach der Geburt zu töten.32
Die Eugenik fand schnell überall auf der Welt ihre Anhänger. Bereits 1907 wurde im US-Bundesstaat Indiana ein Gesetz zur Zwangssterilisation von behinderten Menschen und Kriminellen erlassen. Ab den Zwanzigerjahren entstanden in 15US-Bundesstaaten ähnliche Gesetze, ebenso in mehreren skandinavischen und baltischen Ländern.33
In Deutschland war die Eugenik zu dieser Zeit vor allem als »Rassenhygiene« bekannt, ein Ausdruck, der auf den Arzt Alfred Ploetz zurückgeht.34 Ploetz, ein Freund Haeckels, sah in der Pflege von Menschen mit Behinderungen, Kranken und Armen »humane Gefühlsduseleien«, die »nur die Wirksamkeit der natürlichen Zuchtwahl« verhindere.35 Ebenso wie Galton war Ploetz der Meinung, dass der Staat die Fortpflanzung der Bevölkerung steuern müsse.36
Obwohl es bereits während der Weimarer Republik Bestrebungen in diese Richtung gab, sollte es jedoch noch bis 1933 dauern, bis mit dem »Reichsgesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« die Zwangssterilisation von behinderten Menschen, psychisch Kranken und Alkoholikern vorgeschrieben wurde.37 Bis es so weit war, blieb die »rassische Zuchtauswahl« auf Tiere beschränkt, auch wenn schon von Stephanitz im Sinne Haeckels und Ploetz’ bereits einen Schritt weiterdachte: Der Hundezüchter, der unter anderem empfahl, missgebildete, schwächliche oder nur überzählige Welpen lieber zu erschlagen, schrieb bereits 1932: »Wir können unsere Schäferhundzucht recht wohl mit der menschlichen Gesellschaft vergleichen.«38 In den »Bestimmungen über die Führung des Zuchtbuchs« legte er schließlich fest, dass der »Anteil fremden Blutes« in der Schäferhundzucht bis zu 1/128 anzugeben sei. Und ebenso wie der Deutsche Schäferhund sollte auch der »deutsche Volkskörper« rein gezüchtet werden.391935 griffen die Nationalsozialisten von Stephanitz’ »Zuchtbestimmungen« in der »Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz« auf.40 Nur ging es nicht mehr um die »Blutbeimischung« bei Schäferhunden, sondern um den »Mischlingsgrad« von »Juden« und »Zigeunern«.41
Von Stephanitz traf mit der gezielten Zucht des Deutschen Schäferhundes den Nerv der Zeit. Reinrassigkeit bei Tieren galt in den bürgerlichen Kreisen des 19. Jahrhunderts als erstrebenswert, da man glaubte, auf diese Weise das Verhalten eines Tieres besser und präziser voraussagen zu können.42 Innerhalb von zwölf Jahren stieg die Zahl der als reinrassig anerkannten Tiere von 250 auf rund 13.000.43 Anfang der Dreißigerjahre umfasste das Zuchtbuch bereits mehr als 400.000 Deutsche Schäferhunde.44
Innerhalb weniger Jahrzehnte war der Deutsche Schäferhund so zum Sinnbild des deutschen Hundes aufgestiegen. Wurden um die Jahrhundertwende noch die Doggen des Reichskanzlers Otto von Bismarck respektvoll »Reichshunde« genannt und später dann die Dackel Kaiser WilhelmsII. »als Sinnbild des gemütlichen Deutschen« angesehen, stand fortan von Stephanitz’ Schäferhund für das Deutschtum schlechthin.45
Auf dessen vermeintlich soldatische Tugenden wollen die Nationalsozialisten dann auch im Krieg nicht verzichten. Mit Kriegsbeginn1939 ergehen reihenweise Musterungsbefehle an private Hundehalter. Allein im ersten Kriegsjahr werden schätzungsweise 200.000 Hunde aus deutschen Haushalten eingezogen. Neben dem Deutschen Schäferhund sind vor allem Airedale-Terrier, Dobermann, Rottweiler, Riesenschnauzer und Boxer begehrt. Die Aufgaben der Hunde im Militär haben sich im Vergleich zum Ersten Weltkrieg deutlich verändert: Die Zeit der Sanitäts- und Meldehunde ist vorbei, gerade die großen Rassen sind nun vor allem als Spür- und Wachhunde gefragt. Da die Verluste an der Ostfront besonders hoch sind, werden 1941 die Anforderungen gelockert und nun auch Mischlingshunde — oft abfällig als »Bastardhunde« bezeichnet — gemustert, solange sie eine Schulterhöhe von mehr als 50 Zentimetern haben.46 Kurzerhand wird die ideologische Weltsicht rasch den neuen Gegebenheiten angepasst, wie es auch in anderen Bereichen des NS-Staats so häufig der Fall ist.
Aber zurück zum Deutschen Schäferhund und einem seiner größten Verehrer. Adolf Hitler kann sich keinen anderen Hund an seiner Seite mehr vorstellen, seit er zu seinem 33. Geburtstag am 20. April 1922 seinen ersten Schäferhund bekommen hat. Er war ein Geschenk seiner Parteigenossen. Und da Hitler zum romantischen Kitsch neigt, hat er ihn »Wolf« genannt.47 Denn für den wilden Urahn des Hundes hat er ebenfalls eine gewisse Vorliebe. Im vertrauten Kreis lässt er sich selbst gern mit »Wolf« anreden, unterschreibt private Briefe mit diesem Spitznamen und quartiert sich gerade zu Beginn seiner politischen Laufbahn des Öfteren unter dem Namen »Herr Wolf« in Hotels ein. Mehrere seiner zahlreichen Führerhauptquartiere tragen zudem den Wolf im Namen — wie die »Wolfsschanze« in Ostpreußen, die »Wolfsschlucht« im besetzten Belgien oder »Werwolf« in der Ukraine.
Der Begriff »Werwolf« wird gegen Kriegsende noch eine weitere Bedeutung bekommen, denn SS-Chef Heinrich Himmler verwendet ihn ab 1944 für seine paramilitärischen Verbände, die in den deutschen Grenzgebieten Sabotageakte gegen die vorrückenden Alliierten verüben sollen. Und Propagandaminister Joseph Goebbels stachelt in einer Rundfunkansprache Anfang April 1945





























