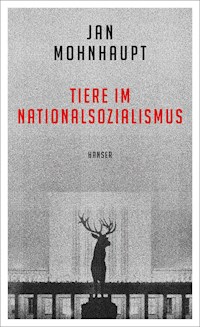Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Architektur, Wissen, Geschichte, Kunst und Sprache – die Spinne und ihr ungeahnter Einfluss auf unsere Kultur Nominiert für den Wissenschaftsbuchpreis 2025 Nützliche Mitbewohnerinnen, Ekelobjekte oder verblüffende Wesen? An Spinnen scheiden sich die Geister. Von manchen bewundert für ihre kunstvollen Netze und das Archaische ihrer Erscheinung, von anderen gefürchtet. Aber warum ist das so? Dieses Buch dringt tief in das Beziehungsgeflecht von Spinnen und Menschen vor. Es zeigt den Einfluss der Spinnen auf unsere Sprache, Wissen, Träume und Geschichte. Warum verglich man Napoleon mit einer Spinne? Wie prägte die christliche Symbolik die Abneigung gegenüber Spinnen? Und wieso wurden gleich drei Weltraummissionen von Spinnen begleitet? Jan Mohnhaupt lockt die Spinne kulturhistorisch aus ihrer dunklen Ecke und zeigt die vielen Verbindungen zwischen Spinne und Mensch. Eine arachnologische Apologie, wie es sie bisher nicht gab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Nützliche Mitbewohnerinnen, Ekelobjekte oder verblüffende Wesen? An Spinnen scheiden sich die Geister. Von manchen bewundert für ihre kunstvollen Netze und das Archaische ihrer Erscheinung, von anderen gefürchtet. Aber warum ist das so? Dieses Buch dringt tief in das Beziehungsgeflecht von Spinnen und Menschen vor. Es zeigt den Einfluss der Spinnen auf unsere Sprache, Wissen, Träume und Geschichte. Warum verglich man Napoleon mit einer Spinne? Wie prägte die christliche Symbolik die Abneigung gegenüber Spinnen? Und wieso wurden gleich drei Weltraummissionen von Spinnen begleitet? Jan Mohnhaupt lockt die Spinne kulturhistorisch aus ihrer dunklen Ecke und zeigt die vielen Verbindungen zwischen Spinne und Mensch. Eine arachnologische Apologie, wie es sie bisher nicht gab.
Jan Mohnhaupt
Von Spinnen und Menschen
Eine verwobene Beziehung
Hanser
1
Nähe
Alphas Ende
»Das Unerlangbare an Tieren: wie sie einen sehen.«
Elias Canetti
An einem Tag im Sommer 2021 ist mein Kindheitstraum erfroren. Sie war zusehends schwächer geworden. Seit Wochen hatte sie nichts mehr gefressen, ihr Leib war eingefallen. Ihre einst gespannte Haltung — stets zum Sprung bereit — war einem Lungern gewichen. Ihre Beine glichen Gebälk, das allmählich unter der eigenen Last nachgibt. Schlaff saß sie da — nur manchmal zuckte eines ihrer Beine, bewegte sich langsam auf und ab, ein zweites tat es ihm gleich. Tattrig trat sie so auf der Stelle, bis alle Bewegung wieder in Schwäche erstarrte. Ob sie litt, lässt sich schwer sagen. Tiere wie sie, die in der Lage sind, verlorene Gliedmaßen zu ersetzen und ganze Organe zu erneuern, nehmen Schmerzen wohl anders wahr als Warmblüter wie wir. Sie würde sterben, das war klar. Aber es konnte noch eine ganze Weile dauern, wenn ich nichts unternahm. Doch ich tat nichts, sah nur zu. Ich scheute mich, ihr Leben zu beenden.
Fast ein Vierteljahrhundert lebte sie schon bei mir, so lange wie kein anderes Wesen. Als ich sie bekommen habe, war ich noch keine vierzehn Jahre und sie erst wenige Wochen alt. Sie war ein Überbleibsel auf einer Börse, wo Menschen wie ich Tiere wie sie kaufen können. Kurz vor Toresschluss hielt mir eine Frau eine Plastikdose hin, wie wir sie von der Fleischtheke im Supermarkt oder vom Olivenstand am Wochenmarkt kennen. Anstatt Weinblättern oder Wurstsalat befand sich darin eine dünne Schicht Erde. Und darauf saß sie, eine junge Vogelspinne der Art Aphonopelma seemanni. Sie war gerade mal so groß wie der Kopf einer Reißzwecke und strahlte in hellem Blau.
Mit jeder Häutung wurde ihr Körper grauer, ihre Beine wurden dunkler, nur auf ihren Knien und Unterschenkeln zeichneten sich weiße Streifen ab. Sie wuchs langsam, aber stetig, bis sie nach mehreren Jahren die Spannweite eines Bierdeckels erreicht hatte.
Je älter und größer sie wurde, desto weniger ließ sie sich auch gefallen. Anfangs lief sie noch davon, wenn ich sie vorsichtig mit einem Finger berührte, doch das änderte sich mit der Zeit. Fühlte sie sich dann in die Enge getrieben, bäumte sie sich drohend auf und schlug mit dem vordersten ihrer vier Beinpaare. Als ich sie vor rund zehn Jahren wieder einmal mit einer Plastikdose einfangen wollte, um sie in ein größeres Terrarium zu setzen, schlug sie so plötzlich und heftig nach dem Deckel, dass dieser in meiner Hand vibrierte. Den Schlag hatte ich nicht einmal kommen sehen.
Vor einigen Jahren musste ich sie erneut umsetzen. Wieder schlug sie zu, nur widerwillig ließ sie sich mithilfe eines Pinsels aus der Dose ins Terrarium drängen. Dort verharrte sie aufrecht drohend. Es dauerte mehrere Stunden, bis sie wieder ihre gewohnte hockende Haltung einnahm.
Hocken beschreibt es jedoch nur im Ansatz. Denn das menschliche Hocken hat nichts mit dem ihrigen zu tun. Es ähnelt vielmehr dem Lauern eines Sprinters im Startblock. Mit dem Unterschied, dass sie stundenlang innehalten konnte, ohne zu erlahmen. Die meiste Zeit hockte sie reglos in einer Ecke und wartete. Ihre Beute ließ sie stets so nah herankommen, bis diese sie beinah berührte. Und manchmal, wenn ich schon dachte, sie sei satt, drehte sie sich blitzschnell in Richtung des Insekts, packte es mit ihren Beinen und schlug ihre Chelizeren, zwei sichelförmige Beißklauen, ins Fleisch.
Ungezählte Grillen und Heuschrecken hat sie so überwältigt. Sie war eine Meisterin der Effizienz, machte keine Bewegung zu viel und verfehlte ihr Ziel fast nie. Ihr Gift war vergleichbar mit dem der Bienen und Wespen; sie brauchte es vor allem zum Verdauen. Für die Jagd war es nicht entscheidend. Seit Jahrmillionen töten ihre Artgenossinnen allein mit der Kraft ihrer Klauen.
Trotz der langen Zeit, die sie bei mir lebte, war unsere Beziehung nie besonders innig, geschweige denn gegenseitig. Von einem Austausch wie mit anderen Heimtieren — ob Hunden, Katzen, Vögeln oder auch Fischen — kann keine Rede sein. Trotz ihrer acht Augen konnte sie nur schlecht sehen, bestenfalls Umrisse erkennen, und auch nur dann, wenn die Lichtverhältnisse günstig waren. Dennoch bemerkte sie mich. Spürte jeden Luftzug meiner Stimme und jede Erschütterung durch meine Schritte.
Sie nach all den Jahren so schwach zu sehen tat mir leid. Zu ahnen, dass sie nach all der Zeit verschwinden würde, machte mich traurig. Ausgerechnet sie, die so langsam gewachsen war, weil ich sie bei Zimmertemperatur hielt und nur mäßig fütterte. Je wärmer man sie hält und je mehr man sie füttert, desto schneller wachsen sie und desto schneller altern sie auch. Weibchen ihrer Art werden in der Regel rund 15 Jahre alt — sie war bereits 24. Doch bald würde auch sie ihre Beine unter den Körper ziehen, wie es Tiere wie sie meistens tun, wenn sie sterben. Ähnlich einer altersschwachen Menschenhand, der jede Kraft fehlt, sich noch zur Faust zu ballen.
Es kommt mir makaber vor, über ihr Sterben zu schreiben. Denn sie war nicht bloß irgendein Tier. Nicht für mich. Seit ich ein Kind war, wollte ich eine wie sie haben. Ich mochte auch ihre Verwandten in der Hecke im Garten und in den Kellerecken. Diese ästhetischen Jägerinnen, die sich so elegant auf ihren acht Beinen durch ihre Netze und Gespinste bewegten und darin den Insekten nachstellten, zogen mich magisch an: Ich lauschte dem Summen der Stubenfliegen, wenn sie sich im Fadengewirr verfingen, schaute zu, wie die Jägerinnen ohne Hektik herbeikamen, die Beute mit ihren Beinen packten und drehend einsponnen, um sie dann mit einem Biss zu töten. Jäh erstarb das Summen und bald darauf auch das letzte Zucken der Fliegenbeine. Gespannt sah ich ihnen beim Fressen zu; es hatte nichts Gieriges, sondern etwas geradezu Gesittetes. Sie ließen sich Zeit, wickelten alles in feinste, glänzende Seide und schienen bedächtig zu kauen. Es war eine andere Welt, so nah und doch so fremd. Es gebe »keine Brücken von ihrer Gesellschaft zur unsrigen«, schrieb der Journalist Horst Stern1975 in seinem Buch Leben am seidenen Faden:
»Weder kann der Mensch Spinnen vermenschlichen, wie er es oft mit höher organisierten Tieren tut, noch kann, umgekehrt, eine Spinne den Menschen vertierlichen, ihn zum sozialen Kumpan machen, wie dies bei vielen Säugetieren im Umgang mit uns zu beobachten ist. Spinnen sind exklusiv, von uraltem erdgeschichtlichen Adel.«1
Dies vollkommen Andere und Fremde war es wohl, das mich von Beginn an begeisterte. Alles an ihnen schien ungewöhnlich, ihr Körper, ihre Bewegungen, ihr Verhalten, ihr Leben. Keine Tiere zum Anfassen, sondern bloß zum Bewundern. Schon bald hatten sie mich in ihren Bann gezogen. Ich fing einige von ihnen, setzte sie in durchsichtige Plastikkästen, in die ich Sand gefüllt und Zweige oder Pflanzenbüschel gesteckt hatte, damit sie dazwischen ihre Netze spinnen konnten, und fütterte sie mit Fliegen. In einer dieser Behausungen baute eine Hauswinkelspinne(Tegenaria domestica) einen erbsengroßen Kokon, aus dem schließlich Dutzende winziger Spinnen schlüpften, die ich wieder ins Freie entließ.
Sechs Jahre Warten
Mit meiner Begeisterung bin ich nicht alleine. Die schottische Schriftstellerin Esther Woolfson schreibt, sie habe schon immer eine »freundschaftliche Beziehung zu Spinnen« gehabt …
»[…] wenn denn ›Beziehung‹ das richtige Wort ist. Ich akzeptiere voll und ganz, dass es einseitig ist, dass ihre einzige Anforderung darin besteht, dass ich mich so weit wie möglich von ihnen fernhalte, aber ich mag und bewundere sie, so wie ich alles bewundern würde, was als ›klein auf der Welt, aber überaus weise‹ beschrieben wird. […] Ich denke, dass man leichter auf der Welt leben kann, wenn man Spinnen mag.«2
Die kleinen, heimischen Arten im Garten und Keller genügten mir bald nicht mehr. Seit ich acht Jahre alt war, wollte ich eine Vogelspinne haben. Als ich meiner Mutter davon erzählte, schaute sie nicht einmal auf, sondern antwortete nur: »Wenn du vierzehn bist und immer noch eine haben willst, dann kriegst du eine.« Klare Ansage. Keine Diskussion. So wartete ich. Sechs lange Jahre.
An einem Tag im Sommer 1997 wurde mein Kindheitstraum wahr. Ich nannte sie ›Alpha‹, weil sie die Erste war. Und weil es zum wissenschaftlichen Namen ihrer Gattung passte: Aphonopelma — was übersetzt auf leisen Sohlen bedeutet. Der Name passte zu ihr, denn kurz nachdem ich sie bekommen hatte, war sie auch schon verschwunden. Ich hatte sie in ein Einweckglas gesetzt, das ich zuvor zur Hälfte mit Erde befüllt hatte. Sooft ich es auch drehte, ich konnte sie darin nirgends finden. Das war’s mit meiner ersten Vogelspinne, dachte ich. Erst Wochen später entdeckte ein Schulfreund sie am Grund des Glases. Sie hatte eine senkrechte Röhre gegraben und an deren Ende eine Höhle angelegt, ganz so wie es ihre Artgenossinnen auf den sonnenbeschienenen Weiden ihrer mittelamerikanischen Heimat seit Menschengedenken und noch viel länger tun. Sie war weder verschwunden noch tot, sie hatte sich bestens eingelebt.
Die Gesellschaft von Tieren ermöglicht es einem, ihr Leben vom Anfang bis zum Ende miterleben zu können. Die wenigsten Heimtiere — abgesehen von Papageien oder Schildkröten — haben eine Lebensdauer, die an unsere heranreicht. Hunde und Katzen werden kaum 20 Jahre alt. Weibliche Vogelspinnen hingegen können 30 Jahre und älter werden. Wer sich für sie entscheidet, lässt sich auf eine einseitige, aber lange dauernde Beziehung ein.
Wie alle Spinnentiere zählen Vogelspinnen zu den sogenannten ›Wirbellosen‹, früher auch als ›Niedere Tiere‹ bezeichnet. Der Name Wirbellose bezieht sich auf ihr fehlendes Innenskelett und verrät zugleich, welchen Stellenwert wir ihnen beimessen. Wirbellos, das meint auch: ohne Rückgrat, charakterlos. Es ist nicht bloß eine biologische Beschreibung ihres Körperbaus, es ist eine moralische Bewertung ihres Wesens.
Dabei sind Spinnen unsere häufigsten Haustiere; keine Wohnung ist vor ihnen sicher, ob wir wollen oder nicht. Dort errichten sie ihre Netze vor unseren Fenstern, hinter unseren Schränken und in den Ecken unserer Zimmer. So schaffen sie sich mit ihrer besonderen Architektur ihre ganz eigenen »tierlichen Orte« inmitten unserer menschengemachten Räume.3
Genau genommen leben nicht sie bei uns, sondern wir bei ihnen. Sie waren lange vor uns da, lebten bereits in den Höhlen, die unsere Urahnen einst aufsuchten, um sich vor Kälte und Nässe, vor Frost und Feinden zu schützen. Später bauten wir unsere Häuser, Dörfer und Städte in ihre Welt. Und sie haben uns hingenommen, sich sogar an uns angepasst. Nur die Frage, inwieweit sie uns persönlich wahrnehmen, bleibt offen. Vermutlich sind wir, wie Horst Stern schrieb, nicht mehr als ein »Schatten auf ihrem Weg«.4 Ein Schatten, der vorübergeht und wieder verschwindet.
Von den heimischen Achtbeinerinnen, die unter und über mir leben, nehme ich Notiz, von ihren Netzen und Kokons in den Zimmerecken, von ihren abgestreiften Häuten hinterm Schrank und von ihren winzigen Kotspritzern auf der Fensterbank. Sie kommen und gehen. Alpha aber war im wahrsten Sinne des Wortes ein Heimtier: Ihr Leben lang saß sie neben meinem Schreibtisch. Achtmal zog sie um. Viermal in eine andere Stadt, was sie kaum zu stören schien, und viermal in ein größeres Terrarium, wogegen sie sich stets sträubte. Solange sie in ihrem gewohnten Raum blieb, blieb sie ruhig. Im Herbst 2019 häutete sie sich zum letzten Mal. In den Jahren danach ließ ihr Jagdtrieb nach, ihre Farben verblassten zusehends.
Ich hatte nicht erwartet, dass sie so alt werden würde. Und vielleicht machte dies den Abschied umso schwerer. Zehn Tage lang rang ich mit mir und drückte mich vor dem Entschluss. Ich hatte Skrupel, sie, die schon so lange bei mir lebte, zu töten. Doch ihr Verfall schritt voran. Zuletzt konnte sie sich kaum noch auf den Beinen halten.
Da sich ihr Kreislauf stets der Temperatur ihrer Umgebung anpasst, war es das Schonendste, sie einzufrieren. Je kälter es würde, desto träger würde auch sie. Als ich ihr Terrarium öffnete, versuchte sie noch einmal, mir zu drohen. Aber sie war schon zu schwach, fiel zur Seite und blieb rücklings liegen. Wie in Zeitlupe bewegten sich ihre Glieder auf und ab, als suchten sie Halt. Behutsam schob ich den Deckel unter sie, schloss die Dose darüber und trug sie zum Eisfach.
24 Jahre, einen Monat, drei Wochen und sechs Tage lebte Alpha bei mir, ohne dass wir uns wirklich kannten. Sie ging, wie sie gelebt hatte. Auf leisen Sohlen. Lautlos schwand sie dahin. Sie erfror, ohne es zu merken.
Vernachlässigte Beziehungen
Alphas Ende steht am Anfang dieses Buches, denn sie war im Grunde auch sein Auftakt, lange bevor ich ahnte, dass ich es schreiben würde. Es handelt von den Beziehungsgeschichten, die Spinnen und Menschen verbinden. Und es ist dadurch zwangsläufig ein einseitiges Buch. Denn es kann ernsthaft nur aus menschlicher Sicht geschrieben sein. Wie sollte ich wissen, was es heißt, eine Spinne zu sein? Und falls ich es wüsste, welche genau? Welche der mehr als 50.000 bekannten Arten soll gemeint sein, wenn von der einen Spinne die Rede ist?
Mit der ›Spinne‹ verhält es sich ähnlich wie mit dem ›Tier‹. Wen meinen wir, wenn wir vom ›Tier‹ sprechen — Menschenaffen, Bärtierchen, alle beide oder am Ende gar uns selbst? Die zoologische Vielfalt ist riesig und die menschliche Einfalt enorm. Oder um es mit dem französischen Philosophen Jacques Derrida zu sagen:
»Jedesmal wenn ›man‹ ›Das Tier‹ sagt, […] im Singular und ohne mehr zu sagen, und dabei behauptet, auf diese Weise alles Lebende zu bezeichnen, das nicht der Mensch wäre, […] sagt […] dieses ›man‹, dieses ›ich‹, eine Dummheit.«5
Im französischen Original ist Derridas Gedanke noch treffender, da sich das französische Wort für »Dummheit« — bêtise — vom Wort bête für »Tier« oder »Bestie« ableitet. Indem sich der ›Mensch‹ also vom ›Tier‹ abgrenzt, entlarvt er sich als ebensolches. Die fortschreitenden Erkenntnisse der Zoologie und Verhaltensforschung zeigen, dass die selbst ernannte ›Krone der Schöpfung‹ in keiner zoologischen Monarchie lebt. Das jedenfalls besagt der Animalismus, dem zufolge wir Menschen Teil der tierlichen*1 Welt, also selbst Tiere sind. Obwohl diese Theorie in ihren Anfängen schon auf Aristoteles zurückgeht, fand sie danach in der Philosophie vor allem mächtige Gegner wie Platon, René Descartes oder Immanuel Kant. Sie gingen davon aus, dass Tiere nicht in der Lage seien zu denken, geschweige denn Vernunft oder Moral zu kennen. Wir wissen jedoch heute, dass eine ganze Reihe nicht-menschlicher Tiere denken kann — Menschenaffen, Ratten, Papageien, Rabenvögel, aber auch Kraken und — wie wir noch sehen werden — wohl auch manche Spinnen (siehe Kapitel Leib).6 Und es kommen immer weitere Arten hinzu. Je mehr Erkenntnisse Zoologinnen und Verhaltensforscher über die Fähigkeiten von Tieren gewinnen, desto mehr bewahrheitet sich die Aussage des Literaturhistorikers Roland Borgards: »Was immer die Menschen können, das kann auch irgendein Tier. […] Was immer die Menschen können, ist Teil ihrer tierlichen Existenz.«7 Auch wir sind bloß Tiere. Dennoch gibt es Unterschiede. Sie offenbaren sich aber selten dort, wo wir es erwarten.
Derrida zufolge hat ein Mensch mit einem Gorilla mehr gemein als ein Gorilla mit einer Spinne.8 Aber eine beinah blinde Vogelspinne, die tief in der Erde lebt, oder eine Seidenspinne in ihrem Radnetz, das einer Parabolantenne gleicht, nehmen ihre Umwelt anders wahr als eine Springspinne, deren Sehkraft sogar die mancher Vögel übertrifft. Die Welt der ersten beiden besteht vor allem aus Schwingungen und Erschütterungen, die der letzten aus Bildern und Formen. Was die Wahrnehmung betrifft, so hat eine Springspinne womöglich mehr mit einer Katze gemein als mit den meisten anderen Spinnen — und damit auch mit uns.
Eine Geschichte der Beziehung(en) von Spinnen und Menschen ist daher immer anmaßend. Denn es stellt sich allein schon die Frage, würden Spinnen — wenn sie eine menschliche Perspektive einnehmen könnten — ein erzählerisches Sachbuch wie dieses hier wählen? Würden sie sich überhaupt einigen können? Oder würde jede Spinne(nart) ein anderes Format bevorzugen? Eine Vogelspinne könnte mit einem Video nichts anfangen, im Gegensatz zu einer Springspinne. Das mag absurd klingen und ist es in gewisser Weise auch, weil unser Wissen über die Wahrnehmungen der Spinnen so gering ist. Wir können nur mutmaßen und deuten, aber es bleibt ein Schattenspiel. Das Licht, das es erzeugt, können wir nicht ergründen. Das ureigene Empfinden der Spinnen bleibt uns verborgen. Wenn wir annehmen, sie hätten keine Persönlichkeit und fühlten keine Schmerzen, dann nur deshalb, weil wir all das nicht bemessen können. Die vermeintlichen Grenzen ihres Seins sind in Wahrheit die Schranken unserer Wahrnehmung.
Wahrscheinlich wäre ihre Wahl der Geschichtsschreibung so unterschiedlich wie die Form ihrer Netze und Behausungen oder die Strategien ihrer Jagd. Wir Menschen im Allgemeinen — und damit auch ich im Speziellen — können nur aus unserer Sicht über sie schreiben. Aber wir können achtsam sein für ihre Sinne, können versuchen, die Grundzüge ihrer Welt in unsere Wahrnehmung aufzunehmen und in unsere Sprache zu übersetzen. Es gilt, ihr Verhalten in unsere schriftliche Welt zu holen. So wie die Historikerin Sandra Swart eine Geschichte vonseiten der Pferde vorschlägt, die nicht bloß eine Geschichte ihrer Reiter sei, so soll dieses Buch zumindest in Teilen eine Beziehungsgeschichte vonseiten der Spinnen sein.9
Schließlich begleiten sie uns seit langer Zeit auf unserem Weg auf der Erde; sie sind uns gefolgt, ohne sich nach uns zu richten. Und wir haben sie wenig beachtet, dafür umso mehr benutzt: Mal diente die ›Spinne‹ uns als Chiffre, mal als Platzhalterin, mal als Gimmick und oft genug bloß als abschreckendes Beispiel. Doch im Sinne einer wirkmächtigen Akteurin, die die Geschichte der Menschen mitbeeinflusst, blieb sie bislang weitgehend unbemerkt.
Spinnen hausen seit ungezählten Generationen unter, über und bei uns. Sie sind stets Wildtiere geblieben — ohne jedes Anzeichen der Domestikation. Damit zählen sie zu jener Gruppe von Tieren, die die kanadische Schriftstellerin Sue Donaldson und der kanadische Philosoph Will Kymlicka als liminal animals bezeichnen, im Deutschen etwas sperrig ›Schwellenbereichstiere‹ genannt. Dabei handelt es sich um Wildtiere, die die menschengemachte Umgebung als ihren Lebensraum nutzen. Aber auch Donaldson und Kymlicka erwähnen in ihrer Auflistung nicht die sichtbarsten Vertreterinnen dieser Gruppe — und das sind neben Insekten wie Fliegen und Mücken nun mal die Spinnen.10
So paradox es auch klingt, vermutlich hat gerade ihre allgegenwärtige Präsenz uns sie so lange übersehen lassen. Damit sind sie nicht alleine. Der bereits erwähnte Literaturhistoriker Borgards sieht in den — ebenfalls oft übersehenen — Flöhen im Werke Franz Kafkas …
»[…] eine Metapher für die seltsame Mischung aus Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Präsenz und Absenz, Dringlichkeit und Verdrängung […], die in unserer abendländischen Tradition mit den Tieren verbunden war und in vielen Belangen noch immer verbunden ist: Die Tiere sind überall, und doch bedarf es einer eigenen Anstrengung, auf diese Allgegenwart angemessen zu reagieren.«11
Diese Beobachtung lässt sich auf unsere Sicht auf die Spinnen übertragen. Je weiter wir uns von der Natur entfernt und diese verformt haben, desto fremder sind uns auch die Spinnen geworden. Wir haben uns von ihnen immer weiter entfernt — und damit vielleicht auch von uns selbst. Um sie zu verstehen, braucht es mehr als bloßes Wissen. Es braucht Empathie für sie. Und Geduld mit uns selbst. Einen ersten Schritt in diese Richtung möchte ich mit diesem Buch machen. Begeben wir uns auf die Spuren der Spinnen. Folgen wir ihren Fäden.
2
Werk
Die Lehre von den Luftschlössern
»Welche feine Elastizität hat der Faden einer Spinne! Und die Künstlerin zog ihn aus sich selbst, zum offenbaren Erweise, daß sie auch in ihren Trieben und Kunstwerken eine wahre Künstlerin sei, eine kleine Weltseele.«
Johann Gottfried Herder
Die Fäden der Spinnen sind dünn und lang. Wo sie beginnen, wo sie enden, können wir kaum ermessen. Sie spannen sich über alle Zeiten und Orte der Menschen hinweg; sie reichen vom Altertum bis ins All. Mindestens.
Es gibt verschiedene Weisen, sich der Spinnenseide und den daraus geschaffenen Werken zu nähern: über ihre Form und ihren Zweck, ihre Bestandteile und Bedingungen, ihre Entstehung und Bedeutung. Spinnennetze lieferten den Menschen seit jeher Anleitungen für ihr eigenes Bauen und Denken. Sie dienten ihnen als Sinnbild feingliedriger Systeme — sei es jenes der menschlichen Nerven oder der kosmischen Galaxien. Spinnennetze, wohin wir auch schauen.1
Doch sie ziehen auch Unmut auf sich. Zum einen, weil sie oft an den falschen Orten hängen. So gelten Spinnen auch als Zeichen der Unreinheit — Spinnweben weisen auf Stillstand und Nichtstun hin, nicht der Spinnen, sondern der Menschen. Wo die einen nicht hinlangen, nutzen die anderen bald den Raum, ob hinter dem Schrank, vor dem Fenster, an der Decke oder unter der Treppe. Ihr ›Fleiß‹ ist Beweis unseres Müßiggangs. Und zum anderen, weil Menschen seit Langem versuchen, es aber bislang nicht geschafft haben, die Netze und die Seide der Spinnen für ihre Zwecke zu nutzen, so wie sie es seit langer Zeit mit den Werken von Bienen und Faltern wie den Seidenspinnern tun. Die Spinnen haben viele ihrer Geheimnisse für sich behalten, auch das ihrer Seide. Sie führen uns dadurch vor Augen, dass wir mit unserem Hang zur Ordnung nie weit kommen und unsere Erkenntnis stets beschränkt bleibt.
Dabei sind viele Eigenschaften dieses Stoffes, aus dem Träume wie Räume gemacht sind, längst bekannt. Etwa, dass es sich dabei um einen wahrlich uralten Stoff handelt. Schon die ›Urspinne‹ Attercopus fimbriunguis— eine Vorfahrin der heutigen Spinnen — konnte Seide spinnen. Sie lebte vor rund 400 Millionen Jahren im Devon, jenem Erdzeitalter, in dem sich das Leben erstmals an Land wagte. Seide herzustellen war vermutlich eine Anpassung an die neuen Lebensbedingungen außerhalb des Wassers. Die uns bekannten Webspinnen begannen sich vor rund 250 Millionen Jahren zu entwickeln. Vor 130 bis 120 Millionen Jahren fingen sie an, Radnetze zu weben, wie wir sie von den heimischen Kreuzspinnen oder den tropischen Seidenspinnen kennen. Vorausgegangen war dem wohl ein prähistorisches Wettrüsten. Als der Boden vor lauter Achtbeinerinnen den Sechsbeinern zu unsicher wurde, erhob sich ein Teil von ihnen in die Lüfte. Die Spinnen hatten vorerst das Nachsehen. Sie mussten reagieren und taten es. So fingen viele von ihnen an, Fallstricke zu legen und Netze zu spannen. Allerdings blieb das Radnetz eher die Ausnahme. Nur rund 15 Prozent aller Webspinnen bauen eines. In ihrer Gestalt sind Spinnennetze weitaus vielfältiger und andere Formen deutlich häufiger.2
Nicht alle Spinnen bauen Netze, aber alle Spinnen spinnen. Deshalb heißen sie auch, wie sie heißen: Araneae, Webspinnen. Ob Kreuzspinnen oder Schwarze Witwen, Vogelspinnen, Wolfsspinnen oder Springspinnen. Sie alle eint, dass sie körpereigene Seide herstellen und nutzen, etwa zum Bau ihres Unterschlupfes oder zum Einwickeln ihrer Beute. Zur Jagd wählen sie jedoch verschiedene Strategien. Die einen, wie die Vogelspinnen, verlassen sich auf ihre Schnelligkeit und Stärke; andere, wie die Springspinnen, setzen auf Sprungkraft, Sehvermögen und Schläue, aber dazu später mehr (siehe Kapitel Leib). Andere wiederum haben das Talent entwickelt, mit größter Akribie und in mannigfaltiger Form Netze zu weben. Um diese Netzbauerinnen und Fallenstellerinnen geht es in diesem Kapitel.
Neid und Nähte
In Jahrmillionen haben sie die unterschiedlichsten Formen von Seide entwickelt. Seide zum Abseilen und Sich-treiben-Lassen, zum Brückenschlagen, Fesseln und zum Schutz der eigenen Brut.3
Der Faden einer Spinne ist 50 bis 100 Mal dünner als ein menschliches Haar, aber viel elastischer; er ließe sich auf eine Länge von 80 Kilometern dehnen, bevor er unter seinem eigenen Gewicht reißt. Ein Faden von einem Zentimeter Dicke könnte bis zu acht Tonnen Last tragen. Wie reißfest Spinnenseide konkret ist, wollte 2010 das Team der ARD-Wissenssendung Kopfball herausfinden. Behilflich waren dabei Forscherinnen und Forscher der Universität Oxford, vor allem aber australische Seidenspinnen der Art Trichonephila edulis. Die Spinnen lieferten 28.000 einzelne Fäden, die jeweils nur einen Durchmesser von 0,005 Millimetern hatten und anschließend zu einem Seil verdreht wurden. Dieses war stabil genug, um eine 70 Kilogramm schwere Reporterin aus dem Becken eines Schwimmbades zu heben. Es gibt zwar natürliche und künstliche Stoffe, die die Spinnenseide in einzelnen Eigenschaften überbieten — Gummi ist viel elastischer, Stahl oder die Kunstfaser Kevlar sind um einiges reißfester. Doch im Gegensatz zu diesen Stoffen ist Spinnenseide äußerst vielseitig, da sie verschiedenen Ansprüchen genügt. Sie ist leicht, dehnbar und reißfest. Das US-Militär und andere Armeen versuchen daher seit Langem, schusssichere Westen aus künstlicher Spinnenseide herzustellen — bislang ohne Erfolg.4
Hinzu kommen ihre chemischen Vorzüge: Obwohl sie weitgehend aus Eiweiß besteht, ist sie antibakteriell und schimmelt nicht. Das liegt daran, dass der Faden einen leicht sauren pH-Wert von vier besitzt. Zudem wird sie vom menschlichen Körper nicht abgestoßen. All das hat sie zu einem begehrten Stoff gemacht. Biotech-Konzerne erforschen, wie sich Gene aus der Seide isolieren und in Bakterien einsetzen lassen, um so unabhängig von den Spinnen große Mengen Seide zu erhalten. Eines Tages könnten sich daraus künstliche Herzklappen, Sehnen und Bänder sowie Verbände für schwere Verbrennungen herstellen lassen.
Die Medizinerin Anna Bartz von der Universitätsklinik Bonn hat in ihrer Doktorarbeit erforscht, ob sich Spinnenseide als »Trägerstruktur zur Behandlung von Knochendefekten« einsetzen lässt. Als Grundlage diente dabei ein Gerüst aus Seidenfäden. Darauf siedelte Bartz Stammzellen an, aus denen Knochenzellen entstehen sollten. Die benötigte Seide lieferten ihr weibliche Seidenspinnen der Gattung Nephilaaus dem Tierpark Bochum sowie dem Aquazoo Düsseldorf. Bartz’ Forschungen ergaben, dass sich die Seide bestens eignet, um darauf menschliche Knochenzellen zu züchten. Denn die Spinnenseide fördert die Knochenneubildung und wird selbst mit der Zeit vom Körper abgebaut. Doch die Forschung ist erst der Anfang. Bis die Methode bei Operationen zum Einsatz kommen kann, dürften laut Bartz noch 15 bis 20 Jahre vergehen.5
Die medizinische Nutzung von Spinnenseide ist noch längst nicht etabliert — oder eher, sie ist es nicht mehr. Denn ihre Arzneigeschichte reicht weit zurück. Schon in der Antike wurde das Spinnennetz, das tela araneae, wie es auf Latein hieß, zur Wundheilung, gegen Fieber und Malaria verwendet.6 Auch die Heilkundlerin und Universalgelehrte Hildegard von Bingen erwähnte seine lindernde Wirkung bei Geschwüren, hielt es ansonsten aber für nutzlos, was wohl ganz dem Wissensstand des 12. Jahrhunderts entsprach.
Die medizinische Verwendung des Netzes verlor in Europa im Laufe der Frühen Neuzeit weiter an Bedeutung, auch wenn der Aberglaube sich in der Heilkunde als hartnäckig erwies: Der Naturmaler Eleazar Albin behauptete noch 1736: »Ihr Netz mit der Zugabe von Froschlaich ist ein ausgezeichnetes blutstillendes Mittel für Nasenbluten oder jede andere leichte Wunde am Körper.«7
Dabei war der Wissensstand zu dieser Zeit eigentlich schon ein anderer. Bereits ein Jahrhundert zuvor hatte der englische Arzt und Philosoph Thomas Browne in seinem Werk Pseudodoxia Epidemica viele solcher Mythen anhand von Experimenten überprüft und als Irrtümer entlarvt. Doch das erlangte Wissen setzte sich nur langsam durch. So hatte auch Browne feststellen müssen, dass die größten Feinde der Erkenntnis der Aberglaube und das starre Festhalten an antiken Lehrmeinungen waren. So paradox es auch klingen mag: Ansichten wie jene Albins waren auch im 18. Jahrhundert schon nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber oft noch das Maß aller Dinge.8 Darüber hinaus versuchten Menschen in Europa zunehmend, die Spinnenseide auch als Webstoff für sich zu nutzen. In anderen Teilen der Welt hatte dies bereits eine lange Tradition: Im westlichen Afrika wurden Spinnenkokons als Membranen für Instrumente benutzt, um damit Tierstimmen zu imitieren. Auf dem Vanuatu-Archipel im Pazifik webten die Menschen aus Radnetzen von Seidenspinnen der Gattung NephilaHauben und Umhänge für ihre Initiationsriten. Und in Papua-Neuguinea setzen Menschen seit Generationen die metergroßen Netze zum Fischfang ein.9
Solch große Exemplare von Spinnen, die gleichermaßen ausladende Netze spinnen, gibt es in Europa nicht. Wohl auch deshalb blieb hier die textile Nutzung von Spinnenseide vorerst nur ein Traum. Erste Berichte über ihre Verwendung finden sich zwar seit dem 17. Jahrhundert, doch die Menschen wussten das Werk der Spinnen nicht dauerhaft zu nutzen. Es gelang ihnen einfach nicht, ihnen ihr Geheimnis zu entlocken. Deshalb schimpften sie sie ein eigensinniges Tier, das sie nicht an seinen Fertigkeiten teilhaben ließ. Ganz anders als die Biene, die den Menschen Honig und Wachs lieferte. Die Spinnen betrieben im Gegensatz dazu ein »eigennütziges« Handwerk. Davon zeugen zahlreiche Gedichte, Märchen und Fabeln, in denen Spinnen als »unnütze Weberinnen« herhalten mussten.10
Als an der Schwelle vom 17. zum 18. Jahrhundert ein Gelehrtenstreit darüber entbrannte, inwieweit die Antike noch als Vorbild für die Künste der Gegenwart tauge, griff der irische Schriftsteller Jonathan Swift dies in seinem Werk Battle of the Books auf. Zur Illustration des Disputs bediente er sich der ›Biene‹ und der ›Spinne‹. Während das Honig und Wachs produzierende Insekt für das »materiell-gemeinschaftliche« Altertum stand, verglich er die aufstrebenden Naturwissenschaften der Moderne mit der »flüchtige[n] wie egomanische[n] Befestigungsarchitektur« des Spinnennetzes.11
Neben den Bienen wurden oft auch die Seidenraupen den Spinnen gegenübergestellt und wegen ihres selbstlosen Tuns gelobt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Seidenraupen dies stets mit dem Leben bezahlen, da sich der Faden ihres Kokons erst beim Kochen löst. Die Puppen werden bei lebendigem Leibe gesiedet. In Johann Christoph Friedrich Haugs Gedicht Der Seidenwurm und die Spinne aus dem frühen 19. Jahrhundert beschwert sich eine Spinne beim Seidenwurm, dass die Menschen, »die dich verschonen, mich befehden!«. Dieser antwortet darauf: »[D]ein Geweb’ ist zart und auserlesen, ja künstlerisch, doch nutzlos; meines nützt.«12 Diese materialistische Sicht war nicht auf den europäischen Raum beschränkt: In einem arabischen Märchen sagt die Seidenraupe zur Spinne: »Mein Gewebe wird das Gewand der Könige und das deinige ist für die Mücken.«13
Doch der Seidenbau, der in China seit mindestens 5000 Jahren existiert und im Mittelmeerraum seit der Antike bekannt ist, blieb in Europa ein aufwendiges und anfälliges Unterfangen; Krankheiten warfen die Zucht der Raupen zudem häufig zurück.
All das bewog den französischen Beamten François Xavier Bon am Beginn des 18. Jahrhunderts, Textilien aus Spinnseide herzustellen, um so eine Alternative zur Seidenraupenzucht zu schaffen. Er ging dabei so vor, wie es schon seit Jahrtausenden mit den verpuppten Larven des Seidenspinners gehandhabt wurde: Er ließ Eikokons von Spinnen sammeln, bis er rund 350 bis 400 Gramm Seide beisammenhatte. Diese klopfte er mit einem Stock aus und wusch sie in warmem Wasser, bis das Wasser klar wurde. Anschließend legte er die Seide in einen großen Topf mit Seife, Salpeter und einigen Stücken Gummi Arabicum und ließ das Ganze zwei bis drei Stunden lang auf kleiner Flamme köcheln. Anschließend wusch er die Seide erneut und trocknete sie mehrere Tage, bevor sie kardiert wurde. So entstand ein aschgrauer Faden, der dünner, aber fester als jener der Seidenraupen war.
Der Aufwand war immens, der Ertrag gering. Immerhin ließen sich daraus mehrere Paare Handschuhe und Strümpfe fertigen, die Bon1709 der Französischen Akademie der Wissenschaften vorlegte. Im Jahr darauf veröffentlichte er seine Erkenntnisse in einer Abhandlung, die mehrfach übersetzt wurde: Bon hob darin vor allem die Fruchtbarkeit und Effizienz der Spinnen hervor. Im Vergleich zu Seidenspinnern brächten sie deutlich mehr Nachkommen hervor. Die Schmetterlingsraupen seien zudem anfällig für alle möglichen Krankheiten und müssten stets gepflegt werden, wohingegen die Spinnen im Spätsommer von ganz alleine aus ihren Eiern schlüpften. Und während von den 700 bis 800 Jungspinnen aus dem Kokon einer Gartenkreuzspinne nur wenige starben, schafften es von hundert Seidenraupen keine 40, sich zu verpuppen. Bons Ziel war es daher, Spinnen in Zukunft ebenfalls in Räumen zu züchten. Als weiteren Vorteil der Spinnenseide erwähnte er auch deren medizinische Wirkung. Sie wirke wie ein Balsam, der kleine Wunden vor der Luft schütze und heile.14
Die Akademie beauftragte daraufhin unter anderem den Naturforscher René-Antoine Ferchault de Réaumur — dem wir noch in einem späteren Kapitel (siehe Kapitel Heim) begegnen —, die Ergebnisse zu überprüfen. Réaumur fand vor allem ästhetische und wirtschaftliche Nachteile. Er kam zu dem Schluss, dass Spinnenseide unansehnlicher als Raupenseide und zudem unrentabel sei. Dies begründete er mit dem hohen Bedarf an Spinnen: Während für 500 Gramm Seide rund 2500 Seidenraupen nötig seien, bräuchte es für die gleiche Menge mehr als 55.000 Spinnen. Zudem müssten diese Spinnen mit lebender Nahrung versorgt und zugleich davon abgehalten werden, sich gegenseitig zu fressen, was ihre Unterbringung wiederum aufwendig mache.15 Die Bedenken blieben bestehen — und Stoffe aus Spinnfäden eine extravagante Rarität. 50 Jahre später unternahm der spanische Jesuit Abbé Ramon de Termeyer einen neuen Versuch. Obwohl er jahrelang experimentierte und eine Maschine zum Melken der Spinnen entwarf, konnte er nur ein paar Hundert Gramm Seide gewinnen. Auch ihm gelang es nicht, Spinnenseide in so großer Menge zu sammeln, dass sie eine Konkurrenz zum traditionellen Seidenbau hätte werden können.16
Es war vor allem ein Problem der Masse. Die Spinnennetze waren zu klein, die Spinnenhaltung zu aufwendig und die Techniken der Menschen zu unausgegoren, um die Fäden zu Gold zu spinnen. Es sollte noch ein Jahrhundert dauern, bis Meldungen von großen Spinnen, die in den Tropen hausen und riesige goldene Netze spinnen, übers Meer nach Europa gelangten.
Erneut war es ein Jesuit, der französische Pater und Arachnologe Paul Camboué, der sich der Sache annahm. 1882 hatte es ihn nach Madagaskar verschlagen, dort lernte er jene Tierart kennen, die die Einheimischen in ihrer Sprache Malagasy Halabé nennen — die Goldene Seidenspinne(Trichonephila inaurata). Die Radnetze der Weibchen können einen Durchmesser von bis zu anderthalb Metern erreichen. Camboué sah die Gelegenheit, mit diesen Tieren die Seidengewinnung in industriellem Stil anzustoßen. Dazu gründete er eigens eine Fabrik in der Hauptstadt Antananarivo. Die Tiere bekam er aus der näheren Umgebung. Einheimische Sammlerinnen brachten täglich Hunderte weiblicher Seidenspinnen. Um die Seide zu gewinnen, nutzten Camboué und seine Gehilfen eine eigens dazu entwickelte Maschine; es handelte sich um ein Gestell aus Kork, in das sie die Spinnen einspannten. Um sie zum Spinnen anzuregen, hielten sie ihnen Fliegen vor. Der abgelassene Faden wurde mit einer Spindel aufgefangen. Dies geschah nicht einzeln, sondern gleichzeitig und in großer Zahl. Die fixierten Spinnen wurden in einer Art Setzkasten aufgereiht, von wo aus die Fäden auf einer Spule zusammenliefen.
Bei jedem Melken kamen bis zu 600 Meter Faden zusammen. Eine Spinne bekam den katholisch-kolonialen Eifer besonders zu spüren, innerhalb eines Monats sollen ihr ganze vier Kilometer Faden entzogen worden sein. Pro Monat mussten die Spinnen mehrmals ins Korkgestell. Wie oft, lässt sich kaum überprüfen. Die Informationen darüber gehen auseinander. Mal heißt es, die Spinnen seien fünf bis sechs Mal gemolken worden, bevor sie starben. Ein anderes Mal ist die Rede davon, sie hätten zwei bis drei »Abwicklungen« durchstehen müssen, bevor sie sich für einige Wochen wieder im Park erholen durften. Monatlich sollen so mehr als 36 Kilometer Faden zusammengekommen sein. Camboué ließ die gewonnene Seide zur Prüfung in ein Labor nach Lyon schicken. Auf der Weltausstellung in Paris 1900 wurde ein spinnseidener Baldachin aus seiner Fabrik präsentiert. Die Nachricht ging um die Welt. Beinah unglaublich muteten die Eigenschaften dieses wundersamen Garns an, das golden glänzte, um ein Vielfaches dünner, aber auch reißfester und leichter als herkömmliche Seide war. Das damals populäre US-amerikanische Wochenmagazin The Literary Digest sah bereits den neuen »Rivalen des Seidenwurms« gekommen und fragte: »Wird dies die Seide der Zukunft sein?«
Aber auch diesmal gelang es nicht, Spinnseide zum Massenprodukt zu machen. Das Labor in Lyon war zwar beeindruckt von der Qualität, sah aber keine Möglichkeit, die Spinnen im gemäßigten Klima Europas zu züchten. Es hätte enormen Aufwand bedeutet, die Spinnen einzeln zu pflegen und zu füttern. Anders als Seidenraupen lassen sie sich nicht auf engem Raum in Massen halten, da sie sonst übereinander herfallen. »In den Tropen wäre bei billigen Arbeitskräften noch am ehesten an so etwas zu denken«, schrieb der deutsche Naturwissenschaftler Kurt Floericke ganz im Geiste des Kolonialismus.17
Es sollten noch einmal hundert Jahre vergehen, bis die Versuche Bons, Termeyers und Camboués fortgesetzt wurden: 2004 stellten der britische Textilexperte Simon Peers und der US-amerikanische Designer Nicholas Godley einen Schal und ein Cape aus goldener Nephila-Seide vor, die sie nach Camboués Vorlagen angefertigt hatten. Geholfen hatten ihnen dabei ein Team aus 80 Personen und mehr als eine Million weiblicher Seidenspinnen. Jeder wurden ungefähr 400 Meter Seidenfaden per Spule abgenommen. Bis alle Tiere gefangen, gemolken und wieder in die Freiheit entlassen, bis die einzelnen Spinnfäden versponnen und zu den Textilien verwoben waren, vergingen drei Jahre. 350.000 Euro flossen in das Projekt. Die beiden Werke befinden sich heute im Victoria and Albert Museum für Kunstgewerbe in London.18
Zu jener Zeit, als Termeyer noch versuchte, den kleinen Kreuzspinnen im großen Stil Seide zu entlocken, kam die Idee zu einer anderweitigen Verwendung der Spinnenseide auf. Für diese bedurfte es auch keiner rauen Mengen, sondern bloß eines einzelnen Fadens: 1755 schlug der italienische Naturwissenschaftler Felice Fontana vor, für die Fadenkreuze von Fernrohren und Mikroskopen Fäden von Kreuzspinnen anstatt derer von Seidenraupen zu verwenden. Diesem Beispiel folgten weitere Wissenschaftler, allen voran Astronomen. Diese Methode etablierte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts weiter und hielt sich bis weit ins 20. Jahrhundert.19 Wohin anfangs nur ihre Blicke reichten, sollten eines Tages die Menschen selbst reisen. Und mit ihnen auch Spinnen. Aber dazu später mehr.
Eine andere Nutzung hat vor einigen Jahren der japanische Chemiker Shigeyoshi Osaki von der Medizinischen Universität Nara erforscht. Osaki befasste sich bereits seit mehreren Jahren mit Spinnenseide, diesmal erforschte er, wie sich aus den Seidenfäden Saiten für Violinen entwickeln ließen. Dazu nutzte er die sogenannte »dragline«-Seide, jene Fäden, die die Spinnen weben, um sich abzuseilen. Um diese in der benötigten Menge zu erhalten, wurde 300 südostasiatischen Seidenspinnen der Art Nephila pilipes Seide entnommen. Für jede Schnur ließ Osaki zwischen 3000 und 5000 einzelne Fäden zu einem Bündel zusammendrehen, drei von diesen wiederum ergaben eine Saite. Das Ergebnis ließ sich hören: Wegen der besonderen Struktur der Spinnenseide erzeugen diese Spinnensaiten eine hohe Tonqualität. Vermutlich liegt das an der Struktur der Fäden, die den Spinnen in Form ihres Netzes auch als eine Art Klangkörper dienen, an dessen Schwingungen sie spüren, wo sich ein Insekt im Netz verfangen hat.20
Trotz dieser langen Geschichte ist die Erforschung der Spinnenseide bis heute ein Nischenthema geblieben. Es ist schwierig, Fördergelder zu erhalten. Im deutschsprachigen Raum werde nur an wenigen Orten dazu geforscht, »vor allem von Frauen«, sagt Anna Bartz.21
Zwischen Kunst- und Handwerk
Was ist das Spinnennetz — ist es ein Gegenstand, ein Gerüst oder schon ein Raum? Ist es Arbeit oder Kunst? Generationen von Gelehrten haben sich den Kopf darüber zerbrochen, ob Tiere Kunst hervorbringen können. Das kommt sicher auch auf die Definition von Kunst an, die je nach Epoche variierte. Ursprünglich war damit etwas »Gemachtes« gemeint, das im Gegensatz zum »Natürlichen« stehe, im Sinne einer bestimmten (menschlichen) Fertigkeit oder Kenntnis.22
Bereits der griechische Universalgelehrte Aristoteles nannte das Spinnennetz »kunstreich«.23