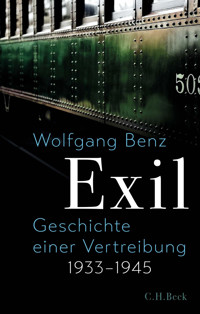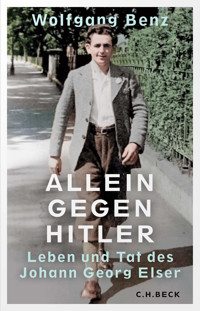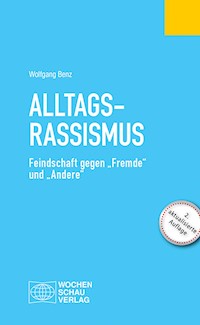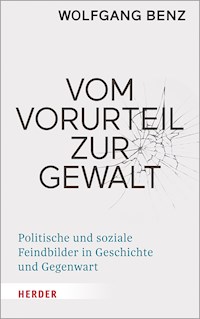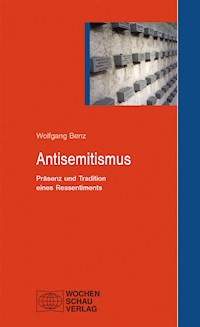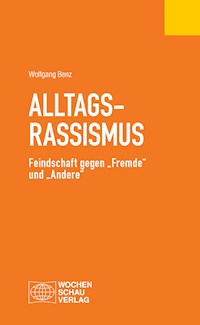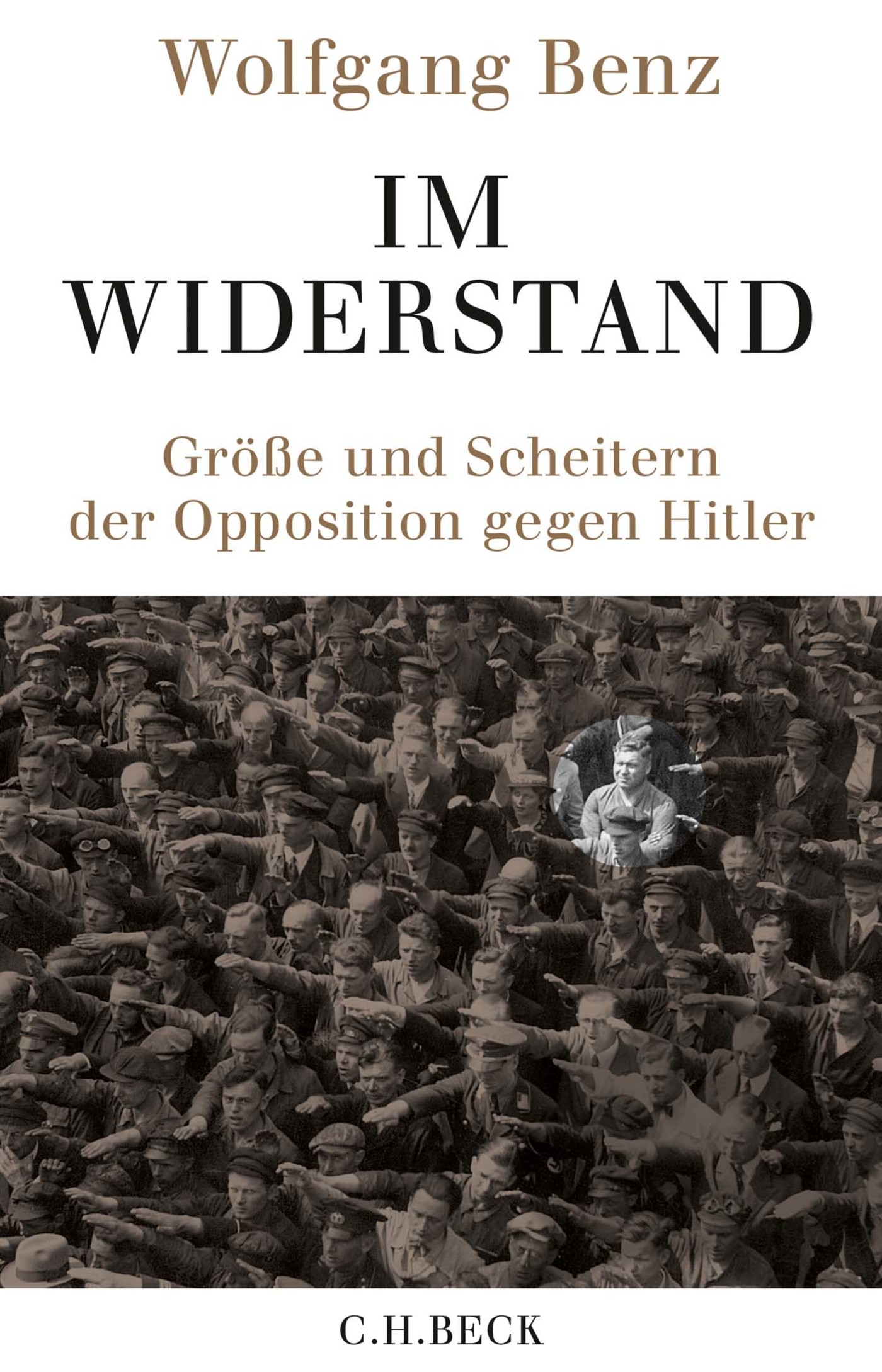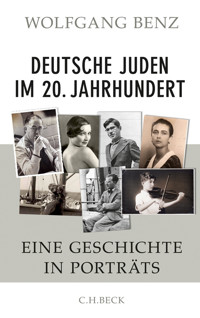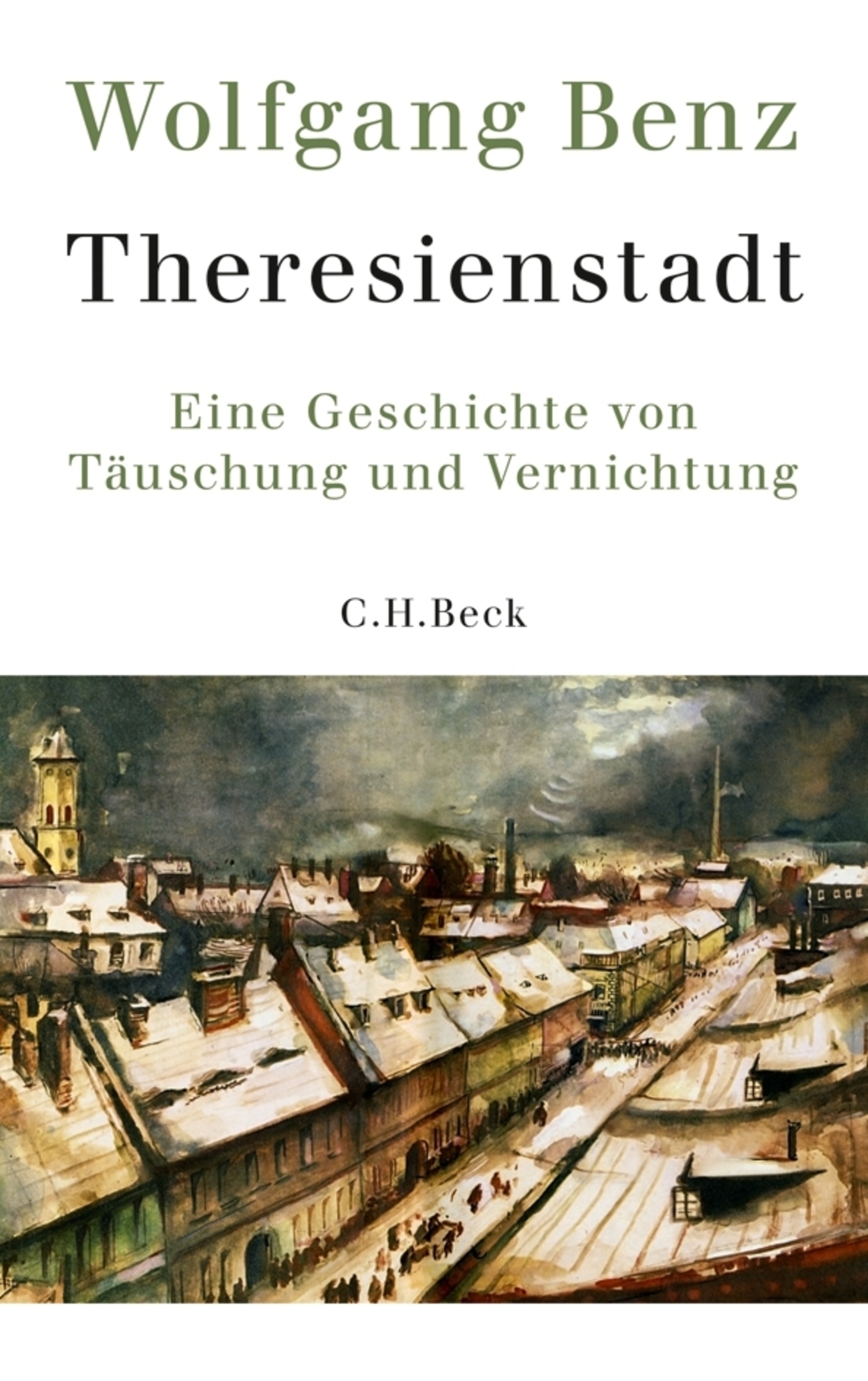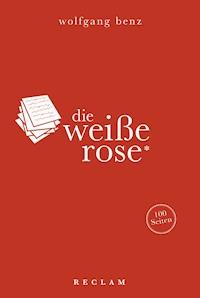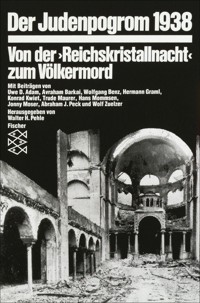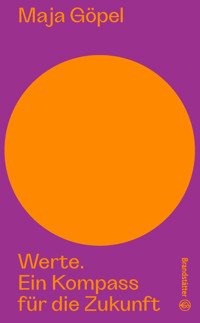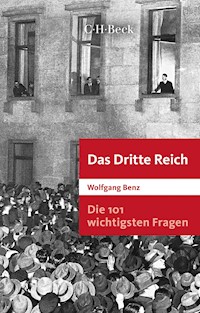
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"EIN BUCH, DAS JEDER LESEN SOLLTE, DER SICH FÜR DIE NS-DIKTATUR INTERESSIERT." SVEN-FELIX KELLERHOFF, DIE WELT
Woher kommt der Begriff "Drittes Reich"? Was war der Arierparagraph? – Welche Rolle spielten die Kirchen im Dritten Reich? – War Hitler ein genialer Feldherr? – Was wussten die Deutschen vom Holocaust? Diese und andere Fragen beantwortet Wolfgang Benz knapp, kenntnisreich und für jeden verständlich. Insgesamt bieten die Fragen und Antworten, die nach Themen wie "Aufstieg zur Macht", "Ideologie", "Strukturen", "Protagonisten", "Ereignisse" gegliedert sind, eine ebenso umfassende wie sachkundige Einführung in die Geschichte des Dritten Reiches.
- Eine ideale Einführung für alle, die sich über die Geschichte des "Dritten Reiches" informieren möchten
- Über 20.000 verkaufte Exemplare
- Von einem der renommiertesten Zeithistoriker
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch
Woher kommt der Begriff «Drittes Reich»? – Was war der Arierparagraph? – Welche Rolle spielten die Kirchen im Dritten Reich? – War Hitler ein genialer Feldherr? – Was wussten die Deutschen vom Holocaust? Diese und andere Fragen beantwortet Wolfgang Benz knapp, kenntnisreich und für jeden verständlich. Das Buch enthält ganz einfache Fragen, die teilweise gar nicht so leicht zu beantworten sind, aber auch schwierige Fragen mit überraschend einfachen Antworten. Insgesamt bieten die Fragen und Antworten, die nach Themen wie «Aufstieg zur Macht», «Ideologie», «Struktur», «Protagonisten», «Ereignisse» gegliedert sind, eine ebenso umfassende wie sachkundige Einführung in die Geschichte des Dritten Reiches.
Über den Autor
Wolfgang Benz war bis 2011 Leiter des Instituts für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Er ist einer der renommiertesten Zeithistoriker Deutschlands und hat zahlreiche Publikationen zur Geschichte des Nationalsozialismus, des Holocaust und des Widerstands vorgelegt. Zuletzt erschien bei C.H.Beck: Im Widerstand. Größe und Scheitern der Opposition gegen Hitler (2018).
Wolfgang Benz
Die 101 wichtigsten Fragen
Das Dritte Reich
Inhalt
Vorbemerkung
Aufstieg zur Macht
1. Was steht im Parteiprogramm der NSDAP?
2. Welche Bedeutung hatte das Ermächtigungsgesetz?
3. Woher kommt der Begriff «Drittes Reich»?
4. Hat die Großindustrie die NSDAP finanziert?
Ideologie
5. Was war der «Arierparagraph»?
6. Was bedeutet Lebensraum?
7. Was ist Antisemitismus?
8. Was heißt Rassenlehre?
9. Was bedeutet «arisch»?
10. Welche Rolle hatten Frauen im Dritten Reich?
11. Wer erhielt das Mutterkreuz?
12. Was war «entartete Kunst»?
13. Gab es eine nationalsozialistische Kunst?
14. Hat der Nationalsozialismus zur Modernisierung Deutschlands beigetragen?
15. Was bedeutet «völkisch»?
16. Wodurch unterschied sich der Faschismus vom Nationalsozialismus?
17. Woher kam das Hakenkreuz?
Strukturen
18. Was bedeutet Großdeutschland?
19. Was geschah auf den Reichsparteitagen in Nürnberg?
20. Was bedeuteten die Nürnberger Gesetze?
21. Was war «Euthanasie»?
22. Was war die Gestapo und wie funktionierte das Reichssicherheitshauptamt?
23. Was tat der Reichsarbeitsdienst?
24. Wie wurden Fremdarbeiter rekrutiert und behandelt?
25. Was war das «gesunde Volksempfinden»?
26. Was bedeutete «Einheit von Partei und Staat»?
27. Wo lag Germania?
28. Was war die Volksgemeinschaft?
29. Welche Funktion hatten die Medien im Dritten Reich?
30. Wer hat den Volkswagen erfunden?
31. Was waren Volksempfänger?
Institutionen
32. Welche Rolle spielten die Kirchen im Dritten Reich?
33. Wie viele Konzentrationslager gab es?
34. Was waren Todeslager?
35. Was machte der Volksgerichtshof?
36. Was war ein Ghetto?
37. Welches Ziel hatte der Kreisauer Kreis?
38. Was war das «Winterhilfswerk»?
39. Was war der Volkssturm?
40. Wer war in der SA?
41. Was unterschied die Waffen-SS von der SS?
42. Was war der BDM?
43. Wie gefährlich war der Werwolf?
44. Was machte der Reichsnährstand?
45. Welchen Zweck hatte die Deutsche Arbeitsfront?
46. Wozu diente die Organisation Todt?
Protagonisten
47. Wer wohnte auf dem Obersalzberg?
48. War Hitler ein genialer Feldherr?
49. Wer war der Wüstenfuchs?
50. Wie mächtig war Rudolf Heß, der «Stellvertreter des Führers»?
51. War Göring weniger brutal als Himmler?
52. War Joseph Goebbels ein Intellektueller?
53. Hat Albert Speer von den Verbrechen des Regimes gewusst?
54. Hatte Leni Riefenstahl etwas mit Politik zu tun?
55. Wer war Martin Bormann?
56. Wer war Reichsjägermeister?
57. Welche Funktion hatten Gauleiter?
Ereignisse
58. Wie verlief die «Machtergreifung»?
59. Was geschah beim «Röhmputsch»?
60. Wie kam es zur Fritsch-Krise?
61. Worüber wurde das Münchner Abkommen geschlossen?
62. Was war die «Aktion Reinhardt»?
Verfolgung und Widerstand
63. Was bedeutet Holocaust?
64. Wer hat Widerstand gegen das NS-Regime geleistet?
65. Was geschah in der «Reichskristallnacht»?
66. Was war ein Gaswagen?
67. Warum sind nicht alle Juden emigriert?
68. Warum scheiterte das Attentat am 20. Juli 1944?
69. Wie behandelte die Wehrmacht Deserteure?
70. Was wurde auf der Wannsee-Konferenz beschlossen?
71. Was waren «Arbeitserziehungslager»?
72. Was war Sippenhaft?
73. Was enthielt der «Generalplan Ost»?
74. Was wussten die Deutschen vom Holocaust?
75. Warum wurden Homosexuelle verfolgt?
76. Weshalb kamen Zeugen Jehovas ins KZ?
77. Seit wann wurden Sinti und Roma verfolgt?
Legenden
78. Wer hat die Autobahn erfunden?
79. Welche «Wunderwaffen» kamen zum Einsatz?
80. Wurden im «Lebensborn» Menschen gezüchtet?
81. Wo lag die Alpenfestung?
82. Hat die Wehrmacht Verbrechen begangen?
83. Wer war schuld am Reichstagsbrand?
Krieg
84. Wie begann der Zweite Weltkrieg?
85. Woher kommt der Ausdruck «Achsenmächte»?
86. Was war das Generalgouvernement?
87. Ab wann gab es Lebensmittelkarten?
88. Wozu diente der Hitler-Stalin-Pakt?
89. Was ist ein Blitzkrieg?
90. Wie wurde die Rüstung für den Krieg finanziert?
91. Was war der Kommissarbefehl?
Folgen
92. Was wurde auf der Potsdamer Konferenz beschlossen?
93. Welche Ziele wurden mit dem Morgenthau-Plan verfolgt?
94. Was beabsichtigte die Umerziehung der Deutschen?
95. Gibt es eine Kollektivschuld?
96. Warum wurden die Deutschen aus dem Osten vertrieben?
97. Was ist Beutekunst?
98. Wann wurde die Teilung Deutschlands beschlossen?
99. Waren die Nürnberger Prozesse Siegerjustiz?
100. Wie lange muss Deutschland noch Wiedergutmachung leisten?
101. Wen betraf die Entnazifizierung?
Vorbemerkung
Natürlich lässt sich die komplexe Geschichte der Ideologie des Nationalsozialismus und seiner Herrschaft im Dritten Reich nicht im Raster von 101 Fragen abschließend darstellen. Als Einstieg und Annäherung an das Thema oder zur Vergewisserung über Sachverhalte und Zusammenhänge ist die Verortung in der Form von Fragen – die zur Beschränkung auf das Wesentliche zwingen – hilfreich und entspricht modernen Rezeptionsgewohnheiten. Die Darstellung der Geschichte des NS-Staats und seines weltanschaulichen Programms, seiner Entstehung und seines Unterganges wie seiner Folgen in Aspekten, den 101 Fragen, soll die Zusammenhänge nicht auflösen, sondern möchte durch immer neue Zugänge ein dichtes Bild entstehen lassen.
Die Fragen verstehen sich als horizontale Gliederungselemente, die zusammen mit vertikalen Strukturen das Verständnis einer höchst komplizierten und folgenreichen Ära der jüngeren deutschen Geschichte ermöglichen sollen. Der Strukturierung dienen zehn Abschnitte, in denen der Aufstieg des Nationalsozialismus zur Macht und dann die Grundfragen der Ideologie thematisiert werden, gefolgt von den Strukturen und Institutionen nationalsozialistischer Herrschaft.
Den Protagonisten – als Individuen, als Typen, als Gruppenvertreter – ist ein Kapitel gewidmet, dem ein Abschnitt folgt, in dem zentrale Ereignisse als Metaphern und Ausformungen historischer Realität («Machtergreifung», «Röhmputsch», Fritsch-Krise, Münchner Abkommen, «Aktion Reinhardt») behandelt sind. Dem Komplex Verfolgung und Widerstand, in dem Antworten auf Fragen zum Attentat vom 20. Juli 1944, zur Wannsee-Konferenz, zur Verfolgung von ethnischen, religiösen, sozialen Gruppen gesucht werden, folgt unter dem Titel Legenden ein Bündel von Problemen, die für Vorurteile, Mutmaßungen, für Irrationalität und Abwehr der Realität des Dritten Reiches stehen. Der Krieg als zentrale Kategorie des NS-Staats ist im vorletzten Kapitel Gegenstand von Fragen, schließlich sind die Folgen nationalsozialistischer Herrschaft – Potsdamer Konferenz, Nürnberger Prozesse, Teilung Deutschlands, und Entnazifizierung auf der Sachebene, «Kollektivschuld», Wiedergutmachung, Morgenthau-Plan, Umerziehung, Chiffren im Erinnerungsdiskurs – Gegenstand der letzten zehn Fragen.
Viele weitere Fragen etwa nach Denunzianten und Eliteschulen, nach der Rolle der Medizin und der des Sports, nach Kollaborateuren, Profiteuren, Verrätern, nach Technikern, Künstlern, Handlangern des Regimes wären mit ähnlicher Berechtigung zu stellen, aber die Beschränkung auf die 101 wichtigsten schließt ja weiteres Forschen nicht aus. Im Gegenteil, dazu soll ausdrücklich durch dieses Buch ermuntert werden.
Aufstieg zur Macht
1. Was steht im Parteiprogramm der NSDAP? Das Parteiprogramm der NSDAP, am 24. Januar 1920 von Adolf Hitler im Münchener Hofbräuhaus verkündet, war eine Mischung aus publikumswirksamen Phrasen und populären Forderungen, die in 25 Punkten zusammengefasst und 1921 für «unabänderlich» erklärt wurden. Wichtige Punkte bildeten die Forderung nach einem Großdeutschland, bei dem die Volkstumsgrenzen mit den Reichsgrenzen zusammenfallen sollten, die Aufhebung der Friedensverträge von 1919, die koloniale Erweiterung des deutschen Siedlungsgebietes, der Ausschluss von Juden aus der Staatsbürgerschaft, der Vorbehalt von Staatsbürgerschaft und Staatsämtern für «Volksgenossen», die nach rassistischen Gesichtspunkten («deutsches Blut») definiert wurden, und ein Einwanderungsverbot. Die vagen Forderungen nach Ersatz des Römischen Rechts durch ein «deutsches Gemeinrecht» zur Hebung der Volksgesundheit, nach «gesetzlichem Kampf gegen die bewusste politische Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse», nach «positivem Christentum» und Kampf gegen den «jüdisch-materialistischen Geist» entsprachen dem Bedürfnis nach verbalem Radikalismus. Ernster nahmen die frühen Anhänger und Wähler der NSDAP wohl die Programmpunkte, die die Abschaffung des «arbeits- und mühelosen Einkommens», die «Brechung der Zinsknechtschaft», die Einziehung von Kriegsgewinnen, die Verstaatlichung aller vergesellschafteten Betriebe, die «Schaffung eines gesunden Mittelstandes», die «sofortige Kommunalisierung der Großwarenhäuser und ihre Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende», eine Bodenreform und den Kampf gegen «gemeine Volksverbrecher, Wucherer, Schieber» verhießen.
Die unbestimmten und energischen Verheißungen waren nicht das Ergebnis einer Programmdiskussion. Die Ideologie der Hitler-Partei war, somit sie nicht die rassistischen und expansionistischen Ziele betraf, vor allem Inszenierung und Propaganda. Denn Propaganda, das hatte Hitler seinen Getreuen frühzeitig klar gemacht, war wichtiger als jede Theoriediskussion, die Hitler 1926 bei einer Führertagung der NSDAP in Bamberg ein und für alle mal unterbunden hatte. Alle Ansätze, mit programmatischen Mitteln Hitlers Führungsanspruch in Frage zu stellen, waren vor 1933 mit dem Ausscheiden der parteiinternen Opposition aus der NSDAP (Gregor Straßer) oder mit der Unterwerfung unter Hitler (Joseph Goebbels) erledigt worden.
Die Bedürfnisse seiner Anhänger nach einer Erklärung des Weltgeschehens, nach sozialen und politischen Visionen für Deutschland und nach einem Gedankengebäude, in dem sich ihre Sehnsüchte und Wünsche wiederfanden, erfüllte Hitler mit weit ausgreifenden, stundenlangen Monologen, Anklagen, Schuldzuweisungen und Prophezeiungen, mit denen er sein Publikum rhetorisch zu fesseln wusste. Seine Kundgebungen waren perfekt inszeniert. In seinem Buch «Mein Kampf» war überdies nachzulesen, welche «Weltanschauung» der Demagoge vertrat.
2. Welche Bedeutung hatte das Ermächtigungsgesetz? Hitlers Forderung («Gebt mir vier Jahre Zeit und ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen») nach Handlungsvollmacht ohne parlamentarische Einschränkung und Kontrolle durch andere Verfassungsorgane, erhoben nach der enttäuschenden Wahl am 5. März 1933, die der NSDAP keine absolute Mehrheit beschert hatte, wurde verwirklicht im «Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich». Unter starkem Druck auf den Reichstag, durch später nicht eingehaltene Zusagen, durch Manipulation der Geschäftsordnung kam die erforderliche Zweidrittelmehrheit am 24. März 1933 für das Gesetz zustande, das Hitler ermächtigte, Gesetze ohne Zustimmung des Reichstags und des Reichsrates und ohne Gegenzeichnung durch den Reichspräsidenten zu erlassen sowie Verträge mit anderen Staaten zu schließen. Gegen die 94 Stimmen der SPD (die Abgeordneten der KPD waren bereits verhaftet oder auf der Flucht) wurde das Ermächtigungsgesetz mit den Stimmen des Zentrums, der Bayerischen Volkspartei und der Deutschen Staatspartei als Akt der Selbstentmachtung des Parlaments verabschiedet. Das Ermächtigungsgesetz bildete die Grundlage zur Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur.
3. Woher kommt der Begriff «Drittes Reich»? Der Begriff, unter dem die nationalsozialistische Herrschaft propagiert und popularisiert wurde, stammte aus dem ideologischen Laboratorium der Jungkonservativen, einer politischen Gruppierung in der Weimarer Republik. «Das Dritte Reich» hieß die 1923 erschienene Schrift des Publizisten Moeller van den Bruck. Im gleichen Jahr hatte Hitler in München zum ersten Mal nach der Macht gegriffen. Die christliche Utopie des idealen Staates aus dem Mittelalter sollte sich im Mythos vom endgültigen Reich (nach dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und nach Bismarcks Staatsgründung von 1871) erfüllen. Als Heilslehre schloss die Sehnsucht nach einem «dritten Reich» die Revision des Versailler Vertrags ebenso ein wie die völkische Idee eines Großdeutschland, in dem eine «Volksgemeinschaft» mit ständestaatlichen, hierarchischen und egalisierenden Vorstellungen, mehr auf Sozialromantik als auf konkrete politische Vision, mehr auf Gefühle als auf Rationalität gründend, verwirklicht werden sollte. Als das «Dritte Reich» bezeichnete der NS-Staat sich selbst, und diese Bezeichnung dient heute als Epochenbegriff für die Zeit von 1933 bis 1945.
4. Hat die Großindustrie die NSDAP finanziert? Am 19. November 1932 wurde dem Reichspräsidenten Hindenburg ein Brief übergeben, in dem Vertreter von Industrie und Banken die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler empfahlen, weil sie von der Politik des NSDAP-Chefs Impulse für die deutsche Wirtschaft erwarteten. Entgegen einer verbreiteten Annahme hat das Großkapital aber den Aufstieg Hitlers und der NSDAP nicht finanziert. Die frühen Förderer der NSDAP kamen aus dem gehobenen Mittelstand, lediglich die Industriellen Fritz Thyssen und Ernst von Borsig haben die NSDAP anfänglich mit namhaften Beträgen unterstützt. Bis zum Ende der zwanziger Jahre finanzierte sich die NSDAP im Wesentlichen selbst, durch Eintrittsgelder, Mitgliedsbeiträge und Sammlungen. 1926 kamen dadurch 114000 Reichsmark, 1927 104000 Reichsmark zusammen. Erst der Erfolg bei den Reichstagswahlen 1930 veranlasste Industrielle, auch für die NSDAP zu spenden, mehr als 10 bis 15 Prozent der für Parteien rechts der SPD insgesamt aufgewendeten Mittel entfielen aber nicht auf die Hitler-Partei. Die bürgerliche Rechte blieb Hauptempfängerin von Subventionen aus Industriekreisen.
Unter den deutschen Unternehmern hatte Fritz Thyssen bis Januar 1933 mit 400 000 Reichsmark den größten Anteil. Aus dem Ausland spendete der Shell-Konzern einen größeren Betrag an die NSDAP «zur Bekämpfung des Bolschewismus». Haupteinnahmequelle bis zum Machterhalt blieben aber die Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder zu Veranstaltungen. Erst nach dem 30. Januar 1933 floss Geld in größeren Strömen an die NSDAP. Die von Krupp angeregte «Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft» erbrachte bis 1945 über 700 Millionen Reichsmark zu Gunsten der Partei bzw. zur persönlichen Verfügung Hitlers.
Ideologie
5. Was war der «Arierparagraph»? Durch das «Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums» vom 7. April 1933 verloren Juden ihren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst. Das war die erste praktische Konsequenz aus dem Parteiprogramm der NSDAP, vorläufig noch gemildert für diejenigen, die schon vor dem 1. August 1914 Beamte oder im Weltkrieg Frontkämpfer gewesen waren oder Väter oder Söhne im Weltkrieg verloren hatten. Als «Nichtarier» im Sinne des Berufsbeamtengesetzes galt, wer einen (oder mehrere) Eltern- oder Großelternteil(e) jüdischen Glaubens hatte. Ebenfalls am 7. April wurde das Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erlassen, das Anwälte «nicht-arischer Abstammung» vom Anwaltsberuf ausschloss, wenn sie nicht zunächst noch die Privilegien, wie sie auch im Berufsbeamtengesetz galten, in Anspruch nehmen konnten. Am 22. April 1933 verloren jüdische Ärzte die Kassenzulassung, ebenfalls im April 1933 begrenzte das «Gesetz gegen die Überfüllung der deutschen Schulen und Hochschulen» die Zahl der Juden in den Bildungsanstalten. Es war die Vorstufe zum vollständigen Ausschluss der Juden aus der deutschen Gesellschaft. Im September 1933 wurde Juden durch das Reichskulturkammergesetz die Tätigkeit in allen Bereichen von Kunst, Literatur, Rundfunk, Theater verboten, das «Schriftleitergesetz» untersagte im Oktober 1933 die Beschäftigung von Juden bei der Presse, und das Wehrgesetz (Mai 1935) machte die «arische Abstammung» zur Voraussetzung für den Militärdienst.
Verhängnisvoll war der vorauseilende Gehorsam, mit dem Vereine, Berufsorganisationen und Verbände ohne staatlichen Zwang Juden ausschlossen. Der «Arierparagraph» nach dem Vorbild des Berufsbeamtengesetzes diente in allen Lebensbereichen zum Ausschluss von Juden. Seit September 1933 wurden vom Deutschen Automobilklub keine Juden mehr aufgenommen, ab Januar 1934 wurden Juden von den Freiwilligen Feuerwehren in Preußen ausgeschlossen, Gesangvereine und akademische Verbindungen, Sportclubs und gesellige Vereinigungen beeilten sich, den Juden die Mitgliedschaft zu verweigern. Schlimmer noch waren die Berufsverbote. Schon im September 1933 hatte die Generalsynode der preußischen Union der evangelischen Kirche verboten, «Nichtarier» als Geistliche und Beamte der Kirchenverwaltung zu berufen. Das Gleiche galt für Ehemänner «nichtarischer» Frauen. «Arische» Beamte, die eine Person «nichtarischer» Abstammung heirateten, wurden ebenfalls aus dem Kirchendienst entlassen. Mit den Nürnberger Gesetzen vom September 1935 erloschen auch alle Ausnahmebestimmungen und Privilegien. Für Bewerbungen im öffentlichen Dienst war der Abstammungsnachweis der «arischen» Herkunft ebenso erforderlich wie für den Dienst in der NSDAP der große Abstammungsnachweis». Für die SS galten noch strengere Bestimmungen.
6. Was bedeutet Lebensraum? Die Chiffre «Lebensraum», dem Arsenal völkischer und alldeutscher Phrasen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg entlehnt, wurde im Rahmen der nationalsozialistischen Ideologie zur Motivierung des Expansionsdranges benutzt. Der Begriff taucht 1901 als Titel eines Essays des Geographen Friedrich Ratzel auf, wurde dann verdichtet in den sozialdarwinistischen Überlegungen der geopolitischen Schule Karl Haushofers und schließlich populär durch den in den 20er Jahren viel gelesenen Roman «Volk ohne Raum» von Hans Grimm, der Hitler das Motto gab für das imperialistische Projekt, im Osten Europas Territorium durch koloniale Aneignung zu gewinnen. Eingebettet in die Ideologie von Blut und Boden, das Recht des Stärkeren sowie die rassistische Überzeugung von der Höherwertigkeit der Germanen gegenüber slawischen Völkern, war die Vorstellung, «Lebensraum» für das deutsche Volk erkämpfen zu müssen, eine zentrale Forderung nationalsozialistischer Außenpolitik, die durch kriegerische Auseinandersetzung eingelöst werden sollte. Die rassistische Komponente und die Orientierung nach Osten unterschieden die nationalsozialistische Konzeption vom traditionellen deutschen Nationalismus, der «Lebensraum» durch Kolonien in Übersee erstrebte und nach dem Ersten Weltkrieg die Grenzen von 1914 wiederherstellen wollte. Die nationalsozialistische Vorstellung von «Lebensraum» war untrennbar mit der Idee des Herrenmenschentums und dem daraus abgeleiteten Anspruch der Eroberung, Unterdrückung und Vernichtung von Menschen verbunden.