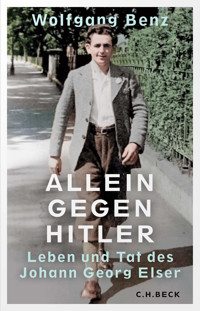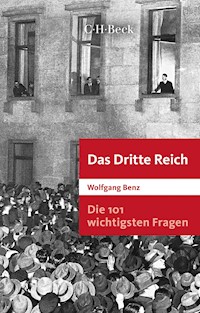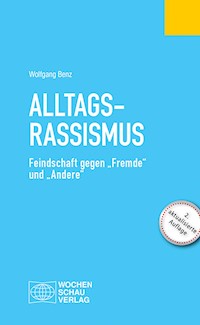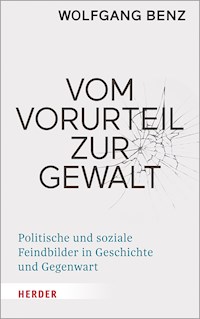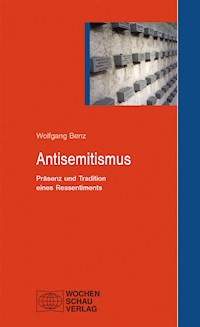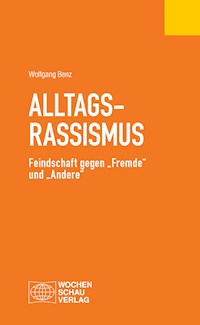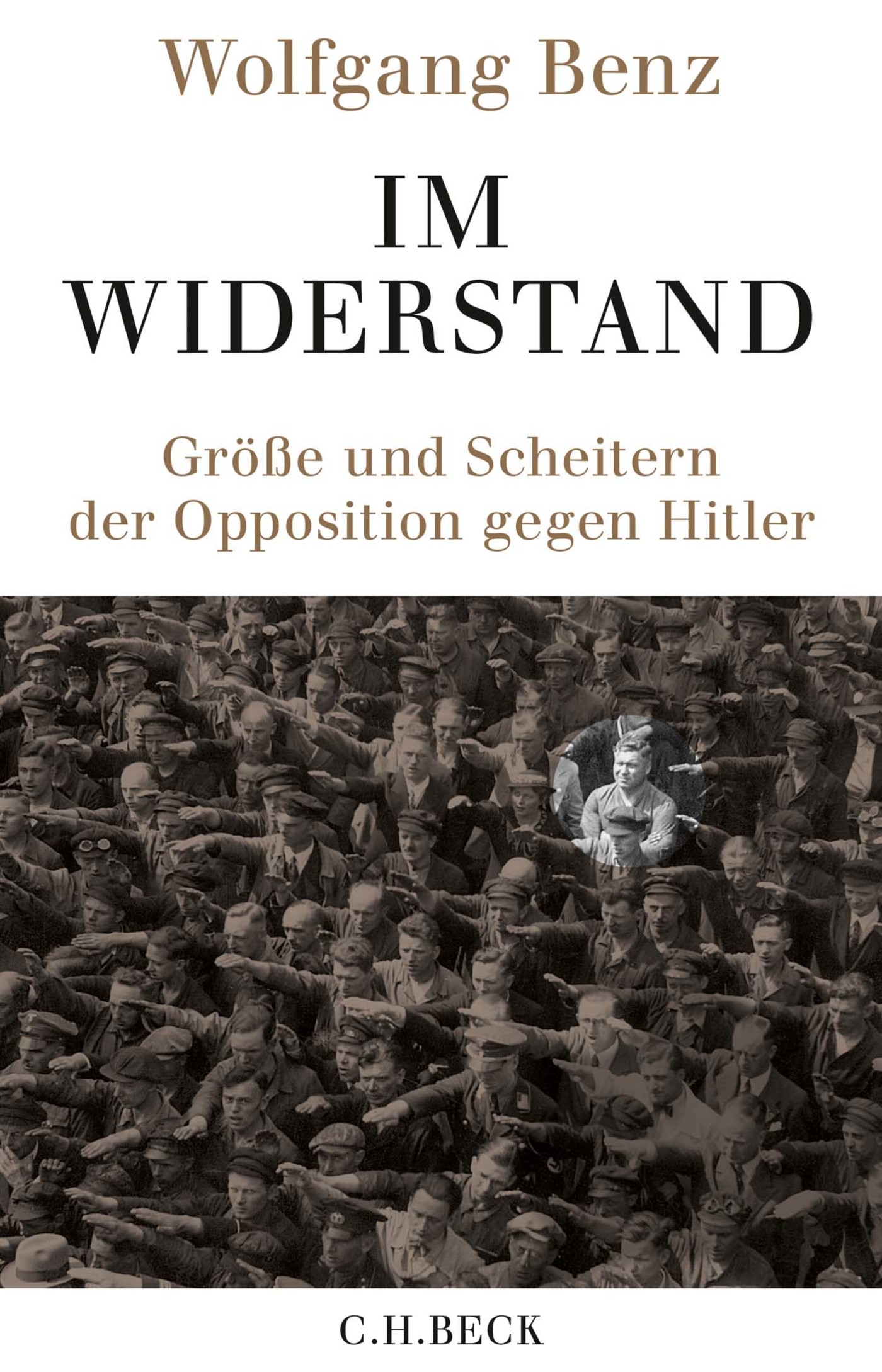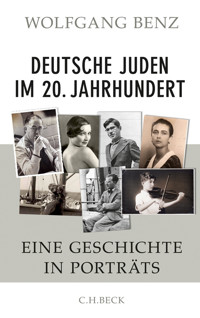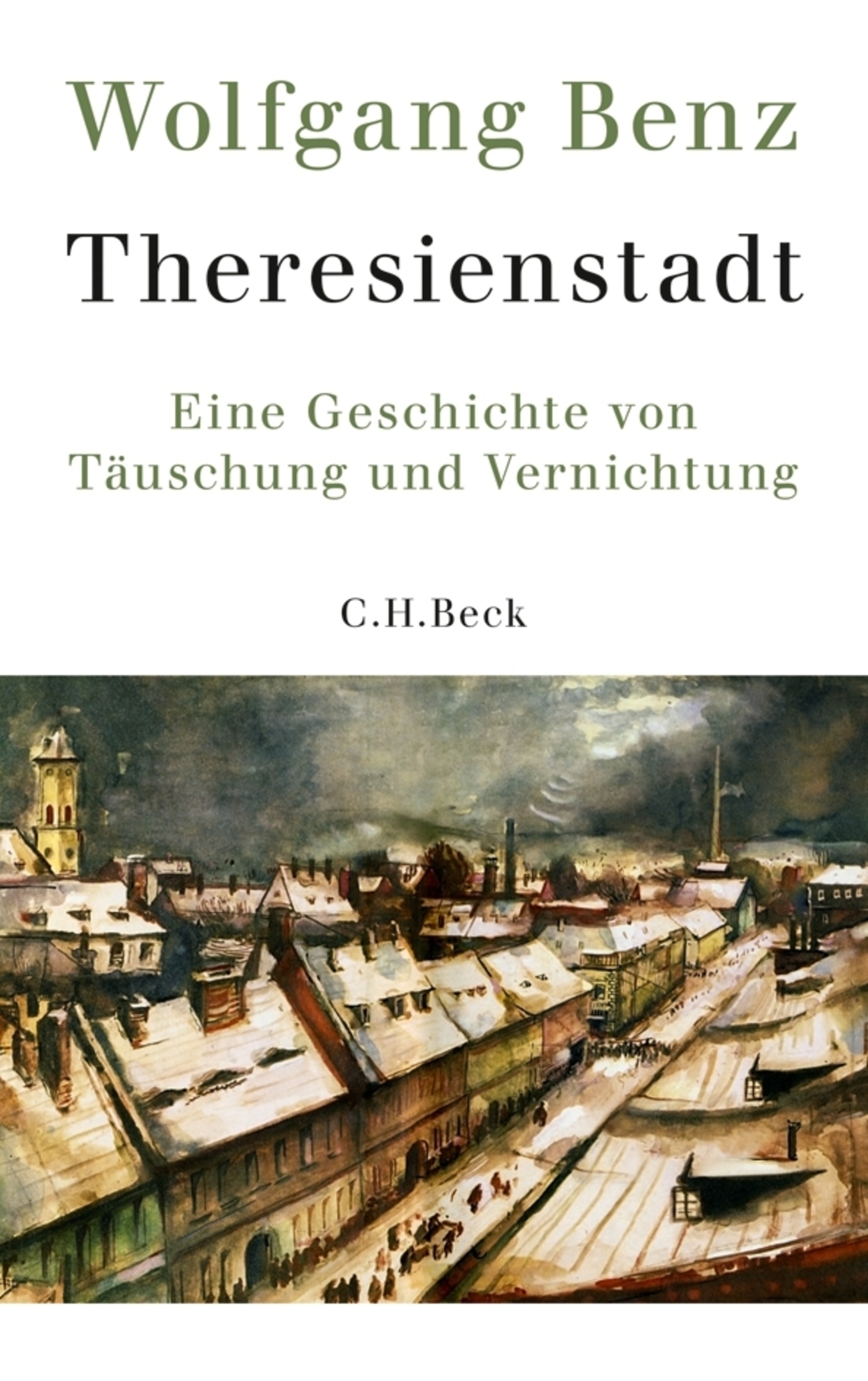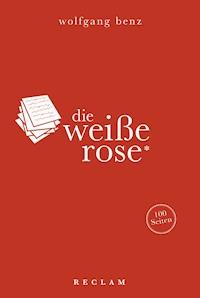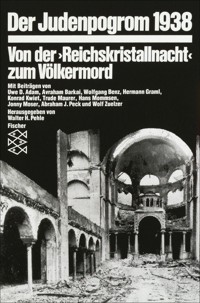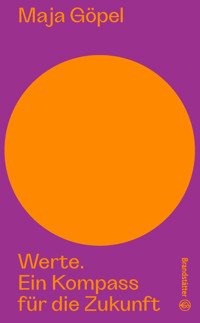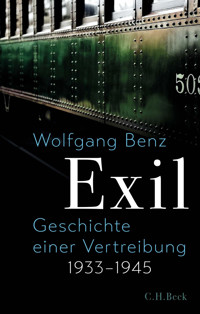
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eingepfercht auf einem Schiff hoffen jüdische Flüchtlinge auf ein neues Leben in Israel. Thomas Mann ist als berühmter Schriftsteller in den USA zwar privilegiert, aber auch er muss sich in einem Leben im Exil einrichten. Marianne Cohn gelingt die Rettung nicht. Sie wird auf der Flucht in die Schweiz geschändet und erschossen. Das Exil in der Zeit des Nationalsozialismus besteht aus unendlich vielen Geschichten und führt in alle Weltgegenden. Wolfgang Benz, einer der besten Kenner des Themas, legt nun die erste große Gesamtdarstellung vor. Das Dritte Reich zwang hunderttausende Menschen dazu, Deutschland zu verlassen. Jüdinnen und Juden mussten ebenso um ihr Leben fürchten wie solche Deutsche, die sich gegen die Nazis engagiert hatten oder nicht mit ihrer Weltanschauung übereinstimmten. In seiner grundlegenden Darstellung erzählt Wolfgang Benz ebenso eindringlich wie quellennah die Geschichte dieser gewaltigen Fluchtbewegung. Er zeichnet minutiös die Etappen und Orte des Exils nach, die oft demütigenden Umstände der Visabeschaffung und die schwierigen Lebensbedingungen als Fremde und häufig Unwillkommene in einem anderen Land. Dabei gibt er den «Berühmtheiten» wie Hannah Arendt, Sigmund Freud oder Thomas Mann eine Stimme, vor allem aber auch Menschen, denen sonst nur wenig Aufmerksamkeit zuteil wird. So steht das Schicksal einer unbekannten jüdischen Kinderfürsorgerin gleichberechtigt neben dem Weg des weltberühmten Begründers der Relativitätstheorie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Wolfgang Benz
EXIL
Geschichte einer Vertreibung 1933–1945
C.H.Beck
Frontispiz
Zeichnung ihres Fluchtwegs von Belgien nach Südfrankreich von Regina Solzbacher
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Frontispiz
Inhalt
Vorwort
1. Politische Emigration im Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik
Ein Krupp-Direktor im Schweizer Exil
Im Streit um die Kriegsschuld
Der Fall Nicolai
Die «Freie Zeitung»
Friedrich Wilhelm Foerster: Pazifist und Europäer
Als radikaler Demokrat verfemt: Emil J. Gumbel
2. Flucht vor der «nationalen Revolution»
Exodus der Gegner: Das politische Exil
Diffamierung, Diskriminierung, Verfolgung: Prinzipien nationalsozialistischer Diktatur
Das Kulturexil
Das Exil als tödliche Falle
Karrierebrüche
Hilfe und Selbsthilfe
Paradigmatische Existenz: Werner Hegemann, Architekt und Publizist
3. Vertreibung durch Diskriminierung. Jüdische Auswanderung 1933–1938
Nationalsozialistische «Judenpolitik»
Die Illusion jüdischer Selbstbehauptung
Der schwere Entschluss zur Auswanderung
Die zionistische Alternative: Kurswechsel nach den Nürnberger Gesetzen
Psychologische und bürokratische Barrieren
Hachschara
Das Haavara-Abkommen
Deportation der Ostjuden
Reichskristallnacht
Hertha Nathorffs Weg ins Exil
Das offizielle Ende jüdischer Emigration
Ernst Loewy, ein enttäuschter Zionist
4. Orte des Exils
Erste Stationen: Saarbrücken, Wien, Amsterdam
Schweiz
Prag und Brünn
Paris und Marseille
Mexiko
London
Moskau
New York
Ibibobo und Buenos Aires
Shanghai
Sydney und Melbourne
5. Kindertransporte
Vorbereitung auf Erez Israel: Die Jugend-Alijah
Vom Frankfurter Waisenhaus nach Kfar Hanoar und Jerusalem
Die «Cedar Boys»
Kindertransporte nach Großbritannien 1938/39
Corporal Gene O’Brian
Fred Jordans Karriere: Zionist in Wien, Metalldreher in London, Verleger in New York
Tragödie in Annemasse
Solidarität und Hilfe: Die Kinder der Villa Emma in Nonantola
Recha Freier, die streitbare Retterin
6. Alijah Bet. Verbotene Wege nach Palästina
Unerreichbares «Gelobtes Land»
Sonder-Hachschara
Gestrandet in Kladovo
Ein langer Weg nach Israel
Die Irrfahrt der «Exodus»
7. Fiktion und Realität: Literatur im Exil
Themen und Karrieren
Der Moskauer Schriftstellerkongress
Audienz bei Stalin
«Das siebte Kreuz»
«Der Weg zur Grenze»
8. Rückkehr aus dem Exil
Distanzierte Erkundung
In der Uniform der Sieger
Willkommen bei richtiger Gesinnung
Staatstragende Prominenz. Kulturschaffende Remigranten in der DDR
Widerstand, KZ, Flucht, Heimkehr: Als jüdische Kommunistin im Exil
Ressentiments
Staatsgründung im Westen. Anteil und Konzepte des Exils
Juden und andere Emigranten unerwünscht
«Charterflug in die Vergangenheit»
9. Wann endet das Exil?
Anhang
Anmerkungen
Vorwort
1. Politische Emigration im Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik
2. Flucht vor der «nationalen Revolution»
3. Vertreibung durch Diskriminierung. Jüdische Auswanderung 1933–1938
4. Orte des Exils
5. Kindertransporte
6. Alijah Bet. Verbotene Wege nach Palästina
7. Fiktion und Realität: Literatur im Exil
8. Rückkehr aus dem Exil
9. Wann endet das Exil?
Quellen und Literatur
Handbücher und Periodika
Ausstellungskataloge
Ausgewählte Studien und Dokumentationen
Bildnachweis
Register
Zum Buch
Vita
Impressum
Vorwort
Die Geschichte des Exils ist zuerst die Geschichte einzelner Menschen. Auch in der Massentragödie ist kein Schicksal dem anderen gleich. Gewiss, die Wege ins Exil waren so ähnlich wie die Motive, Deutschland und die unter NS-Ideologie beherrschten Gebiete Europas zu verlassen, nämlich politischer oder rassistischer Verfolgung zu entgehen. Aufgabe des Historikers ist es darüber hinaus, mit dem Blick auf individuelle Schicksale das Drama der Austreibung, der erzwungenen Flucht, der Ausbürgerung und Ausplünderung, schließlich das Ankommen im fremden Land als Ganzes auf die Bühne zu bringen, d.h. anschaulich und verständlich zu machen. Ebenso wichtig war es, die Situation in den Aufnahmeländern darzustellen, das Willkommensein und – häufiger – die Reserve gegenüber Flüchtlingen. Damit ist das Thema auch überaus aktuell.
Die Exilforschung begann als Zweig der Literaturwissenschaft, und die Konzentration auf Schriftsteller und Dichter hatte so gute und naheliegende Gründe wie die anhaltende Faszination des Feuilletons durch Künstler aller Sparten, die sich durch ihr Werk manifestieren: die Maler Paul Klee, Wassily Kandinsky, Lyonel Feininger oder die Architekten Mies van der Rohe, Hannes Meyer, Ernst May, Walter Gropius, Erich Mendelsohn oder Musiker wie Paul Hindemith, Arnold Schönberg, Arturo Toscanini, Kurt Weill. Theaterleute und Filmschaffende wie Max Reinhardt und Leopold Jessner, unzählige Sänger und Schauspieler gingen ins Exil. Robert Stolz und Lotte Lehmann sind auch hier nur zwei Namen von vielen. Die Berühmten, etwa Billy Wilder, Elisabeth Bergner, Lilli Palmer, fassten in Hollywood Fuß, die Mehrzahl lebte im Elend. Auch Gelehrte und Politiker haben Spuren hinterlassen, haben wie die Kulturschaffenden die Zeitumstände analysiert und die eigene Rolle reflektiert, beschrieben ihr Exil oder wichtige Aspekte als Zeugenaussage und gaben damit der Historiografie profunde Dokumente als Quellen an die Hand. Als Zeitzeuge resümiert Carl Zuckmayer die Endgültigkeit der Auswanderung: «Die Fahrt ins Exil ist the journey of no return. Wer sie antritt und von der Heimkehr träumt, ist verloren. Er mag wiederkehren – aber der Ort, den er dann findet, ist nicht mehr der gleiche, den er verlassen hat, und er ist selbst nicht mehr der gleiche, der fortgegangen ist. Er mag wiederkehren, zu Menschen, die er entbehren mußte, zu Stätten, die er liebte und nicht vergaß, in den Bereich der Sprache, die seine eigene ist. Aber er kehrt niemals heim.»[1]
Der Terminus «Exil» hat ursprünglich auch und vor allem eine zeitliche Dimension, die Hoffnung auf Rückkehr nämlich, oder doch wenigstens auf ein Ende der Situation des Vertriebenseins, der Unfreiwilligkeit von Aufbruch und Abschied, die Demütigung und Preisgabe von Identität. Emigration umschreibt dagegen als Begriff den selbstbestimmt gefassten Entschluss zur Auswanderung. Eindeutig in diesem Sinne ist lediglich die «Remigration» als oft vergeblicher Wunsch und Versuch, das Exil zu beenden, um wieder anzuknüpfen und dort fortzufahren, wo die Ausgrenzung begann. Das ist nur wenigen in seltenen Fällen und unter besonders günstigen Umständen geglückt.
Die Mehrheit der aus dem nationalsozialistischen Herrschaftsbereich Fliehenden und Vertriebenen war nicht an der philosophischen Klärung dessen, was ihr widerfuhr, interessiert, sondern von der existentiellen Sorge des Überlebens absorbiert, und sie hatte, von möglicherweise mangelnden intellektuellen Voraussetzungen abgesehen, weder Muße noch Anlass oder Neigung zur erzählenden, gar deutenden Darstellung ihres Schicksals.
Der terminologische Unterschied zwischen «Exil» und «Emigration» ist von den wissenschaftlichen Disziplinen, die sich zur Exilforschung zusammenfanden – Germanisten und Historiker mit Soziologen, Psychologen, Politologen und Kulturwissenschaftlern im Gefolge –, nicht geklärt worden. In Handbüchern und Monografien werden die Begriffe weithin synonym verwendet.
Im Mittelpunkt des folgenden Versuches, die Geschichte des Exodus aus Hitlers Machtbereich zu erzählen, stehen nicht die berühmten Männer und Frauen, die den Gebildeten in den Sinn kommen, wenn sie auf das Exil der Jahre 1933 bis 1945 angesprochen werden, um, die großen Namen nennend, zu beklagen, welchen ungeheuren Verlust an Kultur, Geistigkeit, Wissenschaft der deutsche Sprachkreis hinnehmen musste. (Damit scheint unbewusst auch gleich die Schuldfrage entschieden: Was haben Albert Einstein und Sigmund Freud, Thomas Mann und Carl Zuckmayer, Arnold Schönberg und die «Comedian Harmonists» uns dadurch angetan, dass sie Deutschland verließen, um andere Nationen mit ihrem Schaffen zu bereichern?) Natürlich sind die Zelebritäten des Exils auch auf den Seiten dieses Buches zu finden, schon wegen der Werke, die sie hinterließen, die Aufschluss geben über die Phänomene Flucht und Vertreibung, über Aufnahme und Existenz im Gastland.
Das Wagnis, die Geschichte des Exils aus Hitler-Deutschland und seiner politischen und sozialen Strukturen darzustellen, kann nur bei (oft schmerzlichem) Verzicht auf manches Detail gelingen. Das bedeutet, dass auf jeden Anschein von Vollständigkeit zu verzichten war, dass auch die biographischen Exkurse paradigmatischen Charakter haben, dass die ausgewählten Orte des Exils zugleich exemplarisch und singulär sind.
Gefasst sieht der Autor, sich des Dilemmas bewusst, den in großer Zahl möglichen Einsprüchen entgegen, dass diese oder jene wichtige Person nicht erwähnt ist, dass Städte und Länder der Erde, die Asyl boten, gar nicht oder nicht zureichend behandelt sind. Der Philosoph Karl R. Popper oder der Dichter Karl Wolfskehl, die in Neuseeland überlebten, oder die bedeutendste Lyrikerin deutscher Zunge, Else Lasker-Schüler, konnten nicht gewürdigt werden, wie sie es verdient hätten. Leonhard Frank, der weithin vergessene Schriftsteller, der 1915 erstmals und 1933 zum zweiten Mal in die Schweiz, nach England und in die USA ins Exil musste, 1950 zurückkehrte, aber nicht mehr an die Erfolge vor 1933 anknüpfen konnte, ist zum Bedauern des Autors, wie viele andere, nicht behandelt. Zu viele, die es ins Exil verschlug, zum Teil in exotische Gegenden Afrikas und Asiens, hätten ebenfalls Beachtung, mindestens Erwähnung verdient.
Jedenfalls sollten nicht die Prominenz aus Wissenschaft und Kunst, die Protagonisten der Politik, die bekannten Namen die Sicht auf die Mehrheit der nicht berühmten und gefeierten Menschen verstellen, für die das Exil – in das die Mehrheit als Juden getrieben worden ist – nur Vernichtung von Lebensentwürfen und Existenzgrundlagen, Zerstörung von Überzeugungen, Hoffnungen, Illusionen war.
Die Geschichte des Exils aus dem «Dritten Reich» ist ein Lehrstück, geschrieben in einer Zeit, in der Menschen in großer Zahl politisches Asyl begehren, in der Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge Schutz und Hilfe in dem Land suchen, aus dem einst Bürger wegen ihrer Gesinnung oder ihrer Herkunft verfolgt und ermordet wurden, auf das Arme der existentiellen Hoffnungslosigkeit in ihren Heimatländern zu entkommen suchen. Das Versprechen «politisch Verfolgte genießen Asyl» wurde in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland im Bewusstsein der Erfahrung der NS-Herrschaft verankert. Vielfach abgeschwächt unter dem Eindruck anschwellender Zuwanderung, mit einschränkenden Klauseln wie der «Sicheren Drittstaatenregelung» versehen, vom Angstruf «Das Boot ist voll» untermalt und mit der realitätsverweigernden Beteuerung, Deutschland sei «kein Einwanderungsland», bekräftigt, hat sich die deutsche Asylpolitik in den 75 Jahren, in denen das Grundgesetz gilt, von der Selbstverständlichkeit der Erinnerung an die Flucht deutscher Bürger vor Hitler in den Jahren 1933 bis 1945 und an die zwölf Millionen deutscher Menschen, die anschließend als Folge der nationalsozialistischen Politik ihre Heimat verloren, immer weiter entfernt. Der historische Augenblick, der uns ein Stück vom Odium des Barbarentums nimmt, war der, als den Hilfsbedürftigen und Schutzsuchenden an Deutschlands Grenzen 2015 die Arme geöffnet wurden. Nach der generösen Geste, die historisch notwendig war, die Verfolgten und Flüchtenden vor Diktatur und Bürgerkrieg die Grenzen Deutschlands öffnete, zogen sich verzagte Bürger und moralisch Anspruchslose vom rechten Rand der Gesellschaft in Wagenburgen zurück. Eine neue Partei, deren Programm im Wesentlichen aus der Parole «Ausländer raus» besteht, stieg in der Wählergunst auf befremdliche Höhe und radikalisierte sich.
Im Herbst 2023 rotteten sich Reaktionäre mit Rechtsradikalen zusammen, um in geheimem Palaver den Masterplan auszuhecken, mit dem durch Vertreibung aller Migranten, auch der längst erfolgreich Eingebürgerten, Deutschland nach der Parole «Blut und Boden» zum völkischen Nationalstaat, zur spießigen Idylle des Selbstgenügens zurückzuführen sei. Dass Deutschland ein Glied Europas ist, dass es ohne Zuwanderung ökonomisch und sozial veröden würde, betonen auch konservative Funktionäre der Wirtschaft, Manager, Industrielle. Seit dem Komplott des ultrarechten Zirkels in Potsdam demonstrieren Bürger zu hunderttausenden auf Deutschlands Straßen für Demokratie, Toleranz und Humanität. Das ist – unausgesprochen – die richtige Erkenntnis aus der Geschichte des Exils.
Dieses Buch basiert auf jahrzehntelanger Beschäftigung mit dem Thema Exil, nicht zuletzt im Amt des langjährigen Vorsitzenden der Gesellschaft für Exilforschung. Prägende Begegnungen, am frühesten mit Hans Rothfels, dem aus Chicago zurückgekehrten Nestor des neuen Faches Zeitgeschichte, später mit dem Historiker George L. Mosse, mit dem Mediziner Wolf W. Zuelzer, mit Norbert Wollheim, Edzard Reuter, Richard Duschinsky, Klaus Loewald, Bern Brent, George Dreyfus, Felix Werder, Juan Jacoby, Hellmut Stern, Ruth Körner, W. Michael Blumenthal, Ernst Loewy, Alfred Grosser, Konstanza Prinzessin Löwenstein und vielen anderen bilden das Fundament dieses Buches.
Nicht wenige Begegnungen mit diesen Menschen, die sich aus Hitlers Deutschland oder aus dem vom Nationalsozialismus dominierten Europa retten konnten, in die USA und nach Südamerika, nach Israel oder nach Australien, begannen als beruflicher Kontakt und mündeten in lebenslange Freundschaft. Sie alle haben zu dieser Geschichte des Exils beigetragen, viele ihrer Schicksale und Erfahrungen sind eingeflossen, ohne sie wäre das Buch nicht entstanden. Allen bin ich zu tiefstem Dank verpflichtet. Anteil haben auch die Wegbegleiter in der Gesellschaft für Exilforschung, derer ich (zugleich für viele weitere) in Dankbarkeit gedenke: Inge Belke, Marion Neiss, Cornel Meder, Klaus Voigt, Karl Holl.
Herzlich danke ich auch denen, die mir zur Seite standen bei der Arbeit am Text dieses Buches. Zuerst Dr. Maria Stolarzewicz, die die Mühen, dem Manuskript die äußere Gestalt zu geben, auf sich genommen hat. Claudia Tschischniewski hat die Schlusskorrektur des Gesamttextes besorgt. Die Bibliothekarinnen Irmela Roschmann-Steltenkamp und Angela Siebert im Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin haben einmal mehr ihre Bravour und ihre Hilfsbereitschaft unter Beweis gestellt, als sie entlegene Literatur beschafften. Und Konrad Kwiet, Freund und Kollege, der meine Forschungen zum Exil in Australien seit Jahrzehnten mit Rat und Tat begleitet, ist in den Dank sehr herzlich eingeschlossen. In der langjährigen freundschaftlichen Zusammenarbeit mit Detlef Felken schließt sich der Kreis mit diesem Buch. Er hat als junger Lektor die Anthologie «Das Exil der kleinen Leute», meine erste Annäherung an das Thema, betreut und sorgte mit kritischer Souveränität und Empathie in der neuen Rolle als frisch emeritierter Lektoratschef im Haus C.H.Beck für das Gelingen des Projekts. Laura Ilse, Julia Odak und Magnus Stuber haben mit Bravour die Probleme der Bebilderung gemeistert. Auch der nimmermüden Janna Rösch im Verlag danke ich für die Zusammenarbeit in vielen Jahren sehr herzlich.
1. Politische Emigration im Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik
Die Schweiz war das klassische Asylland des 19. Jahrhunderts. Freiheitskämpfer, Demokraten, Revolutionäre, politische Flüchtlinge fanden bei den Eidgenossen einen sicheren Ort. Sie durften dort sogar für ihre Ideale kämpfen. Im Ersten Weltkrieg war die Schweiz sowohl Tummelplatz kriegerischer Propaganda der kämpfenden Parteien, die dort außer ihren diplomatischen Missionen, Pressebüros und Agenturen auch eigene Zeitungen unterhielten, als auch Refugium für Emigranten, die freundlich geduldet Asyl genossen, ohne in der Regel im Heimatland ausdrücklich durch Verfolgung bedroht zu sein. Deutsche Oppositionelle, die sich als Kritiker des Wilhelminischen Obrigkeitsstaates oder wenigstens seiner Kriegsführung exponiert und von Deutschland abgewendet hatten, vertraten im Schweizer Exil publizistisch ihre Kritik am kaiserlichen Deutschland.
Zu den deutschen Emigranten gehörten nicht nur bekannte Pazifisten wie Alfred H. Fried, der sich mit der Zeitschrift «Friedens-Warte» in die Schweiz zurückgezogen hatte, sondern auch der Sohn des einstigen Reichskanzlers Alexander Prinz von Hohenlohe-Schillingsfürst (1862–1924), der Reichstagsabgeordneter und Bezirkspräsident im Elsass gewesen war, der, nachdem er sich als Herausgeber der «Denkwürdigkeiten» seines Vaters den kaiserlichen Zorn Wilhelms II. zugezogen hatte, bis August 1914 als Privatmann in Paris lebte und dann in die Schweiz übersiedelte, wo er gelegentlich durch Artikel für die «Neue Zürcher Zeitung» und für Organe wie die «Friedens-Warte» oder die «Weltbühne» in Erscheinung trat.
Der bayerische General Max Graf von Montgelas, der 1915 Probleme mit der Obersten Heeresleitung hatte und zur Disposition gestellt war, sich aus Empörung über die Missachtung der belgischen Neutralität dem Pazifismus zuwandte und zum engagierten Gegner des deutschen Militarismus wurde (was ihn später nicht daran hinderte, sich im Rahmen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Reichstags gegen den Kriegsschuldartikel des Versailler Vertrages zu engagieren), wartete in Bern das Ende des Krieges ab.
Wie offen im Vergleich zur Emigration aus Hitler-Deutschland die Situation war, wie wenig von einer hermetisch abgeschlossenen, von Verfolgung bedrohten Existenz der Exilanten in ihrem Heimatland die Rede sein konnte, geht auch daraus hervor, dass etwa Friedrich Wilhelm Foerster, Inhaber eines Lehrstuhls für Pädagogik an der Münchner Universität, trotz kritischer Artikel in deutschen Zeitungen, trotz unverhohlener Sympathien für Frankreich, trotz der Forderung Ludendorffs nach seiner Verhaftung zwischen der Schweiz und dem Deutschen Reich hin- und herreisen konnte, ebenso wie der Redakteur der sozialdemokratischen «Münchner Post» Adolf Müller, der sich oft in Bern aufhielt. Beide wurden nach der Novemberrevolution offizielle diplomatische Vertreter in der Schweiz: Foersters Mission als bayerischer Gesandter blieb eine Episode der Revolutionszeit. Der Sozialdemokrat Müller amtierte von 1919 bis zum Ende der Weimarer Republik als deutscher Gesandter in Bern.
Mehr noch als der umtriebige (und deshalb ins Zwielicht geratende) Foerster, der für eine Minderheit deutscher Intellektueller stand, die ihre kulturelle Neigung zu Frankreich nicht blindlings auf dem Altar des deutschen Patriotismus zu opfern bereit war, geriet die intellektuelle Existenz einer Annette Kolb als deutsch-französische Schriftstellerin durch den Krieg in äußerste Gefährdung, der sie sich schließlich nach Behinderungen und Verboten in Deutschland um die Jahreswende 1916/17 in die Schweiz entzog. Sie wandte sich (am 5. April 1917) in einem offenen Brief im ententefreundlichen «Journal de Genève» gegen die «Boches» in Deutschland. René Schickele, mit dem sie befreundet war, stand als Elsässer zwischen den Fronten und lebte deshalb ab 1916 in der Schweiz. Ähnlich motiviert war der elsässische Sozialdemokrat Salomon Grumbach[1], der freilich auch im Sinne der französischen Sozialisten von der Schweiz aus Politik machte, u.a. als Herausgeber einer Serie politischer Broschüren unter dem Titel «Republikanische Bibliothek», die in Lausanne erschien und in der die Klassiker der These der deutschen Kriegsschuld publiziert wurden. Die Schweizer Zensur beobachtete argwöhnisch sein Treiben. Zu den großen Namen deutscher Kultur, die sich während des Ersten Weltkriegs in der Schweiz aufhielten, gehören auch die Schriftsteller Hermann Hesse und Rainer Maria Rilke, Leonhard Frank, Claire und Iwan Goll. Letztere sympathisierten besonders mit dem in Genf lebenden französischen Pazifisten Romain Rolland, der sich wie seine deutschen Gesinnungsgenossen im Kampf gegen den Wilhelminismus in der Auflehnung gegen den französischen Chauvinismus exponiert und isoliert hatte.
Eine nicht unbeträchtliche Rolle spielte auf der Schweizer Bühne in den Kriegsjahren auch ein Diplomat, der bis 1914 deutscher Konsul in Belgrad gewesen war. Hans Schlieben (1865–1943) hatte sich nach Kriegsausbruch pensionieren lassen, war dem pazifistischen Bund «Neues Vaterland»[2] beigetreten wie auch die regimekritischen Diplomaten Fürst Lichnowsky (ehemals Botschafter in London), Graf von der Gröben (Paris), Graf von Leyden (Stockholm) und Graf Monts (Rom), die alle erhebliche Zweifel an der Integrität Deutschlands hegten und artikulierten. Ab 1917 war Schlieben erst hinter den Kulissen, dann auch öffentlich die wesentliche Gestalt des Exil-Blattes «Freie Zeitung». 1917 war Schlieben durch ein Pamphlet hervorgetreten, das unter dem Titel «Die deutsche Diplomatie, wie sie ist und wie sie sein sollte» erschienen war.
Ein Krupp-Direktor im Schweizer Exil
Am rigorosesten im moralischen Engagement und nicht zuletzt deshalb von großem Einfluss auf die deutsche Emigration in der Schweiz war die regimekritische, gegen den Obrigkeitsstaat und gegen den preußischen Militarismus gerichtete Haltung Wilhelm Muehlons, der bis zum Herbst 1914 Direktor der Abteilung für Kriegsmaterial bei Krupp in Essen gewesen war. Muehlon hatte im Juli 1914 nach Gesprächen und Erkundigungen wirklich gutunterrichteter Kreise – Helfferich, Krupp von Bohlen und Halbach, Staatssekretär Jagow – den Eindruck gewonnen, dass Berlin den Krieg unbedingt wollte. Muehlon zog daraus zunächst persönliche Konsequenzen und gab seine glänzend bezahlte Position bei Krupp auf: Im Auftrag des Auswärtigen Amtes erwarb er sich in der Folgezeit Verdienste um Lebensmittellieferungen an das Deutsche Reich aus Ungarn und Rumänien, die er aufgrund persönlicher Beziehungen zuwege brachte.[3] Sosehr er den Krieg verabscheute, hielt er diese diplomatischen Sondermissionen doch für seine Pflicht, jedenfalls bewies er damit seinen Patriotismus, der ihm bald danach öffentlich abgesprochen wurde. Im Spätherbst 1916 übersiedelte Muehlon in die Schweiz, wo er im Interesse eines Verständigungsfriedens ehrenamtlich in der deutschen Gesandtschaft mitarbeitete. Nach der Ankündigung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges durch Deutschland am 1. Februar 1917 brach er jedoch den Verkehr zu allen offiziellen Stellen in Deutschland ab.
In einem sorgfältig formulierten Brief an den Reichskanzler Bethmann Hollweg begründete Muehlon Anfang Mai 1917 seine Verurteilung der deutschen Kriegsführung und sagte sich förmlich und «endgültig von den Männern des heutigen deutschen Regimes» los: «So zahlreich und schwer auch die Irrtümer und Verfehlungen auf deutscher Seite von Kriegsbeginn an waren», schrieb Muehlon nach Berlin, «so glaubte ich lange Zeit hoffen zu können, daß eine bessere Einsicht und Gesinnung bei unseren maßgebenden Persönlichkeiten allmählich durchdringen werde. In dieser Hoffnung hatte ich während des Krieges meine Mitarbeit in Rumänien in gewissem Maße zur Verfügung gestellt, und war ich bereit, auch in meinem jetzigen Aufenthaltslande, der Schweiz, mitzuhelfen, so weit das Ziel der Bemühungen Annäherung der feindlichen Parteien sein sollte … Seit Anfang dieses Jahres ist mir jede Hoffnung hinsichtlich der heutigen Leiter Deutschlands geschwunden. Das Friedensangebot ohne Angabe der Kriegsziele, der verschärfte Unterseebootskrieg, die Deportationen der Belgier, die Verwüstungen in Frankreich, die Versenkung englischer Hospitalschiffe sind Beispiele der Handlungen, die immer wieder von neuem unsere verantwortlichen Persönlichkeiten derartig disqualifiziert haben, daß sie nach meiner Überzeugung für eine gutwillige, gerechte Verständigung überhaupt nicht mehr in Betracht kommen.»[4]
Im August 1917 verfasste Muehlon über seine persönlichen Beobachtungen zu den Kriegsvorbereitungen im Juli 1914 ein Memorandum, das nur den Abgeordneten des Deutschen Reichstags zugedacht war, jedoch seinen Weg in die Öffentlichkeit fand und ab Ende 1917 als Beweis der deutschen Schuld am Kriege zusammen mit der Denkschrift des Fürsten Lichnowsky von der gegnerischen Propaganda in großem Stil benutzt wurde.[5] Der Hauptausschuss des Reichstages beschäftigte sich im März 1918 mit dem Fall und erledigte ihn auf die damals übliche Weise, indem der Verfasser des gefährlichen Memorandums als nervenkranker Phantast abqualifiziert und seine Ausführungen als «Ausgeburt einer kranken Phantasie» diffamiert wurden. Muehlon reagierte mit der Veröffentlichung seines Tagebuchs aus dem Herbst 1914. Die Publikation unter dem Titel «Die Verheerung Europas» in einem Schweizer Verlag erreichte große Verbreitung, wurde in viele Sprachen übersetzt und brachte den Verfasser, weil die Entente Raubdrucke des Büchleins über deutschen Schützengräben abwarf, endgültig in den Ruch des Vaterlandsverräters und Söldlings der Feinde Deutschlands.[6]
Nichts hatte Muehlon, einem Mann liberaler und demokratischer Überzeugung, der aber Bindungen an Parteien und Vereinigungen auswich, ferner gelegen. Er hatte Zeichen setzen wollen auf dem Weg zu Neubesinnung und Umkehr, und das blieb auch nach 1918 sein Anliegen. Er war der Mittelpunkt eines illustren Kreises deutscher Friedensfreunde und Gegner des Wilhelminismus und Militarismus. Zu diesem Kreis gehörten die schon genannten Schriftsteller ebenso wie Prinz Alexander Hohenlohe, der ehemalige bayerische General Montgelas, der in Zürich lehrende Professor Hermann Staudinger, zeitweise auch die Radikaldemokraten um die «Freie Zeitung» und viele andere Leute mit großem Renommee.
Im Streit um die Kriegsschuld
Muehlon war das Vorbild für die politischen Publizisten des Exils in der Schweiz, die in reichlicher Anzahl Bücher und Pamphlete erscheinen ließen, die je nach Perspektive als deutschfeindliche Propagandaschriften erst Gegenstand des Protestes der deutschen Gesandtschaft in Bern, daraufhin Objekt der Untersuchung durch die Eidgenössische Presskontrollkommission bzw. Element radikaldemokratischer Aufklärung waren. Im Mittelpunkt stand die Erörterung der Kriegsschuldfrage, die von den Autoren mit eindeutiger Zuweisung an die deutsche Regierung, die deutsche Schwerindustrie und das deutsche Militär beantwortet wurde. Kaiser Wilhelm II. und das Haus Hohenzollern waren in das Verdikt einbezogen, und die Forderung nach dem Sturz der Monarchie war integraler Bestandteil der Anklage. Protagonist dieser Literatur war ein Autor, der im Gegensatz zu seiner einstigen politischen Bedeutung völlig vergessen ist. Richard Grelling war von Haus aus Jurist, und als Schriftsteller und Mitgründer der «Literarischen Gesellschaft» in Berlin hatte er einen guten Namen. Er war Syndikus des Deutschen Schriftstellerverbandes und mit Bertha von Suttner und Alfred Hermann Fried 1892 einer der Geburtshelfer der «Deutschen Friedensgesellschaft» gewesen. Bis zur Jahrhundertwende führte Grelling als Vizepräsident deren Geschäfte.
Grelling propagierte auf der Linie des aufklärerischen Fortschrittsoptimismus einen Rüstungsstopp durch übernationale Abkommen: «Nur durch internationale Vereinbarungen kann dem Rüstungsfieber Einhalt geboten werden. Das ist vielleicht schon heute die öffentliche Meinung Europas, wenn sie auch in der Tagespresse nicht genügend zum Ausdruck kommt. Das ist das Heilmittel, über dessen Notwendigkeit und Nützlichkeit in wenigen Jahren – wenigstens bei den Regierten – kein Zweifel mehr bestehen wird.» Grelling plädierte durchaus moderat nicht für vollständige Abrüstung, sondern lediglich für einen Stillstand: «Mögen sie vorläufig ‹jeden Mann und jeden Groschen’ behalten. Aber nur keine neuen Männer und keine neuen Groschen!»[7]
Grelling zog sich 1903 im Alter von fünfzig Jahren auf ein Landgut bei Florenz ins Privatleben zurück, er schrieb auch nichts mehr. Die Julikrise 1914 lockte ihn freilich wieder nach Berlin. Er kam zu der Überzeugung, dass der Kriegsausbruch von Deutschland provoziert worden war, dass Deutschland einen Angriffskrieg führte, und diese Überzeugung machte ihn zum Ankläger. Nach dem Kriegseintritt Italiens lebte Grelling bis 1920 in der Schweiz. Dort ließ er 1915 anonym im betont ententefreundlichen Verlag Payot in Lausanne eine Schrift erscheinen, die unter dem Titel «J’accuse!» sensationellen Erfolg hatte.[8] Ermuntert hatten ihn drei Männer aus der sozialdemokratischen Minderheit, die sich über die Verweigerung der Kriegskredite dann zur USPD zusammenfand: Eduard Bernstein, Karl Kautsky und Hugo Haase. Grellings Anklageschrift erregte den Abscheu aller vaterländisch Gesonnenen, und das umso mehr, als das Buch in viele Sprachen übersetzt und von der alliierten Propaganda gegen Deutschland benutzt wurde. Phantastische Vorstellungen kursierten über die Summen, die der Verfasser aus den Reptilienfonds der Ententemächte erhalten haben sollte.
Im Mai 1918 wurde Grelling vom Oberreichsanwalt in Abwesenheit des Landesverrats angeklagt. Nach dem Krieg blieb er in Acht und Bann, als sich in der Kriegsschuld-Debatte die Reihen fest geschlossen hatten: Wer an der Unschuld des Deutschen Reiches zu zweifeln wagte, galt als Nestbeschmutzer, Vaterlandsverräter, als ein von der Entente gedungenes Subjekt. Richard Grelling, der noch eine Reihe von Büchern zur Kriegsschuldfrage verfasste und als einer der besten Kenner der diplomatischen Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges galt, kam in Deutschland nur noch in pazifistischen und linksrepublikanischen Blättern zu Wort, etwa in der «Weltbühne», in der Zeitschrift «Die Menschenrechte» oder in «Das Andere Deutschland». Seine Vision, dass die Weimarer Republik wegen der revanchistischen und chauvinistischen Tendenzen der Mehrheit zum Untergang verurteilt sei, schuf ihm nach der Veröffentlichung der Schrift «Videant Consules» drei Jahre vor seinem Tod noch einmal neue Feinde.[9]
Aus den kleineren Geistern der deutschen politisch und kulturell motivierten Emigration, die vielfach mehr durch Eifer und Fanatismus als durch Talent und staatsmännische Klugheit, öfter durch Leidenschaft als durch Augenmaß auffielen, ragten zwei Protagonisten hervor: Hugo Ball und Ernst Bloch. Ball war im Mai 1915 zusammen mit seiner späteren Frau, der Literatin Emmy Hennings, in die Schweiz gekommen. Nachträglich bekannter durch seine Mitwirkung in der künstlerischen Szene in Zürich, als Mitgründer der Bewegung des Dadaismus, trat er vom Herbst 1917 bis Frühjahr 1920 vor allem als politischer Publizist in Erscheinung und als treibende Kraft in der «Freien Zeitung» und im Freien Verlag in Bern.[10]
Ab Frühjahr 1917 lebte Ernst Bloch, er war Anfang dreißig und mittellos, zwei Jahre lang in der Schweiz. Es war sein erstes freiwilliges Exil. Unterstützt von Wilhelm Muehlon, dem ehemaligen Krupp-Direktor, der als mäzenatischer und anregender Mittelpunkt des heterogenen Kreises von Literaten und politisierenden Kritikern des Wilhelminischen Deutschland in Bern lebte, schrieb Bloch politische Kommentare und Artikel, die vor allem in der «Freien Zeitung», gelegentlich auch in der «Friedens-Warte» und in der von René Schickele redigierten pazifistischen und dem literarischen Expressionismus verschriebenen Zeitschrift «Die Weißen Blätter» publiziert wurden. Thema der politischen Publizistik des promovierten Philosophen Bloch war scharfe antiborussische Kritik an Deutschland, getragen von der Überzeugung der deutschen Kriegsschuld und beseelt vom Wunsch nach radikaler Demokratisierung Deutschlands. Seine hauptsächlichen Angriffsziele waren die Hohenzollerndynastie und die Oberste Heeresleitung, personifiziert durch Hindenburg und Ludendorff, dazu gehörten aber auch der von Ludwig Quidde geführte bürgerliche Pazifismus sowie der Sozialismus der Zimmerwalder Konferenz von 1915 und die Bolschewiki nach dem Frieden von Brest-Litowsk.
Unter dem Pseudonym «Dr. Fritz May, Nürnberg» erschien im Oktober 1917 eine Artikelfolge aus der Feder Ernst Blochs in der «Freien Zeitung» mit dem Titel «Was schadet und was nutzt Deutschland ein feindlicher Sieg?». Bloch schrieb unter verschiedenen Pseudonymen in der «Freien Zeitung», veröffentlichte aber 1918 im Freien Verlag Bern unter seinem richtigen Namen eine Broschüre von 23 Seiten Umfang «Schadet oder nützt Deutschland eine Niederlage seiner Militärs?», die im Wesentlichen aus der Artikelserie bestand.
Die deutsche Gesandtschaft beschwerte sich im Oktober 1918 über das Traktat, worauf die Eidgenössische Presskontrollkommission dessen öffentliche Auslage untersagte. Dagegen protestierte der mit der «Freien Zeitung» identische Freie Verlag und verlangte, dass das «aus sachlichen und moralischen Gründen zu Unrecht erfolgte Verbot revidiert und aufgehoben werde». Gleichzeitig wurde der Protest bekräftigt mit der Drohung, dass «der Verfasser vor die Öffentlichkeit treten würde, was dem Ansehen unserer demokratischen Republik gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt einer demokratischen Erneuerung Deutschlands schaden könnte».[11]
Blochs Gedankengänge spiegeln den Geist der radikal demokratischen republikanischen Opposition gegen den Wilhelminismus im Schweizer Exil. Stilistisch überragen sie den Durchschnitt der zahlreichen Artikel und Pamphlete des Exils erheblich. Es ging Bloch um den Nachweis, dass das demnächst Verlorene – Elsass, Lothringen, Posen, die Kolonien – ohnehin nicht zu halten, der Besitz auch nicht erstrebenswert sei, dass die befreiende Wirkung der Niederlage in der Möglichkeit zur Reform, in der moralischen und kulturellen Erneuerung bestünde. In der Artikelfolge von 1917, in der Bloch stärker als im Traktat von 1918 mit einem idealistisch-romantischen Freiheitsbegriff und mit eher ethisch motivierter als marxistisch operierender Kapitalismuskritik arbeitet, stellt sich als Aufgabe und Problem, «aus der militärischen Niederlage die Auferstehung des preußisch vernichteten, alten, kulturvollen Deutschlands zu betreiben».[12] Die Schlussfolgerung lautet: «So bildet es keinen Verrat am Sozialismus und noch weniger an der deutschen Nation, auch den Sieg der Entente, diese Kehrseite preußischer Niederlage zu wünschen, der unter allen Umständen dem Sieg des geliebten Deutschlands, des Reichs der Tiefe, näher steht als der Triumph Preußens, und der, wie die Dinge liegen, die unerlässliche Voraussetzung zu einer Reformatio Germaniae in capite et membris bildet.»[13]
In der Broschüre von 1918 geht es direkter gegen die preußische Militärkaste, gegen Junkertum, Feudalismus, es wird angesichts des fortgeschritteneren Kriegsverlaufs stärker appelliert als deduziert (wie in der Artikelserie 1917), der Generalnenner lautet «Wie lange wehren sich deutsche Menschen noch gegen ihr Erwachen?»[14], und die moralischen Implikationen sind noch griffiger herausgearbeitet. Sie zeigen deutlich den Einfluss Wilhelm Muehlons, dessen Absagebrief an den Reichskanzler Bethmann Hollweg vom 8. Mai 1917 für die politischen Emigranten in der Schweiz eine Art Schlüsseldokument darstellte.[15]
Bloch verkündete in ähnlichem Pathos, wie es ein Vierteljahrhundert später der bürgerliche Widerstand gegen den Nationalsozialismus gebrauchte, die Rückkehr zu den Idealen der Menschheit, wenn erst «ein furchtbares Gewitter vom Westen und Osten» über diese moralische Zermürbung Deutschlands niedergegangen sei. «Dann aber wollen wir uns aufrichten und reuig alles hinter uns werfen, was uns in dieses Elend führte. Nur die Freiheit sei unser erwähltes Teil, damit der Anblick Deutschlands wieder eine Freude und Ehre und nicht wie jetzt vor der Welt ein Gestank und ein Abscheu sei.»[16]
Der Fall Nicolai
Der spektakulärste Konflikt zwischen borussischem Militarismus und deutschnationaler Hybris einerseits und dem Appell zu Frieden und Verständigung, der den Propheten einer besseren Welt ins Exil führte, war der Fall des Mediziners Nicolai. Er war es auch deshalb, weil Georg Friedrich Nicolai besonders streitbar war und immer wieder für Lärm in der Öffentlichkeit sorgte. Der damals vierzigjährige Gelehrte – Privatdozent, Titularprofessor der Medizin an der Berliner Universität und Oberarzt der Charité – hatte 1914 einen «Aufruf an die Europäer» verfasst, der sich gegen den «Aufruf an die Kulturwelt» richtete, den 93 prominente deutsche Intellektuelle zur Rechtfertigung des Krieges als einer deutschen Kulturmission publiziert hatten. Unterzeichnet hatten Nicolais Manifest gegen die Chauvinisten auch Albert Einstein und Wilhelm Foerster, der Berliner Astronom. Der Vater des Philosophen und Pädagogen Friedrich Wilhelm Foerster unterschrieb Nicolais Text mit besonderem Eifer, weil er irrtümlich auch die «Kundgebung der 93» unterzeichnet hatte. Nicolais «Aufruf an die Europäer» war nicht nur eine Zurückweisung des Hurrapatriotismus der 93 deutschen Dichter, Künstler, Musiker, Wissenschaftler, er beschwor die gemeinsame friedliche Zukunft der Europäer: «Soll auch Europa sich durch Bruderkrieg allmählich erschöpfen und zugrunde gehen? Denn der heute tobende Kampf wird kaum einen Sieger, sondern wahrscheinlich nur Besiegte zurücklassen. Darum scheint es nicht nur gut, sondern bitter nötig, daß gebildete Männer aller Staaten ihren Einfluss dahin aufbieten, daß – wie auch der heute noch ungewisse Ausgang des Krieges sein mag – die Bedingungen des Friedens nicht die Quelle künftiger Kriege werden, daß vielmehr die Tatsache, daß durch diesen Krieg alle europäischen Verhältnisse in einen gleichsam labilen und plastischen Zustand geraten sind, dazu benutzt werde, um aus Europa eine organische Einheit zu schaffen.»[17]
Nicolais Aufruf hatte keine Resonanz, es fand sich noch ein vierter Mitunterzeichner, aber mehr nicht. Nicolai erinnerte sich später, dass selbst die besten Deutschen in jenen Tagen nicht gute Europäer sein wollten. Nicolai war als in Fachkreisen international geschätzter Kardiologe im September 1914 vom preußischen Kriegsministerium zum Chefarzt der Herzstation des Lazaretts Tempelhof ernannt worden. Wegen kriegsgegnerischer Vorlesungen fiel er jedoch unangenehm auf und wurde an das Seuchenlazarett Graudenz delegiert. Das war die erste Station einer Serie von Strafversetzungen und Degradierungen, die (nach Verhaftung und Kriegsgerichtsverfahren) mit der Kommandierung zum Militärkrankenwärter und schließlich zum Musketier, der aber die Ausbildung an der Waffe verweigerte, endete.
Hauptursache der beträchtlichen Schikanen, in die aller Erfindungsgeist des preußischen Militarismus investiert wurde, war, neben demonstrativ zur Schau getragener antinationaler Renitenz, die Veröffentlichung des Buches «Die Biologie des Krieges» 1917 in der Schweiz. Die Druckbogen waren bei Nicolai beschlagnahmt worden, und seine militärischen Vorgesetzten hatten die Publikation verboten, weil man zu Recht pazifistisches Gedankengut in dem Werk vermutete. Der Schriftsteller Leonhard Frank schaffte das Manuskript nach Zürich, wo es bei Orell Füssli erschien und Aufsehen erregte.[18] Das Buch war, im Gewande einer wissenschaftlichen Untersuchung – und allen philosophischen, soziologischen, historischen und naturwissenschaftlichen Ansprüchen tatsächlich standhaltend –, die aggressivste Streitschrift gegen den Krieg, die bislang veröffentlicht worden war. Romain Rolland nannte sie das vornehmste Werk, das in diesen drei furchtbaren Kriegsjahren herausgekommen sei. Nicolai, inzwischen nach Eilenburg bei Leipzig versetzt, wo man ihn wie einen Gefangenen hielt und wo er zum Waffendienst gezwungen werden sollte, entzog sich weiteren Schikanen durch die Flucht nach Kopenhagen; das war im Sommer 1918 besonders sensationell, weil dazu ein Flugzeug benutzt wurde.
Im kurzen dänischen Exil gründete Nicolai, zusammen mit Georg Brandes, Ellen Key, Fridtjof Nansen und Romain Rolland, die Zeitschrift «Das Werdende Europa». Ende November 1918 nach Berlin zurückgekehrt, spürte er bald, dass seine Haltung im Krieg nicht vergessen war und dass sein publizistisches Engagement in der Nachkriegszeit im «Bund Neues Vaterland» als Vortragsredner, als Propagandist einer Versöhnung mit Frankreich ein akademisches Comeback verhinderten. Den Versuch, die medizinischen Vorlesungen wieder aufzunehmen, vereitelten nationalistische Studenten im Januar 1920 mit tagelangem gewalttätigem Radau. Im März 1920 wurde Nicolai die Venia Legendi aberkannt. Den Prozess gegen den Rektor und den Senat der Berliner Universität verlor der geächtete Wissenschaftler und Publizist. Zwei Jahre später verließ Nicolai Deutschland endgültig. Der Fall Nicolai hatte längst internationales Aufsehen und Sympathie erregt. In Südamerika wartete eine glanzvolle akademische Karriere auf ihn. Das zweite Exil war lebenslang. In Argentinien und Chile hatte er Lehrstühle für Physiologie (Cordoba) und für Soziologie (Rosario) inne. In ganz Südamerika wurde er bis zu seinem Tod 1964 als universaler Denker und Mentor verehrt.[19]
Ein Vergleich mit dem zweiten Exil, der Flucht vor Hitler, bietet sich an, wobei freilich die Dimensionen dessen, wogegen die Warnungen und Aufrufe gerichtet waren, gewertet werden müssen, um eine unzulässige Gleichsetzung von preußischem Militarismus und chauvinistischer Überheblichkeit mit dem Nationalsozialismus zu vermeiden: Thomas Manns Appelle während des Zweiten Weltkriegs, über BBC nach Deutschland ausgestrahlt[20], waren ebenso vergebliche wie dringende und notwendige Aufrufe, der Welt Signale zu setzen, dass Regime und Regierte nicht in deckungsgleicher Harmonie lebten. Der Zweck von Thomas Manns Beschwörungen war damit den Anstrengungen deutscher Demokraten im Ersten Weltkrieg ähnlich, nämlich der Gegenseite zu signalisieren, dass aus moralischem eigenen Antrieb Erneuerung möglich gewesen wäre, dass das besiegte Deutschland nicht nur als von Fanatikern und Verstockten repräsentiertes Objekt strenger Behandlung durch die Sieger denkbar war.
Die «Freie Zeitung»
Die «Freie Zeitung» war länger und vehementer als alle anderen publizistischen Mittel Sprachrohr der Kritik deutscher Emigranten am kaiserlichen Deutschland, sie war das repräsentative regimekritische Organ. Aber an ihr schieden sich die Geister, nachdem ihr jeder Kontakt zur Realität verlorengegangen war und nachdem evident war, dass die Zeitung in Diensten der Entente stand.[21] Das Blatt erschien ab 14. April 1917 zweimal wöchentlich, mittwochs und samstags, im Umfang von vier Seiten. Als Redakteur traten bis Oktober 1917 Siegfried Streicher und dann Hans Huber in Erscheinung, beide waren Schweizer Bürger. Sie hatten die Funktion, den Charakter der Veröffentlichung als Schweizer Organ zu manifestieren. Wohl auch aus diesem Grund war der Schriftsteller Carl Albert Loosli als Teilnehmer der Gründungsveranstaltung willkommen. Im Weiteren sorgte er vor allem für Hohn und Spott der Gegner, weil er als publizistischer Vorkämpfer der freien Liebe und als Streiter wider die Institution von Strafanstalten unter den Eidgenossen nur eine zweifelhafte Reputation genoss.
Erst ab Herbst 1919 trat derjenige öffentlich auf den Plan, der von Anfang an hinter den Kulissen die Sache betrieb: der ehemalige deutsche Konsul in Belgrad Hans Schlieben. Die wichtigsten Köpfe waren Hugo Ball und Ernst Bloch, zu den regelmäßigen Mitarbeitern gehörten Edward Stilgebauer, Hermann Fernau, Richard Grelling. Aber auch Friedrich Wilhelm Foerster, Iwan Goll, Otfried Nippold, Hellmut von Gerlach schrieben gelegentlich für die «Freie Zeitung», und vertreten waren schließlich, zum Teil durch Nachdrucke aus anderen Publikationen, auch Franz Pfemfert, Maximilian Harden und andere.
Von den Schweizer Behörden mit Argwohn beobachtet, da das Blatt ganz offensichtlich mehr Geld zur Werbung zur Verfügung hatte, als es einnehmen konnte[22], war die «Freie Zeitung» die Stimme entschiedener deutscher Republikaner und Demokraten im Exil. Sie berief sich auf die Traditionen von 1848 und propagierte die Ideen des amerikanischen Präsidenten Wilson. Dafür sorgte nicht zuletzt der amerikanische Pazifist George Davis Herron, der als Privatier in der Schweiz lebte, dort in offiziöser Mission in Wilsons Sinne tätig war und den Frieden zu fördern suchte, indem er Kontakte zu oppositionellen und gemäßigten Politikern der Mittelmächte pflegte.[23]
Die «Freie Zeitung» kämpfte für den Sieg der «Prinzipien der demokratisch-republikanischen Völkerrechte» und verfocht einen radikalen Pazifismus, propagierte den Sturz der Hohenzollern und der Habsburger, die Beseitigung der preußischen Hegemonie in Deutschland, und sie zeigte sich von der Kriegsschuld der Mittelmächte überzeugt. Die Spalten der «Freien Zeitung» standen allen offen, die dafür Beweise hatten oder denen die moralische Verurteilung Deutschlands (und Österreich-Ungarns) ein Anliegen war. Das Blatt wollte den bürgerlichen Demokraten, wenn sie nur radikal genug waren, ebenso als Forum dienen wie sozialistischen Republikanern, wenn sie nur nicht zu parteidogmatisch dachten. Als Ziel galt die «Erreichung und Errichtung der demokratisch-republikanischen Staatsform in allen jenen Staaten …, die sie noch nicht besitzen». Den Weltkrieg verstand man als «Krieg gegen Autokratie und Despotismus, gegen Gottesgnadentum und dynastische Regierungsmethoden. Nicht Völker werden also in ihm besiegt werden, sondern Regierungssysteme, die nicht mehr in unsere Zeit gehören.»[24] Weil die Leute der «Freien Zeitung» aber so radikal waren und so offen sagten, dass sie auf die Niederlage der Deutschen hofften, blieb ihre Wirkung auch unter den Friedensfreunden begrenzt. Die größte Aufmerksamkeit fanden die deutschen Emigranten um die «Freie Zeitung» 1917 und 1918, auch weil die Ententemächte ihre Artikel als Arsenal für anti-deutsche Flugblätter benutzten. Nach dem Krieg wurde es stiller um sie, und 1920 war die Zeitung (mit der letzten Nummer am 27. März) am Ende.
Der deutschen Gesandtschaft in Bern war die «Freie Zeitung» natürlich ein Dorn im Auge. Sie verlangte das Einschreiten der eidgenössischen Behörden, sie unterstützte auch das in Zürich ab Ende August 1917 bis 7. November 1918 erscheinende hohenzollernfromme und regierungsfreundliche Gegenstück der «Freien Zeitung», «Das Freie Wort – Zeitschrift für Wahrheit und Frieden», in dem die deutschen Republikaner und Radikaldemokraten ständig und aufs schärfste attackiert wurden.
Aber auch in der Schweiz wurde Anstoß genommen an der Gazette. So forderte der Berner Rechtsanwalt Altherr das Politische Departement zum Einschreiten auf: «Die Haltung des betreffenden Blattes steht in krassem Widerspruch zur Neutralität, welche wir Schweizer einhalten sollten. Mit einer Unverfrorenheit, die ihresgleichen sucht, wird da kühn und keck die Absetzung der Hohenzollerndynastie in Deutschland gefordert. Die politischen Verhältnisse in Deutschland werden in der einseitigsten Weise dargestellt, und der Endzweck aller Artikel läßt sich nur schwer verdecken. Was würde Frankreich sagen, wenn wir eine solche Zeitung gegen jenes Land herausgeben würden? Es gäbe gewiß an Frankreich auch vieles zu kritisieren, ebenso an England und Italien. Wenn aber ein Schweizer Blatt die Absetzung der Dynastie von Koburg-Sachsen-Gotha in England, der Savoyer in Italien und des Präsidenten Poincaré forderte, so würde gewiss auch die Meinung vorherrschen, daß man sich da in Dinge mische, die uns nichts angehen. Das Gebaren der ‹Freien Zeitung› ist für einen neutralen Schweizer empörend, und ich bitte Sie im Namen vieler guter Patrioten, dem unwürdigen Treiben ein Ende zu bereiten.»[25] Die Zensurkommission ließ es stattdessen bei einer Ermahnung der Redaktion der «Freien Zeitung» bewenden.
Der Sturz der Hohenzollern und die Gründung der Weimarer Republik waren Folgen der militärischen Niederlage und nicht Wirkungen radikal-demokratischer Propaganda aus dem Exil. Nicht zuletzt ist die politische Emigration im Ersten Weltkrieg an ihrer Maßlosigkeit gescheitert, aber auch daran, dass wesentliche Protagonisten von der Entente abhängig und damit auch für deutsche Regimekritiker unglaubwürdig geworden waren. Das machte sie letztlich wirkungslos. Die Agitation der deutschen Dissidenten in der Schweiz ist aber auch ein Lehrstück für den Umgang mit politisch agierenden Exilanten: Im Ersten Weltkrieg haben es die Schweizer Behörden jedenfalls an Augenmaß, Zuwendung und Toleranz gegenüber einer schwierigen Klientel von Asylbegehrenden nicht fehlen lassen. Im Zweiten Weltkrieg war die eidgenössische Politik gegenüber asylsuchenden Feinden Hitler-Deutschlands rigoroser.
Friedrich Wilhelm Foerster: Pazifist und Europäer
Der international renommierte Philosoph und Pädagoge Friedrich Wilhelm Foerster, Sohn des Berliner Astronomen Wilhelm Foerster, engagierte sich früh in der «ethischen Bewegung», als Pazifist und Kritiker des Wilhelminismus. Im Alter von 26 Jahren wurde er 1895 wegen Majestätsbeleidigung in einem Artikel gegen eine der berüchtigten Reden Kaiser Wilhelms II. zu drei Monaten Festungshaft verurteilt. 1901 wurde Foerster Privatdozent in Zürich, 1912 Professor in Wien. 1914 bis 1920 hatte er einen Lehrstuhl an der Universität München, von dem er 1916 nach Protesten gegen seine Haltung zum Weltkrieg beurlaubt wurde. Er lebte bis 1920 in der Schweiz.
Den Versuch, die Lehrtätigkeit in München wieder aufzunehmen, machte der Radau nationalistischer Studenten zunichte. Seine Thesen zur deutschen Kriegsschuld zogen ihm den Hass der Mehrheit deutscher Patrioten zu. Als Propagandist des Wilsonschen 14-Punkte-Programms, als Warner vor deutschem Neo-Militarismus, aber auch als extremer Föderalist, Antipreuße und Verfechter christlicher Ethik, saß er politisch zwischen allen Stühlen. In unzähligen Schriften vertrat Foerster einen radikalen Pazifismus, der aber nicht «auf dem Aberglauben an die guten Absichten des anderen» aufgebaut sein dürfe, sondern rational auf die Erforschung der Ursachen jeder Art von Friedensstörung gegründet sein müsse.
Dem konservativen Bürgertum war Foerster auch deshalb suspekt, weil er 1918/19 die Revolutionsregierung Kurt Eisners als bayerischer Gesandter in der Schweiz vertreten hatte. Nach Morddrohungen aus dem rechtsradikalen Lager floh Foerster 1922 zum zweiten Mal und diesmal endgültig aus Deutschland. Erste Station war wieder die Schweiz, dann lebte er von 1926 bis 1937 in Paris und anschließend in einem Dorf in Hochsavoyen. Im Exil kämpfte Foerster weiter gegen Nationalismus und Militarismus, er warnte vor einem zweiten Weltkrieg und beschwor die Idee europäischer Gemeinschaft.
Das NS-Regime machte den prominenten unbequemen Publizisten, der sich für die Unantastbarkeit der polnischen Westgrenze und die deutsch-französische Aussöhnung engagierte, 1933 durch Ausbürgerung zum Staatenlosen. Im Herbst 1938 wurde Foerster Franzose. Das erwies sich zwei Jahre später beim Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Frankreich als Unheil: Foerster floh mit seiner Familie wieder in die Schweiz, wurde aber zurückgewiesen, da er nach Meinung der dortigen Behörden als französischer Staatsbürger von den Deutschen nichts zu befürchten und deshalb keinen Anspruch auf Asyl habe. Die Rettung kam aus Portugal: «Meine Ausweisung aus der Schweiz, die mich zwang, nach Frankreich zurückzukehren, brachte mich in die absolute Gefahr, von der französischen Regierung ausgeliefert zu werden, welcher Gefahr bekanntlich der in Frankreich weilende sozialdemokratische Abgeordnete Dr. Breitscheid zum Opfer fiel. Ich wäre also verloren gewesen, wenn ich nicht einen persönlichen Brief von Präsident Salazar von Portugal erhalten hätte, worin derselbe mich einlud, auf unbegrenzte Zeit in sein Land zu kommen (Präsident Salazar hatte mein Buch «Europa und die deutsche Frage» in französischer Übersetzung kennen gelernt). Mit seinem Briefe in der Hand konnte ich durch Spanien reisen, ohne von irgendwelcher Seite belästigt zu werden. Der Empfang in Portugal kontrastierte merkwürdig mit der Ausweisung aus der Schweiz, wo ich 16 Jahre als Hochschullehrer, Vortragender und Jugendlehrer gewirkt hatte.»[26] Von Portugal aus erreichte Foerster die USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er nach Europa zurück, aber nicht nach Deutschland, sondern in die Schweiz. Dort ist er 1966 gestorben.
Das Exil im Ersten Weltkrieg war keine Massenflucht, und für die meisten Kritiker des Wilhelminismus oder der deutschen Kriegsführung blieben die Grenzen zwischen Heimat und dem Schweizer Exil durchlässig. Der Rückkehr ins Vaterland stand nach der Novemberrevolution 1918 auch grundsätzlich nichts im Wege. Für einige der Exilanten des Ersten Weltkriegs hatte der Protest gegen die Politik des kaiserlichen Deutschland allerdings lebenslange Folgen. Wilhelm Muehlon etwa blieb als «Vaterlandsverräter» gebrandmarkt, andere, wie der Schriftsteller Grelling, blieben geächtet. Das Schicksal des prominentesten Kritikers Friedrich Wilhelm Foerster kann man als lebenslanges Exil bezeichnen, das im Ersten Weltkrieg begann und nach dem Zweiten Weltkrieg nicht endete. Die Fälle Foerster und Nicolai sind exemplarisch für den chauvinistischen Hass, der den Menschen entgegenschlug, die nationalistischem Taumel und Kriegsgebrüll mit Argumenten entgegentraten und statt Revanche Versöhnung predigten. Ähnlich erging es dem Philosophen Theodor Lessing am Ende der Weimarer Republik, der als Intellektueller und politischer Publizist 1926 seine Dozentenstelle an der Technischen Hochschule Hannover verlor, weil er den Feldmarschall Hindenburg als ungeeignet für das Amt des Reichspräsidenten bezeichnete. Der Visionär ging nach Hitlers Machterhalt ins Exil in die Tschechoslowakei. In Marienbad fiel er Ende August 1933 nationalsozialistischen Mördern, die auf ihn angesetzt waren, zum Opfer.[27]
Als radikaler Demokrat verfemt: Emil J. Gumbel
Der Weg des Physikers Albert Einstein, der in den Jahren zwischen 1905 und 1916 die Relativitätstheorie entwickelte und damit Weltruhm erwarb, begann im freiwilligen Exil. Als Feind chauvinistischer Ressentiments und militaristischer Parolen wurde er, 27 Jahre alt, Bürger der Schweiz. 1909 bis 1914 war er Hochschullehrer in Zürich und Bern. Als Pazifist engagierte er sich trotz seiner Stellung als Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts in Berlin (1914–1932) gegen Militarismus und Krieg und für die Verständigung mit Frankreich. Das brachte ihm Morddrohungen und Aggressionen ein, auch weil er Jude war. 1932 verließ er Deutschland, als wahrscheinlich prominentester Emigrant lebte und arbeitete er bis zu seinem Tod in Princeton.[28] Aus ähnlichem Grund, weil er als Pazifist und Jude angefeindet war, begab sich auch der Mathematiker Emil Julius Gumbel 1932 ins Exil. Seine Karriere war weniger glanzvoll.
Emil J. Gumbel auf einer Veranstaltung der Liga für Menschenrechte, 1932
Der 1891 in München geborene Sohn eines Privatbankiers Emil Julius Gumbel beendete im Juli 1914 das Studium der Mathematik und Nationalökonomie und zog als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg. Zum Pazifisten gewandelt, schloss er sich 1915 dem «Bund Neues Vaterland», der späteren «Deutschen Liga für Menschenrechte» an. Als entschiedener Republikaner und Propagandist der Aussöhnung mit Frankreich machte er sich mit Publikationen über Fememorde, rechtsradikale Geheimbündelei und die «Schwarze Reichswehr» Feinde.[29] Die gleichen Themen behandelte er als Vortragsredner bei pazifistischen Vereinigungen und Veranstaltungen auch im Ausland und in Artikeln, die in der Zeitschrift «Menschenrechte» und gelegentlich in der «Weltbühne», aber auch in Tageszeitungen erschienen. Die Wirkung beruhte auf der ebenso schmucklosen wie akribischen Kompilation von Fakten.
Anfang 1923 hatte sich Gumbel in Heidelberg als Privatdozent für Statistik etabliert; trotz seines internationalen Renommees, das er durch wissenschaftliche Veröffentlichungen erwarb, verlieh ihm die Universität den Titel eines außerordentlichen Professors nur widerwillig und erst 1930. Bereits 1924 hatte sich ein akademischer Untersuchungsausschuss mit Gumbel befasst, weil er bei einer Versammlung von Kriegsgegnern die Gemüter der Nichtanwesenden durch eine missverständliche Formulierung erregt hatte. Die Kommission, der Karl Jaspers angehörte, fand keine formalen Anhaltspunkte, Gumbel die Venia Legendi zu entziehen, aber ihr veröffentlichter Beschluss war eine moralische Hinrichtung.
Den Höhepunkt erreichte der Skandal im Mai 1932 nach zahllosen nationalistischen und antisemitischen Krawallen in Heidelberg und rechtsextremistischen Diffamierungen des mittlerweile prominenten Pazifisten und radikalen Demokraten, für den auch Albert Einstein Partei ergriff. Die Universität reagierte auf den Druck der Konservativen und entließ den unbequemen Hochschullehrer im August 1932. Die Nationalsozialisten, die Gumbel auch wegen seiner jüdischen Herkunft diffamierten, erwiesen ihm die Ehre, seine Bücher im Mai 1933 öffentlich zu verbrennen. Mit mindestens vier der neun «Feuersprüche», die im Mai 1933 die Bücherverbrennung zum Ritual stilisierten, waren auch die Schriften Emil Julius Gumbels als Produkte «undeutschen Geistes» angeklagt und zum Scheiterhaufen verurteilt worden.[30] Gumbel ging noch vor Hitlers Machtantritt ins Exil und folgte Einladungen der Universitäten Paris und Lyon.[31] Weitere Stationen des Exils ab 1940 waren die New School for Social Research in New York und andere amerikanische Hochschulen.
Ansicht des Institute of Social Research der Columbia University New York
Aber ebenso wie die akademische Position in Lyon war Gumbels Stellung in New York befristet und unsicher, jedenfalls immer weit entfernt von den materiellen Annehmlichkeiten und dem Prestige der Inhaber von Lehrstühlen. An der «Graduate Faculty of Political and Social Science» der «New School for Social Research» in New York firmierte Gumbel als Visiting Professor; bezahlt wurde er mit einem Rockefeller-Stipendium, das im Herbst 1944 nicht mehr verlängert werden konnte. An der Columbia University hatte er zuletzt, ab 1953, den Rang eines Adjunct Professors, das war weder glanzvoll noch lukrativ, dasselbe galt für seine Tätigkeit als Special Lecturer an der Newark School of Engineering 1946–1948 und als Associate Professor (1947) am Brooklyn College und ebenso für die anderen Institutionen, an denen er als Gast lehrte und forschte. Seine und anderer Bemühungen, ihn am renommierten Institute for Advanced Study in Princeton unterzubringen, wo Thomas Mann, Albert Einstein, Hermann Weyl und andere prominente Emigranten wirkten, erwiesen sich als aussichtslos. Das Format für Princeton hatte Gumbel offenbar doch nicht. Wie Hermann Weyl im September 1944 an einen New Yorker Kollegen, der sich für Gumbel einsetzte, schrieb, gelte er unter Fachleuten zwar als tüchtig, aber nicht als hervorragend, außerdem habe er in den letzten zehn oder mehr Jahren auf seinem Gebiet nichts entscheidend Neues hervorgebracht, und wenn man sein Alter bedenke – Gumbel war inzwischen 53 Jahre alt –, dann sei es überhaupt nicht leicht, etwas für ihn zu finden. Die Princeton-Professoren hielten eine Anstellung in der privaten Wirtschaft für das Gegebene; solange Gumbel nicht amerikanischer Staatsbürger war (er hatte damals einen französischen Pass und die Einbürgerung in den USA erst beantragt), bot sich auch keine Aussicht auf eine Beschäftigung in Diensten der Regierung.[32]
Gumbels Dilemma lag darin, dass er einerseits für das auf tatsächliche oder potentielle Nobelpreisträger reflektierende Princeton und andere, vergleichbare Institute nicht in Frage kam, andererseits aber auch vom Typ des durchschnittlichen amerikanischen Hochschullehrers erheblich abwich. Vor allem traf er nicht den dort gewohnten kameradschaftlich-familiären Umgangston zwischen Professoren und Studenten.
Gumbel – das galt für die meisten Wissenschaftler im Exil – konnte jedenfalls nicht wählerisch sein und musste die eher bescheidenen Möglichkeiten, die sich ihm boten, nutzen. Dazu gehörten Aufträge von Regierungsstellen; so war er 1959/60 an einem Forschungsprojekt der US-Army «Technical Applications of Extremes» maßgeblich beteiligt, 1949 war er «Consultant» beim National Bureau of Standards in Washington gewesen.
Für das Office of Strategic Services (OSS), den im Zweiten Weltkrieg aufgebauten amerikanischen Geheimdienst, der Informationen über Deutschland und andere europäische Länder sammelte, um sie bei der Besatzung nach Kriegsende zu benutzen, verfasste Gumbel im Frühjahr und Sommer 1945 mehrere Schriftsätze, die den Einfluss der NS-Ideologie auf die Schweiz, Schweden und Portugal zum Gegenstand hatten. Andere, umfangreichere Memoranden Gumbels waren seinen klassischen Themen gewidmet, den «Wegbereitern des deutschen Faschismus», den deutschen Militärbünden 1919–1923, der «Einstellung der NSDAP zum politischen Terror».
Ob diese Manuskripte mehr als platonische Bedeutung hatten, ist schon aufgrund des verwendeten Quellenmaterials fraglich. Die Ausarbeitungen über den Einfluss der Nazis auf die neutralen Länder basierten auf veralteter Literatur, und auch über die Militärbünde oder andere Wegbereiter des Faschismus konnte Gumbel im Sommer 1945 in New York bestimmt nicht mehr aussagen als in seinen früheren Schriften. Bei der «day by day history of Munich from November 1918 to November 1919», einer kurzen Chronik der Ereignisse nach der Novemberrevolution, die das OSS im Januar 1945 in Auftrag gab und die innerhalb kürzester Frist fertig gestellt werden musste, liegt die Vermutung nahe, dass Mildtätigkeit der einzige Grund für den Auftrag war. Am 7. Februar 1945 wurde Gumbel bestätigt, dass sein termingerecht gelieferter Bericht den Erwartungen voll entsprochen habe und dass der Auftraggeber hoch zufrieden sei. Allerdings, so hieß es im entsprechenden Brief an Gumbel, wisse der Auftraggeber ebensowenig wie sein Vorgesetzter – das war der emigrierte ehemalige deutsche Gewerkschaftsjurist Franz Neumann – oder der Verfasser des Manuskripts, warum jemand diese Informationen angefordert habe.[33]
Gumbel widmete sich aber hauptsächlich seinem eigenen Fach, der mathematischen Statistik. In Fachkreisen erwarb er sich einigen Ruhm. Sein Buch «Statistics of Extremes», 1958 erschienen[34], galt als bahnbrechend, es wurde ins Japanische und Russische übersetzt. Die «Gumbel-Formel», Ende der vierziger Jahre zur Berechnung der Höchst- und Tiefststände von Strömungen entwickelt, erwies sich beim Bau von Staudämmen als höchst nützlich. Aufgrund seiner Forschungen erhielt Gumbel auch Einladungen zu internationalen Kongressen und zu einer Vortragsreise nach Asien im Sommer 1960 mit Stationen in Bangkok und Osaka.
1962 erschien auch noch einmal ein politisches Buch von Gumbel: «Vom Fememord zur Reichskanzlei».[35] Es war der Versuch einer knappen Geschichte der Zerstörung der Weimarer Republik, der freilich mit den Ergebnissen der historischen Forschung, die gleichzeitig oder wenig später veröffentlicht wurden, nicht mehr konkurrieren konnte. Gumbel hat es sehr bedauert, dass er in beiden deutschen Nachkriegsstaaten als politischer Publizist nicht mehr gefragt war. Er hätte anlässlich kurzer Gastprofessuren in Berlin und Hamburg gerne auch Vorträge zu politischen Themen gehalten, aber es bestand kein Interesse, es gab keine Einladungen.
Als politischer Schriftsteller war Gumbel nicht durch Brillanz und Originalität aufgefallen, sondern durch die kompromisslose und schlichte Dokumentation skandalöser Missstände. Die Kompromisslosigkeit des linksintellektuellen Antifaschisten war aber unverzeihlicher als das Fehlen der Brillanz. Die Redlichkeit und Akribie seiner Darstellung wissen Historiker immer noch zu schätzen. Gumbels Schriften über den Rechtsextremismus in der Weimarer Republik behielten Quellenwert. Für die Tagespolitik in Nachkriegsdeutschland waren die Ereignisse, die Gumbel geschildert hatte, indessen nicht mehr aktuell.
Das radikal-demokratische Engagement, wohl auch die Formen, in denen er sich engagierte, machten Gumbel zum unbequemen Mann. Seine politischen Positionen waren und sind mit Hilfe gängiger Raster kaum einzuordnen, und dafür ist auch bezeichnend, dass der Antifaschist Gumbel, der mit der bürgerlichen Gesellschaft nicht gerade konfliktlos zurechtkam, in der DDR noch mehr in Vergessenheit geriet als in der Bundesrepublik. Die späte Renaissance seiner Schriften hat er nicht mehr erlebt, auch nicht die Entstehung eines neuen Pazifismus, der sich freilich als Friedensbewegung sui generis ohne historische Wurzeln begriff und ihn kaum zu seinen Ahnen zählt. Das Engagement seiner Wiederentdecker am Ende der siebziger Jahre konnte er ebenfalls nicht mehr genießen. Es blieb bei der materiellen «Wiedergutmachung», die nach 1945 geleistet wurde.
Am 10. September 1966 starb Gumbel in New York. Keine einzige Zeitung in Deutschland druckte einen Nachruf. Der Republikaner der ersten deutschen Republik, einer von wenigen, die bedingungslos für sie kämpften, der Pazifist, der politische Publizist war der Öffentlichkeit unbekannt. Oder blieb er, in der Weimarer Republik und im Dritten Reich als Republikaner, Demokrat und Pazifist geschmäht, als Vaterlandsverräter, Jude, Bolschewist verfemt und vertrieben, auch als Emigrant – und hier steht Gumbels Name für viele – suspekt?
Die Biographien des Physikers Albert Einstein, des Philosophen Ernst Bloch, des Mathematikers Gumbel sind paradigmatisch für die Flucht und Vertreibung von Intellektuellen, die wegen ihrer Gesinnung, der Opposition gegen Zeitgeist und Obrigkeit oder wegen ihrer Herkunft verfolgt wurden. Das erste Exil Blochs begann in der Schweiz, wo er im Ersten Weltkrieg als Pazifist gegen den Wilhelminismus agierte. Das zweite Exil begann 1933 mit der Flucht über Zürich, Wien und Paris. 1938 bis 1949 lebte er in den USA, wo sein Hauptwerk «Das Prinzip Hoffnung» entstand. Die Berufung auf den Lehrstuhl für Philosophie in Leipzig bedeutete die Rückkehr nach Deutschland. Die brillante akademische Laufbahn endete 1957 mit der Zwangsemeritierung des wegen seines Freiheitsbegriffs wieder in Opposition zur Obrigkeit der DDR stehenden Gelehrten. Wissenschaftliche und ideologische Kampagnen und der Erfolg im Westen veranlassten Bloch zum dritten Exil: Wegen der Abriegelung des Staatsgebiets durch die Berliner Mauer kehrte er im August 1961 von einer Vortragsreise in die Bundesrepublik nicht in die DDR zurück. Die Universität Tübingen bot ihm Asyl. Dort ist er 1977 gestorben.
Der Exodus kritischer Geister und politischer Außenseiter begann nicht erst mit dem Machterhalt Hitlers und der NSDAP 1933, und er endete auch nicht mit dem Zusammenbruch des «Dritten Reiches» 1945.
2. Flucht vor der «nationalen Revolution»
Unmittelbar nach ihrer Machtübernahme begannen die Nationalsozialisten mit ihren politischen Gegnern abzurechnen und sie zu verfolgen. Das waren in erster Linie die Kommunisten, aber auch exponierte Sozialdemokraten, Pazifisten und entschiedene Demokraten, die sich gegenüber dem Nationalsozialismus publizistisch und politisch hervorgetan hatten.
Der Reichstagsbrand am 28. Februar 1933 bot den willkommenen Vorwand, die Kommunisten aus dem öffentlichen Leben auszuschalten, Instrument dazu war – durch Notverordnung begründet – die «Schutzhaft», vollstreckt wurde sie in Konzentrationslagern, die im Frühjahr 1933 wie Pilze sprossen. In diesen frühen KZ wurde auch Rache an lokalen Gegnern genommen, wurden Honoratioren drangsaliert, weil sie die nationalsozialistische Machtübernahme zu verhindern getrachtet hatten. Nach dem Muster von Dachau, wo der Reichsführer SS Himmler in seiner Funktion als kommissarischer Chef der Münchner Polizei im März 1933 eines der frühen KZ errichten ließ, entstand ab 1936 das endgültige System von Konzentrationslagern, das dem Staatsterror eine einheitliche und verbindliche Ordnung gab. Die «wilden KZ» der Frühzeit wurden geschlossen, das System blieb bis zum Ende des NS-Regimes unverändert, erweiterte sich im Krieg noch einmal beträchtlich, bis zuletzt 25 Hauptlager mit über 1200 Außenlagern den ganzen deutschen Machtbereich überzogen.[1] Die Konzentrationslager existierten außerhalb des Justizapparats und jenseits rechtsstaatlicher Norm. «Schutzhäftlinge», deren Verfolgung durch die «Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat» lediglich scheinlegalisiert war, standen ausschließlich unter der Willkür der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) und der SS.[2]
Exodus der Gegner: Das politische Exil
In einer ersten Emigrationswelle entzogen sich ab Frühjahr und Sommer 1933 Gegner des Nationalsozialismus, die durch parteipolitische, publizistische oder sonstige Aktivitäten exponiert waren, durch Flucht der Verfolgung. Es waren vor allem Funktionäre der Arbeiterbewegung, Kommunisten, Sozialdemokraten, Angehörige sozialistischer Parteien links der SPD, Journalisten und Literaten, Künstler und Intellektuelle, die den zu Macht gekommenen Nationalsozialismus fürchten mussten. Ende 1935 waren nach Angaben des Flüchtlingskommissars des Völkerbunds 6–8000 Kommunisten, 5–6000 Sozialdemokraten und etwa 5000 andere Personen aus politischen Gründen emigriert. Insgesamt waren es etwa 30.000 Menschen, die zwischen 1933 und 1939 das Deutsche Reich (einschließlich des 1938 angeschlossenen Österreich und der annektierten Sudetengebiete) aus politischen Gründen verlassen hatten.[3]
Die politische Emigration verlief in mehreren Wellen. Die erste setzte mit dem Terror der «Machtergreifungs»-Zeit ein, und zu ihr gehörten auch die Errichtung von Stützpunkten und Auslandsvertretungen des Exilvorstandes der Sozialdemokratie in Prag (Mai 1933) und die Verlegung der KPD-Zentrale nach Paris. Eine zweite politische Emigrationswelle erfolgte 1934, als einige tausend Protagonisten der österreichischen Arbeiterbewegung nach dem Schutzbundaufstand gegen die Dollfuß-Regierung vor allem in die Tschechoslowakei flohen. Die dritte Welle brachte die Saar-Abstimmung 1935, als wiederum in erster Linie Angehörige der Arbeiterbewegung aus dem Saargebiet u.a. nach Frankreich fliehen mussten, weil das Territorium ihres Exils nach dem Plebiszit an das Deutsche Reich fiel. Unter diesen ca. 4000 politischen Flüchtlingen befanden sich viele, die bereits in der ersten Emigrationswelle das Deutsche Reich verlassen hatten. Nach dem Anschluss Österreichs im Frühjahr 1938 flohen nicht nur die Reste der Sozialdemokraten und Kommunisten, sondern auch christlich-soziale Anhänger des Ständestaats und bürgerliche Konservative vor Hitler vor allem in die Tschechoslowakei.[4] Die letzte Emigrantenwelle folgte der Annexion der Sudetengebiete; 4–5000 Sozialdemokraten und etwa 1500 Kommunisten begaben sich ins Exil, Aufnahmeländer dieser Gruppen waren namentlich Großbritannien und Schweden.[5]
Das politische Exil verstand sich als eine Form des Widerstands im Kampf für ein besseres Deutschland nach Hitler. Andere als publizistische Waffen standen kaum zur Verfügung, die Zahl der Druckschriften – Bücher, Zeitschriften, Pamphlete, Flugblätter –, die in den Orten des deutschsprachigen politischen Exils veröffentlicht wurden, die die Meinung des Auslands beeinflussen und auch in Deutschland Wirkung haben sollten, war aber beträchtlich.
Das politische Exil äußerte sich im Kampf gegen Hitler vielstimmig, nach politischen Richtungen getrennt, in Fraktionen gespalten. Alle Bemühungen, in einer «Volksfront» die Kräfte des «anderen Deutschland» gegen den Nationalsozialismus zu bündeln, wie sie Mitte der 1930er Jahre in Paris unternommen wurden, scheiterten am Gegensatz von Sozialdemokraten und Kommunisten, an dogmatischer Intransigenz auf der einen und Misstrauen auf der anderen Seite.[6]
Diffamierung, Diskriminierung, Verfolgung: Prinzipien nationalsozialistischer Diktatur
Die Verfolgung politischer Gegner lag in der machtpolitischen Logik der nationalsozialistischen Diktatur. Aus anderen Gründen, ideologischen Prämissen folgend, wurden Menschen verfolgt, weil sie sozial auffällig waren oder von der Mehrheit abweichende sexuelle Gewohnheiten hatten: «Asoziale»[7] und Homosexuelle[8] wurden, ebenso wie mehrfach bestrafte Kriminelle[9] und Angehörige religiöser Minderheiten[10], Insassen in Konzentrationslagern. Am unbarmherzigsten jedoch diskriminierte und verfolgte der NS-Staat auf Grund seiner Rassenideologie Minderheiten, allen voran die Juden. Verfolgung bis zur Vernichtung traf als erste Gruppe psychisch und physisch Behinderte aus dem eigenen Volk. Der als «Euthanasie» geschönte Mord an Anstaltsinsassen und anderen, wegen einer geistigen oder körperlichen Behinderung zu «Ballastexistenzen» deklarierten Menschen in der Größenordnung von ca. 250.000 Menschen war ab Herbst 1939 die Einübung der Verwirklichung rasseideologischer und sozialdarwinistischer Ideale des nationalsozialistischen Programms.[11]
Die Tiraden zur «Lösung der Judenfrage», die in Hitlers «Mein Kampf» zu lesen waren und deren Quintessenz im Parteiprogramm der NSDAP