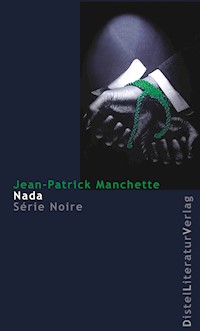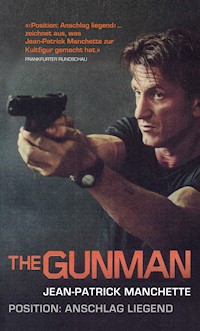Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Distel Literatur Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Série Noire
- Sprache: Deutsch
Der junge Henri Butron ist ein richtiger Fiesling; er will alles: Geld, Sex und Ruhm, und das sofort, und er hält sich für einen ganz harten Typen. Ein politischer Wirrkopf. Früher beteiligte er sich an den Gewalttaten der rechten OAS. Als er Anne und ihre Mutter Jacquie kennenlernt, wechselt er die Seiten. Er wird Leibwächter von N'Gustro, dem Führer einer afrikanischen Befreiungsbewegung, und mischt sich in Politik und Komplotte ein, nur zum Spaß, wegen des Geldes, dem Ruhm. N'Gustro muß es ausbaden; er wird mitten in Paris von zwei Männern, die sich als Polizisten ausweisen, mitgenommen und entführt. Die Geschichte Manchettes beruht auf einem realen Fall: Der «Affäre Ben Berka». Der marokkanische Politiker war Führer einer Befreiungsbewegung und lebte in Frankreich im Exil. 1965 wurde er in Paris unter mysteriösen Umständen entführt und dann ermordet. Der Skandal wurde von den Behörden vertuscht und ist bis heute nicht restlos aufgeklärt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DistelLiteraturVerlag
Jean-Patrick Manchette, geboren 1942 in Marseille, liebte Jazz, Kino und Literatur. Er radikalisierte den europäischen Roman noir und gilt als Begründer des neueren sozialkritischen französischen Kriminalromans, des sogenannten Néopolar.
Manchette arbeitete als Drehbuchautor und veröffentlichte neben Theaterstücken und zahlreichen Essays auch zehn Kriminalromane, die ihn zur Kultfigur machten, und von denen die meisten verfilmt wurden, so Nada (1973) von Claude Chabrol; Tödliche Luftschlösser (Folle à tuer, 1975) von Yves Boisset, mit Marlène Jobert; Westküstenblues (Trois hommes à abattre, 1980) von Jacques Deray, mit Alain Delon; Knüppeldick (Pour la peau d’un flic, 1981) von und mit Alain Delon; Position: Anschlag liegend (Le choc, 1982) von Robin Davis, mit Catherine Deneuve und Alain Delon; Volles Leichenhaus (Polar, 1983) von Jacques Bral; Position: Anschlag liegend wurde 2015 unter dem Titel The Gunman neu verfilmt von Pierre Morel mit dem zweimaligen Oscar-Preisträger Sean Penn.
Alle Kriminalromane sowie die gesammelten Essays zum Roman noir in den «Chroniques» sind auf Deutsch im Distel-LiteraturVerlag erschienen.
Jean-Patrick Manchette starb 1995 im Alter von 52 Jahren in Paris. Er wurde zur Leitfigur für eine neue Generation von Krimiautoren in Frankreich
Jean-Patrick Manchette
Die Affäre N’Gustro
Aus dem Französischenvon Stefan Linster
DistelLiteraturVerlag
Copyright © 2004, 2016 by Distel Literaturverlag Sonnengasse 11, 74072 Heilbronn Die Originalausgabe erschien 1971 unter dem Titel «L’affaire N’Gustro» in der Série Noire bei Éditions Gallimard (Paris) Copyright © Éditions Gallimard 1971 Umschlagentwurf: Jürgen Knauer, Heilbronn ISBN 978-3-923208-64-7 (Print) ISBN 978-3-942136-09-9 (E-Book)
Eine Auswahl an Urteilen über Henri Butron, die in den Wochen nach seinem Tod abgegeben wurden.
EDDY ALFONSINO
Ich habe ihn in einem meiner Kurzfilme, der in Hyères* gelaufen ist, eine Rolle spielen lassen. Ich kann nicht viel über ihn sagen, außer, dass er nicht der Typ Mann war, der sich abknallt. Vorsicht, ich will da nichts behaupten. Wenn die Flics sagen, dass er sich abgeknallt hat, werde ich dem nicht widersprechen. Ansonsten eher der ehrliche Typ. Zu vertrauensselig. Vorsicht, ich kannte ihn kaum. Die Presse versucht, mich als die Person hinzustellen, die ihn als Letzte lebend gesehen hat, das stimmt vielleicht, aber ich war weder sein bester Freund noch sonst was. Da müssen Sie andere fragen. Gehen Sie mir nicht auf den Wecker.
JACQUIE GOUIN
Er war eine ziemlich faszinierende Figur. Mitleiderregend, wenn er versuchte, den Harten zu spielen, aber hart, wenn man Mitleid mit ihm hatte. So eine Art tiefgekühlte Gehässigkeit allem gegenüber, absolut allem. Wenn er intelligent gewesen wäre, hätte er was von Stirner an sich gehabt, wenn Sie wissen, was ich meine. Aber er war nicht intelligent.
BEN DEBOURMANN
Butron war ein mieser kleiner Schakal. Das ist mir erst nachträglich aufgefallen, als ich erfahren habe, welche Rolle er in der Affäre N’Gustro gespielt hatte. Der war ein echter Nazi. Ein Schakal. Ein mieser kleiner Schakal.
JACQUIE GOUIN
Er ist das Produkt einer Epoche und eines Milieus. Und da liegt das ganze Problem, denke ich, dazu habe ich mich ausführlich in meinen Artikeln geäußert. Feindselig gegenüber jeder Art von Autorität. Hasserfüllt. Furchtbar hasserfüllt. Hassen ist stupide und ermüdend.
KOMMISSAR GOÉMOND
Man sah gleich, dass er ein hoffnungsloser Fall war. Er hatte einen Hass auf alles. Und kein Benehmen. Man sah gleich, dass das böse enden würde. Ich kannte seinen Vater gut, ich bin froh, dass der nicht alt genug geworden ist, um das mitzuerleben. Und außerdem war er ein pathologischer Lügner. Der Fall Butron, der ist letztendlich ein pathologischer Fall.
* Erklärungen zu einigen Wörtern, Namen und Begriffen am Ende des Buches (Anm. d. Übers.).
Henri Butron sitzt ganz allein in dem düsteren Büro. Er trägt eine Hausjacke mit Borten. Sein Gesicht ist blass. Er schwitzt leicht. Er trägt eine dunkle Brille vor den Augen und einen weißen Hut auf dem Kopf. Vor ihm steht ein kleines Tonbandgerät, das läuft. Butron raucht kleine Zigarren und spricht in das Gerät. Er stolpert über manche Worte.
Es ist ziemlich spät in der Nacht und völlig still um das Haus, das weit entfernt vom Hafen von Rouen liegt.
Butron ist fertig. Er streicht sich seinen Schnurrbart glatt und stoppt das Tonbandgerät. Er spult die Aufnahme zurück. Er will sie sich anhören. Sein eigenes Leben fasziniert ihn.
Der Türgriff quietscht. Butron springt vom Sessel hoch. Schweiß quillt aus seiner Stirn wie Öl aus einer gepressten Olive. Die Tür öffnet sich nicht sofort, weil das Schloss verriegelt ist. Butron bekommt den Schluckauf. Das Büro hat keinen anderen Ausgang als diese Tür. Er hätte sich in ein anderes Zimmer setzen sollen. Es ist zu spät, um darüber nachzudenken. Jemand tritt mit dem Absatz gegen die Tür, in Höhe des Schlosses; das bricht auf, und es ist offen. Butron versucht törichterweise, in die gegenüberliegende Wand zu verschwinden. Er will seinen Rücken in ihr eingraben. Seine Hände krallen sich in die Blümchentapete, seine Nägel dringen in den Gips ein, zerkratzen ihn, brechen ab.
Zwei Männer treten ohne Eile in das Büro. Der Weiße im Ledermantel wirft einen Blick auf Butron, schätzt ihn als harmlos ein und geht auf das Tonbandgerät zu. Die Spule hat sich ganz aufgewickelt, und das Bandende flattert wie wild durch die Luft. Der Weiße stoppt das Gerät. Der andere Typ, ein Neger, der eine kleine Schirmmütze aus marineblauem Tuch und einen Regenmantel von der Sorte Royal Navy trägt, bleibt vor Butron stehen und holt eine spanische Astra-Halbautomatik, mit einem selbstgebastelten Schalldämpfer, aus seiner Tasche. Butron hat seine Körperfunktionen nicht mehr unter Kontrolle. Er macht sich in die Hose. Der Neger feuert eine Kugel auf ihn ab, die ihm das Herz durchbohrt, und im Rücken, unterhalb des linken Schulterblattes, durch ein tomatengroßes Loch wieder austritt; Fleisch und Blut spritzen auf die zerkratzte Wand; Butrons Herz ist zerplatzt. Sein Kopf schlägt gegen die Wand, und er prallt nach vorne und fällt mit dem Gesicht mitten auf den Teppich. Drei oder vier Sekunden lang, nachdem er schon tot ist, treten immer noch seine Exkremente aus.
Der Neger nimmt den warmen Schalldämpfer von der Astra und steckt ihn in die Tasche, dann wirft er die Astra an der Wand auf den Boden.
Der Weiße steckt das Tonband mit der Aufnahme in einen Umschlag, klebt ihn zu und verstaut ihn innen in seinem Ledermantel.
Währenddessen hebt der Neger den Telefonhörer neben dem Tonbandgerät ab und wählt eine Nummer.
«Butron hat sich gerade umgebracht», verkündet er. «Sie können kommen.»
Kurz darauf umstellen Polizeibeamte das Haus. Zwei Polizisten in Regenmänteln und ein kleiner, rundlicher Mann, der der Gerichtsmediziner sein muss, betreten das Haus. Der Weiße und der Neger geben einem der beiden Männer in Regenmänteln die Hand.
«Gut», sagt der Weiße, «na dann, wir müssen uns auf die Socken machen.»
«Ciao», sagt der Kommissar, dem sie die Hand geschüttelt haben.
Die beiden Männer gehen fort. Sie steigen in einen Ford Mustang und fahren Richtung Paris. Unterwegs hören sie im Autoradio Melody For Melanie von Jackie McLean. Der Weiße, der am Steuer sitzt, klopft den Takt auf das mit Leder bezogene Lenkrad und kann von Zeit zu Zeit ein kurzes schwachsinniges Kichern nicht unterdrücken. Der Neger jedoch sitzt regungslos da, nach einer Weile schläft er ein und beginnt zu schnarchen.
Kurz nachdem der Mustang die Autobahn verlassen hat, wacht er wieder auf. Der Wagen befindet sich in der Nähe von Montfort l’Amaury. Er fährt auf Landstraßen. Er gelangt zu einer Villa, die von wildem Wein und Stockrosen verdeckt ist. Es brennt Licht. Man hat auf sie gewartet.
Sie betreten ein Büro. Hinter einem Tisch, vor einem Bücherregal, das mit schönen gebundenen Büchern ausgestattet ist, sitzt ein Neger mit schmaler Adlernase. Er hat eher die Physiognomie eines Danakalis als die eines Negers. Er trägt einen italienischen Anzug. Und mehrere Ringe. Er raucht eine Bastos. Es ist Maréchal George Clémenceau Oufiri. Die beiden Killer geben ihm den Umschlag mit dem Band und brechen wieder auf.
Der Maréchal holt ein kleines Tonbandgerät aus einer Schublade des Schreibtisches; er legt das Band ein. Er hört es sich an und lacht sich halb tot dabei. Wenn er so lacht, sieht man, dass er spitzgefeilte Zähne hat.
Es hat angefangen, das Ganze beginnt 1960 auf dem Gymnasium Pierre Corneille in Rouen, wo ich den philosophischen Zweig besuche, was beweist, dass ich nicht so bescheuert bin, wenn man bedenkt, dass ich im Dezember 1942 geboren bin.
Es sind die ersten Tage nach den Sommerferien. Wir haben uns in der Sekunda angewöhnt, keinen Strich zu tun, wir werden das nicht mehr ändern. Zunächst einmal behandeln wir Physik und Mathematik mit totaler Verachtung. Wir haben den Physiklehrer in der Pause dabei ertappt, wie er in das Waschbecken des Labors uriniert hat; er weiß, dass wir das wissen. Der Mathemensch ist ein alter Korse mit Hundevisage und rauer Behaarung: man sieht, wie sich die weißen, glatten Haare, stachelig wie Fischgräten zwischen den schlaffen Krümmungen seines Gesichts aufrichten, das so ausgeleiert ist wie ein altes Gummiband. Er will es gar nicht wissen, ob wir arbeiten oder nicht, es ist ihm völlig egal. Die Mathenote zählt beim Philo-Abi nicht viel.
Die geisteswissenschaftlichen Fächer machen mir gar keine Probleme. Ich habe schon immer enorm viel gelesen. Ich könnte brillieren, wenn ich wollte, aber das ist mir schnuppe. Ich sitze lustlos an meinem Tisch zwischen Leroy, der Rugby spielt und mit Professionellen verkehrt (er hat sich gerade einen Tripper eingefangen und tastet sich durch das Loch in seiner Hosentasche immer ängstlich seine Vorhaut ab, um jedes Mal entsetzt festzustellen, dass eine seröse Flüssigkeit herausperlt), und Babulique, der sehr dick, von bescheidener Herkunft ist und der nach Schweiß stinkt.
Der Philosophielehrer spricht über Psychologie, vom Verhalten des Huhns, das hinter einem halbkreisförmigen Drahtzaun steht, vor dem Körner liegen; es wird nie, niemals genug Grips haben und um den Zaun herumgehen. Das Wetter ist mild, eine Sonne wie in der Nachsaison, Indian Summer, das ist der Titel eines Stücks von Stan Getz mit Al Haig am Piano; eine schwachsinnige Musik. Leroy mag den West-Coast-Jazz, besonders Gerry Mulligan. Ich mag ihn nicht; ich mag den Hard-Bop; die Jazz Messengers, Charles Mingus, und solche Sachen.
Es läutet. Allgemeines Geraschel von Blättern und Heftern, und wir gehen raus; in der nächsten Stunde haben wir Mathe, ich gehe durch das Haupttor, gehe schnell am Seineufer entlang, in ein Bistro für Fernfahrer, nahe bei der Warenbörse, genehmige mir einen Calvados, spiele eine Runde Flipper. Mir bleiben nur noch fünftausend alte Franc bis zum Ende der Woche, und es ist Mittwoch. Vater Butron hält mich kurz. Ich sollte von meiner Mama, dieser saublöden Alten, zusätzlich Geld verlangen und beispielsweise vorgeben, die Klasse habe einen Beitrag für die Philosophiebibliothek beschlossen; die Philosophie ist wichtig und teuer; und das ist nützlich.
Ich gehe die Rue Jeanne d’Arc wieder hoch in Richtung Bahnhof. Ich glotze einer Schnalle nach, die mit einem Birnenarsch und widerspenstigen Locken vor mir herläuft. Die muss sich für hochgradig schön halten mit ihrer dreckigen Kameltreibernase. Sicher eine orientalische Jüdin. Ich kenn die Juden ziemlich gut, ich habe schon mehrere Jüdinnen gefickt.
Ich mache vor dem Schallplattenladen halt. Sie haben eine Les McCann bekommen, gegen die ich nichts hätte, aber es ist eine Langspielplatte, und ich habe meine hautenge, unpraktische blaue Jacke an. Ich betrachte mich im Schaufenster. In ein paar Minuten habe ich eine Verabredung. Meine Haare sind ziemlich lang; ich streiche sie seitlich aus der Stirn. Ich habe eine breite, glatte Stirn und sehr ausdrucksvolle Augen. Eine Durchschnittsnase. Das hat mich noch nie besonders gestört. Ich trage eine hellgraue Röhrenhose, Slipper mit Schnalle und ein hellblaues Hemd mit einer bordeauxroten Strickkrawatte, passend zu den Slippern, und schwarze Socken. Wenn man das so beschreibt, erscheint es ziemlich zusammengewürfelt, aber in Wirklichkeit ist es nicht schlecht. Ich bin eins fünfundsiebzig groß, habe lange Beine, einen geschmeidigen Gang. Ich schaue auf meine Schweizer Armbanduhr und sehe, dass ich schon fünf Minuten zu spät dran bin, ich kann mich also langsam in Bewegung setzen.
Ich gehe bis zum Parkplatz vor der Kathedrale, laufe an ziemlich schicken Wagen entlang, ohne «76» auf dem Nummernschild, und versuche es an den Türen. Ich klaue einen Fiat 1100, bei dem ein Ausstellfenster halb offen steht; ein Kinderspiel, ihn aufzukriegen; ich setze mich ans Steuer, mache auf ganz entspannt; ich hole mein Thermometer und meine Pipette heraus, die ich meinem Vater, diesem alten Deppen, geklaut habe; ich spritze das Quecksilber ins Zündschloss, starte und setze meine dunkle Brille auf.
Ich fahre die Rue Jeanne d’Arc hinauf; vergewissere mich im Vorbeifahren, ob Lyse auf der anderen Straßenseite auf der Caféterrasse sitzt. Ich drehe eine Runde um den dreieckigen Häuserkomplex, oben an der Straße, ich fahre am Bahnhof vorbei und komme wieder zurück, gleite lässig am Trottoir entlang. Ich mache Lyse ein Zeichen. Sie steht halb auf und winkt gleichzeitig mir und dem Lohnsklaven zu. Während sie zahlt, fällt mir ihre Freundin auf, eine kleine Dunkelhaarige in ziegelroter Hose und schwarzem Pulli, kurze braune Haare. Sie hat einen breiten Arsch, was ziemlich selten ist in unseren Tagen. Sie dreht sich um und erwidert meinen Blick. Spürbare Feindseligkeit in ihrer Haltung. Ich kriege einen Ständer. Ich steige aus dem Fiat. Mein Stachel, mit dessen Größe ich zufrieden bin, hindert mich am Gehen, denn meine hellgraue Hose ist ebenfalls ziemlich eng. Lyse wollte gerade einsteigen.
«Wir werden Sie doch nicht allein zurücklassen», sage ich zu ihrer Freundin.
«Sie sehen aus wie ein richtiger Schwachkopf», erwidert sie.
Lyse macht sofort dicht, denn sie ist sich instinktiv klar darüber, dass bei einem solchen Gesprächsbeginn etwas Sexuelles mitspielt, auch wenn sie es nicht bewusst wahrnehmen kann, so wie ich.
Ich schlage ihrer Freundin vor, den Rest des Tages am Meer zu verbringen, sie stimmt mit verächtlicher Miene zu, und meint, sie sei gespannt darauf, zu hören, was für einen Schwachsinn ich von mir geben würde.
Um sie in ihre Schranken zu weisen, lasse ich sie hinten einsteigen, und auf der ganzen Fahrt nach Dieppe richte ich nicht einmal das Wort an sie und tausche in den Kurven Zungenküsse mit Lyse aus, wobei ich am Ende häufig ganz nach links ausschere.
Der Strand nahe bei Dieppe, an den wir gehen, ist schon von Dichtern besungen worden, aber das war vor dem Krieg. Nachdem die Deutschen die Abschussrampen der V-1 in der Nähe aufgebaut hatten, ist der Ort von Bomben platt gemacht worden, wie man sagt. Die strohgedeckten Häuser in Lehmbauweise hat es wie nichts weggeblasen, auch die schönen, solide gebauten Hotels, in die damals die jungen, reichen Engländer in weißen Hosen, mit Tennisschläger unter einem Arm und Banjo unter dem anderen, zur Sommerfrische kamen – zumindest erzählt man sich das. Als der Wiederaufbau kam, hatten die Bauerntrampel Anspruch auf Beton ohne jeden Stil, und die Ortschaft ist entsprechend hässlich geworden. Zudem haben der soziale Fortschritt und die starke Zunahme der Autos diese Region für Arbeiter der Großindustrie erreichbar gemacht; so kommt es, dass in der Saison nicht mehr die jungen, eleganten Engländer die Örtlichkeiten heimsuchen, sondern laute Proletarier mit ihren Bälgern, die überall rumscheißen. Ich hasse diese ganze Vulgarität. Ich spüre, dass ich der ganzen Sache besser gewachsen gewesen wäre, wenn ich in einem wirklich gehobenen Milieu geboren wäre, und nicht nur als Sohn eines Arztes.
Glücklicherweise haben wir jetzt die ersten Tage im Oktober, es gibt keine Sommergäste mehr. Der Strand ist menschenleer, ein lauwarmer Wind weht über ihn hinweg.
«Ich geh ins Wasser», kündet Lyse verführerisch an.
Sie fügt nicht hinzu, wer mich liebt, der folge mir, aber das war der Grundgedanke. Ich rühre mich nicht. Ich mache ihr nur ein onkelhaftes Zeichen, um sie zu ermuntern. Sie steht plötzlich ganz blöd da. Sie weiß nicht mehr, ob sie ins Wasser gehen soll. Sie geht trotzdem rein, aus Stolz, und beginnt zu schwimmen, geradewegs auf England zu. Sicher hätte sie gerne, dass ich mir ihretwegen Sorgen mache. Weit gefehlt. Ich stütze mich auf den Ellbogen, um mir ihre Freundin genauer anzuschauen.
Sie heißt Anne Gouin. Sie hat, wie ich schon sagte, einen breiten Arsch, fest, hoch angesetzt, was sehr gut ist und was man am schwersten findet. Kleine, aber arrogante Brüste; damit will ich sagen, dass sie spitz sind. Rundes Gesicht, kleine Nase, großer Mund, große blaue Augen mit ganz ordentlichen Wimpern. Sie hat einen verächtlichen Schmollmund, total aufgesetzt. Ich habe meine Jacke und meine Krawatte abgelegt; ich knöpfe mein Hemd über meinem Brustbein auf. Mein Oberkörper ist unbehaart, aber braun gebrannt.
«Warum haben Sie mich vorhin beleidigt?»
Sie zuckt mit den Schultern. Sie ist mit sich zufrieden.
«Was habe ich denn Besonderes an mir», sage ich. «Ich habe nichts Besonderes.»
«Genau», sagt sie und ist immer mehr mit sich zufrieden.
«Ich mach mir keine Probleme,» sage ich verlogenerweise. «Vielleicht ärgert gerade das die Leute. Das Leben ist absurd. Uns ist nur ein lächerlich winziges Stück Zeit gegeben, verglichen mit der Ewigkeit; darum sollten wir uns für nichts aufopfern, wir sollten die guten Dinge genießen. Das Essen, den Beaujolais.»
Ich mache eine kurze Pause, um meinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen.
«Man muss das Spiel spielen», erkläre ich.
«Der Beaujolais ist kein Ideal», sagt sie.
«Es gibt keine Ideale», gebe ich mit hartem Gesichtsausdruck zurück. «Gott existiert nicht, und der Marxismus ist ein Schwindel.»
Sie lächelt ironisch.
«Sie werden schon sehen», sagt sie.
«Was werde ich sehen?»
«Es gibt viele wie Sie, die sich einbilden, dass die Geschichte sich nicht weiterentwickelt. Aber sie tut es doch. Schauen Sie sich Algerien an. Schon bald wird die ganze Dritte Welt ihre Herren vor die Tür setzen. Dann wird der Kapitalismus keine Rohstoffe mehr haben und eine Überproduktion von Widersprüchen und eine ökonomische Krise erleben, und Sie werden wissen, warum Sie jammern.»
«Nach mir die Sintflut», sage ich scharfsinnig.
«Nicht nach Ihnen!», ruft sie aus. «Nein! Nein! Noch zu Ihren Lebzeiten wird selbst Frankreich zusehends faschistisch werden. In einigen Jahren wird die Rückkehr der geschlagenen Truppen jeden Einzelnen zwingen, sich endgültig zu entscheiden.»
«Ich entscheide mich dafür, mich nicht zu entscheiden.»
Und zack. Das hat gesessen …
«Armer Blödmann ohne jedes Bewusstsein», flüstert sie in mein Ohr.
Ihr Atem hat sich bei der Hitze der Diskussion beschleunigt. Ich nehme ihren Kopf in meine Hand. Wir sehen uns scharf an. Sie schiebt mir ihre Zunge in den Mund. Ich werfe sie zurück auf die Kieselsteine. Wir reiben uns aneinander. Wir sind ganz rot. Lyse taucht wieder auf, steigt aus dem Wasser, begreift sofort und bleibt für den Rest des Tages zugeknöpft. So oder so, zwischen Lyse und mir ist es aus.
Auf der Rückfahrt steigt Anne vorne ein. Den ganzen Weg über verhält sie sich sehr reserviert. Sie vertreibt sich die Zeit damit, jedes Mal ihre Schenkel übereinander zu schlagen, wenn ich ihre Muschi mit meinem Ellbogen erregen will. Ich tue so, als ob ich nichts bemerken würde. Lyse weint auf dem Rücksitz. Ich setze die beiden dort ab, wo ich sie abgeholt habe. Um sie zu verunsichern, frage ich Anne weder nach ihrem Telefon, noch danach, wo sie zur Schule geht, und weiß dabei genau, dass ich sie leicht wiederfinden kann, wenn ich will; Rouen ist nicht so groß.
Ich stelle den Fiat an der Seine ab und öffne, bevor ich ihn dort stehen lasse, den nicht verschlossenen Kofferraum, um nachzusehen, ob es nichts zu klauen gibt. Ein etwas dickbäuchiger Typ stürzt auf mich zu. Später werde ich erfahren, dass er der Besitzer dieses Schlittens ist.
«Dreckiger kleiner Dieb!», ruft er.
Er will mich am Kragen packen. Ich wehre mich. Er gibt mir eine Ohrfeige. Die Demütigung bringt mich aus der Fassung. Ich packe die Handkurbel im Kofferraum und schlage sie mit aller Kraft auf den Schädel des Typs. Sein Hut ist platt gedrückt. Blut strömt aus seiner geröteten Stirn. Er taumelt. Ich verpasse ihm noch einen Schlag mit der Kurbel quer über die Schnauze. Sein Kiefer klappt nach unten. Er fällt auf das Trottoir und bricht sich den Schädel. Zwei Hafenarbeiter laufen quer über die Straße und stürzen sich auf mich; sie verdrehen mir die Arme und überwältigen mich.
(Auszug aus Notizen von Jacquie Gouin) … Henri Butron wurde am 8. Dezember 1942 in Orléans geboren. Sein Vater, ein achtunddreißigjähriger Arzt, aus einer angesehenen Familie aus der Touraine stammend, arbeitete morgens in einem öffentlichen Vorsorgezentrum und nachmittags in einer Arztpraxis, die er sich mit einem anderen, älteren Arzt teilte. Seine Mutter war eine unscheinbare, eher hässliche Person ohne eigentliche Beschäftigung und tierlieb. Die Familie hat ein äußerst geregeltes Leben geführt. Nichts scheint Henri Butron zur Verkommenheit prädestiniert zu haben. Er ist ein Einzelkind, sicherlich ziemlich verwöhnt, aber der Haushalt Butron ist harmonisch, sein Lebensstandard sicherlich angenehm, alles hält sich in Maßen.
Der junge Henri Butron ist ein etwas schwächliches, aber gesundes Kind. Und ein eifriger Abenteuerromanleser. Seine Lehrer stufen ihn als einen intelligenten und disziplinierten, etwas unscheinbaren Schüler ein.
Mit zehn Jahren ist Butron als Externer in eine von Jesuiten geführte Privatschule eingetreten, wo er den Großteil seiner Mittelstufenzeit verbrachte.
Ende 58 kauft Doktor Butron eine Praxis in Rouen, wo sich die Familie bald darauf niederlässt. Henri Butron tritt während des Schuljahres in die zehnte Klasse des Corneille-Gymnasiums ein. Seine Lehrer stufen ihn als äußerst faul ein. Einige erwähnen seine Intelligenz; alle seine Passivität. Vielleicht hat der Wechsel wegen der unterschiedlichen schulischen Disziplin Butron geschadet. Allerdings scheint er bereits in Orléans nachts einige Fahrzeuge «ausgeliehen» zu haben, um die Frau eines subalternen, in der Stadt kasernierten Offiziers auf amouröse Spazierfahrten mitzunehmen.
Butron kommt im Frühsommer 1960 ohne Schwierigkeit durch den ersten Teil seines Abiturs. Er interessiert sich für Jazz und versucht, Schlagzeug zu lernen, aber er gibt die Beschäftigung mit dem Instrument ziemlich schnell wieder auf. Offenbar hat er es sich nun zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig Autos zu stehlen, und zwar nur, um Spazierfahrten zu machen, und die Fahrzeuge dann ganz in der Nähe des Ortes, wo er sie gefunden hat, und kurz nachdem er sie geliehen hat, wieder stehenzulassen.
Am 3. Oktober 1960 stiehlt er das Auto von Monsieur Albert Ventrée, einem Weinhändler aus Châlon-sur-Marne, um einen Ausflug in die Gegend von Dieppe zu machen. Bei der Rückkehr wird er zufälligerweise von Herrn Ventrée überrascht, als er das Fahrzeug gerade abgestellt hat. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Henri Butron schlägt auf Herrn Ventrée ein, der versuchte, ihn zu umklammern. Der Händler trägt einen Schädelbasisbruch und einen zerschmetterten Kiefer davon. Butron wird ins Gefängnis gesteckt. Zwischen seinem Vater und Herrn Ventrée kommt eine Abmachung zustande. Die Behörden, die Herrn Butron, den Vater, schätzen, stellen sich dem nicht in den Weg. Herr Ventrée zieht seine Anzeige zurück. Henri Butron tritt in die Armee ein. Nach seiner Grundausbildung wird er nach Oran zur Fernmeldetruppe geschickt. Er wird während einer Übung am rechten Auge verletzt und ist wehrdienstuntauglich.
Zugegeben, es ist ziemlich blöd, dass sich dieser Idiot den Schädel gebrochen hat. Das hat alles sofort viel schwieriger gemacht. Aber ich beklage mich nicht. So läuft das Spiel. Man kann nicht jedes Mal gewinnen. Ich glaubte nicht wirklich, dass das Ganze Konsequenzen haben würde. Letztlich war ich beim Gedanken an die Reaktion meines Vaters ziemlich aufgeregt. Dieser alte Knacker, was er zu Hause ständig mir gegenüber zum Ausdruck brachte, war die große Enttäuschung, souveräne Verachtung. Er fand mich degeneriert im Vergleich zu ihm, diese Schwuchtel. Da fand ich es nun ziemlich erregend, seinen Namen richtig in den Schmutz zu ziehen. Er würde schön in der Scheiße sitzen, mir gegenüber recht behalten zu haben.
Auf dem Kommissariat hat mich ein Bulle geohrfeigt, weil ich mich vor Nervosität halb kaputt gelacht habe. Noch nie habe ich es ertragen können, gedemütigt zu werden. Genauso kurz und schnell trat ich ihm in die Eier. Es waren sechs, oder sogar mehr, die über mich hergefallen sind. Ich habe gespürt, wie mich eine extreme und warme Trägheit überkam. Ich konnte gerade noch ein paar Obszönitäten brüllen, während sie mich mit zwölf oder zwanzig Faustschlägen voll in die Fresse zu Boden warfen, einer hatte einen Siegelring, der mir die Backe aufriss; dann gaben sie mir Fußtritte, als ob sie sich einen Ball zuspielen würden. Der Schmerz war furchtbar, besonders als sie mich in die Leber und die Nieren traten. Ein Knobelbecher ließ mir das Fleisch am Unterarm aufplatzen, aber ich spürte es kaum. Sie zogen mich an den Haaren. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich konnte nicht einmal mehr ein Wort rausbringen, weil ich in einer Art Dämmerzustand war. Ich bin weder Homo noch Maso, aber ich sage es offen, es bringt einen gewissen Lustgewinn, von einer Gruppe kräftiger Rohlinge brutal behandelt zu werden, vor allem, wenn sie einem geistig unterlegen sind.
Später wurde ich dem Richter vorgeführt, aber es gelang mir nicht, ihn ernst zu nehmen. Ich kannte Miezen, mit denen er es getrieben hatte. Jeder Respekt in mir war tot.
Ich traf auch mit Kommissar Goémond zusammen. Den kannte ich ein bisschen, weil er manchmal zu uns nach Hause kam. Er schlug mir eine Art Handel vor. Er wollte als Vermittler zwischen meinem Vater und Ventrée fungieren. Mein Vater könne Ventrée Geld geben, damit er seine Strafanzeige zurückziehe. Aber da es vor aller Öffentlichkeit eine schmutzige Geschichte gegeben habe, sei es besser, wenn ich weggehen würde. Er bot mir sogar eine kleine holländische Zigarre an und tat so, als ob er mit mir von Mann zu Mann spreche. Er trug einen gespielten Zynismus zur Schau. Er erklärte mir seine Philosophie. Dass die Gesellschaft gut funktionieren müsse. Dass die Individuen kooperieren müssten. Wenn einer von ihnen nicht kooperiere, habe er, Goémond, persönlich nichts dagegen. Aber die Gesellschaft werde dann mit einem logischen Automatismus zuschlagen. Glücklicherweise seien Männer wie er, Goémond, damit beauftragt, den Lauf des besagten logischen Automatismus zu schmieren. Er legte mir die Armee für eine Art Rückzug nahe, den ich machen solle. Rückzug im religiösen Sinn des Wortes. Dort könne ich in mich selbst schauen. Dort könne ich mir sehr wohl meine Überzeugungen, mein Aufbegehren bewahren, wichtig wäre nur, dass ich lernen würde, sie für mich zu behalten, während ich mich in das soziale Spiel stürze. Genau das nenne man Sublimierung, erklärte Goémond. Er gab mir zu verstehen, dass alle Männer in gehobener Position so handelten, was ihre Instinkte angehe. Alle seien so, Politiker, Männer, die Verantwortung tragen (er dachte an sich selbst), oder große Künstler, alle seien so, nämlich hellsichtig; aus Hellsichtigkeit hätten sie sich entschieden, das Spiel mitzuspielen. Er sagte mir, man müsse meinen Vater verstehen, und er sagte es so, dass ich erkannte, dass er ihn für einen Blödmann hielt. Dadurch erlangte er mein Vertrauen, und ich merkte nicht, dass er auch mich für einen Blödmann hielt.
Er ließ den alten Butron hereinkommen, der irgendwas vor sich hin schluchzte, das für mich nicht hinnehmbar gewesen wäre, wäre ich nicht vorher von Goémond bequatscht worden. Anstatt auf stur zu schalten, unterschrieb ich alles, was man wollte. Ich hatte geglaubt, es könnte zwischen einem Flic und mir eine Komplizenschaft geben.
Bald darauf landete ich in Oran, bei der Fernmeldetruppe. Ich sah kein einziges Gefecht. Zu den einzigen spannungsgeladenen Momenten kam es, wenn wir in den europäischen Vierteln unterwegs waren. Die piedsnoirs, die Algerienfranzosen, hassten uns. Es war ihnen klar, dass es uns scheißegal war, dass ihnen die Kameltreiber das Fell über die Ohren ziehen wollten. Ich hatte ein Malheur mit einer Geschlechtskrankheit, aber kaum schlimmer als der Tripper von Leroy. Dann verpasste mir während einer Nachtübung so ein Kretin einen Schuss mit einer Platzpatrone mitten ins Gesicht. Ich fand mich mit verbrannten Pulverkörnchen und Stückchen von der Patronenfüllung wieder, die irgendwie hinter mein Auge gelangt waren. Meine Sehschärfe ging gegen null. Bei Müdigkeit war ich schlimmer dran als ein Einäugiger. Da meine Mutter ein Mordstheater veranstaltete, dass ich mich noch wirklich umbringen lassen werde, wenn ich dort unten bleiben würde, hat der alte Butron wieder seine Beziehungen spielen lassen, diesmal in umgekehrter Richtung, und ich landete wehrdienstuntauglich wieder auf französischem Boden. Während ich im Zug von Marseille nach Paris fuhr, wurde meine Mutter von einem Fahrstuhl zermalmt.