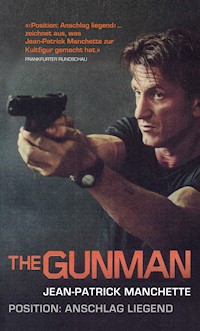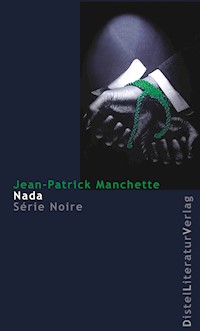
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Distel Literatur Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Série Noire
- Sprache: Deutsch
Sie wollen die Welt verbessern, öffentliche Aufmerksamkeit für ihr Manifest erzwingen und dabei am besten auch noch reich werden: Vier Männer und eine Frau, die sich zur anarchistischen Gruppe mit dem Namen «Nada» zusammentun, beschließen, den US-amerikanischen Botschafter in Frankreich zu entführen. Der wird zwar beinahe rund um die Uhr streng bewacht, doch die fünf wissen, wann sie zuschlagen müssen, und es gelingt ihnen, den Diplomaten aus einem Luxusbordell zu entführen. Aber es läuft nicht alles nach Plan, und schon bald ist ihnen die Polizei mit dem Ermittler Goémond dicht auf den Fersen. Ihr Versteck auf einem abgelegenen Gehöft bleibt nicht lange unentdeckt, und es kommt zu einem brutalen Showdown mit der Polizei. Jean-Patrick Manchettes Roman «Nada» (1972) ist ein Krimi, der sich durch einen kühlen Stil und schwarzen Humor auszeichnet. Bereits ein Jahr nach seinem Erscheinen wurde er von Claude Chabrol erfolgreich verfilmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DistelLiteraturVerlag
Jean-Patrick Manchette, geboren 1942 in Marseille, liebte Jazz, Kino und Literatur. Er radikalisierte den europäischen Roman noir und gilt als Begründer des neueren sozialkritischen französischen Kriminalromans, des sogenannten Néopolar.
Manchette arbeitete als Drehbuchautor und veröffentlichte neben Theaterstücken und zahlreichen Essays auch zehn Kriminalromane, die ihn zur Kultfigur machten, und von denen die meisten verfilmt wurden, so Nada (1973) von Claude Chabrol; Tödliche Luftschlösser (Folle à tuer, 1975) von Yves Boisset, mit Marlène Jobert; Westküstenblues (Trois hommes à abattre, 1980) von Jacques Deray, mit Alain Delon; Knüppeldick (Pour la peau d’un flic, 1981) von und mit Alain Delon; Position: Anschlag liegend (Le choc, 1982) von Robin Davis, mit Catherine Deneuve und Alain Delon; Volles Leichenhaus (Polar, 1983) von Jacques Bral; Position: Anschlag liegend wurde 2015 unter dem Titel The Gunman neu verfilmt von Pierre Morel mit dem zweimaligen Oscar-Preisträger Sean Penn.
Alle Kriminalromane sowie die gesammelten Essays zum Roman noir in den «Chroniques» sind auf Deutsch im Distel-LiteraturVerlag erschienen.
Jean-Patrick Manchette starb 1995 im Alter von 52 Jahren in Paris. Er wurde zur Leitfigur für eine neue Generation von Krimiautoren in Frankreich
Jean-Patrick Manchette
Nada
Aus dem Französischen von Stefan Linster
DistelLiteraturVerlag
Dieses Buch erscheint mit Hilfe desMinistère français chargé de la culture – Centre national du livre
Copyright © 2002, 2016 by Distel Literaturverlag OHG Sonnengasse 11, 74072 Heilbronn Die Originalausgabe erschien 1972 unter dem Titel «Nada» in der Série Noire bei Éditions Gallimard (Paris) Copyright © Éditions Gallimard 1972 Umschlagentwurf: Jürgen Knauer, Heilbronn ISBN 978-3-923208-55-5 (Print) ISBN 978-3-923208-96-8 (E-Book)
Das Herzklopfen für das Wohl der Menschheit geht darum in das Toben des verrückten Eigendünkels über, in die Wut des Bewusstseins, gegen seine Zerstörung sich zu erhalten, und dies dadurch, dass es die Verkehrtheit, welche es selbst ist, aus sich herauswirft und sie als ein Anderes anzusehen und auszusprechen sich anstrengt.
Hegel
Dies ist auch richtig so, und da man bisweilen schießen muss, sollte man es lieber sauber und ordentlich erledigen, ohne sich unnötig mit dem Handikap großer Kaliber und ihren schwerwiegenden Auswirkungen zu belasten. Sauber und ordentlich … In der Tat muss das tadellose Erlegen die größte Sorge des guten Jägers sein: Dem gilt das Hauptaugenmerk dieser Abhandlung. Im Kapitel über den waidgerechten Schuss werden wir uns den zwingenden Geboten widmen, die unserer Ansicht nach dieses Gesetz bedingen. Für den Augenblick aber werden wir uns damit begnügen, ein mehr als ausreichendes Kaliber zu wählen.
(Le Chasseur français, Der französische Jäger)
1
Meine liebe Mama,
diese Woche warte ich nicht erst bis zum Samstag, um Dir zu schreiben, weil ich Dir einiges zu erzählen habe, oh, là, là!!! Wir, also unsere Einheit, waren das nämlich, die die Anarchisten geschnappt haben, die den Botschafter der Vereinigten Staaten gekidnappt hatten. Ich will Dir aber lieber gleich sagen, dass ich persönlich nicht einen Einzigen getötet habe. Das stelle ich hier klar, weil ich ja weiß, dass Dichdasverdrißendichzuverdrießen Du darüber ziemlich verdrossen wärst, meine kleine Mama. Trotzdem sage ich noch mal, dass das etwas ist, das wir ohne Schwäche ins Auge fassen müssen, falls wir eines Tages gezwungen sind, den Staat mit Gewalt zu verteidigen. Die Wange hinhalten ist ja gut und schön, aber was willst du machen, wenn dir Leute gegenüberstehen, die alles zerstören wollen, das frage ich Dich. Unser guter Pater Castagnac ist da ziemlich meiner Meinung (wir haben uns nämlich noch neulich an dem Sonntag, an dem ich nach der Messe gekommen bin, eingehend mit der Frage befasst). Sein Standpunkt ist folgender: Wenn die Polizisten nämlich nicht wie ich zu allem bereit sind, dann gibt es doch überhaupt keinen Grund, dass sich gewisse Individuen nicht alles Mögliche erlauben, und das ist auch mein Standpunkt. Ganz im Ernst, kleine Mama, hättest Du gern ein Land ohne Polizei? Würdest Du wollen, dass der Sohn vom alten Barquignat (ich nehme den jetzt nur so als Beispiel) freie Bahn hätte, mit seinen lüsternen Händen über Deine Tochter herzufallen, die auch meine Schwester ist? Würdest Du wollen, dass sich Gleichmacher und solche Elemente, die alles teilen wollen, auf unser mühsam Zusammengespartes in einer Orgie der Zerstörung stürzen? Ich sag ja nicht, dass im Dorf nicht die Mehrheit der Einwohner brave Leute sind, aber trotzdem, schon in unserer kleinen ländlichen Gemeinschaft, wenn man nicht wüsste, dass es eine Polizei gibt, und dass die wenn nötig auch schießt, dann weiß ich bereits einige, die sich nicht zurückhalten würden, von den Zigeunern gar nicht zu reden.
Auf alle Fälle habe ich gestern nur getan, was mir befohlen wurde. Ich war mit François zusammen, von dem ich Dir schon erzählt habe, und wir haben ziemlich viel gefeuert, aber ohne Erfolg. Schließlich sind andere Ordnungskräfte von der anderen Seite des Gebäudes her in die Räumlichkeiten eingedrungen und konnten diese Individuen niederstrecken. Auf diese blutige Schlachterei, die einem den Magen umdreht, gehe ich nicht näher ein. François bedauert, dass er keinen dieser Anarchisten zu fassen bekommen hat, um ihn eigenhändig umzubringen. So weit gehe ich persönlich nicht, aber ich respektiere seinen Standpunkt.
Das ist jetzt aber ein ziemlich langer Brief geworden, und ich weiß nicht mehr, was ich Dir noch schreiben soll. Daher höre ich für heute auf. Umarme den Vater von mir, wie auch Nadège. Ich drücke Dich an mein klopfendes Herz.
Dein dich liebender Sohn, Georges Poustacrouille*
PS: Könntest Du mir, wenn es Dir keine Mühe macht, den «Quietsch-Camembert» schicken, weil ich den nämlich bräuchte, da wir den Unteroffizier Sanchez wegen seiner neuen Streifen mit einem Fest überraschen wollen. Dank Dir im Voraus.
* Bemerkungen zu den Namen, Erklärungen zu einigen Wörtern und Begriffen am Ende des Buches (Anm. d. Übers.).
2
Épaulard parkte seinen Cadillac halb auf dem Gehsteig und ging dann die Straße hinauf bis zum Pissoir an der Ecke Mosquée und Jardin des Plantes, wo er sich erleichterte. Anschließend machte er wieder kehrt und zündete sich im Gehen eine Française Filter an. Épaulard, ein großer hagerer Mann, hatte die Visage eines Militärarztes, stahlgraues Haar, Bürstenschnitt, er trug einen kittfarbenen Regenmantel mit Schulterklappen. Er betrat eine Weinhandlung mit Ausschank und bestellte einen Sancerre, den er sich schmecken ließ. Mal abgesehen davon, dass man nicht mehr besonders viele Geschmacksnerven besitzt, wenn man sechzig Zigaretten am Tag raucht.
Épaulard parkte seinen Cadillac halb auf dem Gehsteig und ging dann die Straße hinauf bis zum Pissoir an der Ecke Mosquée und Jardin des Plantes, wo er sich erleichterte. Anschließend machte er wieder kehrt und zündete sich im Gehen eine Française Filter an. Épaulard, ein großer hagerer Mann, hatte die Visage eines Militärarztes, stahlgraues Haar, Bürstenschnitt, er trug einen kittfarbenen Regenmantel mit Schulterklappen. Er betrat eine Weinhandlung mit Ausschank und bestellte einen Sancerre, den er sich schmecken ließ. Mal abgesehen davon, dass man nicht mehr besonders viele Geschmacksnerven besitzt, wenn man sechzig Zigaretten am Tag raucht.
Es war fünf nach zwölf. D’Arcy war spät dran. Im selben Moment betrat der junge Mann den Schankraum. Er klopfte dem kittfarbenen Regenmantel mit der flachen Hand auf die Schulter.
«Ciao.»
«Salut.»
«Ich hab um zwei eine Verabredung und noch nichts gegessen. Steht dein Auto in der Nähe?»
«Gegenüber», meinte Épaulard, während er zahlte.
Sie überquerten die Straße. Unter dem Scheibenwischer des Cadillac steckte schon ein Strafzettel. Épaulard warf ihn in den Rinnstein. Sie stiegen in den weißen, schlammbespritzten Wagen.
«Bist du schon lange wieder in Frankreich?» fragte D’Arcy.
«Seit drei Wochen.»
«Hast du irgendeinen von den Jungs wiedergesehen?»
«Nein, keinen.»
«Was machst du zurzeit?»
Während des Gesprächs hatte D’Arcy das Handschuhfach geöffnet und kramte darin herum.
«Im Seitenfach», sagte Épaulard.
D’Arcy griff hinein, fischte einen silbernen Flachmann hervor und trank direkt daraus. Er hatte ein rotes Gesicht und schwitzte. Immer noch genauso versoffen, dachte Épaulard. Als D’Arcy zu Ende getrunken hatte, steckte der fünfzigjährige Épaulard den Flachmann wieder weg. Darauf eingraviert war ein Vogel, der gerade eine Schlange verputzte, und ein Motto in schwülstigen Lettern: Salud y pesetas y tiempo para gustarlos.
«Du warst also in Mexiko», bemerkte D’Arcy.
«Ich war so ziemlich überall. Algerien, Guinea, Mexiko.»
«Und Kuba.»
«Ja, Kuba.»
«Sie haben dich rausgeschmissen», sagte D’Arcy.
Épaulard nickte.
«Und was machst du zurzeit?» wiederholte D’Arcy.
«Du gehst mir langsam auf den Wecker», erwiderte Épaulard. «Was willst du eigentlich von mir?»
«Ein paar Genossen und ich», erwiderte D’Arcy, «bräuchten einen Fachmann.»
«Fachmann für was? Ich bin Fachmann für einen Haufen Sachen.»
«Die bewussten Genossen und ich werden uns den Botschafter der Vereinigten Staaten in Frankreich kaufen», sagte D’Arcy.
Épaulard stieg aus dem Auto und knallte heftig die Tür zu. Er überquerte erneut die Straße. D’Arcy lief hinter ihm her. Es begann zu nieseln: ein garstiger kalter und feiner Regen.
«Mach keinen Scheiß», rief der Alkoholiker. «Ich hab dir doch noch gar nicht alles erklärt.»
«Ich will gar nicht mehr darüber hören. Verpiss dich!»
Épaulard ging zurück in den Weinausschank und bestellte sich einen weiteren Sancerre. D’Arcy blieb unglücklich dreinblickend auf der Türschwelle stehen.
«Ach, leck mich doch am Arsch», sagte er schließlich und verschwand.
3
«Aus diesem Grunde», schloss Treuffais, «können wir mit Schopenhauer sagen, dass ‹der Solipsist ein Verrückter ist, der in einer uneinnehmbaren Festung eingesperrt ist›. Hat irgendjemand hierzu eine Frage?»
Niemand hatte eine. Die Glocke läutete. Mit einer Handbewegung versuchte Treuffais vergeblich, sich dem Radau, der sogleich das Klassenzimmer erfüllte, entgegenzustellen.
«Beim nächsten Mal werden wir uns mit dem zeitgenössischen Rationalismus und seinen Varianten befassen», sagte er noch mit erhobener Stimme. «Ich möchte einen Freiwilligen für ein Referat über Gabriel Marcel.»
Zwei Hände fuhren in die Höhe.
«Mir wäre lieber, es wären nicht immer dieselben», meinte Treuffais sarkastisch. «Monsieur Ducatel, sagen Sie mal, sind Sie über das Wochenende vielleicht zu sehr beschäftigt?»
«Ja, klar», antwortete der Schüler Ducatel arglos, «ich gehe auf die Jagd.»
«Auf Hetzjagd womöglich?» meinte Treuffais ironisch.
«Ja, Monsieur.»
«Trotzdem werden Sie für mich dieses Referat über Gabriel Marcel ausarbeiten. Für Montag. Und nun dürfen Sie ganz ruhig hinausgehen.»
Die Horde von Einfaltspinseln verschwand mit großem Getöse. Treuffais schnallte seine Mappe zu und hörte dabei, wie sich das Getrampel der teuren Quadratlatschen entfernte. Er verließ das Cours Saint-Ange durch eine kleine Tür. Im selben Augenblick fuhr der Ford Mustang des Schülers Ducatel röhrend vorbei, und Treuffais bekam einen Schwall schlammiges Wasser auf seine Hosen. Ducatel bremste scharf und hangelte sich halb aus seiner Karre.
«Tut mir leid, m’sieu», rief er.
Er konnte sich das Lachen nicht verkneifen.
«Armes Arschloch», entgegnete ihm Treuffais.
«So etwas darf man doch nicht sagen», bemerkte Ducatel bösartig.
Schon hatte Treuffais ihm den Rücken zugekehrt und stieg auf der anderen Straßenseite in seinen 2 CV. Der junge Philosophielehrer fuhr schnell aus Bagneux hinaus bis zur Porte d’Orléans und bog dort in westlicher Richtung auf die äußeren Boulevards. Er lief Gefahr, seine Anstellung zu verlieren. Der Schüler Ducatel würde sich bei seinem Papa darüber beklagen, beleidigt worden zu sein. Und Vater Ducatel würde Monsieur Lamour, dem Direktor des Privatgymnasiums, nebenbei bemerkt eine echte Missgeburtsvisage, sein Herz ausschütten.
«Sie sollten sich besser Monsieur Bouillon nennen», wandte sich Treuffais an seinen Schalthebel. «Dann könnten Sie Ihrer Einrichtung nämlich auch Ihren Namen geben: Cours Bouillon.»
Die Ampel sprang auf Grün.
«Aber ich scheiß auf das alles», ergänzte Treuffais.
Hinter ihm wurde gehupt. Der junge Mann lehnte sich aus dem geöffneten Seitenfenster.
«Ihr Franzosenschweine!» schrie er mit übertrieben deutschem Akzent. «Wir haben euch schon 1940 kräftig in den Arsch gefickt. Und wir werden euch noch mal in den Arsch ficken.»
Ein Mofafahrer in Lederjacke stieg sogleich von seiner Maschine, um auf den 2 CV zuzustürzen. Treuffais klappte ängstlich die Seitenscheibe herunter. Der Mofafahrer klopfte mit der Faust gegen das Blech der Wagentüre. Er sah Raymond Bussières ähnlich.
«Komm da raus, du kleines Arschloch!» schrie er.
Treuffais ließ sein Springmesser aufschnappen und öffnete die Fahrertür. Dann richtete er die Klinge auf den Angreifer.
«Me kill you!» knurrte er diesmal mit Negerakzent à la Hollywood. «We make Hosenträger with your Gedärm!»
Der Lohnempfänger kapierte im Wesentlichen, worum es ging, sprang zurück, geriet mit den Füßen irgendwie in sein Solex und flog auf die Fresse. Treuffais startete lachend, fuhr bei Gelb über die Ampel und sauste allein auf den Boulevard Lefebvre.
«Sono schizo», bemerkte er. «Und polyglott. Primoque in limine Pyrrhus exultat!»
Er fand einen Parkplatz in der Rue Olivier-de-Serres, nur ein paar Schritte von seiner Wohnung entfernt. Schon im Fahrstuhl hörte er das Telefon in seinem Appartement klingeln. Er hastete in die Wohnung und hob ab. Am anderen Ende der Leitung war D’Arcy.
«Was meint dein Fachmann?» fragte Treuffais.
«Er weigert sich.»
«Dann machen wir’s eben ohne ihn.»
«Das ist blöd.»
«Wir kommen schon klar. Entschuldige mich bitte, es klingelt an der Tür.»
«Gut, ich leg auf. Ich ruf dich später wieder an.»
«Nicht nötig. Wir sehen uns ja heute Abend.»
«Richtig. Bis heute Abend.»
«Bis dann.»
Er legte auf und ging öffnen. Ein kleiner, aber breitschultriger Typ mit Pomade im Haar, so um die Fünfundzwanzig, also in Treuffais’ Alter, hielt ihm eine billige Illustrierte hin.
«Wir schauen wie jedes Jahr vorbei», erklärte er. «Wir sind von der Föderation bretonischer Medizinstipendiaten.»
«Ficken Sie sich selbst», empfahl Treuffais und schubste den Typen mit der flachen Hand weg.
«Sagen Sie mal, mein Alter …»
«Ich bin nicht Ihr Alter!» schrie Treuffais grimmig und stieß den bretonischen Stipendiaten wütend nach hinten. Dieser schlug ihm mit den Magazinen ins Gesicht. Treuffais verpasste ihm einen linken Leberhaken. Der Hausierer ließ seine Hefte fallen. Und Treuffais verteilte sie mit einem Fußtritt im Treppenhaus.
«Scheisskerl!» schrie der Student. «Ich muss doch meinen Lebensunterhalt verdienen!»
«Was für ein Irrtum!» rief Treuffais aus und stieß den bretonischen Stipendiaten mit beiden Händen zurück, so dass dieser im Treppenhaus auf den Rücken fiel und einen sehr echten und heftigen Schmerzensschrei ausstieß.
Treuffais kehrte in die Wohnung zurück und knallte die Tür zu. Wieder klingelte das Telefon. Der junge Mann spurtete los, um sich schnell eine Flasche Kronenbourg aufzumachen und eine Gauloise anzuzünden, dann hob er ab:
«Marcel Treuffais am Apparat.»
«Buenaventura Diaz.»
«Schon wach?»
«Dieser Blödmann von D’Arcy hat mich gerade angerufen. Also, sein Scheißfachmann weigert sich, einfach so.»
«Ja, so ist es halt. Ist uns aber scheißegal.»
«Mir aber nicht», sagte Buenaventura Diaz. «Der Kerl weiß jetzt Bescheid. Wir müssen dem erst mal auf den Zahn fühlen.»
«Ach, vergiss es.»
«Ich geh heut Abend zu ihm. Kommst du mit?»
«Was willst du ihm denn sagen?»
«Dass er die Schnauze halten soll.»
«Vergiss es doch», riet ihm Treuffais abermals.
«Nein.»
«Wie du willst. Und unser Treffen?»
«Ich werd vielleicht etwas später kommen.»
«Gut.»
«Das wär’s. Und sonst?» fragte der Katalane.
«Nichts. Und bei dir?»
«Nichts.»
«Gut. Dann also salut.»
«Salut.»
Treuffais legte wieder auf und öffnete dann seine Post. Marie-Paule Schmoulou und Nicaise Hourgnon haben die Freude, Ihnen bekanntzugeben … Scheiße, jetzt ist die Ärmste doch noch unter die Haube gekommen. Nächster Wisch. Das Möbelhaus Radieuse, sensationelle Preise. Treuffais schlug den Prospekt auf und studierte die rustikalen und Stil-Bücherwände. Dann warf er die Werbung in den Papierkorb und ging sich ein zweites Bier aufmachen. Er zitterte vor Zorn. Er kam zurück und ließ sich in dem großen Sessel nieder. Rosshaar quoll aus den Löchern des Leders, das Vaters Arsch durchgescheuert hatte. Und der Teppichboden vor dem Sessel war bis zu den Kettfäden durchgewetzt, so sehr hatten ihn Vaters Füße traktiert. Treuffais riss einen weiteren Umschlag auf, der mit dreißig Centime frankiert war. Alljährliches Diner der Libertären Vereinigung des XV. Arrondissements (Gruppe Errico Malatesta). Im Anschluss an das Essen folgt ein zwangloser Vortrag: Die Libertären und der jüdisch-arabische Konflikt, einige Vorschläge mit gesundem Menschenverstand von unserem Genossen Parvulus. Blödsinn. Treuffais knüllte das Blatt zusammen und beförderte es ans andere Ende des Zimmers. Schließlich noch eine Postkarte – Vorderseite: Reisanbau in der Nähe von Abidjan; Rückseite: Den 5. 12. Mein Allder. Werde auch dieses Jahr noch nicht heimkehren. Werde wahrscheinlich nie mehr heimkehren. Du solltest mir hierher nachkommen. Ich habe mir bei der Tochter eines Häuptlings die Syphilis geholt. Ich werde sie dir weitergeben, wann immer du willst. Du darfst mich ganz herzlich am Arsch lecken. Popaul. Treuffais stopfte die Karte in eine Schublade des Büfetts, auch ein Familienerbstück, trank sein Bier aus und ging zum Mittagessen in die Kneipe an der Ecke.
4
Nach dem Mittagessen hatte Meyer eine heftige Diskussion mit seiner Frau, die wie immer endete: Annie versuchte ihn zu erwürgen.
«Hör auf, Herrgott noch mal!» schrie er, doch sie war schon im Begriff, ihm den Kehlkopf zu zerquetschen. Daher tastete seine Hand auf dem Tisch herum, der in Reichweite stand. Es gelang ihm, die dreiviertel volle Evian-Flasche aus Glas zu packen und der jungen Frau einen leichten Schlag auf den Kopf zu versetzen, nur so als Warnung. Annie war mitten in einem Anfall. Sie reagierte nicht. Sie grub vielmehr ihre Nägel in Meyers Hals. Dieser seufzte verzweifelt und schlug zu. Beim dritten Schlag ließ Annie von ihm ab, legte die Hände um ihren Kopf und wälzte sich schließlich kreischend auf dem Fußboden.
«Na, komm schon, Schätzchen», sagte Meyer. «Na komm.»
Annie schrie jedoch weiter, er hielt sich die Ohren zu.
«Scheiße!» brüllte Meyer.
Er lief ins Bad und spritzte sich Wasser ins Gesicht. Als er den Kopf wieder hob, sah er in dem kleinen Spiegel, dass Annie ihm auf beiden Seiten des Halses tiefe Kratzer beigebracht hatte. Es blutete. Er tat etwas Alkohol auf die Wunden, und seine Augen füllten sich mit Tränen. Doch es blutete weiter. Rasch zog er sein weißes Hemd aus, aber zu spät, der Kragen hatte schon Flecken. Wieder betrachtete er sich im Spiegel. Er sah einen Typ von dreiundzwanzig Jahren, blond und schlaff, mit kleinen Augen in der Farbe toter Austern. Er hatte eine Gänsehaut. Er puderte sich den Hals mit Talkum ein, um das Blut damit aufzusaugen. Aus dem angrenzenden Zimmer hörte er, wie Annie mit dem Schädel gegen die Wand schlug. Er ging zu ihr zurück.
«Komm schon, mein Schatz, hör doch auf, ich liebe dich.»
«Du kannst krepieren, du Saukerl», entgegnete ihm Annie. «Dreckiger Jude», fügte sie noch hinzu. «Ich verabscheue dich. Ich werd nach Belleville gehen und mich von Afrikanern ficken lassen. Ich werd mich durchbumsen lassen», beharrte sie ziemlich grob.
Sie rieb sich den Kopf und begann vor Schmerzen zu weinen. Ihr Haar war schön und fein. Meyer hatte Lust, sich zu erschießen oder einfach nur zur Arbeit zu gehen, schwer zu sagen. Er schaute auf seine Armbanduhr. Vierzehn Uhr fünfzehn. Er musste sofort aufbrechen, wenn er pünktlich sein wollte.
Annie hörte plötzlich auf zu weinen und rappelte sich hoch.
«Letzte Nacht habe ich ein schönes Bild gemalt.»
«Willst du es mir nicht zeigen?»
«Nein. Ich hasse dich. Mistkerl.»
«Bitte, mein Schatz», sagte Meyer.
«Is ja gut, is ja gut», meinte Annie mit vulgärer Stimme. «Ich hol’s dir.»
Während sie im anderen Zimmer war, wischte Meyer sich ein letztes Mal den Hals ab, zog sich ein sauberes Hemd an und band eine fertig geknotete schwarze Fliege um. Dann schlüpfte er in ein abgewetztes Samtjackett. Seine weiße Kellnerjacke würde er erst nach seiner Ankunft in der Brasserie anziehen.
Annie kam mit dem großen Aquarell einer Burg in der Wüste zurück. Kleine Männchen mit überdimensionalen Tropenhelmen auf den Köpfen schienen die Festung im Sturm erobern zu wollen, doch offensichtlich ohne Erfolg: Annie hatte mit dem Pinsel zahlreiche braune Brocken angedeutet, die auf sie herabfielen.
«Das sind Kothaufen von Afrikanern», erklärte die junge Frau. «Das ist mein Haus.»
«Sehr hübsch», sagte Meyer.
Annie schaute auf den Wecker.
«Liebling!» rief sie plötzlich. «Du musst sofort gehen, sonst kommst du zu spät.»
«Ja», erwiderte Meyer, «ich hau ab.»
«Verzeih mir wegen vorhin. Heute Abend geht’s mir besser. Ich werd Gardenal nehmen.»
«Nimm nicht zu viel davon», riet ihr Meyer.
An der Tür drehte er sich noch mal um.
«Ich komm heute Abend später heim. Wir haben noch unser Treffen.»
«Du kannst mir ja davon erzählen.»
«Ja», log Meyer.
«Tut mir leid, dass ich so in Rage geraten bin. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ist die Nervosität …»
«Macht doch überhaupt nichts. Entschuldige bitte die Schläge mit der Flasche.»
«Ich liebe dich.»
«Ich dich auch», sagte Meyer und ging davon.
Er kam fünf Minuten zu spät zur Arbeit. Die Brasserie ganz in der Nähe des Gare Montparnasse war brechend voll. Meyer zog seine Kellnerjacke an und machte sich sofort ans Werk.
«Vorsicht, Platz, bitte!»
«Haben Sie sich schon wieder beim Rasieren geschnitten?» fragte Mademoiselle Labeuve, die Kassiererin, ironisch.
«Nein», antwortete Meyer. «Diesmal ist es mein Ekzem. Wenn ich ein Ekzem hab, kann ich einfach nicht anders, dann muss ich mich kratzen.»
5
Nach seinem Telefongespräch mit Treuffais hatte Buenaventura noch mal ein Nickerchen gehalten, aus dem er schließlich um drei Uhr nachmittags durch das Rasseln seines Weckers herausgerissen wurde. In Unterwäsche setzte er sich im Bett auf, sein Mund war trocken, denn er hatte bis fünf Uhr morgens geraucht, getrunken und Poker gespielt. Er rieb sich mit den Fäusten den Schlaf aus den Augen. Zog sich ganz aus, ging hinüber in den Waschraum, wusch sich die Füße, die Achseln und zwischen den Beinen, putzte sich die Zähne und rasierte sich. Anschließend schlüpfte er in eine Kordsamthose und einen an den Ellbogen gestopften Rollkragenpulli. Wieder zurück im Zimmer, räumte er ein wenig auf, machte notdürftig das Bett, brachte die schmutzigen Gläser ins Waschbecken und stellte die leeren Literflaschen neben der Tür an die Wand. In einem Plastikbehälter war noch ein Rest Margnat. Buenaventura kippte ihn hinunter, wurde von einem fürchterlichen Zittern geschüttelt und hätte beinahe wieder alles von sich gegeben. Dann öffnete er die Fensterläden und betrachte die Rue de Buci. Langhaarige Studenten schwatzten auf den überdachten Terrassen der Bistros. Buenaventura schloss das Fenster wieder, sammelte die mit Wein besudelten Spielkarten ein, die auf dem kleinen Klapptisch herumlagen, und warf sie in den Papierkorb. Nicht vergessen, ein Dutzend versiegelter Kartenspiele zu kaufen! Er setzte sich auf sein Bett und machte in einem Notizheft seine Buchführung. Letzte Nacht hatte er fünfhundertdreiundsiebzig Franc gewonnen. Gut. Die Pechsträhne schien ein Ende zu nehmen. Buenaventura brauchte einen Mantel oder zumindest eine lange Jacke. Es wurde allmählich kalt.
Er verstaute das Geld, indem er es auf die verschiedenen geflickten Taschen seiner Hose und seines angeschimmelten Ledermantels, der an etlichen Stellen Löcher hatte, verteilte. Zog sich schmutzige Socken und Gummischuhe an, schlüpfte in den Mantel, wickelte sich einen schwarzen Schal um den Hals und setzte sich einen schwarzen Filzhut auf, der vor dem Zweiten Weltkrieg in Harrisburg, Pennsylvania, hergestellt worden war. Mit seiner hageren blassen Visage und seinen buschigen Koteletten sah er aus wie ein Gauner in einer neorealistischen Aufführung von Carmen.
Buenaventura verließ das Hotel Longuevache und begab sich zu Fuß zu D’Arcy, der ein winziges Appartement mit Kochecke in einem Gebäude mit heruntergekommener Fassade in der Rue Rollin, beim Place de la Contrescarpe, bewohnte. Er klopfte.
«Ja!» schrie der Alkoholiker. «Es ist nicht abgeschlossen!»
«Ich bin’s», verkündete Buenaventura vorsichtig, als er die Tür aufstieß.
D’Arcy hätte ja einen seiner guten Tage haben und, mit einem Hammer in der Hand, hinter dem Türflügel lauern können, bereit zuzuschlagen. Buenaventura trat ein und war erleichtert, als er den Säufer am anderen Ende des Zimmers auf seinem Diwan ausgestreckt, mit einer Flasche Mogana auf dem Bauch, erblickte.
Der Fußboden war unter einer dicken Schicht zertretener Speisereste und Kippen nicht mehr zu sehen. In der Kochnische entdeckte Buenaventura Kaffee, der in einem Topf vor sich hin brodelte. Er goss sich ein Glas ein, zerquetschte eine Ameise auf dem Rand der Zuckerdose und ging zum Telefon.
«Ich hab gerade geträumt, dass mir einer geblasen wird», erklärte D’Arcy geistesabwesend.
Buenaventura antwortete nicht. Er blätterte das neben dem Telefon liegende Adressverzeichnis durch und fand die Anschrift des besagten Épaulard. D’Arcy schaute zur Decke.
«Ich muss meiner Mutter schreiben», sagte er, «damit sie mir Geld schickt. Könntest du mir nicht zwanzig oder dreißig Mäuse leihen?»
Buenaventura lachte höhnisch auf und leerte sein Glas.
«Danke für den Kaffee. Bis heute Abend.»
«Haust du wieder ab?» fragte D’Arcy erstaunt.
Doch der Katalane war schon draußen. Er ging zu Fuß in Richtung Nordwesten.
Am Boulevard Saint-Michel wurde er von einem Mann in blauem Mantel angehalten.
«Polizei. Ihre Papiere!»
Der Bulle zeigte seinen Ausweis. Buenaventura hätte ihm liebend gern eine aufs Maul gehauen, doch ein kleiner Trupp von circa sechzig CRS in Helmen und mit Gewehren bewaffnet stand nicht weit entfernt am Brunnen herum. Der Katalane zückte seine Ausländerpapiere.
«Beruf?»
«Musiker.»
«Da steht aber ‹Student›», bemerkte der Flic und zeigte mit seinem dicken Finger auf die Stelle, wo es stand.
«Der Ausweis ist schon älter. Zu der Zeit war ich noch Student.»
«Das müssen Sie mir aber auf den neusten Stand bringen lassen.»
«Ja, Monsieur.»
Der Flic gab Buenaventura seine Papiere zurück.
«In Ordnung.»
Der Katalane setzte seinen Weg zu Fuß fort. Die Zeit der Entwerter war lange vorbei, als man noch kostenlos mit gewaschenen Bustickets herumfahren konnte. Da er zügig marschierte, erreichte Buenaventura rasch die Rue Rouget-de-Lisle, neben dem Jardin des Tuileries. Er betrat das Gebäude, in dem Épaulard wohnte, und überflog die Liste der Mieter hinter der Scheibe der Conciergeloge. Dann ging er die Treppe hoch in den zweiten Stock. An der Tür verwies ein neues Messingschild auf: André Épaulard, Rechtsberater.