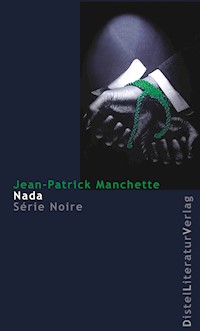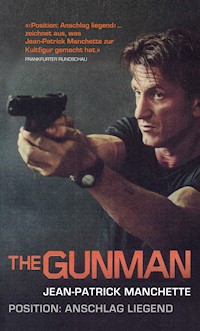Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Distel Literatur Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Série Noire
- Sprache: Deutsch
Dieser erste Krimi von Jean-Patrick Manchette (zusammen mit Jean-Pierre Bastid) begründete den «Neo-Polar», der die französische Kriminalliteratur revolutionierte. Luce, exzentrische Malerin, hat einen illustren Kreis in ihrem halbverfallenen Weiler in Südfrankreich um sich geschart. Dazu gesellen sich drei Gangster, die einen Geldtransporter überfallen haben und den Weiler für das ideale Versteck für sich und ihre Beute halten. Als dann eher zufällig zwei Dorf-Gendarmen vorbeikommen, beginnt ein irrwitziger Show-down ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DistelLiteraturVerlag
Jean-Patrick Manchette, geboren 1942 in Marseille, liebte Jazz, Kino und Literatur. Er radikalisierte den europäischen Roman noir und gilt als Begründer des neueren sozialkritischen französischen Kriminalromans, des sogenannten Néo-polar.
Manchette arbeitete als Drehbuchautor und veröffentlichte neben Theaterstücken und zahlreichen Essays auch zehn Kriminalromane, die ihn zur Kultfigur machten, und von denen die meisten verfilmt wurden, so Nada (1973) von Claude Chabrol; Tödliche Luftschlösser (Folle à tuer, 1975) von Yves Boisset, mit Marlène Jobert; Westküstenblues (Trois hommes à abattre, 1980) von Jacques Deray, mit Alain Delon; Knüppeldick (Pour la peau d’un flic, 1981) von und mit Alain Delon; Position: Anschlag liegend (Le choc, 1982) von Robin Davis, mit Catherine Deneuve und Alain Delon; Volles Leichenhaus (Polar, 1983) von Jacques Bral; Position: Anschlag liegend wurde 2015 unter dem Titel The Gunman neu verfilmt von Pierre Morel mit dem zweimaligen Oscar-Preisträger Sean Penn.
Alle Kriminalromane sowie die gesammelten Essays zum Roman noir in den «Chroniques» sind auf Deutsch im DistelLiteraturVerlag erschienen.
Jean-Patrick Manchette starb 1995 im Alter von 52 Jahren in Paris. Er wurde zur Leitfigur für eine neue Generation von Krimiautoren in Frankreich
Jean-Paul Bastid, geboren 1937, Drehbuchautor und Filmregisseur fürs Kino und Fernsehen, war Assistent bei Jean Cocteau («Das Testament des Orpheus») und Nicholas Ray («What?»), lehrte an den Pariser Universitäten Vincenne und Sorbonne. Als Schriftsteller hat er neben zahlreichen Romanen, Novellen, Theaterstücken und Essays u. a. bisher drei Kriminalromane in der Série Noire bei Gallimard veröffentlicht..
Jean-Patrick Manchette Jean-Pierre Bastid
Lasst die Kadaver bräunen!
Aus dem Französischen von Katarina Grän und Ronald Voullié
DistelLiteraturVerlag
Ouvrage publié avec le concours du Ministère français de la culture – Centre national du livre
Dieses Buch erscheint mit Hilfe des französischen Kulturministeriums – Centre national du livre
Deutsche Erstausgabe Copyright © 2007, 2015 by Distel Literaturverlag Sonnengasse 11, 74072 Heilbronn Die Originalausgabe erschien 1971 unter dem Titel «Laissez bronzer les cadavres!» bei Éditions Gallimard (Paris) Copyright © Éditions Gallimard 1971 Umschlagentwurf: Jürgen Knauer, Heilbronn mit einem Motiv von: © Daniel Barillot / Gallimard ISBN 978-3-923208-83-8 (Print) ISBN 978-3-923208-91-3 (E-Book)
Freitag, 16. Juli
10:15 Uhr
Die 22er-Kugel riss ein kleines Loch in die Leinwand. Die Detonation war kaum lauter als ein Peitschenknall. Im Tal protestierte eine Krähe. Luce stieß ein kurzes, heiseres Lachen aus, dem Schrei der Krähe ziemlich ähnlich.
Gros lächelte selbstgefällig.
«Ich kann sie hinschießen, wo ich will», sagte er. «Soll ich noch ein Loch machen?»
Luce musterte die Leinwand.
Sie hatte das Bild am Vorabend gemalt, in fünf oder sechs Stunden. Früher hätte sie wesentlich länger dafür gebraucht. Wahrscheinlich Monate. Aber früher hatte sie auch geglaubt, dass die Kunst existiert und dass sie selbst Talent hätte.
Sie wedelte betont lässig mit ihrer morgendlichen Upmann-Zigarre.
«Mach, wie es dir passt. Das ganze Magazin. Wie du willst. Geh nach deinem Gefühl. Ein Kunstwerk lebt von der Spontaneität.»
«Was?» fragte Gros.
«Schieß, schieß, kümmer dich nicht um mein Gequatsche. Schieß.»
Gros nickte zufrieden und feuerte in jede der vier Ecken der Leinwand eine Kugel. Luce verzog das Gesicht. Sie mochte keine Symmetrie.
«Was treibt ihr da?»
Brisorgueil war außer Atem, seine Stimme klang ein bisschen abgehackt. Offensichtlich war der Anwalt die Leiter, die zu der Terrasse führte, hastig hinaufgestiegen. Es war schon heiß, und er musste sich das schweißnasse Gesicht abwischen. Dann verharrte er reglos, blickte verwirrt umher, das Taschentuch in der Hand zusammengepresst, die leicht zitterte.
Luce betrachtete ihn mit abgrundtiefer Verachtung.
In der Stadt war Brisorgueil ein Adonis. Er ließ sich dreimal die Woche das rabenschwarze Haar richten. Das passte gut zu seinem matten Teint, der geraden Raubtiernase und dem schmalen Mund. Seine ernsten Gesichtszüge hatten nichts von einem Gigolo. Luce war überrascht gewesen, als er ihr Liebhaber werden wollte, denn trotz der täglichen Massagen und der jährlichen chirurgischen Klammern, die ihre Haut wieder strafften, erfreute sie sich seit einigen Jahren nur noch der Gunst käuflicher junger Leute.
Brisorgueil war also ein Geschenk des Himmels gewesen. Aber Geschenke des Himmels sind nie von Dauer, das war eine von Luces Lebensweisheiten. Jetzt langweilte ihr Anwalt sie. In der Landschaft aus Bruchsteinen und völlig ausgedorrter Erde verblasste sein stattliches Aussehen. Er wirkte deplatziert in seinem blassvioletten Krepphemd, und seine Haare waren zu lang.
«Na gut», meinte Brisorgueil und betrachtete abwechselnd das durchlöcherte Bild und Gros. «Na gut.»
Er wirkte verunsichert.
Gros senkte nervös den Kopf, trat von einem Fuß auf den anderen, seine dicke Zunge fuhr über seine Oberlippe. Er legte Luces Waffe, eine Luger-Erma, auf einen großen Stein und stapfte wie ein Nilpferd Richtung Leiter davon.
Luce presste ihre geschlossenen Lippen auf der Zigarre zusammen.
«Monsieur mag wohl keine Schüsse vor dem Frühstück.»
Brisorgueil zuckte mit den Schultern.
«Ich hab Gott weiß was geglaubt.»
Dann ging auch er Richtung Leiter davon.
Jetzt bedauerte Luce, dass sie ihn eingeladen hatte. Aber wenn Brisorgueil nicht gekommen wäre, hätte er auch seine Freunde nicht mitgebracht. Und das hätte Luce noch viel mehr bedauert.
In den zehn Jahren, seit denen sie alleinige Besitzerin dieses verlassenen und völlig verfallenen Weilers im Département Gard ist, hat Luce es sich zur Gewohnheit gemacht, den Sommer dort zu verbringen.
Sie hat aus diesen Ruinen eine Kulisse geschaffen, die sie übersät hat mit Hängematten, Baumstümpfen in bizarren Formen, mit alten hölzernen Karussellpferden und noch manch anderen selbstgebastelten Gegenständen wie dieser primitive Kronleuchter aus einer Reihe von Fassreifen, von denen jeder Reif mit sieben Kerzen geschmückt ist.
Das Dorf hat weder Strom noch fließendes Wasser, noch Telefon. Allein würde es sich dort nicht gut leben. Deshalb hat Luce zahlreiche Schlafstätten eingerichtet, einige davon in Ruinen unter freiem Himmel. Und ihre Freunde wissen, dass sie sie dort jeden Sommer antreffen und kommen können zu diesem, wie sie es nennt, Primitivurlaub.
«Wieviel Eier?»
Luce zuckte zusammen. Brisorgueils Oberkörper schaute über der Leiter am äußersten Ende der Terrasse hervor. Sie dachte, dass der Anwalt dieser Tage zu einer Einsilbigkeit neigte, die an schlechte Erziehung grenzte.
«Nur eins, von beiden Seiten gebraten», antwortete sie und kehrte ihm den Rücken zu.
Sie ging das Gemälde und die Einschüsse betrachten. Sie beschloss, das Bild unter dem Titel «Festgelage» auszustellen. Dann ging sie zum Frühstück hinunter.
Gros saß am Ende des Tisches, der aus auf Böcke gelegten Brettern bestand. Brisorgueil briet die Eier. Die anderen waren noch nicht da.
«Die Pistole?» fragte Gros. «Habt ihr die weggeräumt?»
«Das vergesse ich immer. Ich hab einfach keinen Respekt vor den Objekten.»
Gros stand mit einem leisen, missbilligenden Zungenschnalzer auf und stieg die Leiter wieder hinauf. Die Sprossen bogen sich unter dem Gewicht seines massigen, in weiße Levi’s-Leinenjeans und ein Seidenhemd gezwängten Körpers.
Luce verließ den Hof, entfernte sich vom Küchenherd und von Brisorgueil. Sie ging die einzige Straße des Weilers hinauf und ließ einen versiegten Brunnen unmittelbar neben dem Mauerwerk des «Four banal», des ehemaligen Backofens des Lehensherrn, hinter sich.
Am Ende der Straße erhob sich eine kleine Kapelle, teilweise in den Berg gehauen, der den Weiler nach Norden hin überragte. Am Fuß des halb verfallenen Glockenturms wandte Luce sich nach rechts, um eine Treppe hinabzusteigen, der einige Stufen fehlten. Das letzte Haus, auf einen stabilen Felsüberhang gebaut, ragte in das Tal hinein. Dort befand sich Max in einem kleinen, weißen Zimmer. Ohne anzuklopfen stieß Luce die Brettertür auf und blieb kopfschüttelnd stehen.
Der Schriftsteller lag vollständig angekleidet auf dem nicht aufgedeckten Bett. Er hatte nur einen Schuh ausgezogen. Sein linker Arm baumelte kläglich herab, eine leere Wodkaflasche lag in Reichweite. Sein Mund stand weit offen, und er schnarchte.
Luce warf einen Blick auf die Reiseschreibmaschine. Ein Bogen Papier war in das Gerät eingespannt. Darauf stand in Großbuchstaben das Wort «Schwanz». Das war das Ergebnis einer Nacht Arbeit. Luce verzog das Gesicht und ging wieder hinaus, ohne den Säufer zu wecken.
Es hatte Jahre gegeben, in denen es in dem Weiler vor Talenten nur so wimmelte. Damals war Luce en vogue gewesen. Und Max selbst hatte gerade den Cesare-Borgia-Preis für seinen Roman «Die Rose unter der Asche» erhalten. In jenem Sommer waren viele Leute da gewesen: Maler, Schriftsteller, ein paar Gigolos, zwei Mäzene und sogar, Gott weiß warum, ein ungarischer Flüchtling. Man hatte Partys gefeiert. Eines Abends hatten Luce und Max, den Körper mit Goldstaub bedeckt, in aller Öffentlichkeit mitten auf der Straße und unter dem Beifall der Zuschauer gebumst. Gott, wie gut dieser arme Max damals bumsen konnte.
Aber jetzt war nur noch Luce da. Und dieser bedauernswerte Max, der impotent sein musste. Und Brisorgueil. Und Brisorgueils komische Freunde.
Luce kehrte zum Hof zurück.
«Ich hab dein Ei anbrennen lassen», sagte Brisorgueil, so als hätte er es absichtlich getan.
«Mach mir noch eins.»
«Keins mehr da. Wir gehen erst heute einkaufen.»
Luce zuckte mit den Schultern und setzte sich ohne weiter hinzuhören vor ihr verbranntes Ei.
Die Freunde des Anwalts saßen jetzt am Tisch. Gros verschlang gebratenen Speck. Das Jüngelchen, Jeannot Sowieso, machte sich Marmeladenbrote. Er mochte kaum älter als zwanzig sein. Seine sonnengebräunte Haut war wesentlich dunkler als sein blondes, lockiges Haar. Er hätte einen wundervollen, kleinen Liebhaber abgegeben mit seinen unschuldigen, blauen Augen; aber es war nicht er, der ihr durch den Kopf ging.
Sie hatte sich angewöhnt, mit sich selbst von «Brisorgueils Freunden» zu reden, als würden sie ein unzertrennbares Ganzes bilden. In Wirklichkeit tat sie das, um die Faszination zu verdrängen, die nur einer von ihnen auf sie ausübte.
Er saß am äußersten Ende des Tisches. Er trank schwarzen Kaffee aus einem steinernen Krug. Er war ein großer, breitschultriger Mann ohne ein Gramm Fett zu viel. Das Gesicht wirkte borniert; aber das lag daran, dass er einen nie anzublicken schien. Die Stirn war nicht sehr hoch, aber breit. Die Nase, einmal gebrochen, war gut wiederhergerichtet. Die Narbe des Bruchs unterstrich die Brutalität eines grobschlächtigen Gesichts. Luce hatte Lust, sich wieder an die Bildhauerei zu machen: noch nie hatte sie eine Fresse mit so wenig Kurven und so vielen Flächen, plan wie Ziegelsteine, gesehen.
Er führte eine Zigarette an seine Lippen, die er sich mit Maispapier gedreht hatte, und Luce hatte den Eindruck, dass er sie platt drücken würde, als er den Mund wieder schloss. Aber nein, er begnügte sich damit, sie vorsichtig anzuzünden.
Das war das Faszinierende. Diese Mischung aus Brutalität und Maßhalten. Als würde man einem logisch denkenden Stier gegenüberstehen.
«Haben Sie gut geschlafen?» fragte der logisch denkende Stier.
Für einen Lidschlag nahm Luce, hinter seinen kurzen Wimpern, seine grauen, fast farblosen Augen wahr. Sie blickten kalt, als sei seine banale Frage Teil eines raffinierten Plans. Luce nickte knapp.
«Und du, Rhino?» sagte das Jüngelchen. «Gut geschlafen?»
«Ja», antwortete der logisch denkende Stier… «In der Erdverbundenheit liegt etwas Gesundes und ein wenig Zauberhaftes. Man wäre nicht überrascht, von einer übernatürlichen Musik geweckt zu werden und an irgendeinem Hexensabbat im Tal teilzunehmen.»
Er hatte diese abstruse Ansprache hergebetet, als würde er das Telefonbuch herunterleiern. Luce war nicht mehr erstaunt als sonst. Rhino gab dreimal am Tag etwas dieser Art zum Besten.
«Ich hoffe, die Atmosphäre sagt Ihnen zu», sagte die Gastgeberin.
«Ja.»
«Ich hoffe, dass Sie lange etwas davon haben.»
«Den ganzen Sommer», antwortete Rhino trocken.
«Das heißt», fügte Brisorgueil eilig hinzu, «wenn Sie die Güte haben, uns die ganze Zeit zu beherbergen, werte Freundin.»
«Natürlich», sagte Rhino. «Natürlich. Genau.»
Luce war überzeugt, dass er niemandes Erlaubnis brauchte, um sich aufzuhalten, wo immer es ihm passte. Was sie wunderte, war, dass Rhino der Weiler so gefiel. Er war nicht «sophisticated» genug, um den mangelnden Komfort zu genießen. Und er mochte die Natur nicht. Seine Manneskraft war städtisch. Man konnte ihn sich als Docker oder Boxer vorstellen. In Wirklichkeit führte er ein Restaurant in Brüssel, obwohl er kein Belgier war. Das hatte Brisorgueil jedenfalls gesagt. Luce hatte keinerlei Grund, daran zu zweifeln. Sie hatte nicht weiter nachgehakt. Sie hatte es schon immer für geschmacklos gehalten, persönliche Themen zur Sprache zu bringen. Und sich über anderer Leute Berufe oder ihren eigenen auszulassen, fand sie todlangweilig.
Gros war in dieser Sache mit dem Restaurant in Brüssel Rhinos Teilhaber. Und Jeannot war ein junger Dichter, ein Schützling des Hauses, der, so sagte man, an Dienstagabenden im Restaurant seine Verse vortrug. Einen Moment lang hatte Luce befürchtet, dass er auch hier eines Tages rezitieren wollte. Zum Glück war nichts dergleichen geschehen, und Luce hatte das undeutliche Gefühl, dass sich dieses Problem nie stellen würde.
«Gut», sagte Rhino.
Er leerte seinen Krug schwarzen Kaffee.
Wie auf ein Signal aß Jeannot hastig sein Brot auf, und Gros verschlang den restlichen gebratenen Speck auf wenig elegante Weise. Er kaute noch, als er nach Rhino aufstand.
«Wir gehen runter», sagte letzterer.
«Ich hab die Einkaufsliste», fügte Jeannot hinzu, klopfte sich auf die Hemdtasche und lächelte einfältig.
Luce zuckte mit den Schultern und aß den Rest ihres verbrannten Eis auf.
Sie wechselten sich mit den Einkäufen in der Stadt ab. Die drei Männer waren noch nicht lange genug da, um schon an der Reihe gewesen zu sein. Luce sah, wie ihr Citroën DS-Kombi aus der Scheune, die als Garage diente, fuhr, und sich auf die fünf Kilometer lange, serpentinenreiche Abfahrt machte, die den Weiler mit einer Landstraße verband.
«Eine kleine Partie Pikett?» schlug Luce vor.
Brisorgueil war einverstanden.
Luce fiel auf, dass er wesentlich schlechter spielte als sonst.
*
Gegen elf Uhr morgens stieß der DS-Kombi auf die Nationalstraße 101 und ein wenig später auf die Nationalstraße 86, über die der Wagen nach Pont-Saint-Esprit hineinfuhr, wo die drei Männer die Besorgungen für den Weiler erledigten.
Einmal die Woche wurde eingekauft. Dort oben gab es keinen Kühlschrank, und jede Fahrt in die Stadt hinab war eine Gelegenheit, sich ordentlich mit Frischfleisch einzudecken.
Jeannot hielt den Kombi vor der Schlachterei an. Gros stieg aus. Er bestellte einen ganzen Hammel und blieb, um die Zubereitung und das Wiegen des Tieres zu überwachen. Währenddessen erledigten Rhino und Jeannot die anderen Einkäufe. Als sie wiederkamen, war die Bestellung fertig, und Gros hatte bezahlt. Die drei Männer luden das in ein Stück weißes Tuch gehüllte Tier hinten in den DS.
Es war zwölf Uhr. Sie fuhren aus der kleinen Stadt hinaus und hielten vier Kilometer weiter an. Dann wühlten sie unter den Wagensitzen und zogen graue Kittel, Frankensteinmasken, zwei 38er-Colts, eine Astra-Condor-9-mm-Automatik, zwei MAT-69-Maschinenpistolen und Tränengasgranaten hervor.
Um 12:30 Uhr steuerte ein gepanzerter Kastenwagen auf sie zu, begleitet von zwei Motorradpolizisten.
Gros und Rhino eröffneten mit den Maschinenpistolen das Feuer auf den Konvoi. Der Coup war unter dem festen Vorsatz zu töten vorbereitet worden, wie der mit der Ermittlung beauftragte Kommissar abends in einer Presseerklärung bemerkte. Die beiden Motorradpolizisten und eine der Begleitpersonen wurden kurzerhand erschossen. Dem tödlich verletzten Fahrer des Lieferwagens gab Rhino den Gnadenschuss in den Nacken. Gleichzeitig stieg Jeannot auf das Dach des gegen einen Baum gekrachten Panzerwagens, und Gros warf drei Tränengasgranaten durch die Trennscheibe zwischen der Fahrerkabine und dem Laderaum.
Die Heckklappe öffnete sich fast sofort, und der Wachmann kam hustend und spuckend hervor, einen Revolver in der Hand. Jeannot schoss ihm vom Dach des Lieferwagens eine 9-mm-Kugel in den Schädel, womit sich die Sache mit dem Wachmann erledigt hatte.
Die Killer schleppten die zweihundertfünfzig Kilo Gold, die der Lieferwagen enthielt, in einem einzigen Gang zu ihrem Kombi. Gros allein trug hundertfünfzig Kilo, und der Schweiß floss aus seiner Maske.
12:43 Uhr
Auf der verlassenen Nationalstraße 101 fuhr Jeannot so schnell wie möglich. Er hatte seine Maske abgenommen. Seine Kumpane hatten Masken und Kittel auf die Sitze gelegt, ebenso die Waffen.
Ohne dass der DS an Tempo verlor, ließ Gros einen Teil des hinteren Bodens zur Seite gleiten, wobei er einen geräumigen Doppelboden freilegte. Dieser verringerte die Bodenfreiheit des Wagens ein wenig, aber nicht gefahrvoll. Gros öffnete die Kisten mit dem Gold und begann, die Barren in den Boden zu legen. Er lachte vor Glück, als er die zweihundertfünfzig Kilo Gold verstaute.
Jeannot bog links in die Landstraße ein und ging ein wenig vom Gas. Hier gab es tückische, hinter Baumgruppen verborgene Kurven.
«Guter Gott!» sagte er. «Spitze!»
Rhino warf einen Blick auf seine Uhr.
«Zwölf Minuten», sagte er. «Uns bleiben noch sechs, wenn der Wachmann einen Funkruf durchgegeben hat, bevor der Lieferwagen den Unfall gebaut hat.»
«Das reicht.»
«Los geht’s, ihr seid verarztet», grinste Gros hämisch und schob den Boden wieder zu.
Der DS gelangte auf eine gerade Strecke. Jeannot gab Gas. Zweihundert Meter weiter trat eine schmale Gestalt vom Seitenstreifen und baute sich gestikulierend mitten auf der Straße auf.
«Ich drück auf die Tube», sagte Jeannot, «dann muss sie wohl oder übel aus dem Weg gehen.»
«Nein», sagte Rhino. «Halt an.»
Der junge Fahrer bremste ohne Widerrede. Gros stieß einen Fluch aus, warf die leeren Metallkisten auf den Ersatzreifen und breitete die Kittel darüber. Sie steckten in einem Durcheinander aus Lebensmittelkartons und Bierkisten. Und mit dem in das weiße, blutbefleckte Tuch gewickelten Hammel würden sie nicht mehr ins Auge springen.
Der Kombi kam wenige Meter vor der jungen Frau zum Stehen. Rhino beugte sich aus dem offenen Fenster.
«So kommen Sie noch unter die Räder, Kleines», sagte er jovial.
Seine rechte Hand war ins Seitenfach der Tür getaucht und entsicherte die Astra Condor. Im selben Moment registrierte sein Blick die Anwesenheit von zwei weiteren Personen: noch eine junge Frau, die auf einem Koffer saß, und ein Junge.
«Bitte», sagte die, die sich auf der Straße aufgebaut hatte. «Wir haben es nicht weit, aber mit diesem Koffer; und dem Kind, das nicht mehr laufen kann …»
Sie war hübsch auf eine unnatürliche, sehr strenge Art. Das Haar zurückgekämmt, ovales Gesicht mit großer Stirn, nervöser Mund, meergrüne Augen, verwirrter Blick. Pseudo-Chanel-Kostüm und hohe Absätze; was hatte sie hier zu suchen?
«Steigen Sie ein», sagte Rhino. «Und du mach hinten auf.» Gros gehorchte.
Jeannot trommelte nervös aufs Lenkrad. Die Sekunden rannen dahin. Rhino hatte Recht damit gehabt, anzuhalten: es bestand die Gefahr, dass diese Tussis sich an den DS erinnern würden. Aber jetzt war es fast noch schlimmer. Sie hatten nur wenige Minuten, um zu entscheiden, was besser war: die beiden jungen Frauen absetzen und sie weiterziehen lassen, oder aber sie töten und die Leichen im Weiler verstecken. Ein Kind umbringen … Jeannot erschauerte vor Entsetzen.
Die Tür schlug zu.
Jeannot fuhr automatisch los und trat das Gas durch. Er sah lieber nicht auf die Uhr. Wenn ein Hubschrauber aufkreuzte, würden sie ihn schon sehen.
«Kommen Sie denn von weit her?» sagte Rhino.
Er gab sich väterlich. Seine rechte Hand befand sich noch immer im Seitenfach, wie geistesabwesend.
«Wir reisen so hin und her», sagte die Reisende mit den grünen Augen.
Sie wirkte wie bei etwas Verbotenem ertappt.
«Und wohin gehen Sie?»
Sie schien sich zusammenzureißen.
«Sind Sie von hier?»
«Im Urlaub in der Gegend.»
«Kennen Sie das Dorf von Madame Luce?»
Das war der Gipfel. Selbst Rhino brauchte den Bruchteil einer Sekunde, um zu reagieren.
«Ja», sagte er.
«Dort wollen wir hin», sagte die Reisende.
«Dort machen wir Ferien», sagte Rhino.
Die junge Frau riss die Augen auf und schüttelte den Kopf. Sie stellte keine Fragen.
Der DS erreichte die Kreuzung zwischen der Landstraße und dem Weg, der zum Weiler hinaufführte. Es ging mit achtzig in die Kurve.
«Entschuldigen Sie», sagte das andere Mädchen, «aber müssen Sie so schnell fahren? Sie werden den Kleinen noch krank machen.»
Rhino drehte sich fast vollständig um, um sie zu mustern. Sie hatte einen kleinen, kantigen Kopf. Schwarze Haare, blaue Augen, rosiger Teint. Kaum älter als zwanzig. Viereckige Fingernägel. Sie hielt das Kind in den Armen. Es war ein schmächtiger kleiner Junge mit zu großen Augen. Viel zu still. Man könnte meinen, ein Schnipser auf die Wange würde genügen, um ihn umzubringen. Was wahrscheinlich auch der Fall war.
«Ihr Sohn?» fragte Rhino.
«Meiner», sagte die Reisende mit den grünen Augen.
«Und Sie werden erwartet?»
«Nicht direkt.»
Was sollte das nun wieder heißen? Rhino war perplex. Diese ganze Bagage umbringen, den Wagen abstellen, ohne dass Luce oder dieser komische Schriftsteller etwas merkten, die Einkäufe ausladen, während der Siesta zurückkommen und die Leichen verscharren, das war machbar, aber es gab zu viele Unbekannte …
Im schlimmsten Fall, dachte Rhino, wäre immer noch Zeit genug, alle Leute im Weiler abzuschlachten.
Mit fünf Menschen auf dem Konto, darunter zwei Bullen, war Rhinos Haut keinen Pfifferling mehr wert, wenn er geschnappt wurde. Es war ihm also völlig gleichgültig, ob er noch ein wenig weitermassakrieren musste, wenn seine Sicherheit davon abhing.
Der DS fuhr in den Weiler hinein. Rhino sah auf die Uhr. Dreiundzwanzig Minuten, seit er das Feuer auf die Motorradpolizisten eröffnet hatte. Wahrscheinlich wurden bereits die Straßensperren aufgebaut.
Jeannot lenkte den Wagen in die Scheune, die als Garage diente, und stellte ihn zwischen dem Peugeot 404 des Schriftstellers und Brisorgueils Ferrari ab. Vor September sollte der Kombi nicht mehr von der Stelle bewegt werden – wenn nichts dazwischen kam.
Gros öffnete die Heckklappe und begann, sich die Einkäufe aufzuladen. Rhino und Jeannot stiegen aus und begleiteten die jungen Frauen. Diese wirkten unschlüssig.
«Ist Monsieur Bernier auch hier?» fragten die grünen Augen.
«Bernier?»
«Der Schriftsteller.»
«Ah ja, der Schriftsteller. Ja, er ist da», sagte Rhino. «Hier entlang.»
Er nahm eine Bierkiste und marschierte Richtung Haupthaus. Auf der Terrasse drei Meter über der steinigen Straße erhob sich Madame Luce, ein Glas in der Hand. Ihr knapper Bikini verbarg leider nichts von ihrem verbrauchten Körper.
«Teufel auch», fluchte sie. «Schleppt ihr jetzt schon Frauen an?»
«Das ist Madame Luce», erklärte Rhino den beiden jungen Frauen.
«Ich wollte zu Monsieur Bernier», murmelte das Mädchen mit den grünen Augen fast unhörbar.
«Max!» brüllte Luce.
Der Schriftsteller trat in den Hof hinaus. Sein fleischiges Gesicht war schweißnass. Er war nicht rasiert, und seine schweißglänzenden Wangen waren mit kleinen, weißlichen Stoppeln gespickt. Ein Hemdzipfel hing aus seiner Trevirahose, die nicht ganz zu war. Auch er hielt ein Glas in der Hand.
Er wirkte verblüfft, dann angewidert, als er die Reisende erkannte.
«Was hast du denn hier zu suchen?» fragte er liebenswürdig.
Die Augen der jungen Frau füllten sich in erstaunlicher Geschwindigkeit mit Tränen. Sie blieb stehen und biss sich auf die Lippen.
«Wer ist das?» fragte Luce interessiert.
«Das ist meine Frau.»
«Teufel auch», sagte Luce zum zweiten Mal.
«Gut», sagte Rhino. «Nun dann, ich stell mal das Bier kalt.»
Er drehte sich um und marschierte bis zum Brunnen. So beweise ich Taktgefühl, dachte er. Hatte Brisorgueil ihm doch geraten, Taktgefühl und eine gewisse Bildung zu zeigen, damit die alte Luce nicht misstrauisch wurde.
Rhino hatte gute Ohren. Während er den Bierkasten an einen Haken hängte und ihn vorsichtig auf den Grund des Brunnens hinabließ, verfolgte er, was im Hof des Haupthauses geredet wurde.
Max war übelster Laune. Melanie (so nannte er seine Frau) heulte.
«Und dann auch noch mit diesem Knirps!» brüllte der Schriftsteller.
«Ich konnte ihn nicht zurücklassen!»
«Durch ihn holst du dir garantiert die Gendarmen an den Arsch!»
Rhino erstarrte wie versteinert.
«Niemand weiß, dass ich hergekommen bin!»
«Könnt ihr mir mal erklären, was hier vor sich geht, Kinder», rief Luce von ihrer Terrasse herunter. «Max hat uns nicht mal gesagt, dass er verheiratet ist.»
«Ich lass mich scheiden», erwiderte Max.
«Jetzt reicht’s aber, Monsieur Bernier», kreischte eine vierte Stimme.
Das war die kleine Brünette, die in Fahrt geriet.