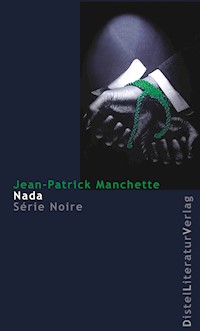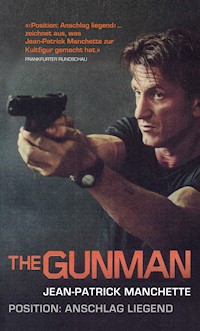Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Distel Literatur Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Série Noire
- Sprache: Deutsch
Mit der Miete für sein armseliges Pariser Appartement im Rückstand und keine Aufträge in Aussicht beschließt Eugène Tarpon, Privatdetektiv und ehemaliger Gendarm, seinen Beruf an den Nagel zu hängen, als er mitten in der Nacht aus seinem alkoholisierten Schlaf gerissen wird. Eine hübsche junge Frau bittet um Hilfe, da ihre Zimmergenossin, ein Filmsternchen, brutal ermordet wurde. Seinen Rat, die Polizei einzuschalten, schlägt sie aus und ihn k.o. Tarpon beginnt zu ermitteln. Dabei gerät er zwischen die Fronten der örtlichen Polizei, amerikanischer Mafiosi sowie politischer Fanatiker und befindet sich plötzlich in Lebensgefahr, als er erkennt, wer der Mörder ist. VERFILMT VON JACQUES BRAL
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DistelLiteraturVerlag
Jean-Patrick Manchette, geboren 1942 in Marseille, liebte Jazz, Kino und Literatur. Er radikalisierte den europäischen Roman noir und gilt als Begründer des neueren sozialkritischen französischen Kriminalromans, des sogenannten Néopolar.
Manchette arbeitete als Drehbuchautor und veröffentlichte neben Theaterstücken und zahlreichen Essays auch zehn Kriminalromane, die ihn zur Kultfigur machten, und von denen die meisten verfilmt wurden, so Nada (1973) von Claude Chabrol; Tödliche Luftschlösser (Folle à tuer, 1975) von Yves Boisset, mit Marlène Jobert; Westküstenblues (Trois hommes à abattre, 1980) von Jacques Deray, mit Alain Delon; Knüppeldick (Pour la peau d’un flic, 1981) von und mit Alain Delon; Position: Anschlag liegend (Le choc, 1982) von Robin Davis, mit Catherine Deneuve und Alain Delon; Volles Leichenhaus (Polar, 1983) von Jacques Bral; Position: Anschlag liegend wurde 2015 unter dem Titel The Gunman neu verfilmt von Pierre Morel mit dem zweimaligen Oscar-Preisträger Sean Penn.
Alle Kriminalromane sowie die gesammelten Essays zum Roman noir in den «Chroniques» sind auf Deutsch im DistelLiteraturVerlag erschienen.
Jean-Patrick Manchette starb 1995 im Alter von 52 Jahren in Paris. Er wurde zur Leitfigur für eine neue Generation von Krimiautoren in Frankreich
Jean-Patrick Manchette
Volles Leichenhaus
Aus dem Französischen von Christina Mansfeld und Stefan Linster
DistelLiteraturVerlag
Deutsche Ausgabe 2. Auflage 2008, 2015 Copyright © 2000, 2008, 2015 by DistelLiteraturVerlag Sonnengasse 11, 74072 Heilbronn Die Originalausgabe erschien 1973 unter dem Titel «Morgue Pleine» in der Série Noire bei Éditions Gallimard (Paris) Copyright © Éditions Gallimard 1973 Umschlagentwurf: Jürgen Knauer, Heilbronn ISBN 978-3-923208-84-5 (Print) ISBN 978-3-923208-95-1 (E-Book)
1
Der Montag war besonders deprimierend. Um neun Uhr klingelte der Wecker, und ich setzte mich auf mein Bett. Falls man dazu Bett sagen konnte. Übrigens hatte ich schon seit zwei Stunden nicht mehr richtig geschlafen, nur noch gedöst. Und ich war um 22.30 Uhr ins Bett gegangen. Ich schlafe viel. Oder döse viel. Nun ja, je nachdem.
Ich brachte mein Lager halbwegs wieder in Ordnung, deckte den abgewetzten blauen Samtüberzug drauf, klappte das Rückenteil und die Armlehnen hoch und schob das Ganze an die Wand. Doch, es sah fast wie ein Sofa aus.
Ich hatte nur Unterhosen an. Es war kühl. Ein beschissener Frühling in diesem Jahr, und nun begann es zu regnen, im Hof hinter dem Milchglasfenster und wahrscheinlich in der übrigen Stadt auch. Ich öffnete das Fenster trotzdem, um zu lüften, mit dem Erfolg, dass das Wasser nun innen an der Wand unter dem Fenster runterlief. Also machte ich wieder zu. Ich sortierte die Zeitungen im Zeitungsständer, alles alte Ausgaben, Express, Paris-Match, Lectures pour Tous und eine verirrte Newsweek. Nicht, dass ich Amerikanisch oder so was spreche, aber das wirkt international, damit zeigt man Format.
Bei wem eigentlich?
Ich ging durch das Büro in die Küche. Am Spülbecken wusch ich mir das Gesicht und rasierte mich. Wie immer beim Rasieren sah ich in den rechteckigen Spiegel, der an der Wasserleitung hing. Und dann schnitt ich mich auch noch und konnte lange die Blutung nicht stillen. Es war fast zehn, als ich meine Zwei-Zimmer-Küche-Diele-Wohnung verließ. Auf dem Treppenabsatz steuerte ich kurz das Gemeinschaftsklo an, dann ging ich (vier Etagen ohne Aufzug) runter, um an der Ecke Rue Saint-Martin einen Kaffee zu trinken. Auf der Straße der übliche Verkehrsfluss, vor zehn Jahren hätte man Stau dazu gesagt, mittlerweile fand man den Verkehr «flüssig». Flüssig vielleicht – abgasgeschwängert ganz sicher. Die Nutten hatten schon den Rückzug in die Hoteleingänge angetreten. In zehn Jahren werden sie selbst dort die Stellung nicht mehr halten können, dann wird ihnen die Luft ganz ausgehen, oder sie müssen zum Anschaffen raus aufs Land.
Für den Kaffee musste ich meinen letzten Hunderter anbrechen. Der Gang zur Bank war unvermeidbar, doch was hatte ich noch auf der Bank? Nicht mal mehr einen Riesen. Und in sechs Wochen war die Miete fällig. Einhundertzwanzigtausend alte Franc. Es sah nicht gut aus.
Ich stieg wieder zu mir hoch, und die vier Etagen gingen mir ganz schön in die Beine. Kein Wunder, dass niemand zu mir raufkam. Wie lange war ich eigentlich schon hier? Drei Monate, noch nicht ganz. Meine gesamten Ersparnisse waren dabei draufgegangen. Ich stand vor meiner Tür und betrachtete die mit Reißzwecken befestigte Visitenkarte. E. TARPON, Ermittlungen. Die Ecken verbogen sich langsam, aber sicher und vergilbten auch. Vielleicht sollte ich unten ein Schild anbringen? Aber nein. Heutzutage rufen die Leute immer zuerst an. In diesem Moment klingelte drinnen das Telefon.
Ich holte schnell meine Schlüssel raus und ging rein. Ich lief durch das Vorzimmer, das heißt mein Schlafzimmer, und hob auf dem Schreibtisch im Büro den Hörer ab.
«Eugène?»
«Wer ist am Apparat?» fragte ich.
«Foran. Weißt du noch?»
«Und ob! Du bist in Paris?»
«Seit drei Wochen. Ich hab auch quittiert.»
«Ach ja. Weshalb denn?»
«Erkläre ich dir später. Kann ich dich treffen?»
«Na ja, schon», brummte ich …
«Wir essen zusammen. Du wohnst doch an den Hallen, oder? Da gibt es wenigstens noch gute Bistros. Ich hol dich ab.»
Ich sagte, dass ich einverstanden sei, und er sagte mir, er könne jetzt nicht länger sprechen, dass er mir aber alles erzählen würde, dass wir beim Essen reden würden, und dann legte er auf und ich auch. Besondere Lust, diesen Foran zu sehen, hatte ich nicht.
Von seinem Anruf bis zu seinem Eintreffen geschah nichts Besonderes. Ich machte meine morgendliche Gymnastik. Ich wusch in der Küche ein paar Sachen und hängte sie zum Trocknen auf. Ich war gerade mit dem Aufhängen fertig, als es klingelte. Halb zwölf, für Foran etwas zu früh, vielleicht ein Klient. Ich trocknete mir die Hände ab, zog mein Jackett wieder über und ging aufmachen. Die Zeugen Jehovas. Höflich bat ich sie, sich zum Teufel zu scheren. Sie ließen mir ein Traktat da, das ich ungelesen wegwarf. So war wenigstens etwas in meinem Papierkorb.
Das sah nach Arbeit aus.
Dann nahm ich mir ein Buch aus dem Regal im Vorzimmer und setzte mich auf das blaue Sofa. Ich hörte die Nähmaschine von dem Schneider über mir, er heißt Stanislavski. In dem Buch ging es um den Generationskonflikt. Es spielte bei den Reichen, und da gab es einen Jungen, der auf die schiefe Bahn geriet und einen auf Hippie machen wollte. Der Vater kämpfte mit aller Kraft gegen diese verderbliche Neigung an, und es gelang ihm, sich durchzusetzen, doch nach und nach verlor er seine Lebensfreude, und als der Junge sich endlich dazu entschloss, zu spuren und wie jedermann Führungskraft zu werden, machte sich plötzlich der Vater aus dem Staub. Er tauchte nie mehr auf, und dabei beließ es der Autor, was mir ziemlich unfair vorkam. Was sich dann abgespielt hat, hätte ich gern gewusst. Was dem Vater passiert ist. Wahrscheinlich war der Autor unfähig, sich das auszudenken.
Abermals läutete die Klingel. Ich legte mein Buch weg und machte auf. Foran. Er hatte weiter an Gewicht zugelegt, doch er war in Zivil, so dass er nicht mehr so nach Hermann Göring aussah wie früher. Er trug einen blauen Anzug mit roter Krawatte zu weißem Hemd, und auch sein Gesicht zeigte Flagge, kleine blaue Augen in der aufgedunsenen roten Visage unter weißblondem Bürstenhaar. Er japste. Er stand einen Moment da und brachte nichts heraus, dann sagte er:
«Die haut einen ja um, deine Treppe. Die Klienten kommen hier hoch?»
Ich zuckte mit den Schultern.
«Wie geht’s dir?» fragte ich.
«Es geht. Kannst du mir was anbieten?»
Ich ging vor ins Büro.
«Setz dich.»
Ich lief rüber in die Küche und machte die Tür hinter mir zu, damit er nicht nachkam. Ich goss zwei Ricard ein und stellte sie zusammen mit einer Wasserkaraffe auf ein Tablett und ging ins Büro zurück.
«Eis hab ich keins», teilte ich ihm mit.
Er antwortete nicht. Er hatte sich nicht gesetzt. Er spazierte im Zimmer herum und besah sich alles, den Schreibtisch aus hellem Eichenimitat mit Schubfächern an beiden Seiten, den leeren Aktenschrank aus Metall, den Sperrholzstuhl und den Skai-Sessel. Einen Martini-Aschenbecher auf dem Schreibtisch und eine Lampe. Das Traktat der Zeugen Jehovas im Papierkorb. Brandflecken von Zigaretten auf dem Teppichboden.
«Wie laufen die Geschäfte?» fragte er.
«Wie du siehst.»
«Nicht besonders?»
Ich zuckte wieder mit den Schultern. Er goss Wasser in jedes Glas und stieß mit seinem an meinem an, das ich noch nicht in die Hand genommen hatte.
«Gerade deshalb wollte ich dich ja sehen», erklärte er. «Um dir einen Job anzubieten. Du wärst also frei, wenn ich das richtig verstehe?»
«Was für einen Job?»
«Wir reden beim Essen drüber.»
Ich hatte keine Lust, mit ihm zu essen.
«Was für einen Job?» wiederholte ich.
Er setzte sich in den Sessel, schwenkte den Ricard in seinem Glas und sah mich lächelnd an.
«Immer noch verbittert, was? Immer noch misstrauisch? Eine richtige Mimose, was? Du musst auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, Eugène. Du machst hier rein gar nichts, und das wissen wir beide. Vielleicht ein oder zwei Fälle, seit du aufgemacht hast. Eine Scheidung. Einen Buchhalter beschatten. Bestenfalls, wenn überhaupt! Irre ich mich?»
Ich setzte mich auf den Stuhl und probierte meinen lauwarmen Ricard.
«Du gehst mir auf die Nerven, Foran. Erzähl mir deine kleine Geschichte. Anschließend gehen wir vielleicht zusammen essen. Aber auf getrennte Rechnung. Soweit zu uns beiden.»
Er lächelte einen Moment lang weiter, dann hielt sein Lächeln nicht mehr.
«Schon gut, schon gut. Wenn das so ist. Ich stelle eine Mannschaft zusammen. Auch Privatpolizei, aber bei mir sind das konkrete Projekte, keine Luftschlösser. Ich hab schon Kontakte geknüpft, mit großen Buden. Bei dem Job geht’s um die Schulung und militärische Organisation von Aufsichtspersonal. Nur, wir müssten zu fünft oder sechst sein. Da hab ich an dich gedacht.»
«Militärische Organisation von Aufsichtspersonal», wiederholte ich. «Was für Aufsichtspersonal?»
«Werkschutz, wenn du so willst.»
«Verstehe.»
«Das kommt doch jetzt genau richtig», beteuerte er, und das Lächeln auf seiner Visage erschien wieder.
«Verstehe», wiederholte ich. «Hau ab.»
Er glaubte, sich verhört zu haben.
«Raus», sagte ich. «Verschwinde. Leck mich.»
Er wurde nicht einmal wütend. Er stand kopfschüttelnd auf, die fleischigen Lippen zu einem amüsierten Lächeln verzogen.
«Solltest dich nicht so aufregen», meinte er. «Aber ich versteh schon. Ich nehm es dir nicht übel. Ich lasse dir meine Karte da.»
«Nicht nötig.»
«Du könntest deine Meinung ja ändern. So was kommt vor.»
«Adieu, Foran», sagte ich.
Er trank erst noch sein Glas aus und winkte mir mit einer knappen lebhaften Bewegung seiner dicken kurzen Hand zu, dann ging er. Ich nahm die Karte, die er auf eine Ecke des Schreibtischs gelegt hatte. Braune Schrift auf Pappe in einem Farbton wie ranzige Butter, sah gar nicht wie eine Visitenkarte aus, eher wie der Berufsausweis von jemandem aus der Gastronomie, und darauf war zu lesen: Militärisch organisierte Aufsicht von Industrieanlagen, und darunter: Charles Foran, Direktor, und darunter weiter: durch ehemalige Angehörige der Gendarmerie und der Streitkräfte. AUSSCHLIESSLICH FRANZÖSISCHES PERSONAL; und zuletzt eine Adresse in Saint-Cloud und eine Telefonnummer. Auf der Rückseite stand in verschnörkelten Buchstaben nur: MÜVI.
Ich drehte die Karte eine Weile hin und her, stieß dann einen tiefen Seufzer aus und zerriss sie. Die Stückchen warf ich in den Papierkorb zu dem mystischen Glaubenstraktat. Das sah immer mehr nach Arbeit aus. Bei dem Tempo konnte ich in einem halben oder einem Jahr mit einem vollen Korb rechnen.
Ich hatte noch zwei Eier im Kühlschrank, und Käse. Das aß ich zu Mittag. Ich hatte keine Lust, runter etwas anderes kaufen zu gehen. Ich wusch die Pfanne ab, den Teller, das Besteck, mein Glas und das von Foran. Ich machte mir einen Nescafé und nahm ihn mit ins Vorzimmer. Die Blumen in der Vase auf dem kleinen runden Tisch waren verwelkt. Ich ging sie wegwerfen, kam zurück und setzte mich wieder auf das blaue Sofa. Ich blieb eine ganze Weile so hocken und tat gar nichts, dann las ich einige Seiten in dem Buch, das mir Stanislavski, der Schneider von oben, geliehen hatte, Die neue Gesellschaft von einem gewissen Merlino. Es stammt aus dem Jahr 1893 und ist ziemlich schlecht gedruckt. Ich konnte irgendwie kein Interesse dafür aufbringen. Alles, was mir Stanislavski leiht, ist sehr seltsam.
Schließlich ging ich wieder ins Büro und nahm den Telefonhörer ab. Es dauerte etwas, bis ich zu der Nummer im Departement Allier durchgestellt wurde.
«Hallo?» hörte ich in der Ferne.
«Teilnehmer, bitte melden», drängte die Frau vom Amt.
«Hallo», meinte ich, «ist dort das Hotel Chartier?»
Es krachte mehrmals hintereinander in der Leitung, und ich hörte, wie jemand ungeduldig «Hallo? Hallo?» rief, dann wurde die Verbindung plötzlich gut, und die Stimme schmetterte in mein Ohr.
«Wer ist am Apparat?»
«Eugène Tarpon. Sind Sie es, Madame Marthe?»
Sie war es und wollte wissen, wie es mir ging, und ich sagte, gut, und fragte, ob sie meine Mutter holen könne. Sie antwortete, mache ich, und ich merkte, dass sie unzufrieden war, weil ich mir nicht die Zeit nahm, mit ihr die Dorfnachrichten durchzugehen und mich zu erkundigen, wer in letzter Zeit gestorben war und ähnlich erfreuliches Zeug.
Es dauerte etwas, bis meine Mutter an den Apparat kam. Sie wohnt zwar nur fünfzig Meter vom Hotel Chartier entfernt, ist aber neunundsechzig und kann sich nicht schnell fortbewegen. Außerdem hat sie nie vernünftig telefonieren gelernt. Ich verstand noch nicht einmal die Hälfte von dem, was sie schrie, und sie verstand fast nichts von dem, was ich sagte. Ich hatte immerzu im Hinterkopf, wieviel Einheiten den Bach runtergingen, und fragte mich, was mich der ganze Spaß noch kosten würde.
«Was sagst du?», schrie meine Mutter.
Sie schreit immer ins Telefon.
«Ich komme heim.»
«Ich verstehe nichts, Eugène, sprich lauter.»
«Ich komme ins Dorf zurück!»
Jetzt fing ich auch schon an zu brüllen.
«Du kommst heim?»
«Sag ich doch.»
«Mittwoch?»
«Genau, Mittwoch», seufzte ich. «Oder vielleicht morgen.»
«Machst du Urlaub?»
«Nein, Mama, ich komme richtig heim.»
Ach was, wozu sollte ich ihr es denn erklären?
«Ich verstehe dich sehr schlecht, weißt du, Eugène.»
«Ja, Mama. Das macht nichts. Ich erzähl dir alles morgen, wenn ich da bin.»
«Ja!» schrie sie unsicher, wie jemand, der taub ist.
«Kuss, Mama», sagte ich. «Bis morgen.»
«Ja.»
«Bis morgen!»
«Ja.»
Schweißgebadet hängte ich ein. Ich mixte mir einen Ricard. Es war erst fünf Uhr nachmittags, aber ich brauchte einen Schluck.
Als ich ruhiger war, also kurz darauf, rief ich am Gare de Lyon an, um mich nach einem Zug zu erkundigen. Es gab einen um 7.50 Uhr, der ewig lange in der Gegend von Vierzon herumzockelte, doch das war immer noch die bequemste Verbindung, und ich konnte hoffen, am späten Nachmittag zu Hause zu sein. Ich schrieb mir alles auf. Ich goss mir noch ein Glas ein.
Zur Abendessenszeit war ich besoffen und hatte das Gefühl, dass man mir den Kopf durch eine Boulekugel ersetzt hatte. Ich hatte meine Sachen gepackt, was nicht weiter schwierig war, und einen Brief an den Hauseigentümer geschrieben, worin folgendes stand: Er könne über die Wohnung verfügen, ob ich denn die Kaution wiederhaben und ihm nur das halbe Quartal bezahlen könnte, da ich ja wegziehe. Und dass er sich die Schlüssel bei Stanislavski abholen solle. Und dass ich die Möbel vor dem Ende der Woche ausräumen lassen wolle. Ich überlegte noch mal, ob es niemand andern gab, den ich von meiner Abreise in Kenntnis setzen könnte. Ich wusste genau, es gab niemanden, deshalb machte ich mir einen sechsten Ricard, das heißt, ich vergaß Wasser und Eis und trank ihn pur. Gar nicht so übel. Weit weniger übel als ein Pflasterstein mitten in die Fresse. Doch daran durfte ich nicht denken. Ich ging mit ungelenken Schritten in der Wohnung auf und ab. Ich hätte gern ein Radio oder einen Fernseher angestellt, um mich wie jedermann damit zudröhnen zu lassen, bis ich schließlich völlig weggetreten wäre. Draußen wurde es dämmrig, ich öffnete das Bürofenster und sah, dass es aufgehört hatte zu regnen. Wenn ich nun nicht zum Fenster hinaus-, sondern in einen Fernseher hineingesehen hätte, wäre ich vielleicht mit meiner eigenen Birne konfrontiert worden. Nur, alte Nachrichten werden ja nicht wiederholt.
Frage: «Aber bevor das geschah, wurden Sie doch selbst verletzt?»
Antwort: «Ja, das stimmt.»
F: «Sie traf ein Geschoß ins Gesicht?»
A: «Ja, das stimmt.»
F: «Ein Pflasterstein?»
A: «Ich glaube, ja, das stimmt.»
F: «Sie haben die Beherrschung verloren?»
Keine Antwort. Groß eingeblendet wurde das unschlüssige (und hässliche) Gesicht des Gendarmen Eugène Tarpon, dann Schnitt, ziemlich trostlose Kamerafahrt über die Kaserne, dann …
2
Es klingelte.
Ich richtete mich auf. Verstört saß ich auf dem blauen Sofa. Ich lief schwankend hinüber zum Schreibtisch, öffnete ein Schubfach und stellte mein Glas rein. Ich sah nach, wie spät es war. Neun Uhr abends. Ich ging aufmachen.
Im Flur stand eine jugendlich wirkende Gestalt. Sie machte einen kurzen Schritt ins Vorzimmer, und das Licht brachte die Erleuchtung. Es war ein Typ. Er mochte nicht viel älter als zwanzig sein. Er hatte langes gekräuseltes Haar. Sein Gesicht war unschuldig, den Eindruck machte es zumindest auf mich; dazu muss gesagt werden, dass ich vielleicht nur deshalb so zur Nachsicht neigte, weil ich sturzbesoffen war. Er trug eine blaue Latzhose mit weißen Streifen und eine Safarijacke aus grünem Wildleder. Er hatte eine Brille.
«Entschuldigen Sie die Störung», sagte er. «Sind Sie Monsieur Tarpon?»
«Höchstpersönlich.»
«Ich habe lange gezögert, ob ich hochkommen soll. Deshalb … Deshalb erlaube ich mir trotz der späten Stunde …»
Er stockte. Er hatte sich irgendwie verheddert. Ich hielt noch immer die Tür mit einer Hand fest. Genaugenommen hielt ich mich an der Tür fest. Um nicht zu schwanken.
«Darf ich reinkommen?» meinte er, nachdem er eine Weile überlegt hatte.
«Wegen was?»
Er schien aus der Fassung gebracht.
«Sie sind doch Privatdetektiv, oder?»
Gleich diese Bezeichnung, wie in einem Roman. Ich zuckte mit den Schultern. Ich trat zur Seite. Er kam rein. Ich sagte ihm nicht, dass Schluss war, dass ich nicht mehr ermittelte, dass es nie angefangen hatte. Ich war froh, jemanden zu sehen.
Ich ging vor ins Büro und machte Licht. Ich setzte mich ziemlich schwerfällig auf den Stuhl und wies auf den Sessel. Er setzte sich ebenfalls.
«Wo klemmt’s denn?» fragte ich.
«Ich heiße Alain Lhuillier», sagte er und hielt inne, er schien auf etwas zu warten, und nach einer Weile begriff ich, ich zog mehrere Schubfächer auf, auch das, in dem das leere Glas stand, und fand schließlich doch noch Papier und einen Bleistift, ich schrieb den Namen auf, nun sah er zufrieden aus.
«Was hat Sie denn dazu gebracht, mich aufzusuchen? Ich meine, woher haben Sie meinen Namen?» begann ich und dachte mir, eine gute Frage, sie wird oft in amerikanischen Filmen gestellt, nur etwas besser formuliert.
«Ihre Annonce stand doch in der Détection.»
«Ja, das stimmt.»
Ich klammerte mich an die Tischkante und hätte am liebsten losgekotzt. Ja, das stimmt. Ich bekam mich wieder in den Griff.
«Richtig», setzte ich wieder an. «Was führt Sie zu mir?»
«Ich bin das Opfer von Erpressern. Na ja, das heißt, besser, ich fange mit dem Anfang an …»
Er warf mir einen kurzen zögernden Blick zu. Ich setzte eine zustimmende Miene auf. Er erzählte weiter.
«Ich hab zusammen mit Freunden einen Schuppen aufgemacht, im 14. Arrondissement, eine Art kleinen Club. Nun ja, privat, theoretisch, aber in Wirklichkeit kann jeder rein. In einem ehemaligen Lebensmittelgeschäft mit Keller. In Wirklichkeit bin ich nur der Geschäftsführer. Verstehen Sie?»
Ich nickte ihm kurz zu.
«Wer ist der Eigentümer?»
«Ein alter Knacker, ich meine richtig alt, ein Rentner. Er hat sich draußen auf dem Land zur Ruhe gesetzt. Das Lebensmittelgeschäft hat ihm gehört, und er fand keinen Nachfolger, da durften wir es dann versuchen, meine Kumpels und ich. Wir dachten erst nicht, dass das was werden könnte, bei uns wird nämlich kein Alkohol ausgeschenkt, verstehen Sie? Aber jedenfalls existiert unsere Bude immer noch, ich glaube, viele sind wegen der Gruppe gekommen.»
«Moment mal», sagte ich. «Welche Gruppe?»
«Orgasmusfunktion», antwortete er, und ich machte große Augen, aber er stellte sofort klar: «Die heißt so, eine Jazz-Rock-Gruppe.»
«Ah!» meinte ich erleichtert. «Eine Pop-Gruppe.»
«Kein Pop. Jazz-Rock.»
«Gut. Einverstanden. Und weiter?»
«Na, mit einem Mal lief es richtig gut. Wir haben im Herbst aufgemacht, und jetzt ist der Schuppen jeden Abend voll. Es lohnt sich. Was ich übrigens sagen wollte, ich hab Geld, um Sie zu bezahlen, wenn Sie nicht zu viel verlangen, ich hab Sie ja noch nicht danach gefragt.»
«Das regeln wir später. Erzählen Sie mir zuerst von Ihrem Problem.»
Er brach sich in seinem Sessel einen ab, um sich eine Zigarette rauszuholen, und ich schob ihm den Martini-Aschenbecher hin. Während er sprach, strich er viel öfter als nötig die Asche ab.
«Vor einem Monat haben mich nach Geschäftsschluss, wenn saubergemacht wird und so, zwei Kerle aufgesucht, Herren im Anzug und so, ältere, gediegene Typen, mit Aktentasche und Krawatte, Sie verstehen, welche Sorte.
»Ich verstand. Ganz gewöhnliche Leute. Er strich seine Gitane ab und fuhr fort.
«Sie erklärten mir, dass sie von einer gewissen Altersversicherungskasse der Gastronomen und Limonadenhändler kämen, ich hab mir den Namen so gut gemerkt, weil das ziemlich komisch war, ‹Limonadenhändler›; um es kurz zu machen, sie haben mir geraten, da Beiträge einzubezahlen, weil das angeblich eine Menge Vorteile bringen sollte. Als ich abgelehnt hab, haben sie gesagt, dass ich dazu verpflichtet sei. Ich hab dann langsam begriffen und denen gesagt, dass sie abhauen sollen, oder? Sie haben gemeint, dass sie wieder vorbeikommen würden. Ich hab denen immer wieder gesagt, dass das nicht nötig wäre. Nun, um es kurz zu machen, am nächsten Abend, als ich ankomme, um aufzuschließen, ich hatte gar nicht mehr an die gedacht, da merke ich, dass schon offen war, das heißt, jemand hatte die Tür aufgebrochen, und der Verstärker war hin.»
«Der Verstärker», wiederholte ich.
Meines Wissens war ein Verstärker nur irgendein Teil am Plattenspieler oder Radio, doch der junge Mann sah vollkommen niedergeschmettert aus.
«Der Verstärker für die Band», erklärte er. «Sie wissen wirklich nicht, was das ist?»
«Nein.»
Er warf einen kurzen Blick auf mich, aus dem Leid und Mitleid sprachen. Er erklärte mir, dass alle Instrumente elektrisch waren. Alle angeschlossen an einen Verstärker, der hatte verschiedene Buchsen, verschiedene Regler, ein mordsschweres riesiges Ding, und ohne konnte man nicht spielen.
«Und der war kaputt. Ich verstehe.»
«Wir haben ihn zwar gebraucht gekauft, sicher, aber der hat uns trotzdem noch fünftausend Franc gekostet.»
«Das ist ja weiter kein Drama», meinte ich.
«Neue Franc.»
«Scheiße», sagte ich.
Für einen Augenblick verharrte er in Trauer und Schweigen.
«Die Kerle sind noch am gleichen Abend wiedergekommen», fuhr er fort. «Ich versichere Ihnen, am liebsten hätte ich sie abgeballert, aber ich hab mich zurückgehalten.»
«Das haben Sie richtig gemacht», bemerkte ich.
Er knirschte mit den Zähnen, um mir zu zeigen, was für ein harter Bursche er war. Es war merkwürdig, er hätte mir eher sympathisch sein müssen, aber er nervte mich. Meine Ohren glühten.
«Sie sind sehr deutlich geworden. Fünfundzwanzig Prozent der Einnahmen wollten sie. Oder das nächste Mal wären dann nicht mehr die Verstärkerteile, sondern meine Hände dran. Ich bin der Sologitarrist.»
«Sind Sie zur Polizei gegangen?»
«Nein.»
«Darf man erfahren, warum nicht? Ich bin kein Hellseher, wissen Sie.»
«Das wird mir allmählich auch klar», meinte er. «Ich bin nicht zur Polizei gegangen, weil sonst der Club futsch wäre. Die Bullen mögen uns nicht besonders, und bei einer Ermittlung hätte es nur Scherereien gegeben, und die Kunden, meine Kumpels und so, die wären dann woanders hingegangen.»
Ist anzunehmen, dachte ich.
«Das war vor einem Monat. Gut. Sie sind nicht zur Polizei gegangen. Was ist dann passiert?»
«Ich habe bezahlt, was meinen Sie denn!»
«Und jetzt reicht es Ihnen.»
«Ja, die wollen jetzt nämlich fünfzig Prozent.»
«Die spinnen. Die werden ihren Laden kaputtmachen.»
«Die wollen mich rausdrängen, das ist alles. Um jemand anderen reinzusetzen.»
Darauf hätte ich von selbst kommen können. Ich fühlte, wie plötzlich die Wut gegen diesen jungen Typen in mir hochstieg. Ich stand auf, nahm mir das leere Glas aus dem Schubfach und schüttete es mit Ricard voll. Dann trank ich es aus. Der junge Typ sah mich finster an.
«Und Sie glauben, dass ich was für Sie tun kann?» meinte ich.
«Genau das frage ich mich gerade.»
Langsam wurde auch er bissig.
«Die Antwort lautet nämlich nein», sagte ich.
Mit einem verächtlichen Lächeln erhob er sich, warf seine Zigarette auf den Teppichfußboden und trat sie seelenruhig aus. Ich wollte mein Glas auf der Schreibtischkante abstellen, es kippte und purzelte runter, ohne zu zerbrechen, ich war mit einem Satz bei dem jungen Typen und packte ihn am Kragen. Er versuchte mich zurückzustoßen, indem er mir seine Faust in die Rippen rammte, ich versetzte ihm einen Schlag in den Magen, kurz und kräftig. Er jaulte laut auf und krümmte sich sofort zusammen. Ein Leichtgewicht. Ich schämte mich. Ich kämpfte mit ganzer Kraft gegen diese Scham an. Ich wusste nicht, wie es soweit kommen konnte.
«Du altes Arschloch, mieser Bulle!» murmelte er.
Da ich ihn immer noch am Kragen hielt, zog ich ihn hoch und stellte ihn an die Wand. Mein Mund war ganz nah an seinem Gesicht. Es war sehr blass und wie versteinert vor Schreck.
«Hör zu, Kleiner», sagte ich. «Versuch nicht zu kämpfen. Hau ab. Und damit meine ich, nicht nur aus meiner Wohnung hier. Verzieh dich aus deinem Schuppen. Verzieh dich aus der ganzen Scheiße überhaupt, verstehst du? Da ist nichts mehr zu machen. Es ist aus.»
«Sie stinken nach Alkohol», stellte er fest. «Sie sind ja stockbesoffen. Lassen Sie mich los.»
Ich ließ ihn los. Ich keuchte.
«Sie sind widerlich», meinte er ganz seelenruhig, dann ging er und machte die Tür leise hinter sich zu; ich hörte, wie er die Treppe runterstieg.
Nur ein einziges Mal in meinem Leben hatte ich mich noch schlechter gefühlt als in diesem Augenblick.
Nach dem Abgang des Jungen fing ich wirklich zu trinken an.
Ich leerte die ganze Flasche. Das, was davon noch übrig war. Natürlich wurde mir schlecht. Das schlimmste war: jedes Mal, wenn mich der Brechreiz überkam, musste ich bis zur Toilette auf dem Treppenabsatz rennen, wobei ich an den Wänden des Ganges anstieß und abprallte.
Schließlich hörte das alles auf, und ich wollte am liebsten nur noch das Bewusstsein verlieren. Ich blickte auf meine Uhr und sah, dass es noch viel früher war, als ich dachte, noch nicht einmal halb zwölf abends. Ich nahm meinen Wecker und stellte ihn auf 6.30 Uhr, klappte das Rückenteil und die Armlehnen des Sofas wieder runter und nahm die Tagesdecke ab. Ich machte die Vorhänge zu. Ich zog mich bis auf die Unterhose aus. In der Küche trank ich drei große Gläser Wasser, steuerte dann auf mein Bett zu und machte hinter mir jeweils das Licht aus, betrachtete dabei vor dem Ausmachen die Räumlichkeiten und sagte mir, dass ich sie nun zum vorletzten Mal sah. Ich legte mich hin, löschte das Licht im Vorzimmer und schlief sofort ein.
Um Mitternacht wurde ich durch eine Reihe von Klingelsalven geweckt. Genaugenommen weckte mich bereits eine davon, aber es gab eine ganze Reihe. Ich sprang hastig auf und stieß dabei das kleine Tischchen und die Vase mit dem Blumenwasser um. Ich lief zur Tür und öffnete. Im Türrahmen stand eine junge Frau, die sich in einem sichtlich aufgewühlten Zustand befand. Da ich keine Lampe angemacht hatte, befand sie sich im Gegenlicht zur gelben Treppenbeleuchtung, trotzdem konnte ich verblüffend deutlich das Weiße in ihren Augen wahrnehmen, und als sie sprach, hörte ich, dass sie mit den Zähnen klapperte.
«Monsieur Tarpon, erkennen Sie mich? Lassen Sie mich rein, ich bitte Sie, ich erkläre Ihnen alles.»
Sie schwankte und wartete meine Antwort nicht ab, stieß mich zur Seite und kam rein. Ich machte Licht. Ich merkte, dass ich in Unterhosen dastand. Das Mädchen merkte es nicht. Sie sah mich mit starren Augen an, schöne Augen übrigens, doch es war, als ob sie durch mich hindurch auf etwas stieren würde. Der Eindruck war so stark, dass ich mich automatisch umdrehte und dabei auch die Tür wieder zumachte. Ich hatte dem Mädchen also den Rücken zugedreht und konnte sein Gesicht nicht sehen, als es sagte:
«Griselda hat man die Kehle durchgeschnitten.»
3
In der Küche machte ich richtigen Kaffee in einer Steingutkanne mit einer Filtertüte. Während er durchlief, ging ich ins Zimmer zurück. Das Mädchen auf dem Boden rührte sich. Ich zog mir meine Hose und mein Hemd wieder an und streifte saubere Socken über.
«Es ist furchtbar», sagte das Mädchen. «Sie ist vollkommen ausgeblutet. Man hat ihr die Kehle durchgeschnitten.»