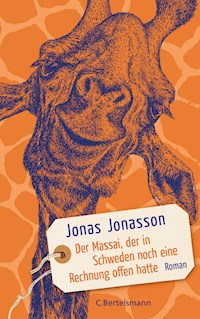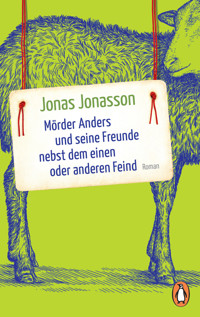9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: carl's books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Freuen Sie sich darauf, was diesem herrlich verrückten Autor für seine neue Protagonistin eingefallen ist!
Die aberwitzige Geschichte der jungen Afrikanerin Nombeko, die zwar nicht lesen kann, aber ein Rechengenie ist, fast zufällig bei der Konstruktion nuklearer Sprengköpfe mithilft und nebenbei Verhandlungen mit den Mächtigen der Welt führt. Nach einem besonders brisanten Geschäft setzt sie sich nach Schweden ab, wo ihr die große Liebe begegnet. Das bringt nicht nur ihr eigenes Leben, sondern gleich die gesamte Weltpolitik durcheinander...
Spitzzüngig und mit viel schwarzem Humor rechnet Jonasson in seinem neuesten Roman mit dem Fundamentalismus in all seinen Erscheinungsformen ab. Eine grandiose Geschichte, die dem »Hundertjährigen« an überbordenden Einfällen, skurrilen Wendungen und unvergesslichem Charme in nichts nachsteht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel Analfabetensom kunde räknaim Piratförlaget, Stockholm.
1. Auflage
Copyright © 2013 Jonas Jonasson
First published by Piratförlaget, Sweden
Published by arrangement with Pontas Literary & Film Agency, Spain
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013
bei carl’s books, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: semper smile, München nach einem Motiv von Pepin van Roojen
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-08308-3www.carlsbooks.de
Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine Analphabetin im Soweto der Siebzigerjahre aufwächst und eines Tages mit dem schwedischen König und dem Ministerpräsidenten des Landes in einem Lieferwagen sitzt, liegt bei eins zu fünfundvierzig Milliarden siebenhundertsechsundsechzig Millionen zweihundertzwölftausendachthundertzehn.
Und zwar nach den Berechnungen eben dieser Analphabetin.
1. TEIL
Der Unterschied zwischen Genialität und Dummheit ist der, dass die Genialität ihre Grenzen hat.
Unbekannter Denker
1. KAPITEL
Von einem Mädchen in einer Hütte und dem Mann, der sie nach seinem Tod da rausholte
Im Grunde hatten sie ja noch ein glückliches Los gezogen, die Latrinentonnenträger in Südafrikas größtem Slum. Sie hatten nämlich sowohl eine Arbeit als auch ein Dach über dem Kopf.
Eine Zukunft hatten sie statistisch gesehen jedoch nicht. Die meisten von ihnen sollten relativ früh an Tuberkulose, Lungenentzündung, Durchfallerkrankungen, Tabletten, Alkohol oder einer Kombination aus alldem sterben. Vereinzelte Exemplare hatten Aussichten, ihren fünfzigsten Geburtstag zu erleben. Zum Beispiel der Chef eines der Latrinenbüros von Soweto. Doch er war sowohl abgearbeitet als auch kränklich. Er hatte allzu viele Schmerztabletten mit allzu vielen Bierchen heruntergespült, und das Ganze immer allzu früh am Morgen. Infolgedessen hatte er einen Repräsentanten des Amts für sanitäre Einrichtungen von Johannesburg angefaucht. Ein Kaffer, der sich Freiheiten herausnahm! Die Sache wurde dem Abteilungsleiter in Johannesburg berichtet, der seine Mitarbeiter in der Kaffeepause am nächsten Vormittag davon unterrichtete, dass es wohl an der Zeit war, den Analphabeten in Sektor B auszutauschen.
Übrigens eine ungewöhnlich gemütliche Kaffeepause. Es gab nämlich Torte anlässlich der Willkommensfeier für den neuen Assistenten im Sanitätsamt. Er hieß Piet du Toit, war dreiundzwanzig Jahre alt und trat hier seinen ersten Job nach dem Studium an.
Der Neue musste sich auch um das Problem in Soweto kümmern, denn so handhabte man das in der Stadtverwaltung Johannesburg: Wer als Neuling anfing, wurde den Analphabeten zugeteilt, zur Abhärtung gewissermaßen.
Ob die Latrinentonnenträger von Soweto wirklich alle Analphabeten waren, wusste zwar niemand, aber man nannte sie trotzdem so. Zur Schule war jedenfalls keiner von ihnen gegangen. Und sie wohnten samt und sonders in Hütten. Und taten sich entsetzlich schwer, zu verstehen, was man ihnen sagen wollte.
* * * *
Piet du Toit war gar nicht wohl in seiner Haut. Sein erster Besuch bei den Wilden. Sein Vater, der Kunsthändler, hatte zur Sicherheit einen Leibwächter mitgeschickt.
Der Dreiundzwanzigjährige betrat das Latrinenbüro und konnte sich einen entnervten Kommentar zum Geruch nicht verkneifen. Dort, auf der anderen Seite des Schreibtischs, saß der Latrinenchef, der jetzt gegangen werden sollte. Und neben ihm ein kleines Mädchen, das zur Überraschung des Assistenten den Mund auftat und erwiderte, Scheiße habe nun mal die lästige Eigenschaft, dass sie stinke.
Piet du Toit überlegte eine Sekunde, ob das Mädchen respektlos gewesen war, aber das konnte doch eigentlich nicht sein.
Also ging er darüber hinweg. Stattdessen erklärte er dem Latrinenchef, dass er – so sei es nun mal an höherer Stelle beschlossen worden – seinen Job zwar nicht behalten, dafür aber mit drei Monatslöhnen rechnen könne, falls er im Gegenzug bis nächste Woche ebenso viele Kandidaten für seine Nachfolge präsentieren konnte.
»Kann ich nicht meine alte Stelle als Latrinentonnenträger wiederhaben und mir so ein wenig Geld verdienen?«, fragte der soeben abgesetzte Chef.
»Nein«, sagte Piet du Toit, »das kannst du nicht.«
Eine Woche später war Assistent du Toit nebst Leibwächter wieder zurück. Der abgesetzte Chef saß hinter seinem Schreibtisch, zum letzten Mal, wie man wohl annehmen durfte. Neben ihm stand dasselbe Mädchen wie zuvor.
»Wo sind Ihre drei Kandidaten?«, wollte der Assistent wissen.
Der Abgesetzte bedauerte, dass zwei von ihnen nicht anwesend sein konnten. Dem einen war am Vorabend bei einer Messerstecherei die Kehle durchgeschnitten worden. Wo sich Nummer zwei aufhielt, wusste niemand. Eventuell handelte es sich um einen Rückfall.
Piet du Toit wollte gar nicht wissen, welcher Art dieser Rückfall sein könnte. Er wollte nur so schnell wie möglich wieder hier weg.
»Und wer ist der dritte Kandidat?«, fragte er ärgerlich.
»Tja, das ist dieses Mädchen. Sie geht mir schon seit ein paar Jahren zur Hand und hilft hier aus. Und ich muss sagen, sie ist wirklich gut.«
»Ich kann doch wohl keine Zwölfjährige zur Chefin der Latrinenverwaltung machen?«, meinte Piet du Toit.
»Vierzehn«, sagte das Mädchen. »Und ich hab neun Jahre Berufserfahrung.«
Der Gestank setzte ihm von Minute zu Minute mehr zu. Piet du Toit hatte Angst, dass er sich in seinem Anzug festsetzen könnte.
»Hast du schon angefangen, Drogen zu nehmen?«, fragte er.
»Nein«, sagte das Mädchen.
»Bist du schwanger?«
»Nein«, sagte das Mädchen.
Der Assistent schwieg ein paar Sekunden. Im Grunde wollte er wirklich nicht öfter als unbedingt nötig hierherkommen.
»Wie heißt du?«, fragte er.
»Nombeko«, sagte das Mädchen.
»Nombeko und wie weiter?«
»Mayeki, glaub ich.«
Mein Gott, die kannten nicht mal ihren eigenen Namen.
»Dann kriegst du eben den Job. Wenn du es schaffst, nüchtern zu bleiben«, sagte der Assistent.
»Das schaffe ich«, sagte das Mädchen.
»Gut.«
Und damit wandte sich der Assistent an den Abgesetzten.
»Vereinbart waren drei Monatslöhne für drei Kandidaten. Macht dann also einen Monatslohn für einen Kandidaten. Abzüglich einen Monatslohn dafür, dass du es nicht fertiggebracht hast, mir etwas Besseres zu präsentieren als eine Zwölfjährige.«
»Vierzehn«, sagte das Mädchen.
Piet du Toit ging grußlos von dannen, seinen Leibwächter immer zwei Schritt hinter sich.
Das Mädchen, das gerade Chefin ihres eigenen Chefs geworden war, dankte ihm für seine Hilfe und erklärte, dass er mit sofortiger Wirkung wiedereingestellt war, als ihre rechte Hand.
»Und was ist mit Piet du Toit?«, fragte ihr ehemaliger Chef.
»Wir ändern einfach deinen Namen. Ich bin ziemlich sicher, dass der Assistent einen Neger nicht vom anderen unterscheiden kann.«
Sagte die Vierzehnjährige, die aussah wie zwölf.
* * * *
Die neu ernannte Chefin der Latrinenleerungstruppe von Sektor B in Soweto hatte nie eine Schule besucht. Das lag zum einen daran, dass ihre Mutter andere Prioritäten gesetzt hatte, zum andern aber auch an dem Umstand, dass das Mädchen ausgerechnet in Südafrika zur Welt gekommen war, und das auch noch in den frühen Sechzigern, als die politischen Machthaber die Meinung vertraten, dass Kinder von Nombekos Sorte nicht zählten. Der damalige Premierminister war berühmt für seine rhetorische Frage, warum Schwarze denn in die Schule gehen sollten, wenn sie doch sowieso nur dazu da waren, Brennholz und Wasser zu tragen.
Rein sachlich gesehen irrte er, denn Nombeko trug weder Brennholz noch Wasser, sondern Scheiße. Trotzdem gab es keinen Grund zu der Annahme, dass dieses schmächtige Mädchen eines schönen Tages mit Königen und Präsidenten verkehren würde. Oder ganze Nationen in Angst und Schrecken versetzen. Oder die Entwicklung der Weltpolitik im Allgemeinen beeinflussen.
Wenn sie nicht die gewesen wäre, die sie war.
Doch die war sie nun mal.
Unter vielem anderen war sie ein fleißiges Kind. Schon als Fünfjährige schleppte sie Latrinentonnen, die so groß waren wie sie selbst. Beim Latrinentonnenleeren verdiente sie genau so viel, wie ihre Mutter brauchte, um ihre Tochter jeden Tag bitten zu können, ihr eine Flasche Lösungsmittel zu kaufen. Ihre Mutter nahm die Flasche mit den Worten »Danke, mein liebes Mädchen« entgegen, schraubte sie auf und begann, den ewigen Schmerz zu betäuben, der darin wurzelte, dass sie weder sich selbst noch ihrem Kind eine Zukunft bieten konnte. Nombekos Vater war zwanzig Minuten nach der Befruchtung zum letzten Mal in der Nähe seiner Tochter gewesen.
Je älter Nombeko wurde, desto mehr Latrinentonnen konnte sie pro Tag leeren, und so reichte das Geld für mehr als nur Lösungsmittel. Daher konnte ihre Mutter das Lösungsmittel mit Tabletten und Alkohol ergänzen. Doch das Mädchen sah, dass es so nicht weitergehen konnte, und erklärte seiner Mutter, sie müsse sich entscheiden: entweder aufhören oder sterben.
Ihre Mutter nickte und verstand.
Die Beerdigung war gut besucht. In Soweto gab es zu dieser Zeit jede Menge Leute, die sich hauptsächlich zweierlei Beschäftigungen widmeten: sich selbst nach und nach ins Grab zu bringen oder aber denjenigen das letzte Geleit zu geben, denen das bereits gelungen war. Nombekos Mutter starb, als ihre Tochter zehn Jahre alt war, und ein Vater war, wie gesagt, nicht greifbar. Das Mädchen erwog, dort weiterzumachen, wo seine Mutter aufgehört hatte, und sich auf chemischem Wege einen permanenten Schutz vor der Wirklichkeit aufzubauen. Doch als der erste Lohn nach dem Tod der Mutter eintraf, beschloss sie, sich stattdessen etwas zu essen zu kaufen. Und als sie ihren Hunger gestillt hatte, sah sie sich um und sagte:
»Was tue ich hier?«
Gleichzeitig wurde ihr aber klar, dass sie keine unmittelbare Alternative hatte. In erster Linie verlangte der südafrikanische Arbeitsmarkt nicht nach zehnjährigen Analphabeten. In zweiter Linie eigentlich auch nicht. Außerdem gab es in diesem Teil von Soweto überhaupt keinen Arbeitsmarkt, und besonders viele Arbeitsfähige im Grunde auch nicht.
Doch die Darmentleerung funktioniert im Allgemeinen auch bei den elendesten Menschengestalten auf unserer Erde, so dass Nombeko etwas hatte, womit sie ein wenig Geld verdienen konnte. Und als ihre Mutter tot und begraben war, konnte sie den Lohn ganz für sich behalten.
Um die Zeit totzuschlagen, während sie ihre Lasten schleppte, hatte sie schon als Fünfjährige angefangen, die Tonnen zu zählen:
»Eins, zwei, drei, vier, fünf …«
Je älter sie wurde, desto schwieriger gestaltete sie ihre Übungen, damit es auch eine Herausforderung blieb:
»Fünfzehn Tonnen mal drei Touren mal sieben Träger plus einer, der rumsitzt und nichts tut, weil er zu besoffen ist … das macht … dreihundertfünfzehn.«
Nombekos Mutter hatte außerhalb des Dunstkreises ihrer Lösungsmittelflasche nicht mehr viel wahrgenommen, aber sie merkte doch, dass ihre Tochter addieren und subtrahieren konnte. Deswegen begann sie während ihres letzten Lebensjahres, sie jedes Mal zu rufen, wenn eine Lieferung Tabletten in verschiedenen Farben und Wirkstoffgraden zwischen den Hütten aufgeteilt werden musste. Eine Flasche Lösungsmittel ist eine Flasche Lösungsmittel, aber wenn Tabletten mit fünfzig, hundert, zweihundertfünfzig und fünfhundert Milligramm je nach Wunsch und Finanzkraft verteilt werden sollen – da muss man die Grundrechenarten schon ein bisschen auseinanderhalten können. Und das konnte die Zehnjährige. Und wie!
Zum Beispiel kam es vor, dass sie in der Nähe ihres Chefs war, wenn er mit seinem monatlichen Gewichts- und Mengenbericht kämpfte.
»Also fünfundneunzig mal zweiundneunzig«, murmelte er. »Wo ist der Taschenrechner?«
»Achttausendsiebenhundertvierzig«, sagte Nombeko.
»Hilf mir lieber suchen, meine Kleine.«
»Achttausendsiebenhundertvierzig«, beharrte Nombeko.
»Was redest du da?«
»Fünfundneunzig mal zweiundneunzig sind achttausendsiebenhundert …«
»Und woher willst du das wissen?«
»Tja, ich denk mir das so: fünfundneunzig sind fünf weniger als hundert, und zweiundneunzig acht weniger als hundert, und wenn man das jetzt umdreht und die Differenz jeweils von der anderen Zahl abzieht, kommt man beide Male auf siebenundachtzig. Und fünf mal acht ist vierzig. Siebenundachtzig vierzig. Achttausendsiebenhundertvierzig.«
»Warum denkst du so?«, fragte ihr verblüffter Chef.
»Weiß ich nicht«, erwiderte Nombeko. »Können wir jetzt mit unserer Arbeit weitermachen?«
An diesem Tag wurde sie zur Assistentin des Chefs befördert.
Doch die Analphabetin, die rechnen konnte, war zunehmend frustriert, weil sie nicht verstand, was die Machthaber in Johannesburg in den ganzen Dekreten schrieben, die auf dem Schreibtisch ihres Chefs landeten. Und der hatte selbst Schwierigkeiten genug mit den Buchstaben. Er buchstabierte sich durch die auf Afrikaans abgefassten Texte und blätterte parallel in einem Englischlexikon, um sich dieses Kauderwelsch wenigstens in eine Sprache zu übersetzen, die ein Mensch verstehen konnte.
»Was wollen sie denn diesmal?«, fragte Nombeko ihn manchmal.
»Dass wir die Säcke besser füllen«, antwortete ihr Chef. »Glaub ich jedenfalls. Oder dass sie vorhaben, die Waschhäuser zu schließen. Das ist ein bisschen unklar.«
Der Chef seufzte. Und seine Assistentin konnte ihm nicht helfen. Deswegen seufzte sie auch.
Doch dann geschah es zufällig, dass die dreizehnjährige Nombeko in der Umkleide der Latrinenleerer von einem schmierigen alten Mann begrapscht wurde. Der alte Schmierlappen kam allerdings nicht weit, denn das Mädchen brachte ihn flugs auf andere Gedanken, indem sie ihm eine Schere in den Oberschenkel rammte.
Am nächsten Tag suchte sie den alten Mann auf der anderen Seite der Latrinenreihe von Sektor B auf. Er saß mit einem Verband am Oberschenkel auf einem Campingstuhl vor seiner grün gestrichenen Hütte. Auf dem Schoß hatte er … Bücher?
»Was willst du hier?«, fragte er.
»Ich glaube, ich hab gestern meine Schere in Onkel Thabos Oberschenkel vergessen, und die hätte ich gern zurück.«
»Die hab ich weggeworfen«, behauptete der alte Mann.
»Dann schuldest du mir eine Schere«, sagte das Mädchen. »Wie kommt es eigentlich, dass du lesen kannst?«
Der alte Schmierlappen Thabo war halb zahnlos. Sein Oberschenkel tat ihm mächtig weh, und er verspürte wenig Lust, mit diesem bösartigen Mädchen Konversation zu betreiben. Andererseits war es das erste Mal, seit er nach Soweto gekommen war, dass sich jemand für seine Bücher zu interessieren schien. Seine ganze Hütte war voll mit Büchern, weswegen ihn seine Umgebung den Verrückten Thabo nannte. Doch das Mädchen hier hörte sich eher neidisch als höhnisch an. Vielleicht konnte er sich das ja zunutze machen?
»Wenn du ein bisschen entgegenkommend wärst und nicht so über die Maßen gewalttätig, könnte es sein, dass Onkel Thabo dir dafür seine Geschichte erzählt. Er würde dir vielleicht sogar beibringen, wie man Buchstaben und ganze Wörter entziffert. Wenn du eben, wie gesagt, ein bisschen entgegenkommend wärst.«
Nombeko hatte mitnichten vor, entgegenkommender zu dem alten Schmierlappen zu sein, als sie es tags zuvor in der Dusche gewesen war. Daher antwortete sie, dass sie glücklicherweise noch eine Schere besaß, die sie aber lieber behalten würde, als sie in Onkel Thabos anderem Oberschenkel zu versenken. Doch wenn der liebe Onkel sich gut benahm – und ihr das Lesen beibrachte –, konnte Oberschenkel Nummer zwei unversehrt bleiben.
Thabo konnte nicht so recht folgen. Hatte das Mädchen ihm gerade gedroht?
* * * *
Man sah es ihm nicht an, aber Thabo war reich.
Er wurde unter einer Plane im Hafen von Port Elizabeth in der Provinz Ostkap geboren. Als er sechs war, nahm die Polizei seine Mutter mit und brachte sie nie zurück. Sein Vater fand, dass der Junge alt genug war, um auf eigenen Beinen zu stehen, obwohl er selbst so seine Probleme damit hatte.
»Pass gut auf dich auf«, lautete die Quintessenz väterlicher Lebensweisheit. Er klopfte seinem Sohn auf die Schulter und fuhr nach Durban, um sich bei einem schlecht geplanten Bankraub erschießen zu lassen.
Der Sechsjährige stahl sich im Hafen zusammen, was er zum Überleben brauchte. Im besten Fall würde er heranwachsen und im Laufe der Jahre entweder im Gefängnis landen oder erschossen werden, wie seine Eltern.
Doch in seinem Slum wohnte seit ein paar Wochen auch ein spanischer Seemann, Koch und Dichter, der einstmals von zwölf hungrigen Matrosen über Bord geworfen worden war, die fanden, dass sie zum Mittagessen etwas zwischen die Kiefer brauchten und keine Sonette.
Der Spanier schwamm an Land, fand eine Hütte, in der er sich verkriechen konnte, und lebte seitdem für Gedichte aus eigener und fremder Feder. Als er mit der Zeit immer schlechter sah, fing er sich stracks den jungen Thabo ein und zwangsalphabetisierte ihn, wofür er ihn mit Brot entschädigte. Für noch ein bisschen mehr Brot musste der Junge dem alten Mann dann bald regelmäßig vorlesen, weil dieser inzwischen nicht nur ganz blind war, sondern auch noch halb senil und selbst nichts anderes mehr zu sich nahm als Pablo Neruda zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendbrot.
Die Matrosen hatten recht gehabt, als sie behaupteten, der Mensch könne nicht von Gedichten allein leben. Der alte Mann verhungerte nämlich, und Thabo beschloss, sämtliche Bücher von ihm zu erben. Einen anderen Anwärter gab es sowieso nicht.
Seine Lesekenntnisse ermöglichten es dem Jungen, sich mit diversen Gelegenheitsjobs im Hafen durchzuschlagen. Am Abend las er Gedichte, Romane und – vor allem Reisebeschreibungen. Als Sechzehnjähriger entdeckte er das andere Geschlecht, das zwei Jahre später auch ihn entdeckte. Denn erst als Thabo achtzehn war, fand er eine funktionierende Taktik. Sie bestand aus einem Drittel unschlagbarem Lächeln, einem Drittel erfundenen Geschichten von irgendwelchen Reiseerlebnissen, obwohl er den Kontinent bis dato nur in seiner Fantasie bereist hatte, und dazu noch einem Drittel dreisten Lügen, wie ewig seine und ihre Liebe währen würde.
Richtigen Erfolg erzielte er jedoch erst, wenn er seinem Lächeln, seinen Erzählungen und den Lügen etwas Literatur beimischte. Unter den geerbten Büchern fand er eine Übersetzung, die der spanische Seemann von Pablo Nerudas 20 Liebesgedichte und ein Lied der Verzweiflung angefertigt hatte. Das Lied der Verzweiflung riss Thabo heraus, aber die zwanzig Liebesgedichte probierte er an zwanzig verschiedenen jungen Frauen im Hafenviertel aus und konnte so neunzehn Mal Gelegenheitsliebe mitnehmen. Und es hätte auch noch ein zwanzigstes Mal geben können, wenn dieser Idiot Neruda nicht ganz am Schluss diese eine Zeile hineingemogelt hätte: »Ja, ich liebe sie nicht mehr.« Thabo merkte es erst, als es zu spät war.
Ein paar Jahre später wussten die meisten im Viertel über Thabo Bescheid, somit waren die Möglichkeiten, sich weitere literarische Erlebnisse zu verschaffen, eher begrenzt. Da half es auch nichts, dass er immer wildere Lügen von seinen angeblichen Reisen erzählte, so wilde Lügen wie seinerzeit König Leopold II. von Belgien, der behauptete, den Eingeborenen in Belgisch-Kongo ginge es gut, während er allen, die sich weigerten, kostenlos für ihn zu arbeiten, Hände und Füße abhacken ließ.
Nun ja, Thabo sollte seine Strafe bekommen (genau wie der belgische König übrigens, der erst seine Kolonie loswurde, dann sein ganzes Geld mit seinem französisch-rumänischen Lieblingsfreudenmädchen verjubelte und schließlich starb). Doch zuerst verließ er Port Elizabeth, reiste nach Norden und landete in Basutoland, wo es angeblich die Frauen mit den tollsten Kurven gab.
Dort fand er Gründe, mehrere Jahre zu bleiben, wechselte nur die Stadt, wenn die Umstände es erforderten, fand dank seiner Lese- und Schreibkenntnisse immer Arbeit und wurde schließlich sogar Chefunterhändler für alle europäischen Missionare, die Zugang zu diesem Land und seiner unaufgeklärten Bevölkerung suchten.
Der Häuptling des Basutovolkes, Seine Exzellenz Seeiso, sah nicht ein, was für einen Wert die Taufe für sein Volk haben sollte, doch er begriff durchaus, dass das Land sich von den Buren befreien musste. Als ihm die Missionare – auf Thabos Initiative – den Vorschlag machten, mit Waffen für die Erlaubnis zu bezahlen, ihre Bibeln zu verteilen, biss der Häuptling sofort an.
So kam es, dass Priester und Diakone einfielen, um das Basutovolk vom Bösen zu erlösen. Im Gepäck hatten sie Bibeln, automatische Waffen und die eine oder andere Tretmine.
Die Waffen hielten die Feinde auf Abstand, während die Bibeln von den verfrorenen Bergbewohnern verheizt wurden. Sie konnten ja doch nicht lesen. Als das den Missionaren klar wurde, änderten sie ihre Taktik und bauten innerhalb kürzester Zeit eine ganze Reihe von christlichen Tempeln.
Thabo arbeitete verschiedentlich als Pfarrersassistent an und entwickelte eine eigene Form des Handauflegens, die er selektiv und im Verborgenen praktizierte.
Doch dann ereilte ihn eine weitere Panne an der Liebesfront. Als nämlich in einem Bergdorf aufflog, dass das einzige männliche Mitglied des Kirchenchors mindestens fünf der neun jungen Mädchen ewige Treue geschworen hatte. Der englische Pastor vor Ort hatte die ganze Zeit schon geargwöhnt, dass Thabo ein falsches Spiel trieb. Singen konnte er nämlich gar nicht.
Der Pastor verständigte die Väter der fünf Mädchen, die ein traditionelles Verhör des Verdächtigen beschlossen: Thabo sollte bei Vollmond aus fünf verschiedenen Richtungen mit Speeren durchbohrt werden, während er mit nacktem Hintern in einem Ameisenhaufen saß.
Beim Warten auf den richtigen Stand des Mondes wurde Thabo in eine Hütte gesperrt, die der Pastor so lange im Auge behielt, bis er einen Sonnenstich bekam. Da ging er stattdessen an den Fluss, um ein Nilpferd zu bekehren. Vorsichtig legte der Mann dem Tier eine Hand auf das Maul und verkündete, Jesus sei bereit, ihm …
Weiter kam er nicht, denn das Nilpferd riss das Maul auf und biss ihn in der Mitte durch.
Nun, da der Pfarrer und Gefängniswärter weg war, gelang es Thabo mit Pablo Nerudas Hilfe, die weibliche Wache zu überreden, ihm aufzusperren, damit er fliehen konnte.
»Und was wird jetzt aus dir und mir?«, rief sie ihm nach, während er in die Savanne hinausrannte, so schnell ihn seine Füße trugen.
»Ja, ich liebe dich nicht mehr«, rief Thabo zurück.
Hätte man es nicht besser gewusst, man hätte meinen können, dass Thabo unter dem Schutze des Herrn stand, denn auf seinem zwanzig Kilometer langen Nachtspaziergang in die Hauptstadt Maseru begegnete er weder Löwen, Geparden oder Nashörnern noch anderem Getier. Als er am Ziel war, besorgte er sich einen Job als Berater bei Häuptling Seeiso, der ihn noch von früher kannte und wieder bei sich willkommen hieß. Der Häuptling verhandelte gerade die nationale Unabhängigkeit mit den hochnäsigen Briten, erzielte aber keine Erfolge, bis sich Thabo einschaltete und ihnen erklärte, wenn die Herrschaften weiter solche Fisimatenten machen wollten, könne Basutoland in Erwägung ziehen, sich an Joseph Mobuto in Kongo-Kinshasa zu wenden.
Die Briten erstarrten. Joseph Mobuto? Der Mann, der die Welt gerade hatte wissen lassen, dass er seinen Namen ändern wollte – in »Der Allmächtige Krieger, Der Dank Seiner Ausdauer Und Seinem Unbändigen Siegeswillen Von Sieg Zu Sieg Eilt Und Dabei Eine Feurige Spur Hinterlässt«?
»Genau der«, sagte Thabo. »Das ist sogar einer meiner engsten Freunde. Der Zeitersparnis halber sage ich Joe zu ihm.«
Die britische Delegation bat darum, sich ungestört beraten zu dürfen. Dabei einigten sie sich darauf, dass die Region eher Ruhe und Frieden brauchte als irgendeinen allmächtigen Krieger, der seinen Namen seinem völlig übersteigerten Selbstbild anpassen wollte. Die Briten kehrten an den Verhandlungstisch zurück und sagten:
»Dann nehmt das Land.«
Aus Basutoland wurde Lesotho, aus Häuptling Seeiso wurde König Moshoeshoe II., und Thabo wurde der unumstrittene Günstling des neuen Königs. Er wurde wie ein Familienmitglied behandelt und bekam eine Tüte Rohdiamanten aus der größten Mine des Landes, die ein Vermögen wert waren.
Eines Tages war er einfach verschwunden. Und er hatte bereits einen uneinholbaren Vorsprung von vierundzwanzig Stunden, als dem König dämmerte, dass sein Augenstern, seine kleine Schwester, die zierliche Prinzessin Maseeiso, schwanger war.
Wer in den Sechzigern in Südafrika schwarz, dreckig und mittlerweile fast zahnlos war, passte nicht in die Welt der Weißen. Nach dem misslichen Vorfall im ehemaligen Basutoland eilte Thabo daher weiter nach Soweto, nachdem er seinen kleinsten Diamanten beim nächstbesten Juwelier zu Geld gemacht hatte.
Dort fand er eine leere Hütte in Sektor B. Er zog ein, stopfte sich die Geldscheine in die Schuhe und vergrub ungefähr die Hälfte der Diamanten im Boden aus gestampftem Lehm. Die andere Hälfte brachte er in diversen Hohlräumen in seinem Mund unter.
Bevor er wieder anfing, so vielen Frauen wie möglich allzu viel zu versprechen, strich er seine Hütte in einem schönen Grün, denn so was imponierte den Damen. Und er kaufte Linoleum, um den Lehmboden zu bedecken.
Der Verführer war in sämtlichen Sektoren von Soweto aktiv, aber mit der Zeit ließ Thabo seinen eigenen lieber weg, denn so konnte er in den Zwischenpausen gemütlich vor seiner Hütte sitzen und lesen, ohne mehr als nötig belästigt zu werden.
Abgesehen vom Lesen und Verführen widmete er sich dem Reisen. Kreuz und quer durch Afrika, zweimal im Jahr. Das brachte ihm sowohl Lebenserfahrung ein als auch neue Bücher.
Aber er kam immer wieder zu seiner Hütte zurück, auch wenn er finanziell unabhängig war. Nicht zuletzt, weil die Hälfte seines Vermögens immer noch drei Dezimeter unter dem Linoleumboden lag. Thabos untere Zahnreihe war noch in einem zu guten Zustand, um weiteren Diamanten Platz zu bieten.
Es dauerte ein paar Jahre, bevor das Getuschel in den Hütten von Soweto begann. Wo hatte dieser Verrückte mit den Büchern eigentlich das ganze Geld her?
Um den Gerüchten nicht gar so viel Nahrung zu geben, beschloss Thabo, einen Job anzunehmen. Am nächstliegenden war es, ein paar Stunden pro Woche Latrinentonnen zu schleppen.
Unter seinen Kollegen befanden sich fast nur junge, alkoholisierte Männer ohne Zukunft. Aber auch vereinzelte Kinder. Darunter eine Dreizehnjährige, die Thabo eine Schere in den Oberschenkel rammte, bloß weil er die falsche Tür genommen hatte, als er duschen ging. Beziehungsweise eigentlich die richtige Tür. Nur das Mädchen war falsch. Viel zu jung, keine Kurven. Nichts für Thabo, außer im Notfall.
Das mit der Schere hatte ganz schön wehgetan. Und jetzt stand sie hier vor seiner Hütte und wollte, dass er ihr das Lesen beibrachte.
»Ich würde dir ja zu gerne helfen, aber leider verreise ich morgen«, sagte Thabo und dachte sich, dass es vielleicht das Klügste wäre, seine Behauptung tatsächlich wahrzumachen.
»Verreisen?« Nombeko war in den ganzen dreizehn Jahren ihres Lebens nicht aus Soweto herausgekommen. »Wohin willst du denn?«
»Nach Norden«, sagte Thabo. »Dann sehe ich weiter.«
* * * *
Während Thabos Abwesenheit wurde Nombeko ein Jahr älter und befördert. Und sie machte sich als Chefin. Dank eines sinnvollen Systems, das ihren Sektor auf der Grundlage demografischer Daten und nicht nach geografischer Größe oder Gerüchten in Bereiche einteilte, konnte die Aufstellung der Plumpsklos viel effektiver vorgenommen werden.
»Eine dreißigprozentige Verbesserung«, lobte ihr Vorgänger.
»Dreißig Komma zwei«, sagte Nombeko.
Das Angebot richtete sich nach der Nachfrage und umgekehrt, und so blieb im Budget Geld übrig für neue Waschhäuser.
Die Vierzehnjährige war unglaublich eloquent, wenn man dagegen die Sprache betrachtete, derer sich die Männer in ihrer alltäglichen Umgebung bedienten (jeder, der schon einmal ein Gespräch mit einem Latrinentonnenträger in Soweto geführt hat, weiß, dass die Hälfte seines Vokabulars nicht gedruckt und die andere Hälfte nicht mal gedacht werden dürfte). Aber es gab auch ein Radio in einer Ecke des Latrinenbüros, und von Kindesbeinen an hatte Nombeko das Gerät angestellt, sobald sie in der Nähe war. Sie stellte immer den Nachrichtensender ein und lauschte interessiert, nicht nur auf das, was da gesagt wurde, sondern auch, wie es gesagt wurde.
Das Wochenmagazin Ausblick Afrika verschaffte ihr erstmals die Erkenntnis, dass es eine Welt außerhalb von Soweto gab. Sie war nicht unbedingt schöner oder vielversprechender. Aber sie war außerhalb von Soweto.
Wie damals, als Angola gerade die Unabhängigkeit erlangt hatte. Die Freiheitspartei PLUA hatte sich mit der Freiheitspartei PCA zusammengetan, um die Freiheitspartei MPLA zu bilden, die zusammen mit den Freiheitsparteien FNLA und UNITA dafür sorgte, dass die portugiesische Regierung es bereute, diesen Teil des Kontinents überhaupt entdeckt zu haben. Eine Regierung, die es im Übrigen in den vierhundert Jahren ihrer Herrschaft nicht fertig bekommen hatte, eine einzige Universität zu bauen.
Die Analphabetin Nombeko durchblickte nicht ganz, welche Buchstabenkombination was bewirkt hatte, aber das Resultat schien doch eine Veränderung zu sein, und das war zusammen mit Essen das schönste Wort, das Nombeko kannte.
Einmal äußerte sie vor ihren Mitarbeitern laut den Gedanken, dass so eine Veränderung auch etwas für sie alle sein könnte. Doch die nörgelten nur, dass die Chefin sich jetzt auch noch hinstellte und über Politik reden wollte. Reichte es nicht, dass sie tagein, tagaus Scheiße schleppen mussten, sollten sie sich jetzt auch noch Scheiße anhören?
Als Chefin der Latrinenleerung kam Nombeko nicht darum herum, sich zum einen mit all ihren hoffnungslosen Fällen von Latrinenkollegen zu befassen, zum andern aber auch mit Assistent Piet du Toit von der Gesundheitsbehörde in Johannesburg. Als er nach ihrer Ernennung zur Chefin zum ersten Mal wieder vor Ort war, richtete er ihr aus, dass es keine vier neuen Waschhäuser geben werde, sondern bloß eines, aufgrund der schwierigen Budgetsituation. Nombeko rächte sich auf ihre eigene Weise:
»Ach, was ganz anderes: Wie beurteilt der Herr Assistent eigentlich die Entwicklung in Tansania? Steht das sozialistische Experiment von Julius Nyerere nicht kurz vorm Scheitern? Oder was meint der Herr Assistent?«
»Tansania?«
»Ja. Die Getreideunterproduktion nähert sich inzwischen fast einer Million Tonnen. Die Frage ist, was Nyerere überhaupt angefangen hätte, wenn es den internationalen Währungsfonds nicht gegeben hätte. Oder betrachtet der Herr Assistent schon den Währungsfonds an und für sich als Problem?«
Sagte das Mädchen, das nie in die Schule gegangen und niemals aus Soweto herausgekommen war. Zum Assistenten, der auf der Seite der Machthaber stand. Der eine Universität besucht hatte. Und keine Ahnung von der politischen Situation in Tansania hatte. Der Assistent war von Natur aus weiß, aber als das Mädchen nun mit dem Politisieren anfangen wollte, wurde er kreideweiß.
Piet du Toit fühlte sich von einer vierzehnjährigen Analphabetin erniedrigt. Die jetzt außerdem sein Dokument bezüglich der Sanitätsanlagen bemängelte.
»Was hat der Herr Assistent sich hierbei eigentlich gedacht?«, erkundigte sich Nombeko, die sich selbst die Zahlen beigebracht hatte. »Warum hat er die Zielvorgaben denn miteinander multipliziert?«
Eine Analphabetin, die rechnen konnte.
Er hasste sie.
Er hasste sie alle miteinander.
* * * *
Ein paar Monate später war Thabo zurück. Als Erstes musste er feststellen, dass das Mädchen mit der Schere seine Chefin geworden war. Und dass sie kein ganz so kleines Mädchen mehr war. Langsam, aber sicher bekam sie doch Kurven.
In dem fast zahnlosen alten Mann bahnte sich ein innerer Konflikt an. Einerseits meldete sich der Instinkt, sich auf sein mittlerweile ziemlich lückenhaftes Lächeln, seine Erzählkünste und Pablo Neruda zu verlassen. Andererseits war sie eben doch seine Chefin. Und dann war da ja noch die Geschichte mit der Schere.
Thabo beschloss abzuwarten, aber in Position zu gehen.
»Jetzt wird es wohl doch höchste Zeit, dass ich dir das Lesen beibringe«, meinte er.
»Super!«, sagte Nombeko. »Lass uns sofort heute nach der Arbeit anfangen. Meine Schere und ich kommen dann zu deiner Hütte.«
Thabo war als Lehrer richtig fähig. Und Nombeko eine gelehrige Schülerin. Schon am dritten Tag konnte sie das Alphabet mit einem Stöckchen in den Lehm vor Thabos Hütte malen. Ab dem fünften Tag begann sie ganze Wörter und Sätze zu buchstabieren. Erst gerieten sie ihr hauptsächlich fehlerhaft. Nach zwei Monaten hauptsächlich richtig.
In den Pausen zwischen ihren Lektionen erzählte Thabo von den Dingen, die er auf seinen Reisen erlebt hatte. Nombeko durchschaute sofort, dass er dabei zwei Teile Dichtung mit höchstens einem Teil Wahrheit mischte, aber das war ihr egal. Ihre eigene Realität war elend genug, von der Sorte brauchte sie nicht unbedingt noch mehr.
Seine letzte Reise hatte ihn nach Äthiopien geführt, um Seine Kaiserliche Majestät, den Löwen von Juda, Gottes Auserwählten, den König der Könige abzusetzen.
»Haile Selassie«, sagte Nombeko.
Thabo antwortete nicht. Er erzählte lieber, als dass er zuhörte.
Die Geschichte von diesem Kaiser, der zu Anfang noch Res Tefari hieß, woraus Rastafari wurde und daraus dann eine ganze Religion, nicht zuletzt auf den Westindischen Inseln, war so deftig, dass Thabo sie sich für den Tag aufgespart hatte, an dem er endlich einmal einen Vorstoß wagen wollte.
Der Gründer war also von seinem kaiserlichen Thron verjagt worden, und rund um den Erdball saßen verwirrte Jünger, kifften und überlegten sich dabei, wie es möglich war, dass der Messias, die Inkarnation Gottes, plötzlich abgesetzt worden war. Konnte man Gott denn absetzen?
Nombeko fragte bewusst nicht nach dem politischen Hintergrund dieser dramatischen Ereignisse. Sie war nämlich ziemlich sicher, dass Thabo keine Ahnung hatte, und wenn sie zu viele Fragen stellte, kam die Unterhaltung zum Erliegen.
»Erzähl weiter!«, bat sie stattdessen.
Thabo fand, dass sich die Sache gut anließ (so kann man sich irren). Er kam einen Schritt näher an das Mädchen heran und erzählte, wie er auf dem Heimweg in Kinshasa vorbeigefahren war, wo er Muhammad Ali vor seinem »Rumble in the Jungle« unterstützt hatte – das Schwergewichtsgipfeltreffen mit dem unbesiegbaren George Foreman.
»Mein Gott, wie spannend«, sagte Nombeko und fand, dass die Geschichte an sich es ja auch war.
Thabo lächelte sein breitestes Lächeln, und zwischen seinen verbliebenen Zähnen glitzerte es.
»Ja, eigentlich wollte ja der Unbesiegbare meine Unterstützung, aber ich spürte, dass …« Thabo hörte erst auf, als Foreman in der achten Runde k.o. war und Ali seinem lieben Freund Thabo für die unschätzbar wertvolle Hilfe gedankt hatte.
Übrigens war Alis Frau ganz entzückend.
»Alis Frau?«, fragte Nombeko. »Du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass …«
Thabo lachte, dass es in seinem Mund nur so klirrte, doch dann wurde er wieder ganz ernst und rutschte noch ein Stück näher an sie heran.
»Du bist sehr schön, Nombeko«, sagte er. »Viel schöner als Alis Frau. Was hältst du davon, wenn wir uns zusammentun? Wir könnten doch irgendwo anders hinziehen.«
Und dann legte er ihr den Arm um die Schulter.
Nombeko fand, dass sich »irgendwo anders hinziehen« wirklich wunderhübsch anhörte. Tatsächlich wäre ihr jeder Ort recht gewesen. Aber nicht mit dem alten Schmierlappen. Für heute schien die Lektion beendet zu sein. Nombeko rammte Thabo eine Schere in seinen anderen Oberschenkel und ging.
Am nächsten Tag kam sie zu Thabos Hütte und sprach ihn darauf an, dass er ohne Krankmeldung seiner Arbeit ferngeblieben war.
Thabo antwortete, er habe zu starke Schmerzen in beiden Oberschenkeln, vor allem in dem einen, und Fräulein Nombeko wisse ja sicher, worauf das zurückzuführen sei.
Ja, und es könne auch noch schlimmer wehtun, denn nächstes Mal gedenke sie die Schere weder in den einen noch in den anderen Oberschenkel zu rammen, sondern irgendwo dazwischen, wenn Onkel Thabo nicht bald mal anfing, sich anständig zu benehmen.
»Außerdem habe ich sowohl gesehen als auch gehört, was du in deinem hässlichen Mund hast. Du kannst dich drauf verlassen, dass ich es Hinz und Kunz auf die Nase binden werde, wenn du dich nicht ab sofort benimmst.«
Thabo war zu Tode erschrocken. Er wusste nur zu gut, dass er seine verbleibende Lebenszeit in Minuten zählen konnte, wenn sein Diamantenvermögen erst einmal allgemein bekannt war.
»Was willst du eigentlich von mir?«, fragte er kleinlaut.
»Ich möchte herkommen und mich durch deine Bücher buchstabieren können, ohne jeden Tag eine neue Schere mitbringen zu müssen. Für unsereinen, der ausschließlich Zähne im Mund hat und sonst gar nichts, sind Scheren nämlich teuer.«
»Kannst du nicht einfach gehen?«, fragte Thabo. »Du kriegst einen von meinen Diamanten, wenn du mich in Frieden lässt.«
Das war nicht sein erster Bestechungsversuch, aber diesmal blieb er erfolglos. Nombeko erklärte, sie erhebe keinen Anspruch auf irgendwelche Diamanten. Was ihr nicht gehörte, gehörte ihr nicht.
Viel später, in einer anderen Weltengegend, sollte sich herausstellen, dass das Leben wesentlich komplizierter war, als sie in diesem Moment dachte.
* * * *
Es war schon Ironie des Schicksals, dass Thabos Leben von zwei Frauen ein Ende gesetzt wurde. Sie waren in Portugiesisch-Ostafrika aufgewachsen und hatten ihren Lebensunterhalt damit verdient, dass sie weiße Siedler erschlugen und deren Geld stahlen. Damit kamen sie so lange durch, wie der Bürgerkrieg anhielt.
Doch als das Land seine Unabhängigkeit erklärte und seinen Namen in Mosambik änderte, bekamen die Siedler, die immer noch im Lande waren, achtundvierzig Stunden, um das Land zu verlassen. Danach blieb den Frauen nichts anderes übrig, als sich aufs Erschlagen wohlhabender Schwarzer zu verlegen. Eine wesentlich schlechtere Geschäftsidee, denn alle Schwarzen, die überhaupt etwas Stehlenswertes besaßen, gehörten zur nun regierenden marxistisch-leninistischen Partei. Daher dauerte es nicht lange und die Frauen waren zur Fahndung ausgeschrieben und wurden von der gefürchteten Polizei des neuen Staates gejagt.
Deswegen waren sie Richtung Süden gezogen und hatten ihren Weg in das wunderbare Versteck Soweto in der Nähe von Johannesburg gefunden.
Der Vorteil von Südafrikas größtem Elendsviertel war, dass man in der Masse untertauchte (wenn man denn schwarz war), der Nachteil jedoch der, dass noch der schlichteste weiße Bauer in Portugiesisch-Ostafrika mehr besaß als sämtliche achthunderttausend Einwohner von Soweto zusammengenommen (Thabo mal nicht mitgerechnet). Die Frauen warfen trotzdem ein paar bunte Pillen ein und gingen auf Mordtour. Nach einer Weile fanden sie den Sektor B, und dort, hinter der Latrinenreihe, erspähten sie eine grün gestrichene Hütte zwischen den übrigen rostbraungrauen. Wer seine Hütte grün anmalt (oder in irgendeiner anderen beliebigen Farbe), hat doch garantiert mehr Geld, als ihm guttut, dachten die Frauen, brachen mitten in der Nacht ein, rammten Thabo ein Messer in die Brust und drehten es um. So wurde dem Mann, der so viele Herzen gebrochen hatte, sein eigenes in Stücke geschnitten.
Als er tot war, stöberten die Frauen zwischen all den verfluchten Bücherstapeln nach seinem Geld. Was hatten sie da denn für einen Trottel umgebracht?
Am Ende fanden sie auf jeden Fall ein Bündel Geldscheine im einen Schuh des Opfers, und noch eins im anderen. Unvernünftigerweise setzten sie sich vor die Hütte, um es aufzuteilen. Doch der Tablettencocktail, den die Frauen mit einem halben Glas Rum runtergespült hatten, bewirkte, dass sie jeden Begriff von Zeit und Raum verloren. Und so saßen sie immer noch dort, beide mit einem Grinsen auf den Lippen, als überraschenderweise tatsächlich mal die Polizei auftauchte.
Sie verhaftete die beiden Frauen, die daraufhin zu einem dreißigjährigen Kostenfaktor im südafrikanischen Justizvollzug wurden. Die Geldscheine, die sie zu zählen versucht hatten, lösten sich gleich zu Anfang der polizeilichen Ermittlungen in Luft auf. Thabos Leiche blieb bis zum nächsten Tag liegen. Im südafrikanischen Polizeikorps war es ein beliebter Sport, es möglichst der nächsten Schicht zu überlassen, sich um einen toten Neger zu kümmern.
Nombeko war schon in der Nacht vom Lärm auf der anderen Seite der Latrinenreihe wach geworden. Sie zog sich an, ging hinüber und erfasste in etwa, was geschehen war.
Als die Polizei mit den Mörderinnen und Thabos ganzem Geld verschwunden war, ging Nombeko in seine Hütte.
»Du warst ein grässlicher Mensch, aber du konntest unterhaltsame Lügen erzählen. Du wirst mir fehlen. Oder zumindest deine Bücher.«
Daraufhin machte sie Thabo den Mund auf und holte vierzehn ungeschliffene Diamanten heraus, genau die Anzahl, die in seinen Zahnlücken Platz gefunden hatte.
»Vierzehn Lücken, vierzehn Diamanten«, sagte Nombeko. »Ging genau auf, was?«
Thabo antwortete nicht. Doch Nombeko entfernte das Linoleum und begann zu graben.
»Hab ich’s mir doch gedacht«, sagte sie, als sie fand, was sie gesucht hatte.
Dann holte sie Wasser und einen Lappen und wusch Thabo, zog ihn aus der Hütte und opferte ihr einziges weißes Laken, um seinen Leichnam zu bedecken. Ein bisschen Würde verdiente er trotz allem. Viel nicht. Aber ein bisschen.
Nombeko nähte Thabos sämtliche Diamanten sofort in den Saum ihrer einzigen Jacke ein, ehe sie nach Hause ging und sich wieder schlafen legte.
Die Latrinenchefin erteilte sich selbst die Erlaubnis, am nächsten Morgen auszuschlafen. Als sie das Büro zu später Stunde betrat, waren schon alle Latrinentonnenträger da. In Abwesenheit der Chefin waren sie inzwischen bei ihrem dritten Vormittagsbierchen und hatten seit dem zweiten die Arbeit ruhen lassen, zugunsten einer Diskussion der Frage, warum die Inder eine unterlegene Rasse waren. Der großmäuligste von ihnen erzählte gerade die Geschichte von dem Inder, der versucht hatte, ein Leck in seinem Hüttendach mit Wellpappe zu flicken.
Nombeko unterbrach die Männer, sammelte alle noch nicht geleerten Bierflaschen ein und erklärte, sie habe den Verdacht, dass ihre Kollegen nichts anderes im Kopf hatten als den Inhalt der Latrinentonnen, die zu leeren ihre Aufgabe war. Waren sie wirklich zu dumm, um zu begreifen, dass Dummheit ein rassenübergreifendes Phänomen war?
Das Großmaul erwiderte, die Chefin könne wohl nicht verstehen, dass man nach den ersten fünfundsiebzig Tonnen am Morgen in aller Ruhe ein Bierchen trinken wolle, ohne sich dabei irgendwelches Gefasel anhören zu müssen, wie wahnsinnig gleich und gleichberechtigt die Menschen doch sind.
Nombeko erwog, ihm zur Antwort eine Klopapierrolle an den Schädel zu werfen, kam jedoch zu dem Schluss, dass es schade um die Rolle gewesen wäre. Stattdessen befahl sie, die Arbeit wieder aufzunehmen.
Dann ging sie nach Hause in ihre Hütte. Und sagte sich einmal wieder:
»Was tue ich hier?«
Am nächsten Tag war ihr fünfzehnter Geburtstag.
* * * *
An ihrem fünfzehnten Geburtstag hatte Nombeko ein seit Langem angesetztes Budgetgespräch mit Piet du Toit vom Sanitätsamt der Stadtverwaltung von Johannesburg. Diesmal war er besser vorbereitet und war die Zahlen genau durchgegangen. Jetzt würde er es dieser Zwölfjährigen aber zeigen.
»Sektor B hat das Budget um elf Prozent überschritten«, sagte Piet du Toit und sah Nombeko über den Rand seiner Brille an, die er eigentlich nicht brauchte, die ihn aber ein bisschen älter aussehen ließ.
»Das hat Sektor B ganz bestimmt nicht«, sagte Nombeko.
»Wenn ich sage, dass Sektor B das Budget um elf Prozent überschritten hat, dann ist das so«, sagte Piet du Toit.
»Und wenn ich sage, dass Piet du Toit so rechnet, wie es seinem Verstand entspricht, dann ist das auch so. Geben Sie mir ein paar Sekunden«, sagte Nombeko, riss Piet du Toit seine Kalkulation aus der Hand, überflog die Zahlen, zeigte auf Zeile zwanzig und sagte:
»Den Rabatt, den ich ausgehandelt hatte, haben wir in Form von Bonuslieferungen bekommen. Wenn Sie den somit herabgesetzten De-facto-Preis berechnen und nicht einen fiktiven Listenpreis, werden Sie feststellen, dass Ihre elf Phantomprozent nicht mehr existieren. Außerdem hat er plus und minus verwechselt. Wenn wir rechnen würden, wie es der Herr Assistent will, dann hätten wir das Budget um elf Prozent unterschritten. Was übrigens genauso falsch wäre.«
Piet du Toit wurde rot. Kapierte dieses Mädchen nicht, wo ihr Platz war? Wo käme man denn da hin, wenn jeder x-Beliebige entscheiden könnte, was richtig und was falsch ist? Also sagte er:
»Wir haben im Büro schon mehrfach über dich gesprochen.«
»Aha«, sagte Nombeko.
»Wir finden die Zusammenarbeit mit dir sehr anstrengend.«
Nombeko begriff, dass sie auf dem besten Wege war, hinausgeworfen zu werden wie ihr Vorgänger.
»Aha«, sagte sie.
»Ich befürchte, wir müssen dich versetzen. Zurück in die normale Truppe.«
Das war ja tatsächlich noch besser als das, was ihrem Vorgänger angeboten worden war. Nombeko dachte sich, dass der Assistent heute wohl richtig gut gelaunt sein musste.
»Aha«, sagte sie.
»Ist ›aha‹ das Einzige, was du zu sagen hast?«, fragte Piet du Toit verärgert.
»Na ja, ich könnte natürlich versuchen, Herrn du Toit zu erklären, was für ein Idiot Herr du Toit ist, aber es wäre wohl vergebliche Liebesmüh, das habe ich in meinen Jahren unter den Latrinentonnenträgern gelernt. Denn hier gibt es auch Idioten, müssen Sie wissen. Am besten geh ich einfach, dann muss ich den Herrn du Toit nicht mehr sehen«, sagte Nombeko und ließ ihren Worten Taten folgen.
Das alles hatte sie in so einem Tempo vorgebracht, dass Piet du Toit erst reagieren konnte, als das Mädchen schon entwischt war. Und der Gedanke, ihr zwischen die Hütten nachzulaufen, verbot sich von selbst. Wenn es nach ihm ging, konnte sie sich dort im Müll verstecken, bis Tuberkulose, Drogen oder einer der anderen Analphabeten ihrem Leben ein Ende machten.
»Pfui«, sagte Piet du Toit und nickte der Leibwache zu, die ihm sein Vater bezahlte.
Höchste Zeit, wieder in die Zivilisation zurückzukehren.
Mit diesem Gespräch war sie natürlich nicht nur ihre Chefposition los, sondern auch den Job, mit dem sie ihren Lebensunterhalt verdiente. Und ihr letztes Gehalt würde sie auch nicht mehr bekommen.
Der Rucksack mit ihren unbedeutenden Habseligkeiten war gepackt. Einmal Kleider zum Wechseln, drei von Thabos Büchern und die zwanzig Stangen Antilopen-Trockenfleisch, die sie gerade von ihrem letzten Geld gekauft hatte.
Die Bücher hatte sie schon gelesen, und sie kannte sie auswendig. Doch Bücher hatten einfach etwas Sympathisches, ihre bloße Existenz war erfreulich. Es war fast wie mit den Latrinentonnenträgern. Bloß umgekehrt.
Es war Abend, die Luft war kühl. Nombeko zog ihre einzige Jacke an. Legte sich auf ihre einzige Matratze und deckte sich mit ihrer einzigen Decke zu (ihr einziges Laken war gerade als Leichentuch draufgegangen). Am nächsten Morgen würde sie von hier fortgehen.
Und plötzlich wusste sie auch, wohin.
Am Vortag hatte sie davon in der Zeitung gelesen. Sie würde in die Andries Street 75 in Pretoria fahren.
In die Nationalbibliothek.
Soweit sie wusste, war Schwarzen der Zutritt nicht verboten, mit etwas Glück würde sie also hineinkommen. Was sie dann machen konnte, außer zu atmen und die Aussicht zu genießen, wusste sie nicht. Aber das reichte ja schon mal für den Anfang. Und sie spürte, dass die Literatur ihr dann schon den weiteren Weg weisen würde.
Mit dieser Gewissheit schlief sie zum letzten Mal in der Hütte ein, die sie fünf Jahre zuvor von ihrer Mutter geerbt hatte. Und sie tat es mit einem Lächeln.
Und das war etwas ganz Neues.
Als der Morgen dämmerte, brach sie auf. Es war nicht gerade eine kurze Strecke, die vor ihr lag. Der erste Spaziergang ihres Lebens außerhalb von Soweto sollte ein neunzig Kilometer langer werden.
Nach knapp sechs Stunden – und sechsundzwanzig der neunzig Kilometer – war Nombeko im Zentrum von Johannesburg angekommen. Das war eine ganz andere Welt! Allein die Tatsache, dass die meisten rundherum weiß waren und eine schlagende Ähnlichkeit mit Piet du Toit besaßen, war bemerkenswert. Interessiert sah Nombeko sich um. Neonschilder, Ampeln und allgemeiner Lärm. Und blitzblanke neue Autos, Modelle, die sie noch nie gesehen hatte.
Als sie sich halb umdrehte, um mehr zu sehen, sah sie, dass eines dieser Autos mit vollem Tempo auf dem Gehweg auf sie zufuhr.
Nomeko konnte noch denken, dass es wirklich ein sehr schönes Auto war.
Aber ausweichen konnte sie nicht mehr.
* * * *
Ingenieur Engelbrecht van der Westhuizen hatte den Nachmittag in der Bar des Hilton Plaza Hotel in der Quartz Street verbracht. Jetzt setzte er sich in seinen neuen Opel Admiral und fuhr Richtung Norden.
Aber es ist und war noch nie leicht, mit einem Liter Kognak im Leib Auto zu fahren. Der Ingenieur kam nur bis zur nächsten Kreuzung, dann schlingerte er mit seinem Opel aufs Trottoir, und – verdammich aber auch! – hatte er da gerade einen Kaffer überfahren?
Das Mädchen unter dem Auto des Ingenieurs hieß Nombeko und war ehemalige Latrinentonnenträgerin. Fünfzehn Jahre und einen Tag zuvor war sie in einer Blechhütte im größten Slum Südafrikas zur Welt gekommen. Umgeben von Alkohol, Lösungsmittel und Tabletten bestanden ihre Aussichten darin, eine Weile im Lehm zwischen den Latrinen von Sowetos Sektor B zu leben und dann zu sterben.
Ausgerechnet Nombeko war ausgebrochen. Sie hatte ihre Hütte zum ersten und letzten Mal verlassen.
Und dann kam sie nur bis ins Zentrum von Johannesburg, wo sie völlig kaputt unter einem Opel Admiral liegen blieb.
»War das etwa schon alles?«, dachte sie, bevor sie in die Bewusstlosigkeit sank.
Aber das war noch nicht alles.
2. KAPITEL
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!