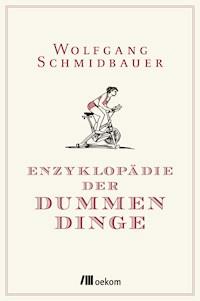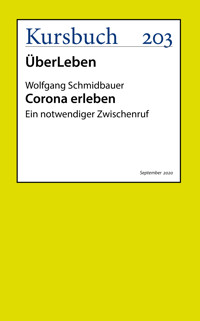9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«‹Die Angst vor Nähe› ist ein anregendes, manchmal aufregendes Buch. So wie Schmidbauer die Muster unserer Beziehungen aufdeckt, können viele Leser sich selbst und ihr zwanghaftes Verhalten, den Partner nach dem eigenen Bild umformen zu wollen, wiedererkennen. Schmidbauer ist auf der Suche nach den einfachen Gefühlen: nach der Fähigkeit, sich einem anderen zu öffnen und seine Andersartigkeit anzunehmen …» (WDR 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Wolfgang Schmidbauer
Die Angst vor Nähe
Über dieses Buch
«‹Die Angst vor Nähe› ist ein anregendes, manchmal aufregendes Buch. So wie Schmidbauer die Muster unserer Beziehungen aufdeckt, können viele Leser sich selbst und ihr zwanghaftes Verhalten, den Partner nach dem eigenen Bild umformen zu wollen, wiedererkennen. Schmidbauer ist auf der Suche nach den einfachen Gefühlen: nach der Fähigkeit, sich einem anderen zu öffnen und seine Andersartigkeit anzunehmen …» (WDR 2)
Vita
Wolfgang Schmidbauer wurde 1941 geboren. 1966 promovierte er im Fach Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München über «Mythos und Psychologie». Er lebt in München und Dießen am Ammersee, hat drei erwachsene Töchter und arbeitet als Psychoanalytiker in privater Praxis.
Neben Sachbüchern, von denen einige Bestseller wurden, hat er auch eine Reihe von Erzählungen, Romanen und Berichten über Kindheits- und Jugenderlebnisse geschrieben. Er ist Kolumnist und schreibt regelmäßig für Fach- und Publikumszeitschriften.
Außerdem ist er Mitbegründer der Münchner Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse und der Gesellschaft für analytische Gruppendynamik.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2023
Copyright © 1985 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlag-Konzept any.way, Hamburg
Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung clu Creative/Getty Images
ISBN 978-3-644-01060-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Einleitung
1 Der Kampf um Nähe
2 Wartezeiten
3 Der überoptimale Geliebte
4 Die Vermeidung von Abhängigkeit
5 Über Anpassung und Liebe
6 Die Strategie der Symbiose
7 Schatten auf dem Kompaß
8 Die Technik und das Gefühl
Die Regelung des Wandelbaren
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Liebes- Wirtschaft
9 Die Heilkraft der Trauer
10 Die Magie der Erwartung
11 Der Normenkrieg
Formen des Harmoniestrebens
12 Verleugnung und Lüge
13 Der Therapeut und die Näheangst
Die Überwindung des Leistungsdenkens
Die liebevolle Trennung
Einzel- oder Gruppentherapie?
Die Gefahren der Spaltung
14 Näheangst und gesellschaftliche Entwicklung
Ersatz für Nähe
Die Näheangst und der Märchenprinz
Das Streben nach Leistung und Kontrolle
Die Sehnsucht nach Gleichheit
Die Angst vor Verschiedenheit
Das zerbrechliche Bild
Die vermiedene Trauer
Die Satire
Nachwort zur Auflage 2004
Register
Vorwort
Go away from my window,
go at your own chosen speed.
I am not the one you want, babe.
I am not the one you need.
You say you are looking for someone
never weak but always strong,
to protect you and defend you
whether you are right or wrong,
someone to open each and every door.
But it ain’t me, babe,
no, no, no it ain’t me, babe,
it ain’t me you are looking for, babe.[1]
Bob Dylan
Der Song von Bob Dylan drückt etwas aus, was man in einer Abwandlung des Goetheschen «Zeitgeists» ein Zeitgefühl nennen könnte. Der Sänger von 1968 wird zu einem Gegentyp des schmachtenden Don Juan, der unter dem Balkon seiner Angebeteten ein Liebeslied singt:
«Deh! vieni alla finestra, o mio tesoro
Deh, vieni a consolar il pianto mio.
Se neghi a me di dar qualche ristoro,
Davanti agli occhi tuoi morir vogl’ io.[2]
Der Liebhaber mit der Mandoline, der nur darauf wartet, die Geliebte in seine Arme zu schließen – und auf der anderen Seite der Mann, der eine Frau von seinem Fenster wegschickt, weil er das Empfinden hat, er könne nie und nimmer ihren Ansprüchen gerecht werden. In ihm erstarrt alles zu Stein, wenn er eben jenes Leuchten in den Augen einer Frau sieht, das Don Giovanni mit allem Schmelz seiner Stimme zu entzünden sucht.
Man mag antworten, daß dem von seinen Groupies umschwärmten Star in den Schoß fällt, wofür Don Giovanni hart arbeiten muß. Kein Wunder, daß Bob Dylan Mauern aufrichtet, wo Don Giovanni sich bemüht, Hindernisse zu überwinden. Aber damit ist noch nicht erklärt, wie der Rückzug aus den intimen Beziehungen zustande kommt, der zu einem so verbreiteten Phänomen geworden ist. Die Zahl der Familien ist – um nur ein Beispiel zu nennen – in Bayern seit 1972 um 19 Prozent zurückgegangen. Familien mit Kindern sind sogar um 30 Prozent seltener geworden. Während sich 1960 nur 6944 Ehepaare scheiden ließen, waren es 1982116538 und 1992135010. Der Weg zur kalifornischen Scheidungsquote von zwei Dritteln aller geschlossenen Ehen ist nicht mehr weit. Die Appelle der Familienminister werden ihn nicht beeinflussen. Die stärkste Zunahme zeigt die Zahl der Ein-Personen-Haushalte: Sie stieg in den letzten zehn Jahren in Bayern um 37 Prozent auf über eine Millionen Menschen. In Deutschland waren es 1992 über zwölf Millionen Singles.
Aus solchen Entwicklungen läßt sich ein ähnlicher Trend hochrechnen wie aus dem Ansteigen der Alkoholiker in der Bevölkerung. Wenn es so weitergeht, dann dauert es noch gut hundert Jahre, und die eine Hälfte der Menschen in diesem Land besteht aus Singles, die andere aus Trinkern; nicht wenige sind beides zusammen. Solche Prognosen unterstreichen freilieh eher ein gegenwärtiges Problem, als uns Aufschluß über die Zukunft zu geben. Zudem bleiben sie abstrakt. Die Vielfalt einzelner Schicksale, die verwickelten Motive, aus denen Menschen allein leben oder sich in einer Fassaden-Beziehung allein fühlen, bleibt außerhalb der Überlegung.
Ich will in diesem Buch die Angst vor Nähe als individuelles und als gesellschaftliches Problem untersuchen. Sie soll aus dem üblichen Schema – «die Männer halten eben den emotionalen Ansprüchen der emanzipierten Frauen nicht stand» – befreit werden, ohne daß der Bezug zum persönlichen Schicksal verlorengeht. Nähe ist das, was zwischen Menschen entsteht, die beisammen sind und nichts gegen sie tun. Das heißt: sie ist ganz einfach. Die Vermeidung von Nähe hingegen setzt hochentwikkelte innerseelische und parallel dazu gesellschaftliche Strukturen voraus. Die Darstellung verleugnet nicht, daß meine Erfahrungsbasis die Praxis der psychoanalytischen Arbeit ist. Ich will Zusammenhänge verdeutlichen, indem ich sie immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachte und an neuem Material beschreibe. Der fruchtlose Verschiebebahnhof von «die Eltern sind schuld» zu «die Gesellschaft ist schuld» zu «die Männer sind schuld» soll stillgelegt werden zugunsten einer Denkpause, in der eine Weile keiner schuld ist und alle beteiligt.
Widmen möchte ich das Buch jenen Menschen, die mit mir über ihre Lebensgeschichte und ihre Beziehungsschwierigkeiten gesprochen haben. Ohne sie wäre es nicht möglich. Ich wünsche mir von ihnen, daß sie mir verzeihen, wenn sie nicht gut finden, was sie jetzt über sich lesen. Eine schriftliche Darstellung verliert viele Einzelheiten, die in einer persönlichen Beziehung unentbehrlich sind. Sie wirkt kälter, zumal ich meiner Neigung zur Ironie die Zügel schießen lasse, wenn ich schreibe. Ich hoffe, daß die Betroffenen an das Wohlwollen meiner Absichten glauben, auch wenn sie mit Einzelheiten unzufrieden sind.
W.S.
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Es hat mich sehr gefreut, daß dieses Buch soviel Aufmerksamkeit gefunden hat. Ich habe den Text noch einmal überarbeitet, Satzfehler und stilistische Mängel verbessert. Ich bedanke mich noch einmal an dieser Stelle für Lob und Ermutigung von seiten vieler Leserinnen und Leser, die mir geschrieben haben.
Juli 1997 W.S.
Einleitung
Die Liebe vom Zigeuner stammt …
liebst du mich nicht,
bin ich entbrannt.
Bizet, Carmen
Man begegnet oft Menschen, die einsam sind und darunter leiden. Dem Außenstehenden scheinen sie anziehend. Er kann das Rätsel nicht lösen, warum dieser Mann oder diese Frau ohne feste Bindung lebt und darüber unglücklich ist. Wer sie näher kennenlernt, entdeckt bald, daß eine seltsame Schicksalsmacht ihr Leben zu bestimmen scheint. Sie können mögliche Partner, die sie begehren und mit ihnen leben wollen, nicht lieben. Hingegen beschäftigen sie sich mit Hingebung und großem Kraftaufwand mit Personen, die sie auf Abstand halten, eine gemeinsame Zukunft nur als vages Versprechen, als abgehobene Phantasie anbieten, jedoch im Alltag eindeutig keine feste Gemeinsamkeit wollen. Wie im klassischen Ballett intime Berührungen trotz großer Harmonie der Bewegungen ausbleiben, scheint der immer wieder gefundene Abstand durch geheimes Einverständnis geschaffen. Eine Frau hat aus einer früheren Beziehung eines oder mehrere Kinder. Ein Mann ist verheiratet. Beide stellen dritte Personen wie eine isolierende Schicht zwischen sich und die mögliche Bindung. In anderen Fällen ist es der Beruf, der so viel Zeit und Aufmerksamkeit erfordert, daß für die persönlichen Beziehungen scheinbar nicht Zeit und Kraft genug übrigbleiben. Eine geplante Weltreise (die nie angetreten wird), Drogenprobleme, Sport, eine Weiterbildung und selbst eine Psychoanalyse werden als Gründe verwendet, um Beziehungen auf Abstand zu halten, Nähe zu verweigern.
Genauere Betrachtung mag diese Gründe als Vorwände entlarven. In die Enge getrieben, gibt der Betroffene endlich zu, daß er «Angst vor Nähe» hat. Dieser Ausdruck ist in der psychologisch aufgeklärten Mittelschicht durchaus üblich. Begriffe wie «der schizoide Charakter» sollen ihn verdeutlichen. Viel gewonnen ist damit nicht. Den schizoiden Charakter zeichnet eben seine Angst vor Nähe aus.
Die hier beschriebene Angst vor Nähe hat mit einer anderen Schwierigkeit zu tun, die oft in Beziehungen auftaucht. Gemeint ist jene Situation, in der zwei Menschen zusammen leben und nach außen als fest verbundene Partner auftreten. Sie streiten sich darüber aber fast jeden Tag, wobei häufig die Drohung laut wird, sich zu trennen. Sie steigert sich gelegentlich zu der Aussage, es sei viel besser, wenn man den Partner nie kennengelernt hätte. Weil aber über die Trennung ebensowenig Einverständnis hergestellt werden kann wie über die Bindung, muß weiter gestritten werden. In vielen Fällen ist die Trennung nicht Teil der offenen Auseinandersetzung, spielt aber in der Phantasie eine wichtige Rolle. Einer der Partner zieht sich zurück und stellt sich vor, wie gut es wäre, wenn er endlich frei sein könnte, unbelastet vom Partner.
Wie kommt es, daß sich Menschen so quälen und sich doch nicht trennen oder - wie im ersten Fall – binden? Daß die ersehnte Geborgenheit unerreichbar bleibt, die Beziehungen nur Mühe, Enttäuschung, vergebliche Leistung zu enthalten scheinen? Ich vermute, daß die Ursachen tiefer reichen als in kindliche Schicksale. Wenn Eltern ihre Kinder nicht als ganze Personen annehmen können, sondern nur als funktionierende Teile einer Familienmaschine, die Teil der großen gesellschaftlichen Maschine ist, dann halte ich es für kurzsichtig, sich mit einer Analyse dieser Familienmuster zufriedenzugeben. Sie sind sehr wichtig, weil sich in ihnen der abstrakte, so oft als vage Ausrede verwendete Aspekt einer «Schuld der Gesellschaft» unmittelbar und sinnlich fassen läßt. Aber das Familienmodell von Beziehungsstörungen ist gefährlich. Es täuscht Täter und Ursachen vor, wo nur Opfer und Zwischenglieder am Werk waren. Es weckt therapeutische Hoffnungen, die durch einen kurzen Blick auf die Beziehungen der Therapeuten selbst auf ein realistisches Maß zurückgerückt werden müssen. Eheberater und Familientherapeuten geben manchmal vor, sie könnten «Beziehungsprobleme lösen», wo sie doch im besten Fall erreichen, daß die Partner mit diesen Problemen leben können. Freud hat von dem «gewachsenen Fels» gesprochen, an dem die analytischen Grabinstrumente nicht weiterkommen.[3]
Mir scheint, daß das biologische Modell Freuds ebenso wie das Familienmodell der neueren Psychotherapieformen mit einem grundlegenden Vorgang der Industrialisierung verglichen werden muß: Natur, auch menschliche Natur wird zum Gegenstand technischer Bewältigung. Die Folgen sind durch psychoanalytisches Eingreifen oft nicht mehr veränderbar. Das eine «biologische» Ursache zu nennen, schreibt das Leiden der Betroffenen ihrer Natur zu, nicht dem verstümmelnden Einfluß, welcher Frauen und Männer in Wut, Angst und gegenseitigen Neid treibt. Die Aufblähung und Überschätzung der intimen und persönlichen Liebe zwischen zwei Menschen mag dann zu einem ebenso guten Heilmittel werden wie die Inflation des Geldes in den Industriegesellschaften.
Zu Beginn der Industrialisierung haben kritische Beobachter mit Entsetzen gesehen, wie Menschen zu Rädchen im Getriebe großer Maschinen wurden, auswechselbar, in ihrer Funktion festgelegt. Diese Maschinen sind durch das Entsetzen, durch die Suche nach Erklärungen und durch das Streben nach Veränderung bisher kaum menschlicher geworden. Im Gegenteil: Manches spricht dafür, daß sie immer größer, immer mächtiger werden, daß sie die Freizeit erfassen und die Netze der Hardware durch jene der Software erweitern. Pflanzer kolonisieren den Urwald, Missionare die Indianer, Pädagogen die Kindheit und Psychotherapeuten die Intimsphäre.
Ich möchte zeigen, wie die Angst vor Nähe zwangsläufig entstehen muß, wenn die Anpassung an technische Zwecke wichtiger wird als die natürliche Vielfalt von Gefühlen und Beziehungen. Sobald die öffentlichen Umgangsformen zur Fassade oder zum Konsum von Schau-Emotionen erstarren, kann die zwischenmenschliche Liebe die Last nicht mehr tragen, welche die entmutigten, verstümmelten einzelnen ihr aufbürden. Der an die Maschine Angepaßte ist ernsthaft behindert, aktiv zu lieben. Desto mehr will er geliebt werden. Sein Partner ist oft ebenso angepaßt, ebenso passiv bedürftig. So klammern sich zwei Schwimmer aneinander, von denen jeder glaubt, daß er ohne die Hilfe des anderen ertrinken muß. Wieviel auch der Maschine geopfert werden mußte – der Partner soll dafür entschädigen. In die Armut der Freizeit soll er Reichtum bringen. Er soll das eigene Leid an der Wirklichkeit einfühlend begleiten. Ich biete mich dir zu Kolonisation, zur Ausbeutung an – wenn du mir versprichst, daß auch ich dich kolonisieren und ausbeuten darf! Kein Wunder, daß es schon zum Sprachgebrauch gehört, «in eine Beziehung zu investieren», daß «die Beziehung gut funktioniert» oder «wieder nicht klappt».
Ich will versuchen, diese Andeutungen im folgenden durch Beispiele zu belegen und theoretisch zu vertiefen. Meine Methode ist dabei psychoanalytisch im klassischen Sinn. Die genial einfache Idee Freuds, seelisch gestörte Menschen alles sagen zu lassen, was ihnen in den Sinn kommt, hat bis heute nichts von ihrer Faszination und Gültigkeit verloren. Ich sehe die Psychoanalyse als qualitative Sozialforschung. Weit mehr als bezahlte oder anders für Forschungsinteressen gewonnene Menschen sind die Klienten des Psychotherapeuten bereit, sich über die Hintergründe ihrer Erlebnisse und Verhaltensweisen Gedanken zu machen, über ihre Einfälle zu sprechen. Meine Fallbeispiele sind durch die Änderung persönlicher Daten, durch Verdichtungen und Auslassungen verschlüsselt. An die Stelle der maschinenmäßigen Objektivität der quantitativen Forschung versuche ich eine an der Beziehung zwischen Untersucher und Untersuchungsgegenstand, Analytiker und Klient orientierte Betrachtung zu setzen. Es geht also auch darum, meine eigenen Gefühle, meine Gegenübertragung mit einzubeziehen. Das heißt keineswegs, daß ich die Leistungen der quantitativen Forschung in der Psychologie geringschätze. Ich finde es wichtig, ihre Inhalte und Grenzen zu kennen, um zu wissen, wann ich in tiefes Wasser gerate.
1Der Kampf um Nähe
Ich brauche nicht die Hoffnung um zu beginnen, noch den Erfolg, um fortzufahren.
Wilhelm von Oranien zugeschrieben
Das Zitat ist kriegerisch, das Bild der Kämpfer ist es oft auch. Das angestrebte Ziel sind Friede und Harmonie. Es bleibt unerreichbar, scheint sich wie die trügerischen Luftspiegelungen in der Wüste in nichts aufzulösen, wenn man erwartet, es mit einer letzten Anstrengung zu erreichen. «Beziehungsschwierigkeiten» sind sicherlich der häufigste Anlaß geworden, psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Sie treten in den Diagnosen zurück, weil es sich um keine Krankheit im Sinn der Reichsversicherungsordnung handelt. Wer genauer untersucht, was die Depression, die Angstzustände oder die psychosomatischen Leiden ausgelöst hat, findet fast immer Einsamkeit, Trennungen, die vergebliche Suche nach Nähe und Geborgenheit. Klienten wünschen sich, vor allem, wenn sie aus der gebildeten Mittelschicht kommen, oft unmittelbar eine Verbesserung ihrer Kontakte. Therapeuten geben angesichts einer Trennungskrise zu bedenken, daß ohne ihre Hilfe die nächste und übernächste Beziehung zum Scheitern verurteilt sei.
Die Klienten glauben, daß ihnen zu einer guten Beziehungsfähigkeit etwas fehlt. Sie müssen etwas Neues haben, müssen die Fähigkeit zur Partnerschaft erwerben. Was in einer Therapie geschieht (wenn nicht nur eine neue Karosserie für die alte Störung entworfen wird), geht in eine andere Richtung. Die Klienten erkennen, daß sie etwas loswerden müssen. Sie sehen, wieviel sie gerade in ihrer Suche nach einer ständigen Verbesserung ihrer Beziehungen gegen Nähe und Kontakt tun. Ein Vergleich mit kleinen Kindern ist hier nützlich. Die Unbefangenheit, mit der sie aufeinander zugehen und sich auch wieder trennen, beruht darauf, daß sie Gefühle ausdrücken, die sie bereits haben und nicht erst in einem Partnerschaftstraining erwerben müssen. Der Einsame, der Verlassene – sie alle tun etwas gegen Kontakt und Nähe. Oft ist es ihnen nicht bewußt oder führt ein Schattendasein am Rand ihrer Aufmerksamkeit.
Beate kommt einige Jahre nach dem Zerbrechen ihrer Ehe in Therapie. Sie hat das Gefühl, steckenzubleiben, unfähig zu neuen Beziehungen zu sein. Sie stammt aus einem großbürgerlichen Haushalt, war die letzte Tochter von fünf Kindern, von denen der erste Sohn viel älter war als sie. Zu Hause hat sie sich immer überflüssig und ungeliebt gefühlt. Sie kann sich nicht erinnern, mit der Mutter jemals offen gesprochen zu haben. Der Vater nahm sie manchmal auf Spaziergänge mit. Das war sehr schön. Zu Hause aber «verriet» er sie, weil er sich nicht auf ihre Seite stellte, wenn die Mutter schimpfte. Mit zwanzig Jahren lernte sie einen Studenten kennen, der ihr einsam und hilflos schien. Sie fühlte sich gebraucht, ja unentbehrlich und heiratete ihn kurze Zeit später. Sie gab ihre früheren Freunde auf, zog die beiden Kinder groß und kümmerte sich aufopfernd um ihren Mann, der nicht lernen und kein Examen machen konnte. Nach zehnjähriger Ehe verwandelte sich die Beziehung zu dem Ehemann. Sie konnte ihn nicht mehr ertragen, als sie sehen mußte, daß er nie die gemeinsamen Ziele erreichen, die Prüfung absolvieren und sie entlasten würde. Die Scheidung war ein langer, erbitterter Kampf, der fünf weitere Jahre dauerte. Es kam vor, daß der Ehemann, nachdem sein Anwalt einen besonders gemeinen Brief verfaßt hatte, bei einem persönlichen Treffen sagte, er würde sofort wieder mit ihr zusammen leben. Sie war dann fassungslos über soviel Verlogenheit.
Zu Beginn der Therapie fühlte ich mich oft überflüssig und ärgerlich. Sie berichtete von den Prozessen und den Schriftsätzen ihres früheren Mannes. Sie beschimpfte ihn wegen seiner Betrügereien und sich selbst, weil sie immer wieder darauf hereinfalle. Ich versuchte ihr zu vermitteln, daß möglicherweise die Lösung ihrer Schuldgefühle und Versagensängste nicht in dem Kampf mit dem Prozeßgegner liege, sondern in dem Bereich neuer Beziehungen, außerhalb der gescheiterten Ehe. Ich hatte das Gefühl, daß sie die Klagen und Kämpfe um die gescheiterte Beziehung wie eine Mauer zwischen mich und sich schob. Die Aggressionen gegen diesen Lügner und Betrüger, aber auch die Klagen über ihre Dummheit und Unfähigkeit gaben mir das Gefühl, wie ein Kriegsberichterstatter zwischen feindliche Linien geraten zu sein, Aggressionen abzukriegen, die mich nicht inhaltlich meinten, emotional aber doch trafen. Einmal wehrte ich mich damit, daß ich sagte, ich sei kein Jurist, und ich wisse gar nicht mehr, was ich für sie tun könne, es gehe ihr doch immer nur darum, wer jetzt recht behalte. Eine Weile kämpfte Beate noch mit immer neuen Rechtfertigungen und Erklärungen. Endlich fing sie an zu weinen. Ich war berührt, aber auch schuldbewußt. Ich hatte das Empfinden, zu weit gegangen zu sein. Allmählich verbesserte sich unsere Beziehung: Ich ging mehr auf ihre Kämpfe ein, während sie allmählich anfing, von ihren Erlebnissen außerhalb der Kämpfe vor dem Familiengericht zu sprechen.
Jetzt wurde das Näheangst-Bild deutlicher. Ich hatte es mir schon angewöhnt, immer dann, wenn ein Klient ausführlich über seine fruchtlosen Bemühungen berichtete, abweisende, unzuverlässige Partner endlich für sich einzunehmen, nach einem ganz anderen Bereich zu suchen: Was geschah, wenn der Klient nicht mehr in imaginären, schier psychochirurgischen Eingriffen versuchte, die Flucht aufzuhalten, sondern selbst geliebt und begehrt wurde? Auch Beate fielen, nachdem sie sich zunächst als einsam und verschmäht darstellte, die vielen zudringlichen Männer ein, die nach der Scheidung etwas von ihr gewollt hatten. Selbstverständlich konnte keiner ihr Herz gewinnen. Sie hatte sie auch schon fast vergessen, schien es für eine unmoralische Zumutung zu halten, überhaupt an sie zurückzudenken. Ich will im folgenden die Inhalte der Angst vor Nähe an dem Fallbeispiel Beates verdeutlichen:
1. Das Streben nach Leistung und Kontrolle. Bedingung für Beates Beziehungen scheint zu sein, daß sie etwas tun, sich anstrengen, etwas machen kann und muß. «Was soll ich jetzt machen? Ich sehe ja schon, daß es so nicht geht. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll!» So fragt sie in nachdenklichen Augenblicken. Beide Sätze - «Was soll ich machen» und «ich weiß nicht» sind kennzeichnend für die Näheangst. Sie drücken aus, daß es sehr schwierig ist, den Bereich zu verlassen, in dem das Machbare, Gewußte vorherrscht. An dieser Stelle wird auch deutlicher, weshalb Menschen wie Beate immer nur den Partner zu sehen scheinen, nur über ihn sprechen: Er ist der Gegenstand kontrollierter Aktivität. Indem an ihm gearbeitet, über ihn nachgedacht, er verändert wird, soll die eigene, im dunkeln liegende Gefühlssituation beeinflußt werden. Die eigene Aktivität richtet sich auf Leistungen für ihn. Gefühle werden als Antwort auf die Handlungen des Partners erlebt. Das Bild des Partners wird nicht durch die eigenen Gefühle festgehalten, sondern durch Aktionspläne, Maßnahmen, Überlegungen, weshalb er sich so und nicht anders verhält.
2. Die Sehnsucht nach Gleichheit. Von dem griechischen Bildhauer Pygmalion erzählt die Sage, daß er aus Elfenbein ein Bild der Venus verfertigte, in das er sich so sterblich verliebte, daß die Göttin aus Erbarmen mit seiner Verzweiflung der Gestalt Leben einhauchte. Die Sehnsucht, einen idealen Partner zu finden, mit dem man verschmelzen und damit das unsichere, eigene Selbstgefühl ein für allemal befestigen kann, steht hinter den Anstrengungen und Mühen, mit denen zahlreiche Pygmalions an ihren Partnern schnitzen. Meist verletzen sie diese dabei, aber der gute Zweck scheint allemal die Mittel zu rechtfertigen. Beate will das ideale Bild eines Mannes schaffen, der eigentlich eine männliche Beate ist. Sie heiratet einen schwachen, abhängigen Partner, der noch unfertig scheint, für den sie viel tun kann. Sie gibt ihre bisherigen Interessen und Freunde auf und widmet sich ganz der Aufgabe in der Hoffnung, wenn er endlich so geworden sei, wie sie ihn braucht, werde er ihr diese aufopfernden Mühen vergelten und sich ebenso um sie bemühen. Die Wirklichkeit widerspricht dieser Erwartung. Je mehr sie in der Beziehung macht, sich sorgt und kümmert, desto passiver wird der Mann. Als endlich die Aussichtslosigkeit der Bemühungen deutlich wird, schlägt die Zuversicht in Verzweiflung, der Wunsch nach Verschmelzung in ein intensives Bedürfnis nach Trennung um. Sie wirft den Mann, an dem sie so lange so hart gearbeitet hat, hinaus. Aber auch in ihrer Verarbeitung des Scheidungsprozesses wird deutlich, daß sie große Schwierigkeiten hat, ihren Mann realistisch wahrzunehmen. Sie weiß zum Beispiel, daß er zu jeder Lüge bereit ist, um Vorteile für sich herauszuschlagen. Aber jede neue Lüge macht sie fassungslos und verwirrt sie so, als sei sie die erste. Jedesmal beteuert sie, sie könne das einfach nicht verstehen. – Ergänzend ist zu sagen, daß dieser Mann (den ich nicht kenne und hier aus der sicherlich verzerrten Sicht Beates beschrieben habe) im Unterschied zu dem unschuldigen Elfenbein Pygmalions vermutlich Beates Neigung durch seine eigenen Bedürfnisse sehr entgegenkam.
3. Die Angst vor Verschiedenheit. Da Beate in ihrer Ehe vor allem eine Aufgabe sieht, die Forderung zu angestrengter Leistung, muß sie sich auch fürchten, ihren Partner wirklich als erwachsenen, selbständigen Menschen zu sehen. Nur dort, wo er ihrem (teilweise unbewußten) Ideal entspricht, ihr eigenes Selbstgefühl wie ein Zwilling verstärkt, nimmt sie ihn wirklich wahr. Was nicht in dieses Bild paßt, wird übersehen und verleugnet. Daher ist sie auch immer so «überrascht», wenn ihr Mann nicht arbeitet, sich nicht auf das Examen vorbereitet, wenn wieder eine Lüge zutage kommt, die er ausgesprochen hat. Der Partner ist dort, wo er nicht in die Sehnsucht nach Gleichheit paßt, entweder gestaltlos oder gefährlich. Er wird nicht wahrgenommen, solange diese Teile unscheinbar bleiben. Wenn er sie durchsetzen will, trifft er auf fassungslosen Widerstand. Eine Lösungsmöglichkeit liegt darin, daß die Partner sich einigen, auf die Zukunft zu setzen. Dann wird ein Teil der Gegenwart mit dem unerwünschten, der Gleichheit widersprechenden Teil des Partners verknüpft. Sie entschuldigen sich gegenseitig. «Wenn mein Mann erst die Prüfung hat, nicht mehr in seinem Studiumstress so schonungsbedürftig und wenig belastbar ist», denkt sich Beate, «dann komme ich endlich auch auf meine Kosten, muß mich nicht mehr aufopfern.» Einige Jahre später heißt es: «Er ist ein Schmarotzer, der mich aussaugt, und von dem ich nie mehr etwas bekommen werde, das ich brauchen kann.» In jeder von Leistung und Anpassung bestimmten Beziehung geht es um ja oder nein, gut oder schlecht, richtig oder falsch, alles oder nichts. Die Absicht, den Partner berechnen zu können, macht ihn unberechenbar. Die Angst, seine Verschiedenheit wahrzunehmen, macht aus ihm einen dunklen Kontinent, in den man bald nurmehr bewaffnete Expeditionen mit großer Vorsicht unternimmt. Die Spannung wird oft dadurch gelöst, daß einer die Feindseligkeiten eröffnet und dem anderen beweist, daß er eigentlich noch nie so war, wie er eigentlich hätte sein müssen.
4. Das zerbrechliche Bild. Angesprochen sind die Erscheinungen, die in der Psychoanalyse mit Ausdrücken wie «Objektkonstanz» und «inneres Objekt» beschrieben werden. Gemeint ist das innere Bild, welches dem Partner entspricht und mit Gefühlen besetzt wird. Bei Menschen mit Näheangst ist dieses innere Bild sehr zerbrechlich. Seine Beständigkeit wird im Lauf der seelischen Entwicklung erworben. Ein Hinweis darauf ist das «Fremdeln» der Kinder, die ab dem vierten Lebensmonat mit beleidigter Miene und Geschrei antworten, wenn statt des erwarteten Partners – der Mutter, des Vaters – ein Fremder sie hochnimmt oder ihnen zu nahe kommt. Das Fremdeln zeigt, daß ein solches inneres Bild entstanden ist. Dieses wird allmählich fester, beständiger. Das Kind kann längere Zeit alleine verbringen, spielen, mal zur Nachbarin schauen. Wenn es eine stärkere seelische Verletzung erlebt (zum Beispiel einen Unfall mit folgendem Krankenhausaufenthalt, ohne daß die Mutter es begleiten kann), dann zerbricht dieses innere Bild. Es löst sich auf. Die Mutter wird angeschaut wie eine Fremde, wenn sie das Kind zum erstenmal besucht. Zu Hause ist das Kind unselbständig. Es hängt wieder am Rockzipfel. Allmählich baut sich das innere Bild wieder auf. Die Mutter wird nicht mehr ängstlich festgehalten, sondern lachend verabschiedet und lachend begrüßt. Menschen mit Näheangst können dieses innere Bild des Partners nicht liebevoll festhalten. Beate erzählte einmal, wie sie ein Freund, den sie einige Jahre nach der Scheidung in ihre Wohnung aufnahm, für eine Reise verließ. Er besuchte eine alte Freundin. Sie war erbittert und konnte nicht schlafen. Da fing sie an, einen Pullover für ihn zu stricken. Sie strickte die halbe Nacht. Schon vorher wußte sie, daß ihr Freund gesagt hatte, er fände Frauen schrecklich, die ihm einen Pullover stricken wollten. Aber sie wollte einen so schönen Pullover stricken, daß er diese Aussage zurücknehmen müsse. Nach Mitternacht verlor sie die Kraft weiterzumachen. Sie fing nun an, die fertigen Pulloverteile wieder aufzuribbeln.
Diese Szene zeigt, weshalb sich kein festes inneres Bild entwickeln kann. Dies würde voraussetzen, daß der Partner beständig als ein und dieselbe Person wahrgenommen wird. Aber da Beate eine zu feste Vorstellung davon hat, wie ihr Freund sein müßte, kann sie kein klares Bild davon gewinnen, wie er wirklich ist. Sie blickt nicht auf eine Zeichnung mit festen Umrissen, sondern in einen Strudel, aus dem die verschiedensten Entwürfe, böse und gute, feindliche und liebevolle, auftauchen und wieder in die Tiefe gerissen werden. So strickt sie dem guten Freund den Pullover und trennt ihn dem bösen wieder auf. Sie ist aber nicht nur Beobachterin, sondern wird in dem Strudel mitgerissen. Später, als sie sich auch von diesem Mann getrennt hatte, klagte sie darüber, sie könne für nichts garantieren, wenn sie sich mit ihm treffe. Sie könne noch so sicher sein, daß sie nie wieder mit ihm leben wolle – wenn er vor ihr stünde, es vorschlage, sei ihr Verstand machtlos. Das zerbrechliche, unklare innere Bild bedingt die Schwierigkeiten, sich abzugrenzen. Beate kann in der Beziehung nicht nein sagen und muß deshalb endlich die ganze Beziehung verneinen. Weil sie kein festes, beständig mit liebevollen Gefühlen besetztes Bild ihrer Partner hat, hängt sie an ihnen wie das Kind am Rockzipfel und muß ihnen alles rechtmachen. Umgekehrt fürchtet sie, bei Partnern, die auf sie zugehen und wirklich eine Liebesbeziehung wollen, völlig aufgeschluckt und vereinnahmt zu werden. Weil das innere Bild so unbeständig ist, kann dem Partner keine Klarheit zugemutet werden, ist keine Auseinandersetzung über unterschiedliche Bedürfnisse möglich. Der Gedanke daran wird schon als erniedrigend erlebt, schließlich müßte ein Partner, der wirklich liebt, doch ohne dieses Aushandeln wissen, was Beate will.
5. Die vermiedene Trauer. Eine wesentliche Seite der Beziehungen Beates zu Männern liegt darin, daß sie selten wirklich traurig ist. Sie fürchtet sich, sie kämpft, sie ist wütend. Trauer ist keine Leistung, sondern ein Gefühl, durch das Verluste «verarbeitet» werden können. Beate hingegen will wissen – in der Therapie immer wieder auch von mir –, ob sie etwas gut oder schlecht, falsch oder richtig gemacht hat. Wenn sie das weiß, will sie es künftig besser machen. Ein anschauliches Beispiel für die Vermeidung von Trauer ist ein kleiner Unfall. Sie hatte ihn, als sie schwankte, ob sie mit einem früheren Freund vielleicht doch wieder engere Kontakte eingehen sollte. Ehe sie sich mit ihm traf, ging sie in den Keller und verletzte sich die Hornhaut eines Auges an einem Stück Holz, als sie sich im Dunkeln bückte. Sie wußte nicht, was sie dort gesucht hatte. Als der Freund zu Besuch kam, hatte sie starke Schmerzen. In der Analysestunde fand sie heraus, daß sie damit ihre mangelnde Fähigkeit ausglich, sich ein klares Gefühl für sich selbst zu erhalten. «Nur weil es mir so schlechtging, habe ich gemerkt, daß sich Otto gar nicht für mich interessiert. Es war ihm egal, ob es mir weh tat oder nicht. Er hat sich das ganz kurz angehört und dann von seinen Sachen geredet.» Ein anderes Beispiel für die Vermeidung von Trauer ist die Geschichte mit dem Pullover, den sie strickte und dann wieder auftrennte. Statt sich einzugestehen, daß Otto sie nicht so liebt, wie sie es will, und darüber zu trauern, versucht Beate etwas zu leisten, zu machen, ihn und sich zu kontrollieren. Sie ist keine ganze Person, die um den Verlust einer anderen Person trauert, sondern ein Bündel aus widersprüchlichen Aktivitäten, getrieben von Wut und Angst: Wut, weil sie nicht bekommt, was sie braucht. Angst, weil die Wut die Beziehung bedroht und jede Hoffnung zerstört, das ideale Bild Ottos könnte endlich doch noch Wirklichkeit werden. Einer muß schlecht sein – Otto oder sie selbst. Einer muß dumm sein und einen Fehler gemacht haben. Einer muß böse und herzlos sein. Schuldige für das Scheitern müssen gesucht werden. Es ist für Beate sehr schwer zu sehen, daß es nicht schlecht, sondern traurig ist, wenn die Beziehung zu Otto zerbricht. Sie kann durch kein noch so gutes Argument, durch keine Form von kämpferischem Einsatz, durch keine Anpassungsleistung diesen Verlust verhindern.
Vielleicht könnte Beate die Trennung vermeiden, wenn sie sich auf ihre Liebe und nicht auf ihre Leistungen verlassen würde. Aber das ist nicht sicher. Verlust und Tod gehören zum Leben wie Geburt und Wachstum. Das ist eine banale Weisheit, aber die «entwickelten» Gesellschaften scheinen sie zu vergessen. Ebenso vergessen sie die Individuen, die in ihrem Kampf um Nähe übersehen, wie bedürftig und schwach auch der Gegner ist, wieviel angst sie ihm machen. «Du bist nicht engagiert, du bist kalt und intellektuell», sagt die Frau. «Du erschlägst mich mit deinen Gefühlen und nörgelst nur an mir herum», sagt der Mann. In dem Krieg darum, wer recht hat, scheinen beide zu übersehen, daß sie sterblich sind und auf einem Planeten leben, der von uns jeden Tag ein Stück mehr aufgefressen wird.
Der Näheangst-Kampf entsteht dann, wenn einer (oder beide) Partner sich vor einer gefühlsbestimmten Beziehung fürchten. Wer es mit dem höchsten Einsatz verwechselt, wenn er nicht mehr über dessen Höhe nachdenkt, der muß auch fürchten, zuviel zu verlieren. Wer vorsichtiger mit seinem Kapital umgeht, muß auch nicht soviel Angst haben, es einzubüßen. Wer diese Ängste wahrnimmt, wird sie um so weniger annehmen und liebevoll mit ihnen umgehen können, je mehr er sie teilt. Sobald ihm Beate ihre Liebe deutlicher ausdrückt oder ihre Sehnsucht nach einer gemeinsamen Zukunft zeigt, kommt Otto nicht mehr pünktlich, belebt Kontakte zu früheren Freundinnen oder muß ganz viel arbeiten. Beklagt sie sich, dann schilt er sie, daß sie ihn auffrißt und er ihr nie eine feste Beziehung versprochen habe. Obwohl sich beide lieben, quälen sie sich, denn jeder versucht, den anderen mit Gift- und Düngemitteln zu behandeln, um die Beziehung zu erhalten. Beate möchte Ottos Bindung und Liebe düngen und seine Ängste und Trennungsphantasien ausrotten. Otto will Beates Wünsche nach Zuverlässigkeit und Beständigkeit ausrotten und erreichen, daß sie sich ähnlich verhält wie er selbst. «Wenn er mich wirklich liebt», denkt Beate, «dann kann er mich doch nicht so hängenlassen!» – «Wenn sie mich wirklich liebt», denkt Otto, «dann muß sie mich doch gehen lassen und kann mir doch meine Freiheit nicht rauben wollen!»
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: