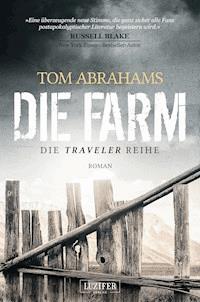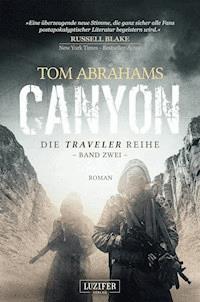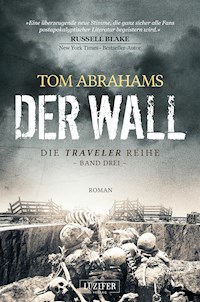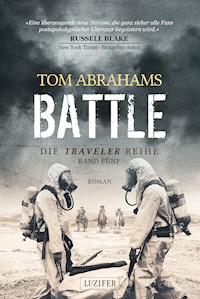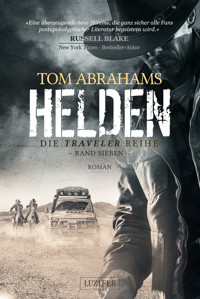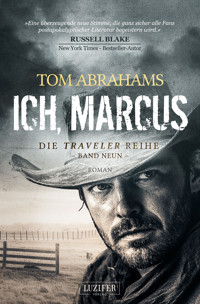Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Bar am Ende der Welt
- Sprache: Deutsch
Eine Welt unter Wasser. Eine verschollene Waffe. Ein Kampf um Erlösung. Zeke Watson hat seine erste Mission als »Watcher« zu erfüllen: Er soll ein entführtes Kind finden, das den Aufenthaltsort einer verschollenen Waffe kennt. Eine Waffe, die in den falschen Händen das Gleichgewicht zwischen guten und bösen Kräften im gesamten Universum durcheinanderbringen könnte. Also macht er sich auf die Suche, nach dem Kind und der Waffe gleichermaßen. Aber wird er sie finden können, in einer überfluteten postapokalyptischen Welt voller erbarmungsloser Piraten, in der seine Fähigkeiten hinter dem Steuer eines Wagens nutzlos sind und seine neugewonnenen Kräfte so unberechenbar wie die raue See? Tom Abrahams' neuester Roman ist ein wilder Ritt durch eine postapokalyptische Welt, die jedoch mit einer phantastischen Wendung aufwartet. Für Fans von Hugh Howey und Stephen Kings "Dunkler Turm"-Saga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Bar am Ende des Meeres
Tom Abrahams
This Translation is published by arrangement with Aethon Books. Title: THE BAR AT THE EDGE OF THE SEA. All rights reserved.
Diese Geschichte ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Orte, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: THE BAR AT THE EDGE OF THE SEA Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Sylvia Pranga Lektorat: Manfred Enderle
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-742-6
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
»Wo ist sie?«
Desmond Branchs regennasse Finger umklammerten den Knochenschaft der Klinge aus Damaskus-Stahl an seiner Seite fester. Er würde nicht noch einmal fragen.
Lucius Mander starrte ihn durch den Schleier kalten, unablässigen Regens an. Die Augen des Mannes waren vor Angst geweitet. Wasser hing schwer an seinen Wimpern und formte sich zu dicken Tropfen, die seine Wangen hinabliefen. Branch erkannte das Erscheinungsbild. Es war buchstäblich bei allen Menschen identisch – bei Männern, Frauen und sogar bei Kindern. Wenn ihre Zeit gekommen war, wenn ihr letzter Augenblick näher rückte, waren sie alle gleich.
Es war der armselige Anblick von Angst, gemischt mit Resignation, dem Wissen, dass alles, was sie jemals ausgemacht hatte, aufhören würde zu existieren. Es würde sich verflüchtigen und vom Wind davongetragen werden, über die Ozeane, die sich endlos in jede Richtung erstreckten. Selbst die, die Trotz vortäuschten und so taten, als würden sie sich im Angesicht des Todes stählen, zeigten diesen Anblick unter der dünnen Oberfläche ihrer aufwallenden Gefühle.
Mander war kein mutiger Mann. Er war armselig, senkte das Kinn und schüttelte den Kopf. Mit klappernden Zähnen gab er dieselbe Antwort wie unzählige Male zuvor. Und es war nicht die Antwort, die Desmond Branch hören wollte.
»Ich weiß es nicht«, sagte Mander. »Ich habe dir gesagt, dass ich …«
Branch legte eine Hand auf Manders bebende Schulter und stieß die Klinge in den Körper des Mannes. Er sah Mander in die Augen, als der Mann keuchte und den Mund öffnete und schloss wie ein Fisch auf dem Trockenen.
»Du hast mir nichts erzählt«, sagte Branch und zog die Klinge zurück. Sie war schlüpfrig vor Blut. Er leckte sich über die Zähne und starrte Mander weiter mit seinem Todesblick an.
Blut floss aus Manders Nase, mischte sich mit dem Regenwasser, das sein langes, blasses Gesicht hinabrann. Es verdünnte die rote Farbe, schwächte ihre Leuchtkraft ab und ließ sie beinahe rosa erscheinen, als sie die Lippen des sterbenden Mannes erreichte und von seinem Schnurrbart auf sein Kinn tropfte.
Mander hustete. Er versuchte, wieder zu sprechen. Bevor er jedoch ein Wort hervorbrachte, hob Branch sein Knie, streckte das Bein aus und trat ihn mit seiner Stiefelspitze.
Mander umklammerte seine Wunde, fiel nach hinten und verschwand aus seinem Blickfeld. Einen Augenblick später fiel sein Gewicht mit einem lauten Klatschen ins Wasser unter ihnen, und Branch wusste, dass der Mann fort war.
Ein frischer Wind trieb Branch den Regen ins Gesicht, als er die Klinge an seiner Hose abwischte und sie zurück in die Scheide an seiner Hüfte schob. Mit der Oberseite seines Arms wischte er sich Regen und Schweiß vom Gesicht. Dann überquerte er das Deck seines Bootes, um zu seinem Steuermann zu gehen, einem vertrauenswürdigen Mann namens Pierre LeGrand.
LeGrand war Branchs bester Freund, wenn ein Mann wie Branch überhaupt Freunde haben konnte. Die beiden würden füreinander sterben. Zumindest wusste Branch, dass LeGrand für ihn sterben würde. Er war sich nicht sicher, wie loyal er sein würde.
»Das war der Letzte von ihnen«, sagte er über den Wind hinweg und schob sich neben LeGrand. »Wenn er etwas gewusst hätte, hätte er es mir gesagt.«
LeGrand zuckte mit den Schultern. »Vielleicht. Wie viele waren es vor ihm?«
Branch zählte mit den Fingern nach. »Neun. Keiner von ihnen wusste etwas. Ich dachte, dass jemand reden würde, bevor ich beim Letzten ankomme.«
»Nichts?«, fragte LeGrand. »Kein Hinweis, wo sie ist?«
»Nein.«
»Einer von ihnen muss etwas gewusst haben«, sagte LeGrand. »Außer die Information ist wertlos.«
»Die Information ist nicht wertlos«, sagte Branch. »Da bin ich mir sicher.«
»Vielleicht warst du nicht überzeugend genug«, sagte LeGrand. »Ein Messer ist eben nur ein Messer.«
Nur wenige Menschen konnten den Captain mit so einer Unverschämtheit beleidigen. Die meisten anderen wären an ihren Worten erstickt, weil sie Branchs Autorität infrage gestellt hatten. Branch rieb sich das Kinn und musterte seinen Steuermann aus zusammengekniffenen Augen. Aus Dünnhäutigkeit geborene Wut brodelte einen Augenblick in ihm und verschwand genauso schnell wieder. Branch ließ es auf sich beruhen, verkürzte im Kopf das Seil jedoch um eine Kerbe. Er legte eine Hand auf die Konsole, die die Brücke einrahmte. Sie bestand aus gewachstem Eichenholz, das mit einer Lackschicht versiegelt war, die den Regen in dicken Tropfen abperlen ließ, die sich auf der Oberfläche bildeten. Sie fühlte sich unter Branchs Fingern glitschig an.
Er lachte. »Was hätte ich deiner Meinung nach denn tun sollen? Ihre Eingeweide an den Mast nageln? Ihre Hände bis auf die Knochen verbrennen? Sie kielholen? Sie über die Planke gehen lassen?«
»Niemand hat je jemanden über die Planke gehen lassen«, sagt LeGrand. »Das ist nur eine Legende.«
»Es ist keine Legende«, sagte Branch. »Die Leute haben das gemacht. Ein Seil, eine Kanonenkugel, Haie und eine Planke. Es konnte wirkungsvoll sein.«
»Weißt du«, sagte LeGrand, »nur weil du Dinge stiehlst, Menschen tötest und nach versteckten Schätzen suchst, macht dich das nicht zu einem Piraten.«
Branch schlug LeGrand mit seiner freien Hand auf den Rücken. Wasser spritzte aus dem durchtränkten Hemd des Steuermanns.
»Doch, das tut es«, sagte er und lachte herzlich. »Genau das ist die Definition eines Piraten. Und jetzt lass uns wieder an die Arbeit gehen.«
LeGrand griff nach dem Gashebel des Bootes und schob ihn nach vorn. Der Motor dröhnte, und das Boot schlingerte, bevor es Geschwindigkeit aufnahm. Das Wasser war kabbelig, und das Boot hüpfte auf den Wellen. Je schneller sie wurden, desto größer wurde der Winkel, bis sie abzuheben schienen und auf den Wellen ritten. Dichte Gischt sprühte bei jeder Abwärtsbewegung über den Bug. Das Kielwasser floss bei jeder Aufwärtsbewegung über das Deck, bevor es durch die Speigatten abfloss oder in den Kielraum rann.
Das Wasser war waffenstahlgrau und mit weißen Schaumkronen bedeckt. Der Himmel über ihnen war dunkel und zornig. Eine Mischung aus salziger Gischt und niederprasselndem Regen zwang Branch, das Gesicht zur Seite zu drehen und schützend einen Arm zu heben.
In einer Meile Entfernung befand sich die Küste. Er warf immer wieder einen Blick darauf, während sie sich ihr näherten. LeGrand navigierte durch das niedrige Wasser, hielt sich rechts der Markierungen, befolgte die Regeln.
Branch war nicht der Typ, der sich an Regeln hielt. Das war er nie gewesen und würde es nie sein.
LeGrand lenkte das Boot auf ihr Ziel zu.
Branch schaute seinen Freund an, der stoisch und mit stählernem Blick geradeaus sah. Der Steuermann sagte in Gegenwart anderer nicht viel. Das Reden überließ er Branch.
Darum war Branch der Kapitän und LeGrand der Erste Offizier. Derjenige mit Persönlichkeit übernahm oft die Führung, wenn er auch nicht das Ruder bemannte.
»Vielleicht hatten die anderen Glück«, sagte LeGrand über die laute Mischung aus Wind, Gischt und das Jaulen des Motors hinweg, der gegen die Brandung ankämpfte.
Branch nickte seinem Freund zu und lehnte sich gegen die Konsole. Er stellte die Füße schulterbreit auseinander und beugte die Knie etwas, um das Auf- und Absteigen des Bootes abzufedern. Sie waren jetzt nah genug an der Küste, dass er die Menschen am Strand sehen konnte. Dutzende saßen in Gruppen im Sand. Einige waren Familien. Andere waren Gruppierungen, die er und seine Männer zusammengetrieben hatten, als sie einige Stunden zuvor das Dorf erstürmt hatten. Seine Männer befanden sich am Rand der Menge und behielten die Dorfbewohner im Auge, während sie auf und ab patrouillierten.
»Wenn nicht«, sagte Branch, »bringen wir weiterhin jeweils ein paar von ihnen aufs Meer hinaus. Wir werden herausfinden, was sie wissen.«
»Ich denke, dass das Zeitverschwendung ist«, sagte LeGrand. »Und Verschwendung von Treibstoff.«
Branch versteifte sich. Er wandte sich seinem Steuermann und Erstem Offizier zu.
»Ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt«, höhnte er. »Ich finde jederzeit leicht jemand anderen, der mein Boot steuert. Du kannst wieder zu dem zurückkehren, was du getan hast, um zu überleben, bevor ich dich gerettet habe …«
LeGrand nahm die Hände vom Steuerrad und hob sie kapitulierend. »Okay, okay«, sagte er. »Vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Ich will sie genauso sehr finden wie du, wenn sie denn überhaupt existiert.«
Branch trat dichter an LeGrand heran, er war nicht zufrieden mit der Unterwerfung seines Steuermanns. Er vergrub die Faust im Hemdkragen des Mannes, wrang das Regenwasser aus dem durchnässten Stoff und zog LeGrand so dicht zu sich heran, dass ihre Gesichter nur noch Zentimeter voneinander entfernt waren.
»Sie existiert«, sagte er. »Und niemand will sie mehr als ich. Nicht ein einziger Mensch auf diesem gottverlassenen Planeten hat mehr Blut vergossen, mehr Schätze ausgegeben oder ist weiter gereist als ich, um sie zu finden. Das schließt dich und jeden Mann unserer Crew ein. Hast du mich verstanden?«
LeGrand nickte und befreite sich aus dem Griff des Kapitäns. Er hob kapitulierend die Hände.
»Okay«, murmelte er. »Ich habe es verstanden.«
Die beiden überquerten die Untiefen in der Nähe des schmalen Küstenstreifens. Diese Insel war wie die meisten anderen – klein, isoliert und Heimat von Menschen, deren Vorfahren das Schmelzen der Polkappen eine Generation zuvor überlebt hatten. Statt Kontinenten umgaben Inselgruppen den Planeten Erde wie Sternbilder. Stämme von Inselbewohnern regierten sich selbst. Sie lebten nach ihren eigenen Gesetzen. Sie entwickelten ihre eigenen Sitten und Gebräuche. Einige waren friedlich und egalitär. Andere waren unterdrückend und militant.
Diejenigen, die nicht auf Inseln lebten, schweiften auf Booten und Schiffen, die noch aus der Zeit vor der Polschmelze stammten, auf der See herum. Die meisten der Seefahrer bewegten sich zwischen den Inseln, handelten mit Gütern und segelten mit guten Absichten von Außenposten zu Außenposten. Andere, wie Desmond Branch, waren Plünderer, deren Leben auf purem Egoismus beruhte. Sie waren immer auf der Suche nach der einen Sache, die ihnen eine Position am oberen Ende der Nahrungskette sichern konnte. Es war eine Waffe, die sowohl mythisch als auch legendär war. Branch war sich so sicher, dass sie in seiner Nähe war, dass er sie fast in seiner Hand spüren konnte. Er würde ihre Macht nutzen und sich so seine Zukunft als unanfechtbarer König dieses versunkenen Planeten sichern.
Branch schloss die Augen und genoss das Stechen des kalten Regens auf seinem Gesicht. Das Boot unter seinen Füßen verlangsamte.
»Ich werde sie finden«, sagte er ebenso sehr zum Wind wie zu sich selbst. »Oder bei dem Versuch sterben.«
Kapitel 2
Zeke Watson prüfte die Balance des Dartpfeils, strich mit den Fingern über den Schaft. Er verlagerte sein Gewicht auf das vordere Bein und ließ das Handgelenk nach vorn schnellen, um den Dartpfeil auf die Zielscheibe zu werfen. In dem Augenblick, als er losließ, nieste Uriel.
Der Dartpfeil segelte nach rechts, bohrte sich in den Kork des schwarzen Rings, der den Rand der Zielscheiben umgab und bekam als Ergebnis null Punkte.
Uriel stieß Zeke mit der Hüfte an. »Tut mir leid«, sagte sie. »Allergien.«
»Die scheinen immer nur aufzutreten, wenn ich mit Werfen an der Reihe bin«, sagte Zeke.
Sie strich sich mit der Hand über die rasierte Seite ihres Kopfes und schlang dann das Ende ihres langen, rotbraunen Zopfes um ihren Zeigefinger. Die pinkfarbene Schleife am Ende des Haares sah wie ein Ring auf ihrem Knöchel aus.
»Ich reagiere wohl allergisch auf die Art, wie du dieses Spiel spielst«, sagte sie.
Zeke trat zu dem runden Stehtisch hinter ihnen und hob sein Glas. Er prostete ihr zu und trank den letzten Schluck seines Kentucky Bourbon Ales. Es hatte einen Beigeschmack von Maisschnaps und war im Abgang süßes, vollmundiges Bier. Von den endlosen Möglichkeiten, die die Bar des Saloons bot, war dies inzwischen sein bevorzugtes Getränk.
Er sah sich in der Kneipe um, bemerkte Staub, der in den Lichtstrahlen tanzte, die durch die Fenster und die Ritzen der Schwingtüren am Eingang hereinfielen. Vielleicht hatte sie auch Allergien.
Uriel trat an die Linie, hielt einen Pfeil zwischen Daumen und Zeigefinger.
»Ich brauche eine Sechzehn, um zu gewinnen«, sagte sie.
»Doppelt oder nichts«, sagte Zeke.
Uriel lachte. »Du hast nichts zum Verdoppeln.«
Sie beugte sich in den Wurf, und der Pfeil segelte los. Die Spitze bohrte sich in die untere linke Ecke der Zielscheibe. Sechzehn.
Sie drehte sich auf dem Absatz um und gesellte sich zu Zeke an den Tisch. Ohne den Blick von ihm abzuwenden, hob sie die Hand und wackelte mit dem Zeigefinger.
»Pedro«, rief sie über den Lärm der Gespräche, der Musik aus der Jukebox und das Klirren der Gläser hinweg. »Noch eine Runde, bitte. Und die geht auf Zeke.«
»Ich glaube, ich habe dich noch nie geschlagen«, stöhnte Zeke.
»Ich weiß, dass es so ist«, sagte sie.
Uriel bestand aus lauter Gegensätzen. Einerseits war sie wild und tatkräftig, andererseits aber auch unbestreitbar feminin. Ihr unsicheres Lächeln, die Rundung ihrer Wangen und die Intensität ihrer grünen Augen konnten nicht über ihre ausgeprägten Muskeln und die breiten Schultern hinwegtäuschen. Doch die bunten Tätowierungen, die den größten Teil ihres Körpers bedeckten, zeigten nur ansatzweise die Macht ihrer Kreativität.
Obwohl Zeke eine andere Frau liebte, fühlte er sich von ihr angezogen. Die Chemie stimmte. Es war eine Anziehungskraft, die elektrische Stöße durch seinen Körper sandte, wenn er in ihrer Nähe war.
Er wandte den Blick von ihr ab und der Theke zu. Pedro, der Barkeeper und Eigentümer des Saloons, näherte sich ihnen. Er trug in jeder Hand ein großes Glas.
Wie immer trug er ein weißes Leinenhemd, das er in eine weite, dunkle Denim-Jeans gesteckt hatte. Die Hemdärmel hatte er bis zu den Ellbogen hochgerollt. Über dem Hemd trug er eine alte, dunkelbraune Weste. Um die Taille hatte er einen breiten Gürtel mit Messingschnalle geschlungen.
Altersflecken sprenkelten seine Handrücken. Krähenfüße hatten sich um seine eisblauen Augen herum eingegraben. Sie waren die Zeichen eines Mannes, der Ewigkeiten in der Sonne verbracht hatte. Sein gebräuntes Gesicht war von einem drahtigen Bart bedeckt, in dem schon mehr Salz als Pfeffer war. Dazu passend hatte er einen dicken Haarschopf.
»Hier, bitte«, sagte Pedro mit seinem üblichen Lächeln. »Zwei Ales aufs Haus.«
Er stellte die Gläser auf den Tisch, wobei die Schaumkronen über die Ränder und auf die Holzoberfläche schwappten. Uriel sah ihn von der Seite an.
»Ich habe gesagt, dass die Drinks auf Zeke gehen«, merkte sie an.
Pedro beugte sich über den Tisch. »Auf seiner Rechnung steht schon mehr als genug.«
Der Barkeeper sah an Zeke vorbei, zur oberen Etage des Saloons. Zeke drehte sich um, um Pedros Blick zu dem Balkon zu folgen, der um die ganze Bar herumlief.
Zeke blickte zu Zimmer 29. Es war hinter ihm und neben seinem Zimmer. Die Tür war geschlossen. Er starrte sie eine Weile an, erwartete fast, dass sie sich öffnen würde. Als das nicht geschah, wandte er sich ab und griff nach seinem Bier.
»Ist sie bereit?«, fragte Pedro.
Zeke trank einen großen Schluck aus seinem Glas. Der Duft von Whiskey breitete sich in seinem Nasenraum aus, und er konnte fast das Fass sehen, in dem das Ale gereift war. Es war himmlisch. Er schluckte, und die Kühle des Biers durchlief ihn. Er schüttelte den Kopf.
»Ich glaube nicht«, sagte er. »Sie will nicht aus dem Bett kommen.«
Uriel verdrehte die Augen. »Wie viele Tage sind es jetzt?«
Zeke hielt fünf Finger hoch.
»Einige brauchen länger als andere«, sagte Pedro. »Damit klarzukommen, wer wir sind und wo wir sind, ist nicht einfach.«
»Besonders wenn man Neuankömmlingen nicht erzählt, wo sie sind oder wer sie sind«, sagte Zeke. »Ich bin nicht sicher, ob ich die Dinge unter Kontrolle habe.«
Pedro winkte Zeke zu. »Komm mit mir mit«, sagte er. »Ich muss dir etwas zeigen.«
Zeke warf Uriel einen hilfesuchenden Blick zu. Sie hob die Brauen, zuckte mit den Schultern und leerte ihr Bierglas zur Hälfte.
Pedro ging zur Theke zurück, und Zeke folgte ihm. Obwohl es in der Bar so voll war, öffnete sich vor Pedro ein Weg. Er musste sich nicht entschuldigen oder darum bitten, durchgelassen zu werden. Die Leute wichen ihm instinktiv aus.
Zeke folgte in seinem Fahrwasser. Er schritt selbstbewusst aus, dieser Ort wuchs ihm immer mehr ans Herz. Er rückte seinen Gürtel zurecht, verschob das Gewicht der großen, sechsschüssigen Waffe an seiner Hüfte. Sie war in ihrem Holster verborgen.
Sie erreichten die Theke am anderen Ende des Raums, und Pedro schob sich dahinter. Der alte Mann strich mit einer Hand über das Herzstück seines Geschäftes. Es reichte von Wand zu Wand. Das dicke, lackierte Eichenholz war vom Alter abgenutzt. Die mit Schnitzereien verzierte Front war zerkratzt und eingedellt. Dahinter befand sich ein wandhoher Spiegel mit schwarzen Alterslinien, der Pedro reflektierte. Auf dem Regal links vom Spiegel befand sich ein Buch, um dessen Rücken Pedro seine fleischige Hand legte. Er zog den Band hervor, brachte ihn zu der Eichenholztheke und ließ es mit einem Knall darauf fallen. Eine Staubwolke stieg von der Bindung auf.
Pedro strich mit den Fingern über den vorderen Einband des Buches, fuhr die Goldschnitt-Beschriftung nach. Er atmete tief durch und seufzte.
»Hast du von Enoch gehört?«,
Zeke blickte auf das Buch. »Ja.«
»Hat Uriel dir von ihm erzählt?«
»Nein«, sagte er. »Das war Gabe.«
»Gabe?«
Zeke nickte. »Ja.«
Pedro trat von der Theke zurück und rief: »Gabe! Komm mal her.«
Gabe gehörte genau wie Uriel zu einer Gruppe von Söldnern, die sich selbst die Watcher nannte. Sie arbeiteten für Pedro. Sie waren mächtig, loyal und, soweit Zeke sagen konnte, unsterblich.
»Was ist los, Boss?«, fragte Gabe.
Gabe war ein muskulöser Mann mit schrankbreitem Brustkorb und kantigem Körperbau. Auf dem Hals hatte er den Schriftzug tätowiert: Fürchte dich nicht. Zeke straffte die Schultern und drückte die Brust heraus, als Gabe neben ihn trat.
Pedro tätschelte das Buch. »Du hast mit Zeke über Enoch gesprochen?«
Gabe zuckte mit den Schultern. »Vielleicht. Ich glaube, Phil hat es ihm erklärt.«
»Phil«, sagte Pedro ausdruckslos.
»Vielleicht war es Phil«, sagte Zeke. »Ich glaube aber, dass Gabe auch über ihn gesprochen hat.«
Phil war ein anderer Watcher. Er spielte gerade Karten an einem Tisch am anderen Ende des Saloons.
»Was hat Phil über Enoch gesagt?«, fragte Pedro.
Gabe zuckte mit den Schultern. »Ich glaube, er hat gesagt, dass Enoch ein Reisender war. Er hat Gutes und Böses gesehen. Er hat Missstände gesehen und versucht, sie in Ordnung zu bringen. Manche Leute glauben, dass es ihn wirklich gegeben hat. Andere nicht.«
»Danke, Gabe«, sagte Pedro.
»Klar. Brauchst du sonst noch etwas?«
»Das ist alles.«
Gabe kehrte zur Jukebox zurück, wo eine aufreizende Frau in Strumpfhose auf ihn wartete. Zeke wusste nicht, wie die Frau hieß oder wie lange sie schon hier war. Ihre Körpersprache sagte ihm, dass sie Gabe mochte. Sie griff nach einem seiner Bizepse, als er sie erreichte. Sie kicherte. Er lachte.
»Zurück zu dem Buch«, sagte Pedro und konzentrierte sich wieder auf Zeke. »Und zu Enoch.«
Zeke räusperte sich und drehte sich zur Theke um. Er stützte sich mit beiden Ellbogen darauf ab.
»Enoch«, fuhr Pedro fort, »war Noahs Urgroßvater. Kennst du Noah?«
»Die Arche«, sagte Zeke. »Aber ich dachte, dieses Zeug wäre eine Legende, die dazu da war, die Menschen zu warnen, nur ja gut zu sein. So etwas wie eine … wie eine …«
»Eine Allegorie«, sagte Pedro.
»Ja«, sagte Zeke. »Eine Allegorie.«
»Es ist, was immer du willst, Zeke.«
»Okay.«
Pedro öffnete das Buch. Der Rücken knackte.
»Enoch«, sagte er, »glaubte, in die Zukunft sehen zu können.«
»Wie ein Prophet?«, fragte Zeke.
Pedros Mundwinkel hoben sich zur Andeutung eines Lächelns. »Nicht genau. Er dachte, er könnte sehen. Das heißt nicht, dass es so war. Dieses Buch, sein Buch, ist kein religiöser Text. Nicht offiziell.«
Pedro strich mit den Fingern über eine Seite. Er senkte das Kinn.
»Die ersten sechsunddreißig Kapitel dieses Bandes heißen ‚Das Buch der Watcher‘«, sagte er. »Watcher ist eine freie Übersetzung des Original-Textes. Genau übersetzt bedeuten die Worte ‚die Wachen‘, weil Watcher niemals schlafen. Zumindest brauchen sie keinen Schlaf.«
»Ist das Buch über Uriel, Gabe, Phil …«
Pedro unterbrach Zeke mit einem herzlichen Lachen. »Nein«, sagte er und kicherte. »Das Buch stammt aus einer Zeit lange vor den heutigen Watchern.«
Er beschrieb mit der Hand einen weiten Bogen, wie ein Zauberer, der das Ende eines Tricks ankündigt. Sein Blick blieb auf Zeke gerichtet.
»Die Watcher behüten seit Langem das Gleichgewicht von Gut und Böse, Ezekiel. Seit sehr langer Zeit.«
Zeke rutschte auf dem Barhocker herum. Der Lärm des Trinkens, Tanzens und Spielens hinter ihm schien zu verstummen. Seine Aufmerksamkeit war gefesselt.
»Es gab schon lange vor Uriel Watcher, lange vor dir, und, wenn es das Gleichgewicht so will, wird es auch lange, nachdem du deine Pflicht erfüllt hast, Watcher geben«, sagte Pedro.
»Wenn es das Gleichgewicht will? Was bedeutet …«
Ein Tumult am gegenüberliegenden Ende des Saloons unterbrach ihr Gespräch. Kunden der Bar sammelten sich an den Schwingtüren des Eingangs.
Sie schauten nach draußen. Ihre Gesichter badeten in hellem Sonnenlicht. Das Schwatzen wurde lauter. Phil stand ganz vorn in der Gruppe. Er winkte Pedro leicht drängend zu sich.
Pedro schloss das Buch und stellte es auf das Alkoholregal zurück. Er schnipste mit den Fingern, und die Musik hörte auf. Im Saloon wurde es still. Alle beobachteten, wie Pedro um die Theke herum und entschlossen zum Eingang ging.
Zeke sprang von seinem Hocker und folgte ihm, er schritt durch den Durchgang zwischen den Menschen, den Pedro überall hervorrief, wo er ging. Die Menschenmenge an der Tür war buchstäblich regungslos. Nur das Geräusch ihrer Stiefel, die über die Holzplanken des Fußbodens schabten, durchbrach die Stille.
Pedro schob sich durch die Türen. Sie quietschten in den Angeln, als sie hin und her schwangen. »Was ist los?«, fragte Zeke.
Er richtete die Frage an alle, an irgendjemanden. Niemand antwortete. Zeke drängte sich zum Eingang durch und blinzelte im grellen Licht, das von draußen hereinfiel.
Bevor sich seine Augen daran gewöhnen konnten, hörte er etwas, das wie platschendes Wasser klang. Er trat an Phil und Gabe vorbei auf die breite vordere Veranda des Saloons und ging auf die Treppe zu. Pedro streckte einen Arm aus und hielt ihn auf.
Zeke blinzelte, bis er seine Umgebung klar sehen konnte, und ihm blieb der Mund offenstehen. Das Wüstenland, das den Saloon umgeben hatte, und in dem es nur eine schmale, zweispurige Straße gegeben hatte, die zum Saloon führte, war verschwunden. Zumindest konnte er es nicht mehr sehen. Statt des ausgedörrten Landes, das sich meilenweit erstreckte, sah er einen endlosen Ozean. Das Wasser war tiefblau und reflektierte den wolkenlosen Himmel darüber. Der Horizont wirkte, als wäre er Millionen Meilen entfernt.
So etwas hatte Zeke noch nie zuvor gesehen. Ein salziger Geruch stieg ihm in die Nase. Die Salzluft schien in seiner Kehle zu kleben.
Wellen klatschten gegen die Veranda, und ein Mann patschte auf sie zu, der gleichzeitig zu schwimmen wie um sich zu schlagen schien. Dicht hinter ihm war dieselbe Horde Männer, die auch Zeke gejagt hatten, bis er Zuflucht im Saloon gefunden hatte. Statt ihn mit Motorrädern, Trucks und Muscle Cars zu verfolgen, jagte ihn der wütende Mob in langen Booten. Sie ruderten schnell und gleichmäßig, tauchten die Ruder tief ins Wasser ein und hoben sie bei jedem Zug koordiniert wieder an.
Sie warfen mit Speeren und schossen Pfeile auf den Schwimmer. Die Geschosse trafen auf das Wasser um ihn herum. Eins traf seine Schulter und ließ ihn aufschreien. Trotzdem bewegte sich der Mann weiter. Er spuckte Wasser aus, während er seinen Körper fast wirkungslos von Seite zu Seite bewegte. Er war fast da.
Zeke stand da und sah mit großen Augen zu. Sein Puls beschleunigte sich. Ohne den Blick von der Jagd vor ihm abzuwenden, flüsterte er: »Was ist das?«
»Nicht jetzt«, sagte Pedro.
Ein weiterer Pfeil traf den Schwimmer. Dieses Mal in den Arm, den er aus dem Wasser hob. Blut spritzte aus der Wunde. Einen Augenblick verschwand der Mann unter Wasser, er gurgelte und stöhnte vor Schmerz.
Die Ruderboote näherten sich ihm. Der Schwimmer kämpfte. Seine Vorwärtsbewegung verlangsamte sich, aber es gelang ihm, den Kopf über Wasser zu halten.
Einige Meter von der Treppe entfernt schob er seinen Körper mit einem angespannten Grunzen aus dem Wasser. Mit rotem, vor Anstrengung verzogenem Gesicht stürzte er sich auf die Veranda. Pedro hockte sich hin und streckte seine große, fleischige Hand aus, gerade weit genug, um den Schwimmer zu erreichen. Er umfasste das Handgelenk des Mannes und zog, hievte ihn auf die gehobelte Holzveranda.
Die Horde hörte zu rudern auf. Ein letzter Speer, der vor Pedros Zugriff geschleudert worden war, bohrte sich in das Geländer und blieb zitternd stecken. Dann trieben die Langboote, Kanus und Ruderboote nur noch langsam voran. Die Krieger an Bord starrten schweigend zum Saloon hinüber, auf das Opfer, das ihnen entgangen war.
Zeke entdeckte das lange, schmale Gesicht ihres Anführers, der im Bug des dichtesten Bootes stand. Ein Schauder durchlief ihn. Er erinnerte sich an ihn. Seine Nasenflügel weiteten sich, als er die Luft schnupperte, wie ein Wildhund auf der Jagd.
Er grinste höhnisch und entblößte gelbe Zähne, die spitz gefeilt waren. Er leckte mit der Zunge darüber und schmatzte mit den Lippen. Das Geräusch hallte auf dem Wasser wider.
Der Schwimmer lag mit dem Gesicht nach unten auf der Veranda. Sein Rücken hob und senkte sich schnell, wässriges Blut rann wie ein Bach darüber und über seine Arme. Er grunzte beim Atmen leise.
Pedro ließ den Arm des Mannes los und richtete sich neben ihm auf. Dann zeigte er auf die Horde.
»Das wäre alles, meine Herren«, sagte er. »Ihr kennt die Regeln. Mein Freund hier ist auf geweihtem Boden.«
Die Horde antwortete nicht. Keins der Boote rührte sich. Sie trieben in der Strömung, doch Zeke bemerkte, dass sie sich dem Insel-Saloon trotzdem nicht näherten.
»Komm schon«, sagte Pedro. »Hilf mir mit ihm.«
Zusammen zogen Zeke und Pedro den Mann auf die Füße. Jeder von ihnen zog sich einen seiner Arme über die Schultern. Der Mann schrie bei der Bewegung, schließlich waren zwei Pfeile in seinem zerschundenen Körper vergraben. Sie überquerten die Schwelle des Saloons, wobei die Füße des Schwimmers eher über den Boden schleiften, als dass er ging. Die Menschenmenge teilte sich.
»Bringen wir dich nach oben«, sagte Pedro.
Der Schwimmer rang nach Luft. Seine Stimme war rau. »Wo bin ich?«
Zeke wollte dieselbe Frage stellen.
Wie hatte die Wüste sich in einen Ozean verwandelt, wenn in seiner Welt doch alle Meere ausgetrocknet waren?, fragte er sich. Warum? Wann? Was hatte es zu bedeuten?
Für Zeke war dieser Ort voller unbeantworteter Fragen. Jedes Mal, wenn er dachte, er würde das Jenseits verstehen, erfuhr er, wie wenig er begriff.
Der Schwimmer flüsterte heiser: »Was ist das hier für ein Ort?«
Pedro sagte nichts und musterte Zeke mit einem Blick, der ihm bedeutete, nicht zu antworten. Sie erreichten die Treppe und begannen mit dem langsamen Aufstieg, eine Stufe nach der anderen. Das im wahrsten Sinne des Wortes tote Gewicht des Schwimmers belastete Zekes Beine und Rücken bei jedem Schub auf die nächste, höhere Stufe.
Der Kopf des Schwimmers hing tief herunter, das Kinn lag auf seiner Brust. Er roch nach Meerwasser, Schweiß und Blut. Zeke hielt wegen der Hebelwirkung sein Handgelenk fest. Die Haut war nass und kalt. Sein Puls war schwach.
Der Mann hob seinen Kopf zu Zeke, als sie eine weitere Stufe erklommen. »Wer bist du?«, flüsterte er.
Der Barkeeper antwortete für Zeke. »Ich bin Pedro. Mir gehört dieser Ort.«
Sie erreichten den oberen Treppenabsatz und halfen dem Mann in ein Zimmer am gegenüberliegenden Ende der oberen Etage. Zeke spürte die aufmerksamen, interessierten Blicke von allein unten im Saloon, als sie die Galerie entlanggingen.
Keine Musik. Kein Dart- oder Kartenspiel. Keine klirrenden Gläser oder Gespräche.
Zeke fragte sich, ob genau das passiert war, als er vor nicht allzu langer Zeit hier eingetroffen war. Er konnte sich nicht an die Zeit zwischen seiner Ankunft und dem Augenblick, als er im Bett aufwachte, erinnern, als er auf wundersame Weise geheilt war.
Als sie das Zimmer erreichten, schob Pedro die Tür auf und brachte sie hinein. Er wies mit dem Kinn auf das Bett und Zeke half ihm, den Schwimmer auf die Matratze zu legen.
Erst da bemerkte Zeke, dass der Schwimmer bewusstlos war. Zwischen seiner letzten Frage und dem jetzigen Zeitpunkt hatte er den Kampf ums Wachbleiben verloren. Zeke fragte sich, ob es Schmerz oder Erschöpfung war, die den Fremden in einen unruhigen Schlaf getrieben hatte. Wahrscheinlich beides.
Sie legten den Schwimmer auf die Seite. Die beiden langen Pfeile ragten aus ihm heraus.
»Die müssen wir abschneiden«, sagte Pedro. »Könntest du zu Uriel runterrufen? Sie weiß, wo mein Werkzeugkasten ist.«
»Werkzeugkasten?«, fragte Zeke.
Pedro wischte sich die Hände an den Seiten seiner Lederweste ab. »Medizintasche.«
Zeke stand einen Augenblick da und taxierte den bewusstlosen Mann auf dem Bett. Er war der erste Fremde, der seit Zekes Ankunft den Saloon erreicht hatte, wie lange das auch immer her sein mochte. Ein paar Tage? Ein paar Wochen?
Zekes Freundin war jetzt auch hier, sie erholte sich den Flur hinunter in einem Zimmer, das genau wie dieses hier war. Er war bei ihrer Ankunft allerdings nicht dabei gewesen. Sie war keine Fremde. Hatte das etwas zu bedeuten?
Pedro hob eine Braue. Ein warmes Lächeln breitete sich unter seinem dicken Schnurrbart aus.
»Du hast viele Fragen, nicht wahr, Ezekiel?«
»Immer«, antwortete Zeke.
»Irgendeine, die ich beantworten kann, bevor du mir die Werkzeugkiste holst? Wir haben Zeit für eine oder zwei.«
»Was zur Hölle ist gerade passiert?«
Pedro starrte Zeke einen Augenblick an, bevor er antwortete. Er rieb sich den Bart, als würde er darüber nachdenken, wie er am besten darauf antworten sollte.
»Neuankömmlinge bringen Teile ihrer Welt mit«, sagte er. »Eine vertraute Landschaft hilft bei dem Schock des Übergangs.«
»Der Mann kommt aus einer Welt, die mit Wasser bedeckt ist?«
»Ja.«
»Ist es die Erde?«
»Natürlich«, sagte Pedro. »Alle hier kommen von der Erde. Sie kommen aus verschiedenen Zeiten und Versionen.«
Zeke war nicht sicher, ob er Pedro richtig verstanden hatte. »Verschiedene Versionen?«
Pedro lächelte wieder. Dieses Mal war es das wissende Lächeln eines Vaters, der seinem Kind etwas so Offensichtliches erklärte, dass das Kind die Wahrheit hätte erkennen müssen, ohne dass man sie ihm erklärte.
»Es gibt mehr als eine Erde, Ezekiel«, sagte er. »Darum ist das Gleichgewicht so schwer beizubehalten.«
Zeke wusste nicht, was er fragen sollte. Er war schwindelig, fast desorientiert von dieser neuen Information. Er dachte an das Wasser, an die Horde, an seine eigene Ankunft im Niemandsland. Sein Magen zog sich zusammen.
»Was ist mit meinem Auto?«, fragte er.
Pedro neigte den Kopf zur Seite. »Der Superbird? Was soll damit sein?«
Zeke warf dem Barkeeper seinen ungläubigsten Blick zu. »Das Wasser? Überall? Mein Auto ist da draußen.«
»Es ist alles in Ordnung, Zeke.«
Die Anspannung verließ seinen Körper. Er wusste nicht, was er denken sollte. Ein Teil von ihm glaubte, dass sein Gehirn explodieren würde, wenn er zu sehr versuchte zu verstehen, was Pedro sagte. Er starrte den Fremden auf dem Bett verblüfft an – ein Mann von einer anderen Version der Erde.
»Wer ist er?«, fragte er.
Pedro drehte sich zum Bett um und trat einen Schritt auf den Schwimmer zu. Der Mann atmete schnell und flach. Sein blutiger Körper zitterte fast unmerklich, er lag weiterhin auf der Seite.
»Sein Name ist Lucius Mander«, sagte Pedro. »Und er ist deine erste Mission.«
Kapitel 3
Desmond Branch stand am Rand des steinigen Strandes. Es hatte aufgehört zu regnen, aber die Luft war schwer vor Feuchtigkeit. Hinter ihm klatschte die Brandung gegen die unebene Küste. Vor ihm knieten ein Dutzend Männer und Frauen. Einige von ihnen wimmerten. Andere waren stoisch, hatten den Blick abwesend in die Ferne gerichtet.
»Ich weiß, dass jemand auf dieser Insel Informationen hat«, sagte er. »Ich werde weiter einen nach dem anderen umbringen, bis niemand von euch mehr übrig ist.«
Eine dünne Frau in der Mitte der knienden Dorfbewohner warf ihm einen bösen Blick zu. In ihrem Blick lag ein Trotz, den Branch bisher nur selten gesehen hatte.
»Tu das Schlimmste, was dir einfällt«, platzte sie hervor.
Branch trat einen unsicheren Schritt auf sie zu. Die Steine unter seinen Füßen rutschten und schabten unter seinem Gewicht.
Die Frau war jung. Ihre Haut war hell, fast wie Alabaster. Hohe Wangenknochen dominierten ihre ansonsten zarten Gesichtszüge. Algengrüne Strähnen zogen sich durch ihr langes, goldenes Haar. Wäre sie nicht so unverschämt gewesen, hätte Branch sie wahrscheinlich für schwach gehalten. Stattdessen war sie eine Anführerin. Sie hatte Mut.
Damit kann ich arbeiten, dachte er. Sie weiß etwas.
Branch blieb vor ihr stehen und senkte den Blick zu ihr in dem Versuch, sie einzuschüchtern. Sie sah ihn nicht an. Ihr Blick war geradeaus gerichtet, ihre Miene immer noch düster.
Er ließ sich in die Hocke nieder und balancierte sein Gewicht auf den Fußballen. Ein schmales Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus.
»Und wer bist du?«, fragte er.
Ihre Miene, dunkel und wütend, änderte sich nicht, als er sie düster ansah und sie ihm antwortete.
»Ich bin diejenige, die dich töten wird«, sagte sie, und jedes Wort war giftgetränkt.
Branch hob das Kinn und lachte. Er stützte die Arme auf den Schenkeln ab und musterte die Reihe der vor ihm kauernden Menschen. Leise Schreie übertönten das Krachen der Brandung.
Statt mit dem wütenden Mädchen zu reden, streckte er die Hand aus und berührte den faltigen Mann neben ihr. Er zuckte zusammen und sah Branch blinzelnd an, sagte aber nichts. Sein Gesicht sah wie eine topografische Karte aus. Die Tränen, die ihm über die Wangen liefen, folgten den Falten wie Wasser, das durch ausgetrocknete Flussbetten rann.
»Wie heißt sie?«, fragte Branch.
Das Kinn des Mannes zitterte. Sein Mund öffnete und schloss sich. Sein ängstlicher Blick schoss zwischen dem Piraten und dem Mädchen hin und her.
»Du kannst mit mir reden«, sagte das Mädchen. »Lass nicht andere nach deiner Pfeife tanzen. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Bist du schwach, Desmond Branch?«
Sie sagte seinen Namen, als hätte sie dabei etwas Verdorbenes im Mund. Branch hob überrascht eine Braue. Die meisten Menschen zuckten vor ihm zurück. Nur wenige boten ihm die Stirn. Und unter ihnen war noch nie ein Mädchen gewesen.
»Wie alt bist du?«, fragte er.
Die Andeutung eines höhnischen Lächelns spielte um ihre Mundwinkel. »Ich beantworte eine deiner Fragen«, sagte sie. »Was willst du wissen, meinen Namen oder mein Alter? Du kannst nicht beides haben.«
Ohne Vorwarnung schlug Branch dem Mädchen mit dem Handrücken ins Gesicht. Bei dem Klatschen keuchten einige Leute, und das Wimmern wurde lauter. Das Mädchen sagte jedoch nichts. Ihr Kopf hing zur Seite, ihr Kiefer war angespannt, und die rechte Seite ihres Gesichts rötete sich.
Branch knurrte: »Ich bekomme, was immer ich will.«
Er stützte sich mit den Händen ab und stand auf. Jetzt ragte er über dem Mädchen auf und ging vor der Reihe kniender Dorfbewohner auf und ab. Seine Wachen richteten ihre Waffen auf sie.
Etwa fünfzig Meter ins Inland hinein saßen zusammengedrängt die übrigen Dorfbewohner. Auch sie wurden von Wachen bedroht und unter Kontrolle gehalten. Alle, bis auf das Mädchen, hatten eine Körperhaltung, die Branch sagte, dass sie Angst vor ihm hatten. Sie waren die Schwachen und würden ihm keinen Widerstand leisten.
Er war sich außerdem sicher, dass die Eltern des Mädchens sich nicht unter den Leuten auf der Insel befanden. Er konnte es an den Mienen und an der Körperhaltung sehen, als er beobachtete, wie die anderen auf seinen Schlag reagierten. Das Mädchen war allein. Sie hatte nichts zu verlieren.
Branchs Erfahrung nach waren Menschen, die alles zu verlieren hatten, Feiglinge. Sie ließen Angst ihre Handlungen und ihr Leben bestimmen.
Diejenigen, die nichts mehr zu verlieren hatten, waren gefährlich. Sie handelten leichtsinnig. Sie widersetzten sich der gängigen Meinung. Sie forderten Autorität heraus.
»Ich suche nach einer Karte«, sagte er. Seine Stimme dröhnte, übertönte das Krachen der Brandung auf den größeren Felsen an der Küstenlinie der kleinen Insel. »Diese Karte ist alt. Sie ist etwas Besonderes. Ich weiß, dass die Karte hier ist.«
Branch hielt inne und musterte die Mienen der Inselbewohner. Außer dem Mädchen sah ihn niemand an. Er verlagerte sein Gewicht und fing an, den steinigen Strand entlangzugehen. Seine Stiefel traten gegen die glatten, grauen Steine. Sie quietschten und rieben sich aneinander, als er über sie hinwegging, die Hände jetzt hinter dem Rücken verschränkt.
»Ich habe diesen gottverlassenen Planeten von Inselgruppe zu Inselgruppe, von Schiff zu Schiff auf der Suche nach dieser Karte bereist«, fuhr er fort.
Er blieb stehen, drehte sich um und ging den Weg zurück. Mit einer weit ausholenden Armbewegung unterstrich er seine ausgedehnte Suche.
»Ich habe alles getan, was mir nötig erschien, um an diese Karte zu gelangen. Die Karte ist hier. Bis ich sie in den Händen halte, werdet ihr einer nach dem anderen sterben.«
Branch blieb vor dem trotzigen Mädchen stehen. Er machte um des Effekts wegen eine Pause, atmete tief durch, und ein dicker, kalter Regentropfen traf seine Wange. Dann noch einer und noch einer.
Donner dröhnte über ihren Köpfen, als der Platzregen erneut einsetzte. Regenvorhänge rauschten über die Insel. Das Geräusch des Regens auf den Felsen, der Brandung und den Dächern der ärmlichen Hütten war fast betäubend. Branch gab einer seiner Wachen ein Zeichen und zeigte auf den mürrischen Mann neben dem Mädchen.
»Fang mit ihm an«, sagte er. »Dann such dir noch neun andere aus. Das Mädchen lässt du aus.«
Die Wache, die Branch am nächsten stand, ein Mann namens Limahong, marschierte auf den alten Mann zu. Er stieß mit seiner Waffe nach ihm und befahl ihm, aufzustehen. Statt zu gehorchen, hob der Mann abwehrend die Hände.
»Nehmt das Mädchen«, schrie der alte Mann. »Sie weiß von der Karte.«
Limahong sah Branch an und wartete auf neue Anweisungen. Der Piratenkapitän hob die Hand und schnipste mit den Fingern, damit die Wache einen Schritt zurücktrat. Limahong zog sich zurück, hielt seine Waffe aber weiterhin auf den alten Mann gerichtet.
Das Mädchen hatte überhaupt nicht auf den Verrat des alten Mannes reagiert. Das sagte Branch, dass der Verräter recht hatte. Sie wusste etwas. Branchs Lächeln kehrte zurück.
»Ich habe mich für eine Frage entschieden«, sagte er zu ihr. »Wie heißt du?«
»Anaxi«, antwortete sie mit Stolz in der Stimme. »Anaxi Mander.«
»Ah, Mander«, sagte Branch und wies mit dem Daumen über seine Schulter, Richtung Ozean. »Ich habe gerade einen Mander kaltgemacht. War er dein …«
»Vater. Lucius war mein Vater.«
»Und deine Mutter?«
»Ich habe keine Mutter.«
»Sehr gut«, sagte Branch. Er beugte sich herunter, um ihr erneut direkt in die Augen zu starren. »Ich dachte, dein Selbstbewusstsein rührt daher, dass du nichts zu verlieren hast. Ich lag falsch.«
Kapitel 4
Durch den Regenvorhang beobachtete Anaxi Mander, wie das einzige Zuhause, das sie je gekannt hatte, am Horizont verschwand. Sie zitterte in der Kälte. Ihre Kleidung, die aus kaum mehr als Lumpen bestand, war durchnässt und klebte an ihrem dünnen Körper.
Sie war allein im Heck des Schiffes. Tränen mischten sich auf ihrem Gesicht mit dem Regen, und sie schmeckte Salz auf ihren Lippen. Das war es, wovor sie sich immer gefürchtet hatte, die Zeit, auf die sie sich ständig vorbereitet hatte.
Anaxi dachte an ihren Vater Lucius. Sie hatte nie einen freundlicheren Mann kennengelernt. Natürlich war ihre Erfahrung begrenzt. Die einzigen Menschen, mit denen sie Kontakt hatte, waren die sechsundneunzig Mitglieder ihres Stammes und gelegentliche Seefahrer.
Eine Seefahrerin, der sie nie begegnet war, war angeblich ihre Mutter. Lucius sprach selten von der Frau und hatte Anaxi nur erzählt, dass sie Josephine hieß und dass sie den Stamm sieben Tage nach der Geburt verlassen hatte.
Keine Nachricht. Keine Erklärung. Ein lauer Wind ließ die schlaffen Segel über ihr flattern, was fast das tuckernde Geräusch des Motors hinten am Schiff übertönte. Anaxi sah zu dem blubbernden, aufgewühlten Wasser hinunter. Sie hatte noch nie einen funktionierenden Motor gesehen. Ihr Vater hatte ihr von Motoren und Treibstoff erzählt. Sie erschienen ihr geheimnisvoll, wie etwas aus einem Traum. Jetzt stand sie über einem dieser Motoren, der dröhnte.
Die Saladin hatte drei Masten: der Besanmast im hinteren Teil des Schiffes, der Hauptmast in der Mitte des Schiffes und der Fockmast im Bug. Es gab eine lange Stange, die sich diagonal vom Bug des Schiffes aus erstreckte und kleine Ausleger mit dem Fockmast verband. Sie dienten als kleine Spinnaker, die dem Schiff unter den richtigen Bedingungen zusätzliche Geschwindigkeit verliehen. Zumindest meinte Anaxi, es aus Gesprächsfetzen der Matrosen an Bord so verstanden zu haben.
An Deck gab es zwei Katapulte, jeweils eins Steuerbord und eins Backbord. Die Mangonels befanden sich neben den Standardkanonen auf Rädern, die auf kurzen Schienen montiert waren, um den Rückstoß abzufedern. Die Rahmen der beiden Mangonels waren in den Deckenplanken und in den Querbalken verankert, die unter Deck in den Bauch des Schiffes führten. Wasser schwappte in die Ladekammern. Anaxi dachte über die Katapulte nach. Sie waren eine seltsame Wahl für ein Piratenschiff.
Unaufhörliche Tränen ließen ihren Blick verschwimmen, aber sie starrte aufs Wasser. Irgendwo unter der Oberfläche war ihr Vater. Er war fort. Wie ihre Mutter würde sie ihn nie wiedersehen.
Sie schloss die Augen und dachte an ihn. Es war erst einige Stunden her, dass die Gangster ihn auf das Boot gezerrt hatten und sie zusehen musste, wie er sich von ihr entfernte, wobei sie wusste, dass er nicht zurückkommen würde. Er hatte sie gewarnt, dass dieser Tag kommen würde. Er würde von ihr getrennt werden, und ihr Training würde zu Bedeutung kommen.
Sie hatte eine Lieblingserinnerung von ihm. Er stand am Strand und brachte ihr bei, flache Steine auf dem Wasser hüpfen zu lassen. Die Sonne schien. Ein leichter Wind wehte vom Meer. Er lächelte und lachte mit ihr, als sie versuchte, mit seitlichen Armschwüngen die Steine in die Brandung zu schleudern.
Er hob selbst einen Stein auf und hielt ihn zwischen Daumen und Zeigefinger. Er leitete sie an, dasselbe zu tun und korrigierte mit seiner freien Hand ihren Griff.
Anaxi erinnerte sich, dass sich der Stein in ihrer Hand kühl anfühlte. Die Berührung ihres Vaters war warm.
»Ana, so musst du ihn halten«, hatte er gesagt.
Lucius beugte die Knie, machte einen Schritt vorwärts und schleuderte den Stein, der sich drehend auf das Wasser zuflog. Er traf einmal auf und prallte noch zweimal von der Oberfläche ab, bevor er in der Brandung versank.
Sie versuchte es erneut und ahmte seine Bewegungen nach. Sie ließ ihre rechte Schulter tief sinken, ließ das Handgelenk vorschnellen und warf den Stein. Er traf auf das Wasser auf und hüpfte einmal.
»Du hast es geschafft«, sagte er. »Gut gemacht.«
Lucius strahlte vor Stolz. Sie erinnerte sich, dass ihr eigenes Lächeln so breit war, dass ihre Wangen wehtaten. Anaxi rief sich das lächelnde Gesicht ihres Vaters wieder und wieder vor Augen. Sie speicherte ihn, sein windzerzaustes schwarzes Haar, die gebräunte Haut, die bernsteinfarbenen Augen, das breite Lächeln.
Wie lange würde sie sich an sein Gesicht erinnern können, bevor ihre Erinnerung daran verblasste? Tage? Wochen?
Ihr Vater hatte ihr erzählt, dass er sich nach so langer Zeit kaum noch an das Aussehen ihrer Mutter erinnern konnte. Er erinnerte sich nicht mehr an ihre Haarfarbe, an ihre Augenfarbe, an ihre Gesichtsform.
War sie groß oder klein? Dünn oder dick?
Er erinnerte sich nicht. Sie stand im Heck des Schiffes, musste auf dem stürmischen Ozean das Gleichgewicht halten und wollte nicht vergessen.
In ihrem Kopf beschrieb sie ihn sich immer wieder. Zerzaustes schwarzes Haar. Gebräunte Haut. Bernsteinfarbene Augen. Breites Lächeln. Groß. Schlank. Freundlich.
Eine Hand berührte sie an der Schulter, riss sie aus diesem Augenblick und ließ sie vor Schreck zusammenzucken. Es war der Pirat Branch.
»In welche Richtung sollen wir steuern?«, fragte er.
Anaxi unterdrückte die Tränen. Sie wollte nicht, dass dieser Mann sie weinen sah.
»Die Richtung?«, sagte er und nahm fälschlicherweise an, dass sie die Frage beim ersten Mal nicht verstanden hatte. »Um die Karte zu finden?«
»Wo immer du hinwillst«, sagte sie. »Du kannst jede Insel und jedes Atoll in diesem Teil der Welt absuchen und wirst ihr dabei nicht ein Stück näherkommen.«
Mit einem heftigen Ruck riss der Pirat sie herum, sodass sie ihn ansehen musste. Der Wind lag ihm im Rücken und blies ihm das Haar ins Gesicht, aber sie sah das Aufblitzen von ungezügelter, verzweifelter Wut. Er sprach durch seine gelben Zähne, wobei seine Spucke auf ihr Gesicht sprühte.
»Spiel keine Spielchen mit mir«, sagte Branch. »Du hast hier keine Macht. Ich kann dich zum Reden bringen.«
Dieses Mal war es an ihr zu lächeln, und sie tat es. Dann lachte sie ihn aus. Sein Gesicht wurde feuerrot. Sein Griff um ihre Schultern wurde fester.
»Du verstehst es nicht«, sagte sie. »Ich spiele keine Spielchen. Du kannst nicht näher an die Karte herankommen, als du es bereits bist.«
Die Miene des Piraten verhärtete sich. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, brachte jedoch kein Wort hervor. Er nahm die Hände von ihren Schultern und trat zurück. Regen peitschte zwischen ihnen herunter. Der Rumpf des Schiffes knarrte, als es sich durch immer höhere Wellen kämpfte.
Ein Blitz flammte über ihnen auf und spiegelte sich in den Augen des Piraten. Donner krachte und vertiefte sich zu einem Dröhnen, das durch Anaxis zitternden Körper vibrierte. Sie war sicher, dass er es jetzt verstand. Eine Erleuchtung.
Das Schiff schlingerte zu einer Seite und wechselte den Kurs. Anaxi verlor das Gleichgewicht und hielt sich Backbord am Seitendeck fest. Branch hielt das Gleichgewicht, unbeeindruckt von der plötzlichen Bewegung.
Der Baum des Hauptsegels ratterte, und das Flickwerk-Segel erschlaffte. Es schlug eine Weile vor und zurück, bevor es wieder Wind auffing und sich straff spannte. Das Schiff richtete sich wieder auf.
Ein Mann rief hinter dem Steuer hervor: »Entschuldigung. Ich versuche, im Wind zu bleiben. Bei dem Sturm ist das schwierig. Ich musste es erst hinkriegen.«
Branch winkte ab, ohne den Blick von Anaxi abzuwenden. Er verschränkte die Arme vor der Brust und kratzte mit klauenartigen Fingern den Bartwuchs unter seinem Kinn.
»Du hast die Karte jetzt?«
Sein Blick wanderte über sie, musterte sie prüfend. Seine Brauen zuckten vor Verwirrung, als sie nicht antwortete.
»Wie könntest du die Karte haben?«, fragte er.
Anaxi dachte darüber nach, wie sie die Frage beantworten sollte. Sie bemerkte einen Riss im Selbstbewusstsein des Piraten. Er war winzig, aber er war da. Jetzt hatte sie die Erleuchtung.
Damit kann ich arbeiten, dachte sie.
Auch wenn sie eine Gefangene war, hatte sie eine Möglichkeit. Sie wusste, wohin die Karte führte und nach welchem Schatz der Pirat suchte. Seit sie sich erinnern konnte, hatte ihr Vater ihr dieselbe fantastische Gutenachtgeschichte erzählt. Es war eine Geschichte über ihre Mutter, einen verborgenen Schatz und eine Karte, die einen Suchenden durch gefährliche Gewässer zu einem ebenso unsicheren Land leitete. Lucius hatte darauf bestanden, dass sie sich jede Einzelheit dieser Geschichte Wort für Wort einprägte. Das hatte sie getan.
Nicht in einer Million Jahren hätte sie ihrem Vater geglaubt, als er ihr gesagt hatte, dass sie eines Tages ihr Zuhause verlassen müsste. Sie hätte niemals erwartet, diese Gutenachtgeschichte benutzen zu müssen oder geglaubt, die Chance zu haben, selbst diesen Schatz zu finden. Dieser fiese Pirat war ihre Chance. Er war nicht so klug, wie er glaubte. Er war zwar brutal, aber sie konnte ihm Schlimmeres antun. Und wenn die Herausforderungen, die vor ihnen lagen, ihn nicht umbringen würden, würde sie es tun.
Anaxi wischte sich einen Film aus Wasser, Schweiß und Tränen vom Gesicht und fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Sie hob das Kinn und sah ihm in die Augen. Adrenalin durchflutete ihren Körper, und sie ballte ihre kleinen Hände zu Fäusten.
»Ich habe die Karte nicht«, sagte sie. »Ich bin die Karte.«
Kapitel 5
Zeke prüfte seine Handkarten. Ein Paar Damen starrte ihn an. Eine dritte Dame gab ihm drei einer Art auf dem Flop. Beim nächsten Turn verbesserte er sich mit einem Paar Dreien zu einem Full House. Nur er und Gabe waren noch im Spiel, als der Geber den River ausgab. Fünf Karten wurden umgedreht. Gabe war am Zug, er war an der Reihe zu wetten.
Gabe grunzte. Phil, der zwischen ihnen saß, lachte leise.
Uriel saß Zeke gegenüber und knabberte an ihren Nägeln. Sie hatte auf dem Flop gefoldet, wie sie es bei jeder Hand tat.
Sie zog den Finger aus dem Mund und lächelte spöttisch. Sie schlug mit der Handfläche auf den Tisch und warf den kleinen Stapel Chips vor Gabe um.
»Das ist keine Entscheidung auf Leben und Tod«, sagte sie ohne jede Ironie. »Es ist eine Single Hand.«
Gabe runzelte die Stirn. Er musterte erneut prüfend den Tisch. Dann rutschte er auf seinem Stuhl herum, sodass die Beine auf dem Boden schabten, und hob die Ecke seiner Hole-Cards an.
»Die verändern sich nicht«, stöhnte Uriel. »Es sind dieselben beiden, die dir ausgeteilt wurden.«
Zeke beobachtete Gabe aufmerksam. Es bestand die Möglichkeit, dass sein Gegner einen Vierling hatte. Er könnte die anderen drei auf der Hand halten. Es war unwahrscheinlich. Gabe hatte jedoch keine Ahnung, dass Zeke ein Paar Damen auf der Hand hatte.
Zeke war risikoscheu gewesen und hatte seine Karten konservativ gespielt, statt alles zu verwetten. Er hatte kleine Erhöhungen angeboten oder war mitgegangen, nichts Offensichtliches. Seine Miene war ausdruckslos und er hoffte, dass Gabe nicht den schnellen Puls an seiner Brust oder seinem Hals sah.
Gabe atmete tief durch. Er warf seine Karten in die Mitte des Tisches. »Ich bin raus.«
Zeke konnte sein Grinsen nicht unterdrücken. Ohne seine Gewinnerhand umzudrehen, schob er seine Karten in den unordentlichen Stapel zu seiner Linken. Er legte die Hände um seine Beute und zog sie zu sich heran.
Gabe hob eine Braue. »Du sagst mir nicht, was du gehabt hast?«
»Nein.«
Uriel lachte. »Gut für dich«, sagte sie. »Du bist ja vielleicht doch einer von uns.«
»Er ist einer von was?«, fragte jemand.
Die Stimme erklang hinter Zekes Rücken. Sie war männlich, aber sanft und unsicher. Der Mann räusperte sich, und Zeke drehte sich um. Es war Lucius Mander.
Zeke erkannte die großäugige Desorientierung auf dem Gesicht des Mannes. Seine Haut war blass. Sein Haar war eng an seinen Schädel gekämmt. Er trug ein weites Baumwollhemd und Baggypants mit Reißverschlüssen um die Oberschenkel. Seine Füße waren nackt. Er gab die erste Frage auf und stellte eine zweite. Dieses Mal war seine Stimme stärker.
»Wo bin ich?«
Uriel antwortete ihm. »Ich weiß nicht, ob du uns glauben würdest, wenn wir es dir erzählten.«
Lucius zuckte mit den Schultern. »Bei was?«
»Egal, was«, sagte Gabe.
»Bei beidem«, sagte Phil.
Zeke schob seinen Stuhl zurück und stand auf. Er streckte Lucius die Hand hin. »Ich bin Zeke Watson.«
Lucius nahm zögernd seine Hand und schüttelte sie, die Bewegung drückte Misstrauen aus. »Lucius Mander.«
»Das wissen wir«, sagte Uriel. »Du bist der neue Kerl. Ein ziemlich dramatischer Auftritt. Beeindruckend. Ich bin Uriel. Das ist Phil. Und Gabe. Und alle anderen.«
Lucius’ Blick schoss durch den Raum. Er ließ Zekes Hand los und verschränkte die Arme vor der Brust. Seine Schultern sackten nach vorn. Seine Augen verengten sich, und er musterte jetzt den Tisch, dann jeden der Kartenspieler.
»Ich erinnere mich kaum an etwas«, sagte er. »Ich meine, ich erinnere mich, dass ich hierher geschwommen bin. Ich erinnere mich, dass ich gejagt wurde von diesen … diesen …«
»Der Horde«, sagte Uriel. »Sie sind süß, oder? Mir gefällt der große, dunkle, gutaussehende Typ, aber zwei von drei dieser Dinge reichen mir.«
Sie zwinkerte Lucius zu, der eindeutig nicht wusste, was er von ihr halten sollte. Er runzelte verwirrt die Stirn. Er antwortete ihr nicht. Stattdessen sah er Zeke an.
»Der Barkeeper hat mir gesagt, dass ich zu dir gehen und einen Drink nehmen soll«, sagte er. »Und das tue ich. Ich meine, was ich getan habe.«
»Woher wusstest du, dass ich es bin?«, fragte Zeke.
»Der Hut.«
Zeke berührte den Stetson auf seinem Kopf. Er war ein Geschenk von Pedro. Der Hut war in der kurzen Zeit, die er ihn trug, zu einem Teil von ihm geworden. Er strich mit den Fingern die Krempe entlang und zog ihn etwas herunter, damit er besser saß.
»Lass uns gehen«, sagte er und führte Lucius vom Tisch zur Theke.
»Kann ich mitkommen?«, fragte Uriel, als sie an ihr vorbeigingen. Ihre Hand fuhr über Zekes Brust, ihre Fingernägel kratzten ihn.
»Vielleicht später.«
Ein paar Schritte vom Tisch entfernt beugte Lucius sich zu Zeke. Er flüsterte über den Lärm hinweg: »Wer ist sie?«
»Uriel«, sagte Zeke.
»Klar. Aber wer ist sie?«
»Wer ist jeder von uns?«, sagte Zeke. Er wusste nicht, was er an dem Neuankömmling sagen durfte und was er geheim halten musste. Vage zu bleiben, schien ihm die beste Option zu sein.
Sie erreichten die Theke und Zeke zeigte auf einen leeren Hocker. Lucius stieg hinauf und Zeke setzte sich neben ihn.
Pedro, der damit beschäftigt war, ein Glas abzutrocknen, wandte ihnen den Rücken zu. Er sah auf und musterte die Reflexionen im hinteren Spiegel.
»Was soll’s sein?«, fragte er. »Die erste Runde geht aufs Haus.«
Lucius schluckte schwer und legte die Handflächen fest auf die Theke. Als er sie wieder anhob, verschwand die Feuchtigkeit, die sie hinterlassen hatten, langsam. Der Neuankömmling war nervös. Das Ganze war verwirrend. Das wusste Zeke aus erster Hand. Er beugte sich zu Lucius.
»Das ist keine Fangfrage«, sagte er. »Du kannst nehmen, was immer du willst.«
»Wasser?«, bestellte Lucius, so als ob Wasser vielleicht nicht auf der Speisekarte stände. Oder vielleicht war er sich nicht sicher, ob es das war, was er wollte.
Pedro drehte sich um, das leere Glas in der Hand. Er legte das Tuch über die Schulter seiner Lederweste. Ein großer Schritt, und er stand direkt hinter der Theke.
»Mit oder ohne Eis?«, fragte er.
Lucius sah Zeke wie ein Kind an, das seine Eltern um Erlaubnis fragt. Zeke zuckte mit den Schultern.
Lucius räusperte sich und sagte: »Mit Eis.«
Pedro nickte. Dann lächelte er, und ein Anflug von Boshaftigkeit glitt über sein Gesicht. »Und nichts in dem Wasser mit dem Eis?«
Lucius schüttelte den Kopf. »Nur das Eiswasser.«
»Und du, Zeke? Whisky? Bourbon?«
Zeke klopfte mit den Knöcheln auf die Theke. Er musterte die Regale mit Alkohol, sein Blick blieb einen Augenblick am Rücken des großen Buchs über die Watcher hängen, das wieder an seinem Platz stand, und zeigte dann auf Pedro.
»Wie wäre es mit einem Bier?«, fragte er. »Phil hat ein Bier mit einem Anflug von Whiskey getrunken.«
Pedro ließ ein paar Eiswürfel ins Glas fallen und gab einen Schuss Wasser darüber. Er stellte das Glas auf die Theke und schob es zu Lucius. Dann hob er einen Finger und wackelte damit hin und her.
»Kentucky Bourbon Ale vom Fass«, sagte er. »Gute Wahl. Es ist ein Bier, das in Bourbon-Fässern gereift ist. Du weißt, dass die Fässer nur für einmaligen Gebrauch gut sind, wenn es um Bourbon geht. Dann werden sie für andere Zwecke eingesetzt. Es fügt dem Bier einen schönen, süßen Geschmack hinzu.«
Pedro verschwand durch eine Tür neben den Alkoholregalen. Nach einem Augenblick kam er mit ein paar Bierflaschen zurück. Er stellte sie auf die Theke vor Zeke und Lucius.
Zeke dankte ihm, prostete ihm zu und trank einen großen Schluck. Das Bier war gekühlt. Das Prickeln von Alkohol blubberte in seinem Kopf. Der Schluck begann mit dem aromatischen Anflug von Bourbon und schloss mit dem sauren Geschmack des Biers. Es war köstlich. Er trank schnell einen weiteren Schluck und bewegte ihn in seinem Mund herum.
»Ich wollte kein Bier«, sagte Lucius. »Danke. Aber mir reicht das Wasser.«
»Warten wir ab, wie du dich nach unserem Gespräch fühlst«, sagte Pedro. »Wenn du das Bier dann nicht willst, bin ich sicher, dass Ezekiel es sich gerne einverleibt.«
Pedro hatte recht. Zeke könnte dieses Bier den ganzen Tag trinken.
Lucius trank zögernd einen Schluck Wasser. Er leckte sich über die Oberlippe und machte mit dem Glas in der Hand eine ausholende Bewegung Richtung Bar. Die Eiswürfel klirrten aneinander.
»Was ist das hier für ein Ort?«, fragte er. »Wo bin ich?«
»Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst?«, fragte Pedro. »Das wäre ein guter Anfang.«
Dieses Mal trank Lucius einen größeren Schluck von seinem Wasser. Ein paar verirrte Tropfen rannen sein Kinn herab. Er wischte sie mit seinem Handrücken ab und entschuldigte sich.
»Kein Problem«, sagte Pedro. »Ist wohl schon eine Weile her, dass du Eis hattest?«
Lucius sah Zeke an und gab dann zu, dass er sich nicht an das letzte Mal erinnern konnte, als er ein kaltes Getränk hatte. Kaltes Essen, ja. Kalte Getränke, nein.
Pedro nahm das Tuch von seiner Schulter und wischte den Tresen um Lucius’ schwitzendes Glas Wasser trocken. Es war eine schnelle, professionelle Bewegung. Dann stützte er sich mit den Ellbogen auf dem Tresen ab, und seine kräftigen, gebräunten Unterarme schienen sich anzuspannen.
»Woran kannst du dich erinnern?«, flüsterte er.
Lucius räusperte sich. »Ich erinnere mich, dass ich das Schiff vor der Küste gesehen habe. Es war keins, das wir je zuvor gesehen hatten.«
Zeke drehte sich auf seinem Hocker, um Lucius anzuschauen, während er sprach. Er erinnerte sich, auf demselben Platz gesessen zu haben, ein Neuankömmling in einem fremden Land. Alles ergab Sinn, und doch auch wieder nicht. Es war surreal und lebhaft, wie ein Albtraum, nur ohne die Panik.
Lucius hatte die Augen geschlossen. Er drückte sie ganz fest zu. Seine Miene war schmerzerfüllt, als er die Erinnerung durchlebte.
»Es gab Händler, die zu Besuch kamen«, sagte er. »Doch das war keiner von ihnen. Wie sich das Schiff näherte, die Anzahl der Männer an Bord – wir wussten, dass es schlimm war.« Seine Hände ballten sich zu Fäusten, die Knöchel traten weiß hervor. »Wir versuchten, unsere begrenzte Verteidigung zu sammeln. Die Kinder versteckten sich. Die Frauen beschützten sie. Die Männer versuchten, zu kämpfen.«
Tränen liefen ihm die Wangen hinunter. Lucius’ Atmung beschleunigte sich. Jedes Wort war atemloser als das vorherige.
»Es waren zu viele von ihnen«, fuhr er fort. »Wir sind kein gewalttätiges Volk. Niemand auf unserer Inselkette kämpft. Wir sind friedlich. Wir sagten den Piraten, dass wir friedlich sind.«
Zeke drehte sich herum, um Pedro anzusehen. Er hob die Brauen und bildete stumm mit den Lippen das Wort ‚Piraten’?
Pedro erwiderte den Blick. Er runzelte die Stirn, hob einen Finger an die Lippen und schüttelte den Kopf.
»Sie trennten mich von meiner Tochter«, sagte Lucius. »Rissen mich von ihr weg und fuhren mit mir aufs Meer hinaus. Als ich ihnen nicht gab, was sie wollten … sie … er … ich …«