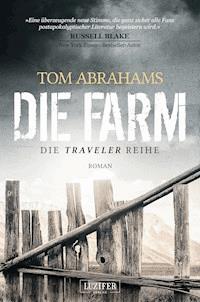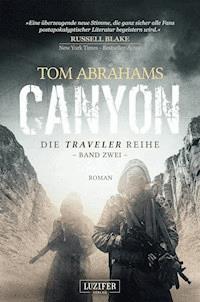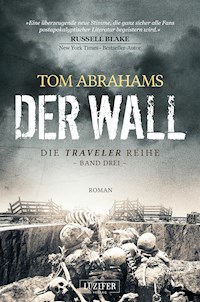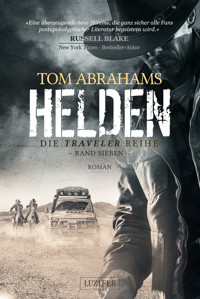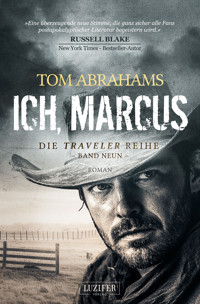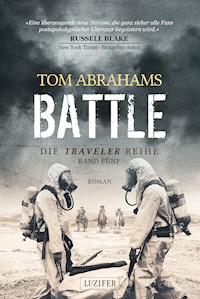
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Traveler
- Sprache: Deutsch
ER SEHNT SICH NACH FRIEDEN. ABER WO ER IST, DA HERRSCHT KRIEG. Marcus Battle ist ein gesuchter Mann. Ganz egal, wohin er geht oder was er tut – es gelingt ihm nicht, jenen zu entgehen, die ihm nach dem Leben trachten. Doch dann zieht eine neue Bedrohung auf. Noch gefährlicher als der Virus, der die Welt in einen dystopischen Albtraum verwandelte. Und sie hat das Zeug dazu, eine zweite Apokalypse heraufzubeschwören. Kann Marcus die neuerlichen Angriffe abwehren oder wird er schließlich einem unverhofften Gegner zum Opfer fallen? Die TRAVELER-Reihe – das sind actionreiche Endzeit-Abenteuer mit einem Schuss Neo-Western.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Battle
Traveler-Reihe – Band 5
Tom Abrahams
Übersetzt von Raimund Gerstäcker
Copyright © 2018 Tom Abrahams
Dieses Buch ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Schauplätze, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Wenn jeder für seine eigenen Überzeugungen kämpfen würde, gäbe es keinen Krieg.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: BATTLE Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Raimund Gerstäcker Lektorat: Manfred Enderle
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-661-0
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
5. Februar 2044, 12 Uhr mittags 11 Jahre und 4 Monate nach dem Ausbruch Baird, Texas
»Langsam werde ich zu alt für so was«, murmelte Marcus Battle.
Locker ließ er die Finger über dem Griff der Glock an seiner Hüfte spielen. Mit schulterbreit auseinandergestellten Füßen stand er fest auf dem rissigen, mit Löchern übersäten Asphalt. Zwischen seinen Beinen verlief die verblasste, ehemals gelbe Straßenmarkierung, die sich durch die Stadt zog. Trotz der trockenen Kälte dieses westtexanischen Winters war Marcus kurzärmlig angezogen. Schweiß sammelte sich in seinem Nacken und unter seinen Armen.
Seine Muskeln spannten sich an, und er fokussierte sich auf sein Ziel, das dreißig Yards von ihm entfernt auf der Straße stand. Er atmete langsam und gleichmäßig.
»Du bist also der, den sie Mad Max genannt haben«, höhnte die Zielperson. »Ich habe überall südlich des Walls von dir gehört.« Marcus positionierte seine Schultern über seinen Zehen. Es war die beste Körperhaltung, um seine Waffe abzufeuern.
»Man sagt, du hast das Kartell im Alleingang erledigt«, fuhr der Mann fort. »Hast den Dwellern den Rücken gekehrt, den Wall nach Norden überquert und bist zurückgekommen, um den größten Teil des Llano-River-Clans zu töten.«
Das Ziel hatte die Geschichte größtenteils korrekt wiedergegeben. In der Stimme des Mannes lag etwas Herausforderndes, aber auch Angst. Marcus konnte es hören, als der Mann den Groschenroman von Marcus Battles gewalttätigen Abenteuern nacherzählte. Er war der neueste in einer langen Reihe von Möchtegern-Haien, die Baird immer wieder umkreisten und in die Gewässer des Ortes eindrangen, in der Hoffnung, seinen legendären Sheriff zu fressen.
Doch Marcus war nicht tatsächlich der Sheriff. Diese Funktion gab es südlich des Walls in dem Gebiet, das einst als Bundesstaat Texas bekannt gewesen war, nicht mehr. Aber er hatte in Baird Menschen gefunden, die seine Führung brauchten. Sie hatten um seine Hilfe gebeten und er hatte bereitwillig zugestimmt.
Sechs Monate lang war es ein einfacher Job gewesen. Bis es sich herumgesprochen hatte. Die Dinge hatten sich verändert. Jetzt kamen fast im Wochenrhythmus einer oder mehrere junge Wahnsinnige und forderten ihn heraus. Sie standen mitten auf der Straße, riefen laut nach Marcus und verlangten ihre Chance auf Ruhm.
Dieser hier war groß und schmal. Seine Arme waren so lang, dass es komisch aussah. Zu diesem Eindruck trug auch bei, dass die Ärmel seiner Jacke weit vor seinen Handgelenken endeten. Seine weite, ausgebeulte Hose reichte gerade einmal bis zu seinen Waden. »Ich habe auch gehört, dass du keine Familie hast«, sagte der Schlaksige grinsend. »Du bist hier, weil dein Zuhause zerstört ist. Man sagt, dass du keinen Ort und keinen Menschen hast, zu dem du gehörst. Deshalb bist du hier. Das ist ganz schön erbärmlich, wenn du mich fragst.«
Am Anfang hatte Marcus versucht, den jungen Männern ihre Mission auszureden, ihnen Zuflucht vor der Gewalt und den Härten zu bieten, die den gesetzlosen, wilden Süden beherrschten. Keiner von ihnen hatte das Angebot angenommen. Einer nach dem anderen waren sie gescheitert, und Marcus hatte sie eigenhändig eine Meile außerhalb der Stadt begraben. Marcus’ Finger hatten zuerst Blasen bekommen, woraus die andauernde Arbeit mit der Zeit dicke Schwielen gemacht hatte.
Das Ziel änderte seine Haltung. Seine Hand schwebte noch immer über dem Holster an seiner Seite. »Früher habe ich geglaubt, was sie sagen!«, rief er. »Früher habe ich diese Geschichten geglaubt. Ich dachte, du wärst ein Riese, ehrfurchtgebietend und voller Muskeln!«
Noch eine Leiche, die ich vergraben muss, dachte Marcus.
Mit der Seite seines Daumens rieb er seinen juckenden Abzugsfinger.
»Du siehst ganz und gar nicht aus wie ein harter Typ«, rief das Ziel. »Alt siehst du aus! Ich bin überhaupt nicht beeindruckt, kein b…«
Das Neun-Millimeter-Geschoss bohrte sich mitten in die Stirn des Herausforderers und explodierte aus seinem Hinterkopf wieder hervor. Marcus hatte die Glock bereits wieder im Holster verstaut und den Verschluss zuschnappen lassen, als das ruhiggestellte Ziel erschlaffte und mit dem Gesicht voran zu Boden fiel. Sein Mund formte immer noch ein B, als sein Gehirn die Funktion einstellte und sein Herz aufhörte zu schlagen. Er hatte seine Waffe nicht gezogen.
»Jetzt hast du die Spannung komplett zerstört«, kommentierte Lou. Sie lehnte gegen die Backsteinfassade eines Gebäudes rechts von Marcus. »Er konnte nicht einmal mehr seinen Gedanken beenden.«
Marcus seufzte und kratzte sich am Bart. Es war wieder Zeit, sich zu rasieren. »Ich hatte genug gehört«, sagte er und ging zu Lou. »Ich habe halb damit gerechnet, dass du eine Klinge in ihn bohrst, bevor ich eine Chance zum Feuern bekomme.«
Lou zuckte mit den Schultern. Sie legte eine Hand auf eines der Messer, die in ihrem Hosenbund steckten. »Ich habe zumindest darüber nachgedacht«, sagte sie. »Er war aber auch wirklich ein gesprächiger Typ.«
Marcus stieg über den Bordstein auf den breiten, aus Beton gegossenen Gehweg, der die Straße von den langen Gebäudereihen auf beiden Seiten trennte. Es war die Main Street, die schnurgerade durch das Zentrum von Baird führte und einen Ort zeigte, in dem es dem Anschein nach genauso gut das Jahr 1894 sein konnte wie das Jahr 2044.
Marcus stellte sich neben Lou. »Ich wünschte«, sagte er, »diese Punks würden mein Angebot auf Zuflucht, Vergeben und Vergessen und so weiter nur ein einziges Mal annehmen. Aber sie sind zu stur und zu überzeugt von ihren Fähigkeiten.«
»Schon«, sagte Lou und verschränkte die Arme vor der Brust, »aber sie müssen nur ein einziges Mal besser sein als du. Du dagegen musst jedes verdammte Mal besser sein als sie.«
Marcus rieb seinen schmerzenden Nacken und presste seinen Daumen gegen einen verhärteten Muskel. Lou hatte recht. Ein Hitzkopf genügte, der mit der Waffe schneller war oder ein Verschlagener, der sich für eine Variante aus dem Hinterhalt entschied.
Er stupste Lou mit der Schulter an. »Hoffen wir, dass dieses unschöne Ereignis eher später als früher eintritt«, sagte er. »So, hilfst du mir jetzt mit der Leiche?«
Lou sah auf ihr leeres Handgelenk, als ob sie eine Uhr tragen würde. Sie tippte darauf. »Ich denke schon. Ich habe heute keine Termine mehr.«
Sie zogen die Leiche an den Straßenrand und luden sie in eine Schubkarre, die Marcus neben einem Gebäude aufbewahrte, das sie als Gefängnis für Eindringlinge und Tunichtgute benutzten, die nicht ganz das Niveau einer Hinrichtung erreichten. Lou griff nach einer gegen das Gebäude gelehnten Schaufel und warf sie zum Toten auf die Schubkarre.
Marcus packte die Schubkarre an den Griffen, hob sie an und schob sie auf ihrem verbogenen Rad zu den Grabstellen. Die Meile bis dahin war quälend lang. Sein Bein schmerzte. Er musste dagegen ankämpfen, nicht vor Schmerzen zu hinken.
»Hast du jemals Krieg und Frieden gelesen?«, fragte Lou, als sie den Rand der Stadt erreichten. Sie spielte mit ihren Messern, während sie neben Marcus ging. Immer wieder ließ sie in jeder Hand eines durch die Luft rotieren und fing sie wieder auf.
»Das Buch?«, fragte Marcus.
»Nein«, sagte Lou, »das Musical.«
Marcus griff die Schubkarre fester und runzelte die Stirn. »Musical?«
Lou schüttelte den Kopf. »Oh Mann. Natürlich das Buch. Du kannst unmöglich ein Musical lesen, Marcus. Manchmal bringst du mich echt zum Erstaunen.«
Marcus schob seine Brust nach vorn. »Danke«, sagte er. »Denn es ist mein Lebensziel, Louise zum Erstaunen zu bringen.«
Lou warf ihm einen finsteren Blick zu, ignorierte aber, dass er sie sarkastisch beim vollen Namen genannt hatte.
»Mein Dad hat mich dazu gebracht, es zu lesen. Er bestand darauf, dass das Buch ein Klassiker ist.«
»Du hast mir nie erzählt, dass dein Vater ein Sadist war«, sagte Marcus. »Das Buch ist sehr dick.«
»Dicker als die meisten, nicht so dick wie andere«, gab Lou zurück. »Mein Dad hat gesagt, Tolstoi habe das Buch geschrieben, ohne der Geschichte einen Helden zu geben. Er hatte recht. Es gibt wirklich keinen. Die Figuren bewegen sich irgendwie zufällig und interagieren ohne erkennbare Motivation. Manchmal können sie nicht erklären, warum sie tun, was sie tun.«
»Habe ich nie gelesen«, sagte Marcus.
Lou nickte. »Überrascht mich nicht.«
Marcus setzte die Schubkarre ab und streckte den Rücken durch. Er holte tief Luft und atmete mit aufgeblasenen Wangen kräftig aus. Er stemmte die Hände in die Hüften und drehte sich hin und her, als würde er Gymnastik machen. Dann beugte er sich vor, um die Schubkarre wieder anzuheben. Er deutete mit dem Kinn nach vorn, in Richtung der Gräber.
»Tolstoi porträtierte mehrere wohlhabende Familien und wie sie mit einer sich wandelnden Gesellschaft zurechtkamen«, sagte Lou. Sie steckte ein Messer ein und begann mit dem anderen, Dreck unter ihren Fingernägeln hervorzukratzen. »Vieles von dem politischen Zeug war zu hoch für mich, aber das Wichtigste habe ich verstanden.«
Stöhnend schob Marcus seine nutzlose Ladung einen Hügel auf dem schmalen Trampelpfad hinauf, den seine regelmäßigen Touren durch Unkraut und Gestrüpp gezogen hatten. »Was willst du mir mit dieser Geschichte sagen?«, fragte er. »Worauf willst du hinaus?«
»Warum«, fragte sie, ohne von ihren Fingern aufzublicken, »ganz egal, welche Art von Dreck man sich unter den Nägeln einfängt, hat dieser immer die gleiche dunkelgraue Farbe, wenn man ihn herauspult? Als wäre er so etwas wie der Rotz der Finger.«
Marcus ignorierte die Bemerkung und wiederholte seine Frage. »Was soll das Gerede über Tolstoi?«
»Was ich meine, ist, dass du nicht immer der Held der Geschichte sein musst, Marcus. Genauer gesagt musst du überhaupt nie der Held sein.«
Marcus kämpfte mit dem Gewicht der Schubkarre und lehnte sich stärker gegen den Anstieg. Er hatte ihn fast bezwungen. Danach würde ein sanftes Gefälle folgen, das bis zu den Gräbern führte.
Lou schnippte den Schmutz von einem Nagelende. »Du machst dir viel zu viel Druck, das ist alles, was ich sagen will. Diese Welt braucht keine Helden, Marcus. Diese Welt braucht Überlebende.«
Marcus schob die Unterlippe nach vorn und blies sich auf die schwitzende Nasenspitze. Er erreichte die Hügelkuppe und lehnte sich zurück, um das Gewicht unter Kontrolle zu halten, das die Schubkarre bergab zog. Sein Rücken protestierte, aber er schaffte es.
»Du musst dich nicht jedem dieser Idioten stellen, die wie aus dem Nichts auftauchen und dich nur zu ihrer Trophäe machen wollen«, sagte Lou. »Du könntest das auch einfach lassen. Du könntest dich zur Ruhe setzen. Du könntest …«
»Entspannt meinen Lebensabend genießen?«
Mit langen Schritten sprang Lou den Hügel hinunter. Sie nutzte ihren Schwung, ließ sich in einen leichten Lauf fallen und überholte Marcus. Am Fuß des Hangs kam sie schlitternd zum Stehen und drehte sich zu Marcus um, der alle Hände voll damit zu tun hatte, seine Last auf dem Weg nach unten zu kontrollieren.
»So ist es«, erwiderte sie. »Ich schlage ja nicht vor, dass wir deine Knochen verkaufen, damit sie Leim daraus machen. Ich sage nur, dass die Last nicht nur auf deinen Schultern liegt. Du hast mich. Du hast Rudy.«
Marcus ließ die Schubkarre ins Gras fallen und rieb sich die Hände an seinem Hemd. Er ging einige Schritte zu einer verkrüppelten Buscheiche und zog eine Schaufel aus der Erde. Erst zwei Wochen zuvor hatte er die Schaufel hier in den Boden gerammt, nachdem er den vorhergehenden Herausforderer vergraben hatte. Er ging die kurze Strecke zurück zur Schubkarre und zu Lou. Sie hatte ihr zweites Messer wieder herausgezogen und begann zu jonglieren.
»Sie kommen jetzt immer häufiger«, sagte Marcus. »Es fühlt sich an, als wäre ich eben erst hier gewesen.« Lou behielt die wirbelnden Messer im Auge, die sie von einer Hand zur anderen warf, fing und wieder in die Luft schnippte. »Warst du auch«, sagte sie. »Genau das ist mein Punkt. Und eines Tages …«
Marcus grinste nur und ließ die Schaufel zu Boden sinken. Er suchte die Fläche nach einer guten, frischen Stelle ab, um seinen neuesten Verehrer zu begraben. Allmählich ging ihm der Platz aus. Das Gelände war mit Steinen als Markierungen bedeckt, die Marcus an das Kopfende jedes Grabes gelegt hatte. Einige der Steine waren ordentlich schwere Felsbrocken, andere kaum größer als ein Kiesel, den man über das Wasser hüpfen lassen konnte. Jeder Stein stand für einen Mann. Dafür, dass er gerade einmal vor einem guten Jahr eingewilligt hatte, den Job als eine Art Sheriff von Baird und den umliegenden Farmen zu übernehmen, lagen hier eine Menge Tote unter der Erde.
Bisher hatte er jeden Angriff erfolgreich überstanden, aber als Marcus die perfekte Stelle für den Neuankömmling gefunden hatte und die Schaufel hob, um sie in die trockene, rissige Erde zu stoßen, realisierte er, dass keiner von ihnen eine ernsthafte Bedrohung gewesen war. Keiner der Männer war auch nur mit der geringsten Unterstützung aufgetaucht, geschweige denn mit einer Armee. Sie waren dumm genug gewesen, es allein zu versuchen.
Marcus rammte die Schaufel in den Boden und hievte eine Ladung Erde heraus. Er wiederholte die Bewegung mechanisch, Schaufel um Schaufel, bis das Loch tief genug war, um darin stehen zu können. Er hörte auf, trank einen Schluck Wasser aus Lous Feldflasche und dankte ihr.
Sie hatte recht. Eines Tages würde jemand kommen, der klug genug war, um Verstärkung mitzubringen. Er würde eine Armee anführen. Und dann würde jemand sein Grab ausheben.
KAPITEL 2
5. Februar 2044, 16:34 Uhr 11 Jahre und 4 Monate nach dem Ausbruch Kerrville, Texas
Jeder seiner Liegestütze löste mehr Schmerzen aus als der vorige. Junior war schon bei einhundertdreißig, als er pausierte und seinen Körper mit ausgestreckten Armen brettgerade auf den Boden gestützt hielt. Schweiß tropfte ihm von Gesicht und Hals. Seine Arme zitterten vor Erschöpfung, seine Brust brannte, aber er hielt seine Position.
Er stellte sich das Gesicht des Mannes vor, der ihm so viel Schmerz, so viel Leid, so viele schlaflose Nächte bereitet hatte. Eine Welle aus Adrenalin durchspülte seinen Körper, er knurrte vor Wut. Er schaffte weitere zwanzig Liegestütze, bevor er auf dem Boden zusammenbrach.
Für einige Minuten lag Junior einfach nur da. Dann rollte er sich auf den Rücken und sammelte Kraft, um sich aufzurichten. Er stand auf und blickte himmelwärts. Es war ein heller Tag, warm für das Texas Hill Country. Aus Süden wehte eine stetige Brise. Er griff mit einem Arm um seinen Körper herum und packte seinen Ellbogen, um ihn nach innen zu ziehen. Dasselbe tat er mit dem anderen Arm. Die ausgebrannten Muskeln in seinen Armen schmerzten beim Strecken, und Junior musste die Zähne zusammenbeißen, um das Brennen auszuhalten. Zum Schluss schwang er seine Arme locker um den Oberkörper herum und streckte seine Halsmuskeln von einer Seite zur anderen.
Er blickte auf eine Schulter, dann auf die andere und betrachtete genau die unregelmäßig verteilten, wulstigen Narben, die die Stellen markierten, an denen er vor sechzehn Monaten schwer verletzt worden war. Er rieb mit dem Daumen über eine der Narben. Es war ein Wunder, dass er die doppelten Verletzungen, die ihm im Abstand weniger Minuten zugefügt worden waren, überlebt hatte. Die meisten Menschen wären ohne Antibiotika gestorben. Irgendwie hatte er die Infektion auch so abgewehrt und überlebt.
Wieder erschien das Gesicht des Mannes, der ihm diese Verletzungen zugefügt hatte, vor seinem inneren Auge. Es war dieses eine Gesicht, das ihm eine ständige Motivationsquelle war, während Junior die langen Tage und Nächte durchstand, die er ertragen musste, um seinen Körper heilen zu lassen und zu stärken.
Sein jungenhaftes Aussehen und seine kleine Statur täuschten über sein Alter hinweg. Er war jetzt Anfang zwanzig und mehr als ein Jahr älter als damals, als er seinem größten Feind das bislang erste und einzige Mal gegenübergestanden war.
Die Heilungsphase hatte zu lange gedauert, aber er wusste, dass er nun endlich bereit war für seine Mission. Die Zeit war gekommen, den Mann zu finden, der sein Leben verändert hatte.
Mit vom Training kribbelnden Beinen ging Junior zu seinem Pferd, holte ein T-Shirt aus einer der beiden großen Satteltaschen und zog es sich über den Kopf. Seine Muskeln spannten sich gegen den Stoff. Er rieb sich über den verschwitzten, rasierten Kopf und wischte die nassen Hände am T-Shirt ab.
Er zeichnete mit der Hand die Form des Gewehrs nach, das im Futteral am Sattel steckte. Langsam ließ er seine Finger über den Stahllauf gleiten, als würde er eine Skulptur berühren statt einer Waffe. Junior war schon vor einiger Zeit die Munition für das Gewehr ausgegangen und er hatte keine neue finden können. Doch die Waffe hatte seinem Vater gehört, also behielt er sie. Sie war identisch mit dem braunen AR-10 FDE, das lange seine Hauptwaffe gewesen war. An dem Tag, an dem er Schüsse in beide Arme davongetragen hatte, war das Gewehr verloren gegangen. Eines Tages würde er eine gute Handvoll ummanteltes Blei nehmen und es an die Bestie verfüttern. Eines Tages.
In der Zwischenzeit blieben ihm seine beiden Revolver, Single-Action aus dem Hause Colt, mit Griffschalen aus Knochen. Es waren keine idealen Waffen, aber er hatte Munition dafür. Das machte sie unbezahlbar.
Er schob seine Hand unter das Doppelholster, das er über das Sattelhorn gehängt hatte, und schnallte es um seine Hüfte. Es fühlte sich gut an. Junior nahm die Colts, schob seine Finger in die Abzugsbügel und senkte die Arme, sodass seine Hände auf der Höhe seiner Hüfte waren. Dann ließ er die Waffen gleichzeitig eine Umdrehung nach vorn rotieren, bevor er sie in eine Rückwärtsdrehung versetzte. Er drehte sie mehrmals nach hinten, hob die Hände und stoppte die Waffen, die nun direkt auf ein Ziel vor ihm ausgerichtet waren.
Er drehte sie perfekt synchron nach vorn und wieder zurück, bevor er sie in ihre Holster gleiten ließ. Noch zweimal wiederholte er den perfekt trainierten Bewegungsablauf.
»Bis du den Trick fertig hast, bist du dreimal tot, Junior«, sagte ein Mann kichernd von hinten. Seine Hände waren blutverschmiert. »Das sind Salontricks.«
Junior steckte die Waffen in die Holster und sah über die Schulter zu seinem Compadre Gil Grissom. Er grinste Grissom nur spöttisch an und spuckte vor seinen Lederschuhen auf den Boden.
»Pass bloß auf«, beschwerte sich Grissom. »Das ist mein letztes Paar.«
»Es beruhigt mich«, sagte Junior.
»Was, auf meine Schuhe zu spucken?«
»Nein, Mann«, sagte Junior, »die Pistolen zu drehen. Es ist entspannend. Lenkt mich ab.«
Grissom zog die Schuhspitze über den Boden. »Entspann dich irgendwo weit weg von meinen Schuhen«, sagte er. »Ich habe ein Kaninchen. Es ist drüben am Feuer.«
Junior fuhr sich mit der Hand über den Kopf und schniefte. Er räusperte sich, holte eine weitere Ladung Rotz und Speichel hervor und spuckte sie Grissom vor die Füße. »Komm schon. Wir haben viel zu tun.«
Grissom grummelte und folgte Junior zu den Überresten des Lagerfeuers, das sie am Abend zuvor gemacht hatten. Sie hockten sich einander gegenüber auf den Boden.
Junior beäugte das vollständig enthäutete Kaninchen, das neben dem verkohlten Holz auf dem Boden lag. Er blickte Grissom finster an. »Starren wir es nur an oder essen wir es auch?«
Grissom schnaubte beleidigt. Er nahm das Fleisch des Tieres und spießte es auf einen angespitzten Mesquite-Zweig.
Jugendlich unbeholfen war die freundliche Umschreibung von Gil Grissoms Wesen. Im Gegensatz zu Junior sah er in allem so jung aus, wie er war. Er hatte dichte Augenbrauen, eine Nase, die für sein Gesicht zu groß schien, und seine Wangen waren übersät mit rosafarbener Akne. Über seiner Oberlippe und am Kinn wuchs erster Bartflaum. Sein Hals war lang und dünn, und sein Adamsapfel hüpfte sichtbar unter seiner blassen Haut. Der lockige Haarschopf saß schief auf seinem Kopf wie eine schlechte Perücke.
»Du musst nicht die ganze Zeit so fies zu mir sein«, beschwerte sich Grissom. »Ich habe dir nie etwas getan, außer vielleicht dich manchmal etwas aufzuziehen.«
Junior bewegte sich im Sitzen hin und her. Seine Bauchmuskeln schmerzten vom Training. »Du bist einfach nicht lustig. Ich würde lachen, wenn du lustig wärst.«
Grissom schob das Fleisch bis zur Mitte des Spießes und kniete sich vor die Feuerstelle. Vorsichtig platzierte er den Spieß auf zwei Astgabeln, die er auf beiden Seiten des Feuers in den Boden gesteckt hatte. Dann nahm er ein paar dickere, zurechtgeschnittene Äste und legte sie unter das Kaninchenfleisch. Über das Holz streute er etwas dünn abgeschälte Rinde und einige trockene, zerkrümelte Blätter. Mit einem Feuerstein entzündete er den Haufen und blies die Glut zu einem niedrig brennenden Feuer. Minuten später garte das Kaninchen.
»Eine Stunde vielleicht«, sagte Grissom, während er sich von den wachsenden Flammen zurückzog. »Könnten auch eineinhalb Stunden sein.«
Junior nickte und zog die Knie an die Brust. Er schlang die Arme um die Beine und verschränkte die Finger ineinander. Er streckte seinen Rücken, während er sein Gewicht ausbalancierte.
Er blickte über die Flammen hinweg, durch die heiße, wabernde Luft, die über ihnen emporstieg, zu den sanften Hügeln im Westen. Die Sonne schwebte knapp über ihnen und tauchte die gewellte Landschaft des Texas Hill Country in ein leuchtendes Orange.
»Wohin sind wir unterwegs?«, fragte Grissom. »Wir sind jetzt seit drei Tagen hier. Ich finde, es ist an der Zeit, weiterzuziehen.«
»Die Pferde mussten sich erholen«, sagte Junior. »Wir haben sie seit El Paso ziemlich hart vorwärtsgetrieben.«
»Dann machen wir uns morgen auf den Weg?«
Junior nickte erneut, den Blick noch immer auf die tiefstehende Sonne gerichtet. »So ist es. Wir reiten nach San Antonio und versuchen, Unterstützung aufzutreiben. Denke, dort könnten wir Glück haben und ein paar gute Männer für unsere Sache gewinnen.«
Grissom drehte den Spieß mit den Fingern. »In El Paso wollte niemand etwas damit zu tun haben«, sagte er. »Glaubst du, die Jungs in San Antonio sind anders drauf?«
Ohne den Kopf zu bewegen, wandte sich Juniors Blick von den fernen Hügeln ab und richtete sich auf Grissom. Junior leckte sich die Lippen, sagte aber nichts.
Grissom bewegte sich unbehaglich hin und her und kratzte sich die Pickel auf einer Wange. »Ich frage ja nur«, sagte er. »Ich meine, wir verlangen viel und zahlen wenig. Mehr will ich gar nicht sagen.«
Junior schüttelte den Kopf. »Wir bieten den Menschen die Chance, zur Legende zu werden. Das sollte reichen.«
KAPITEL 3
6. Februar 2044, 09:45 Uhr 11 Jahre und 4 Monate nach dem Ausbruch Norman, Oklahoma
»Nebraska, soso«, sagte der kleine Mann, der den Leichenwagen betankte. »Sie sind nach Norden unterwegs?«
»Eher nach Osten«, sagte Taskar, dem der Leichenwagen gehörte. Das Fahrzeug hatte seine besten Zeiten schon seit einer Ewigkeit hinter sich. Taskar war Fahrer. Er verdiente seinen Lebensunterhalt damit, Menschen und Gegenstände in beide Richtungen über den Wall zu transportieren.
Der Tankwart wechselte die Hand, mit der er die Zapfpistole hielt. »Osten? Was ist im Osten, wenn ich fragen darf?«
Taskar rieb mit der Hand über das abgenutzte Leder am Lenkrad. Er warf einen Blick auf die Bedienelemente an der Fahrertür und überlegte, ob er das Fenster hochfahren lassen sollte.
»Arbeiten Sie im Osten?«, fragte der Mann hartnäckig weiter. »Habe gehört, dass es da immer mehr Arbeit gibt. Vor allem in den großen Städten soll es gut laufen.«
Taskar tippte mit dem Zeigefinger auf das Lenkrad. »Die Regierung kontrolliert immer noch alles. Sie haben die Jobs.«
Der Mann blickte über die Schulter auf die langsam laufenden Zahlen an der Zapfsäule. »Ich habe nichts mit der Regierung zu tun und auch einen Job«, sagte er in seinem gedehnten Akzent.
Taskar griff in die Mittelkonsole und holte ein Bündel Bargeld heraus. »Schön für Sie. Was schulde ich Ihnen?«
»Bin noch nicht fertig«, sagte der Mann. »Die nächste Tankstelle in Richtung Osten finden Sie erst in ein paar hundert Meilen. Besser, Sie lassen mich den Tank vollmachen.«
Taskar zog das Gummiband von der Geldscheinrolle und begann zu zählen. Geld war nicht mehr das, was es vor dem Ausbruch der Seuche gewesen war. Erst in den letzten Jahren hatte die Regierung wieder damit begonnen, es in Umlauf zu bringen.
Scheppernd kam die Pumpe zum Stillstand, und der Mann zog die Zapfpistole aus dem Einfüllstutzen. Er hängte sie an der Pumpe ein und trat ans Fenster. Er pfiff, als er das Geld sah.
»Meine Güte«, sagte der Tankwart, »ist das eine Menge Kohle. Sie müssen für die Regierung arbeiten. Die sind die Einzigen, die so üppig …«
»Wie viel?«
Der Mann sah über die Schulter auf die Zahlen auf der Pumpe. »Dreihundert«, sagte er und hielt die Hand auf.
Taskar zog drei Hundert-Dollar-Scheine heraus und klatschte sie dem wartenden Mann in die Hand. »Danke.« Er schloss das Fenster und schob den Schalthebel auf D.
Langsam ließ er den Wagen auf den Highway rollen, wickelte das Gummiband wieder um die Geldscheine und legte sie zurück in die Mittelkonsole. Innerhalb kurzer Zeit hatte er eine Geschwindigkeit von sechzig Meilen pro Stunde erreicht. Die relativ neuen Reifen summten auf dem Asphalt und dem Beton, aus dem die noch existierenden Highways nördlich des Walls bestanden.
Er lehnte sich in den rissigen Ledersitz zurück, legte den Arm in das offene Fenster und genoss den kühlen Wind, der seine Hand umwehte. Eigentlich war es zu kalt, um so unterwegs zu sein, vor allem angesichts der verstopften Nase, mit der Taskar seit einer Weile zu kämpfen hatte. Aber um keinen Preis würde er Benzin für die Klimaanlage verschwenden. Außerdem hielt ihn die kalte Luft wach. Sein neuster Job verlangte Wachsamkeit und Konzentration. Ein Nickerchen war einfach nicht drin.
Taskar nahm die Straßenkarte vom Beifahrersitz und warf einen Blick auf die Markierungen, die den Weg zu seinem Ziel zeigten. Er hatte wahrscheinlich noch dreizehn oder vierzehn Stunden und gute neunhundert Meilen vor sich.
Im Rückspiegel versank in der Ferne das hohe Werbeschild der Tankstelle am Horizont. Taskar dachte darüber nach, wie kurz angebunden er auf die Neugier des Tankwarts reagiert hatte. Er hätte netter sein können. Er hätte die Fragen des Mannes beantworten oder zumindest so tun können, als würde er sie beantworten. Aber das entsprach nicht Taskars Verständnis von Professionalität.
Er mochte keine Fragen. Sein Job als Kurier in dieser gottverlassenen Welt verlangte Diskretion. Alles, was er wissen musste, war, wohin und wann. Er wollte keine Namen. Er wollte auch keine rührseligen Geschichten oder irgendwelche Märchen von einem neuen Goldrausch. Was er wollte, war die Hälfte im Voraus und den Rest am Zielort bei Lieferung.
Doch dieser Auftrag war anders.
Vor zwei Wochen war er nach Norden unterwegs gewesen und hatte den Wall zum x-ten Mal in den letzten zehn Jahren passiert. In der Nähe von Oklahoma City hatte er seinen Fahrgast abgesetzt und dann für einen Kaffee und ein Sandwich mit Räucherfleisch in einem kleinen Restaurant Station gemacht.
Er hatte sich auf den Platz in der hinteren Ecke gesetzt, auf dem er immer saß. Als er gerade dabei war, sein Sandwich aus dem Wachspapier auszuwickeln, hatte sich eine Frau ihm gegenüber hingesetzt. Sie hatte ihre Hände flach auf den Tisch gelegt und hörbar ausgeatmet.
»Kann ich Ihnen helfen?«, hatte Taskar gefragt.
»Sie sind derjenige, der illegale Transportdienste anbietet?«
Taskar hatte das weiche Weißbrot mit seinen schwieligen Fingern in beide Hände genommen und sich eine Ecke des Sandwichs in den Mund geschoben. Kräftig auf dem kalten Fleisch kauend hatte er mit vollem Mund geantwortet: »Kommt darauf an.«
Die Frau hatte mit den Händen über den Tisch gerieben, als wollte sie ihn mit den Fingern abwischen. »Worauf kommt es an, Mr. Taskar?«
Taskar hatte den Bissen hinuntergeschluckt und einen Schluck zimmerwarmes Wasser genommen. »Wer sind Sie?«
»Ich bin eine Klientin.«
Es war nicht ungewöhnlich, dass Unbekannte ihn wegen eines Jobs ansprachen. Er hatte es auch nicht als seltsam empfunden, dass sie das Verbotene und Geheime ihrer Unterhaltung zu genießen schien. Trotzdem hatte er gespürt, dass etwas an der Frau anders war. Irgendetwas … stimmte nicht.
»Wer hat mich empfohlen?«
Die Frau hatte gelächelt. »Interessante Menschen.«
Taskar hatte sie einen Moment lang beobachtet und dann wieder von seinem Sandwich abgebissen. Das Fleisch war zu trocken gewesen und hatte am Gaumen geklebt. Dann hatte er begriffen. »Sie gehören zur Regierung.«
Ein Auge der Frau hatte gezuckt, und sie hatte fast unmerklich genickt. Sie hatte ihre Finger langsam zurückgezogen, ihre Handflächen gehoben und sie über dem Tisch gehalten wie ein Pianist vor Beginn eines Konzertes. »Ich bin diejenige, die Ihnen einen beträchtlichen Geldbetrag zahlen will, damit Sie etwas von dieser Seite des Walls auf die andere bringen«, hatte sie gesagt. »Das ist es, worauf es ankommt.«
Taskar hatte sein Sandwich auf das Wachspapier gelegt und noch einen Schluck Wasser getrunken. »In den letzten Jahren ist das Geschäft immer schwieriger geworden«, hatte er gesagt. »Als es hier so übel aussah wie im Süden, hat es niemanden außer dem Kartell interessiert, wer wohin unterwegs war. Viele, die gedacht hatten, sie würden hier im Norden ein besseres Leben finden, sind hergekommen, haben sich die Sache kurz angeschaut und sich dann wieder auf den Rückweg gemacht.«
»Ich kann mich daran erinnern«, hatte die Frau gesagt.
»Jetzt, wo die Regierung in den Städten wieder Strom hat, die Kommunikation teilweise funktioniert und es für die Menschen wieder um etwas geht, ist es nicht mehr so einfach, den Wall zu überqueren.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«
Taskar hatte mit der Zunge geschnalzt und mit gesenkter Stimme gesagt: »Ich meine, dass mit so einem Auftrag viele Risiken verbunden sind. Es gibt Räder, die geschmiert werden müssen.«
Die Frau hatte nur gelächelt. »Das ist kein Problem«, hatte sie ihm versichert, »weder aus finanzieller noch aus logistischer Sicht. Wir kümmern uns darum. Um alles. Sie kommen einfach zur vereinbarten Zeit an den vereinbarten Ort.«
Unter dem Tisch hatte sie ein zusammengerolltes Bündel Geldscheine hervorgeholt, das dicker war als jedes andere, das Taskar bisher gesehen hatte. Das Geld hatte ihm zwei Dinge verraten: Dieser Job lohnte sich, und er war gut beraten, diesen Job auf keinen Fall anzunehmen.
Die Frau hatte die Rolle auf den Tisch gelegt, war von ihrem Platz aufgestanden und ohne ein weiteres Wort gegangen. Taskar hatte sich im Raum umgesehen und dann schnell das Geld vom Tisch genommen. Um die Rolle herumgewickelt und mit einem Gummiband befestigt gewesen war ein Zettel mit Adresse und Datum.
Dieses Stück Papier steckte jetzt an seinem Rückspiegel. Das Datum verwies auf den morgigen Tag, den 7. Februar 2044. Die Adresse lautete 1600 Clifton Road, Atlanta, Georgia.
Atlanta. Seit dem Ausbruch der Seuche war er nicht mehr so weit im Osten gewesen. Er hatte Touren unternommen von und nach New Orleans oder besser gesagt das, was davon übriggeblieben war, nach Little Rock und sogar nach Birmingham, Alabama. Ein Trip hatte ihn gen Westen nach Phoenix geführt und ein anderer nach Denver. Eine Fahrt nach Chicago hatte er abgelehnt. Zu hohes Risiko, zu geringe Bezahlung. Er fragte sich, wie Atlanta wohl aussah.
Er hatte Gerüchte gehört, dass Atlanta ein großer Standort der neuen Regierung war. Die Stadt hatte sich schneller erholt als die meisten anderen, und Überlebende aus anderen Orten waren dorthin geströmt und hatten ihr Wachstum beschleunigt. Ein wichtiger Grund dafür war Elektrizität. Es gab zwei Wasserkraftwerke, eines im Norden der Stadt und eines im Süden, die auch nach dem Ausbruch der Pandemie nie aufgehört hatten, Strom zu produzieren.
Taskar rutschte auf seinem Sitz hin und her, es fing an, unbequem zu werden. Der Tempomat war kaputt und sein Knöchel schmerzte schon von den Touren der letzten Tage und Wochen. Es würde eine lange Fahrt werden.
Der Blick aus dem Fenster auf der Fahrerseite zeigte in der Ferne aufziehende Wolken. Sie waren grau, fast schwarz, und unter einigen waren dunkle Vorhänge zu sehen. Regen. Er versuchte herauszufinden, in welche Richtung die Wolken zogen. Sosehr ihm bewusst war, dass das Land Regen brauchte, so wenig wollte er auf seinem Roadtrip damit zu tun haben. Die Scheibenwischer hatte er seit vier Jahren nicht mehr erneuert. Er machte einen tiefen Atemzug. Die kalte Luft roch noch nicht nach Regen. Das war gut. Sein Blick wanderte von den Wolken zurück zur Straße und dann nach unten zu dem Geldbündel in der Mittelkonsole. Er stellte sich vor, was er mit der doppelten Menge Geld anfangen konnte, wenn dieser Auftrag erledigt war.
Er sah sich im Rückspiegel in die Augen. »Du könntest den Job an den Nagel hängen«, sagte er laut. »Ein kleines Haus finden, sesshaft werden, aus dem Spiel aussteigen.«
Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, als er über die Möglichkeiten nachdachte und sich ein Leben vorstellte, das in allem das Gegenteil war von dem, das er jetzt führte. Er legte eine Hand auf das Geldbündel und umschlang es mit den Fingern.
Er hoffte, dass dieser Job es wert war. Er hoffte es inständig. Auch wenn er ganz tief in seinem Inneren wusste, dass das nicht der Fall sein konnte.
KAPITEL 4
6. Februar 2044, 15:00 Uhr 11 Jahre und 4 Monate nach dem Ausbruch Atlanta, Georgia
Lomas Ward stand auf der Straße und schob die Hände in die Taschen. Er drehte sich auf den Absätzen seiner abgewetzten Lederschuhe herum und betrachtete die heruntergekommene Skyline seiner Stadt. Er erinnerte sich an eine Zeit, in der sie verheißungsvoll geglänzt hatte. Aber das war so lange her, dass es ihm schwerfiel, seine Erinnerung über den allgegenwärtigen sepiafarbenen Filter zu legen, der alles und jeden befallen hatte. Das alte Versprechen auf eine bessere Zukunft war mit Lomas’ Eltern und Geschwistern in den Tagen und Monaten nach dem Ausbruch der Krankheit gestorben. Dieses Versprechen hatte gegolten, bevor sein Leben um ihn herum zusammengebrochen war. Lange bevor er das Angebot erhalten hatte.
Mit seinen fünfunddreißig Jahren hatte Lomas sein halbes Leben in dieser kranken Welt zugebracht, einer Welt, in der sich die Zivilisation zurückgezogen und den Raum freigegeben hatte für die Abgründe, die die Menschen in und um sich herum schufen. Er hatte alles gegeben, um es dennoch zu schaffen, eine Arbeit zu finden, eine Familie zu gründen und ein Zuhause voller Liebe und dem Versprechen auf eine bessere Zukunft aufzubauen. Manche mit besseren Beziehungen als Lomas hatten es weitergebracht. Die Mehrzahl hatte es deutlich schlechter getroffen. Lomas hatte vom Leben südlich des Walls gehört. Es waren Erzählungen von Barbarei und Gesetzlosigkeit. Er hatte sich zu den Glücklicheren gezählt.
Aber das galt jetzt nicht mehr. Das Einzige, was ihm jetzt noch geblieben war, war das Angebot.
Am tiefsten Punkt waren sie zu ihm gekommen, in den Stunden, nachdem seine Frau an einer Schusswunde gestorben war. Er hatte um sie in der Kapelle der Klinik getrauert, auf den Knien vor dem schlichten Altar, als eine feste Hand seine Schulter berührt hatte. In seiner Trauer hatte er zuerst gedacht, es sei die Hand Gottes. Sie war es nicht.
Während er hier auf der Straße wartete und den kühlen Nordwind im Gesicht spürte, fragte er sich, ob die Hand vielleicht zumindest einem Engel gehört hatte.
»Wir werden für Ihre Kinder ein gutes Zuhause finden«, hatten sie ihm gesagt. »Sie werden sich nie wieder Sorgen um Essen oder Gefahren machen müssen«, hatten sie versprochen. »Die Kinder werden in eine Familie mit guten Verbindungen kommen.«
Lomas hatte zuerst gedacht, sie machten Witze, bis der Ernst in den Falten um ihre Augen und ihre Münder ihn vom Gegenteil überzeugten.
»Sie müssen auf der gestrichelten Linie unterschreiben«, darauf hatten sie bestanden. »Sie müssen unterschreiben, bevor jemand anderer es tut. Dies ist ein zeitlich begrenztes Angebot.«
Sie hatten ihm zwanzig Stunden Zeit gegeben, darüber nachzudenken. Eine letzte Nacht mit seinen Söhnen war ihm geblieben.
Er hatte die Entscheidung getroffen. Noch zwei Tage später, während er in der Kälte auf der Straße stand, verursachte sie einen dicken Kloß in seinem Hals.
Lomas rückte seinen Kragen zurecht und drückte den fleckigen Stoff entlang der Bügelfalten zusammen. Mit den Knöcheln rieb er sich die müden, geröteten Augen und die dicken, vor allem unter den Augen geschwollenen Ringe, die sie zu schließen drohten.
Er steckte die Hände wieder in die Taschen, zog sich die Hose hoch und wandte sich dem unscheinbaren Gebäude hinter ihm zu. An gesichtslosen Orten wie diesen war er wahrscheinlich tausendmal vorbeigekommen, ohne sie bewusst wahrzunehmen. Die mehrstöckige Backsteinfassade war bis auf einen rechteckigen Riegel über einer breiten Metalltür fensterlos. Lomas näherte sich der Tür und hob die Hand. Er zögerte, seine geballte Faust schwebte zwischen seiner Vergangenheit und seiner Zukunft. Er biss sich auf die Unterlippe und klopfte mehrmals, wie sie ihn angewiesen hatten, wartete und klopfte erneut.
Eine hohl klingende Stimme dröhnte aus einem neben der Tür in die Wand eingelassenen Lautsprecher aus Edelstahl. »Lomas Ward?«
Lomas starrte auf den Lautsprecher und suchte nach einem Knopf, den er drücken konnte. Es gab keinen.
»Lomas Ward?«, fragte die Stimme erneut, diesmal dringlicher.
Lomas sah über die Schulter hinter sich und zurück auf den Lautsprecher. »Ja«, antwortete er zögerlich. Sein Blick suchte immer noch nach einem Hinweis auf ein Mikrofon. »Ich bin Lomas. Ich habe einen Termin bei …«
Ein lautes Summen ertönte, gefolgt von einem metallischen Klicken an der Tür. »Die Tür öffnet nach außen, bitte treten Sie ein.«
Lomas packte die Türklinke und zog kräftig. Die Tür öffnete sich und gab den Blick auf ein quadratisches Wartezimmer frei, das in weißes Licht getaucht war. Er übertrat die Schwelle, und als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, verstummte das Summen.
Er blickte nach oben und sah Leuchtstoffröhren, die ein grelles Licht abgaben. Energiefressende Leuchtmittel wie diese hatte er seit Jahren nicht gesehen. Da, wo es noch Strom gab, bestanden alle Lichtquellen aus Niedrigenergie-LEDs. Hier in diesem Raum war das Licht viel heller, als er gewohnt war, so hell, dass er die Augen zusammenkneifen musste. Er blickte sich um. In einer Ecke stand der einzige Stuhl im Zimmer, auf dem ein handgeschriebener Zettel lag. BITTE HIER HINSETZEN, war darauf zu lesen.
»Bitte setzen Sie sich auf den bereitgestellten Stuhl«, sagte die Stimme wie aufs Stichwort. »Es wird gleich jemand bei Ihnen sein.«
Lomas bemerkte eine Tür, die weder einen Griff noch einen Knauf hatte. »Ich habe einen Termin bei Dr. Morel. Charles Mor…«
»Es wird gleich jemand bei Ihnen sein«, wiederholte die Stimme. »Bitte nehmen Sie auf dem bereitgestellten Stuhl Platz.«
Lomas ging zu dem Stuhl in der Ecke und setzte sich. Der Stuhl war hart und unangenehm, und er verlagerte immer wieder sein Gewicht im Versuch, sich zu entspannen. Es war zwecklos. Er stützte die Ellbogen auf die Knie und legte den Kopf in die Hände.
Die Gesichter seiner Jungen blitzten in seinen Gedanken auf. Ihre geliebten Gesichter, ihr Lachen. Wie ihre Hände in seinen lagen und wie sie ihre Arme um seinen Hals schlangen. Lomas schluckte schwer und schob die Bilder beiseite. Er hatte getan, was er tun musste. Er hatte ihnen eine Zukunft gegeben, die sie verdienten, eine Zukunft, die er sonst nicht bieten konnte.
Fast dreißig Minuten saß Lomas allein im Raum auf dem Stuhl. Als sich die Tür öffnete, erschien nicht Dr. Charles Morel, einer der Männer, die ihn überzeugt hatten, seine Zukunft gegen die seiner Kinder einzutauschen. Stattdessen kam eine große, spindeldürre Frau herein, die ihre pechschwarzen Haare straff gegen ihren ovalen Kopf zu einem langen Pferdeschwanz gebunden hatte. Ihre wie in einer Comiczeichnung übertrieben geschwungenen Augenbrauen vermittelten ein permanentes Gefühl der Missbilligung, und ihre eng anliegende Kleidung wies deutlich darauf hin, dass sie zu den Menschen mit guten Verbindungen gehörte. Die Seuche schien im Gegensatz zu den meisten anderen spurlos an ihr vorübergegangen zu sein.
Die Frau blieb in der Tür stehen und hielt sie mit einem Fuß offen, der in einem hohen Stiefel steckte. In ihren Händen hielt sie ein schmales Gerät, das im Wesentlichen aus einem großen Bildschirm zu bestehen schien. Seit Jahren hatte Lomas kein Tablet mehr gesehen. Er lehnte sich im Stuhl zurück und umklammerte seine Knie.
»Lomas Ward«, sagte die Frau mit einer heiseren Stimme, in der nichts Weibliches lag. »Ich bin Gwendolyn Sharp. Bitte folgen Sie mir.« Der Gesichtsausdruck der Frau blieb reglos, während sie sprach.
»Ich habe einen Termin bei Dr. Morel«, sagte er, unfähig, sich von seinem Platz zu rühren. »Dr. Morel hat mir gesagt …«
»Mir sind keine Vereinbarungen bekannt, die Sie gegebenenfalls mit Dr. Morel getroffen haben«, unterbrach ihn Gwendolyn Sharp. Fest stand sie da, die Stiefel schulterbreit auseinander. »Was ich jedoch weiß, ist, dass Sie mit mir kommen müssen. Jetzt.«
Sie lächelte auf eine Weise, die Lomas verriet, dass ihre Freundlichkeit nur Fassade war. Ihre Nasenlöcher wirkten so unnatürlich zusammengekniffen, dass er sich kaum vorstellen konnte, wie sie einigermaßen normal atmen sollte. Vielleicht war das der Grund für ihr strenges Erscheinungsbild. Lomas rieb sich mit den Handflächen die Knie und warf einen flüchtigen Blick auf die große Tür, durch die er den Raum betreten hatte.
Sharp seufzte. »Haben Sie Bedenken bezüglich Ihrer Teilnahme?«
Lomas schluckte schwer und presste die Lippen aufeinander. Es gab keine richtige Antwort, obwohl die Frau eindeutig eine rhetorische Frage gestellt hatte. »Nein«, log Lomas.
Sharp deutete mit dem Kopf auf den Raum hinter ihr. »Dann gehen wir besser. Wir haben zu tun.«
Lomas stand auf und ging an Sharp vorbei in einen schmalen Flur, der von dem gleichen grellen Licht erhellt wurde wie das Wartezimmer. Während er den Flur entlangging, folgte sein Blick unwillkürlich den gleißenden Leuchtstoffröhren, die in einer langen Reihe in der Mitte der hohen Decke montiert waren. Hinter ihm klackten Sharps Stiefel auf dem harten Linoleumboden, während seine Schuhe ein leises Quietschen von sich gaben. Es fühlte sich an wie in einem Krankenhaus. Ein Geruch nach Desinfektionsmitteln lag in der Luft und verstärkte die Vorahnung, dass er sich gleich entkleiden und ein Patientenhemd anziehen würde.
Sein Blick schweifte immer wieder zu den Türen, die links und rechts in regelmäßigen Abständen in die frisch geweißten Betonwände eingelassen waren. Auch die Türen waren klinisch weiß, ohne Beschriftung, dafür mit identischen alphanumerischen Keypads versehen. Lomas öffnete den Mund, um Sharp zu fragen, was sich hinter den Türen verbarg, entschied sich aber dagegen.
Als sie die Tür am gegenüberliegenden Ende des Flurs erreicht hatten, stellte sich Sharp vor das Keypad, schirmte es mit ihrem Körper ab und warf einen Blick über ihre Schulter zu Lomas, bevor sie fünfmal begleitet von einem Piepen eine Taste drückte. Ein Mechanismus in der Tür summte und klickte. Sharp drehte den Knauf und schob die Tür mit der Schulter auf.
Lomas folgte ihr und betrat einen kleinen Raum, der wie das Untersuchungszimmer eines Arztes aussah. In der Mitte stand eine große Liege, die mit einer Lage Papier bedeckt war. Am Kopfende des Tisches war ein Kissen befestigt, und von der Decke darüber hing eine Lampe an einem Schwenkarm herab.
Auf einer Seite des Raumes befanden sich ein Waschbecken und ein Schrank, auf der anderen standen offene Regale mit Stapeln von Handtüchern und Schachteln mit gepuderten Gummihandschuhen. Neben dem Regal war ein Otoskop mit verschiedenen Aufsätzen an der Wand befestigt.
»Bitte setzen Sie sich«, befahl Sharp und zeigte auf die Liege. Sie tippte auf ihr Tablet und fuhr mit dem Finger über den Bildschirm.
Lomas stieg auf eine Stufe am Fuß der Untersuchungsliege, drehte sich um und setzte sich. Das Papier knisterte und verschob sich unter seinem Gewicht, und er versuchte, es zurechtzurücken. Sharp nickte kurz, verließ den Raum und schloss die Tür hinter sich.
Lomas versuchte, sich zu erinnern, was Dr. Morel ihm gesagt hatte. Schritt für Schritt hatte er ihm erklärt, was auf ihn zukam, wenn er mit dem Arzt und seinem Team zusammenarbeitete. Doch es schossen ihm so viele Details durch den Kopf, dass er sich nicht sicher war, welche aus seiner Erinnerung stammten und welche aus seiner Vorstellung in der letzten, schlaflosen Nacht. Er konnte sich jedenfalls nicht erinnern, dass es Teil des Deals gewesen sein sollte, in einem Untersuchungsraum zu sitzen.
Lomas ließ sich auf den Rücken sinken und legte den Kopf auf das Kissen. Er sah zur Deckenlampe hoch und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Stattdessen überkam ihn die Erschöpfung, und die Umgebung verschwamm vor seinen Augen. Seine Gedanken verloren sich, er schlief ein.
Als er aufwachte, stand Dr. Morel neben der Liege und rüttelte Lomas sanft an der Schulter. »Lomas«, sagte er leise, »ich muss Sie leider wecken. Wir müssen anfangen.«
Lomas blinzelte und gähnte. »Tut mir leid«, murmelte er, den dicken, sauren Geschmack des Schlafes in seinem Mund.
Dr. Morel lächelte. Seine Augen verengten sich dabei, und tiefe Krähenfüße wurden sichtbar. »Das ist kein Problem, Lomas. Aber wenn Sie sich jetzt aufsetzen könnten, wäre das sehr hilfreich.«
Lomas zog sich an den Kanten der Liege hoch und richtete sich auf. Seine Füße baumelten über dem Boden. Im Raum befanden sich noch zwei weitere Personen – Sharp und ein Mann, der bei Dr. Morel gewesen war, als Lomas das Leben seiner Söhne gegen seine Freiheit eingetauscht hatte. Dieser Mann, dessen Namen Lomas nicht kannte, hielt in einer Hand eine Spritze und in der anderen einen Gummischlauch. Lomas schluckte schwer. Eine unangenehme Hitze breitete sich in seinen Wangen und in seinem Nacken aus.