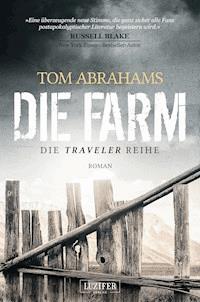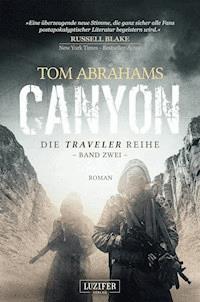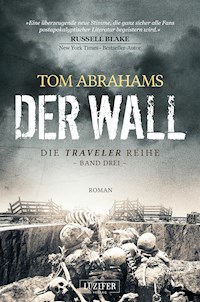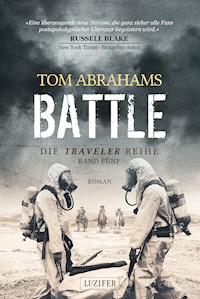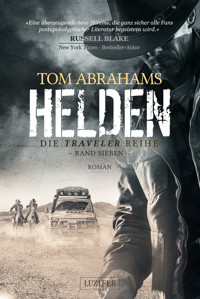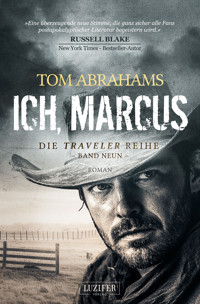Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Traveler
- Sprache: Deutsch
MARCUS BATTLE ÜBERLEBTE DIE APOKALYPSE UND ENTKAM DEM KARTELL. JETZT WILL ER RACHE. Battle hat genug vom Kämpfen. Mit seiner kleinen, zweiten Familie will er einfach nur noch ein ruhiges Leben führen. Doch dafür ist in dieser neuen, unbarmherzigen Welt kein Platz … Als Unbekannte sein Anwesen überfallen und die letzten Menschen töten, die Marcus Battle etwas bedeuten, bricht er auf, um die Männer, die dafür verantwortlich sind, zur Strecke zu bringen. Sie ahnen nicht, dass es ein Fehler war, Battle am Leben zu lassen … Die TRAVELER-Reihe – das sind actionreiche Endzeit-Abenteuer mit einem Schuss Neo-Western.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rache
Traveler-Reihe – Band 4
Tom Abrahams
Übersetzt von Raimund Gerstäcker
Copyright © 2017 Tom Abrahams Dieses Buch ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Schauplätze, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig. tomabrahamsbooks.com
Für Courtney, Sam, Luke und die Menschen in Finnland.
Erfolgreiche Krieger siegen, bevor sie in den Krieg ziehen. Geschlagene Krieger ziehen zuerst in den Krieg und versuchen dann, zu gewinnen.
Impressum
Deutsche Erstausgabe Originaltitel: RISING Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Raimund Gerstäcker Lektorat: Manfred Enderle
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-593-4
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
30. September 2042, 09:07 Uhr Jahr zehn nach dem Ausbruch Östlich von Rising Star, Texas
Als Erstes hörte er den Schrei. Dann knallten die unverkennbaren Geräusche von Gewehrschüssen durch die stille Luft von West Texas.
Lola!
Marcus Battle sprang auf, rannte aus dem Garten und zog im Laufen seine Glock aus ihrem Holster an seiner Hüfte.
Ein weiterer markerschütternder Schrei bohrte sich in seine Ohren und lief ihm über den Rücken, während er hinter der Scheune hervorkam und sah, wie ein Körper vom Baumhaus zu Boden fiel.
Den Finger am Abzug, den Kopf hoch nach oben gereckt, suchte er das hüfthoch gewachsene Gras ab. Rechts hinter dem Baumhaus war ein Mann auf einem Pferd. Marcus duckte sich tief, raste durch das Gras, dessen lange Blätter gegen seinen Körper und sein Gesicht schlugen, und sprintete direkt auf den Fremden zu.
Hinter ihm waren drei gedämpfte, unmittelbar aufeinander folgende Schüsse zu hören, aber Marcus ignorierte sie. Eine Bedrohung nach der anderen. Er widerstand dem Drang, nach Lola, Sawyer oder der kleinen Penny zu rufen. Es würde ihnen nicht helfen und zudem seine Position demjenigen verraten, der zusammen mit dem Mann auf dem Pferd gekommen war.
Er erreichte das Baumhaus und nutzte den dicken, alten Stamm als Deckung. Er drückte sich mit dem Rücken gegen den Baum, ließ sich in die Hocke sinken und lugte auf der Suche nach dem Körper, der vom Baumhaus über ihm herabgefallen war, hinter dem Stamm hervor.
Er hatte fast drei Viertel des Stammes umrundet, als er Sawyers verdrehten Körper sah. Battle biss die Zähne zusammen, schloss die Augen und widerstand dem Drang, laut zu schreien. Er ließ sich nach unten sinken und kroch auf dem Bauch näher an seinen Adoptivsohn heran. Sawyers Gesicht war von Marcus abgewandt, seine abgenutzte Jeansjacke war hoch auf den Rücken geschoben. Brüche in beiden Beinen hatten an mehreren Stellen seine Hose aufgerissen. Marcus streckte seine zitternde Rechte nach dem Jungen aus, strich über seinen Rücken und legte Zeige- und Mittelfinger an Sawyers Hals. Er zog seine Hand weg und ballte sie zur Faust.
Marcus kroch von Sawyer weg, zurück zum Baum. An der harten Rinde schob er sich langsam nach oben. Als er auf den Beinen war, schlich er in Deckung auf den Mann auf dem Pferd zu. Er näherte sich ihm bis auf zwanzig Yards. Der Mann auf dem Pferd erwies sich eher als ein Junge. Ein Junge mit frischem Gesicht und großen Augen, dessen Gewehr auf der Vorderseite seines Sattels ruhte.
Langsam bewegte sich Marcus weiter auf ihn zu und richtete sich dann auf. Aufrecht stand er im Gras und richtete die Glock auf den Jungen. »Lass das besser«, sagte er, als der Junge nach seiner Waffe zu greifen versuchte. »Hände hoch und fang an zu reden.«
Der Mund des Jungen klappte auf, aber er sagte nichts. Er hob seine zitternden Hände über den Kopf. Das Gewehr verlor die Balance und rutschte zu Boden.
»Wie viele?«, fragte Marcus.
Der Junge schüttelte den Kopf.
Marcus drückte den Abzug und traf die Schulter des Jungen. »Wie viele?«
Das Pferd wich zurück, geriet aber nicht in Panik. Der Junge griff sich an die Schulter, Tränen quollen aus seinen Augen. Er stotterte: »F-fünf.«
Marcus sah an dem Jungen vorbei in Richtung Highway. Am Straßenrand konnte er einige Pferde in der Nähe seines Zauns ausmachen. Er trat näher, verstärkte seinen Griff um die Glock und betätigte erneut den Abzug. Das Geschoss traf den Jungen in den anderen Arm und setzte ihn so vollständig außer Gefecht.
Marcus schloss die Lücke zum Pferd und nahm das Gewehr des Jungen, eine halbautomatische, in der Farbe heller Erde lackierte AR-10.
So gut das mit einer Hand möglich war, richtete er das Gewehr auf die Brust des Jungen. »Du bleibst vollkommen still«, sagte er. »Kein Ton. Verstanden?«
Der Junge nickte. Seine Zähne gruben sich in seine Unterlippe, Tränen liefen ihm über das Gesicht. Marcus schob seine Glock zurück ins Holster und rannte zum Haus.
Marcus versuchte, sich zu erinnern, wo der Rest seiner Familie war. Lola war in der Garage gewesen, als er nach draußen gegangen war, um sich um den Garten zu kümmern. Penny hatte in der Scheune geschlafen.
Als er zum Haus zurücklief und den Hof überquerte, bemerkte er aus dem Augenwinkel eine Bewegung zu seiner Rechten. Er wirbelte herum. Zwei Männer verließen die Garage. Marcus presste das Gewehr gegen die Schulter, brachte das Zielfernrohr vor sein rechtes Auge, zielte und drückte zweimal den Abzug.
Der Doppelschuss durchschnitt die Luft und ein purpurroter Strahl sprudelte aus dem Kopf eines der Männer hervor. Marcus schob sich nach links und drückte erneut ab. Die beiden Schüsse erwischten den anderen, diesmal in Hals und Brust. Die zwei Männer sackten zusammen und verschwanden im hohen Gras.
Battle hielt das Zielfernrohr weiter am Auge und bewegte das Gewehr nach links. Keine Ziele zu sehen. Er senkte das AR-10 und rannte zur Garage. Er wäre fast über die Männer gestolpert, die er niedergestreckt hatte. Neben einem lag ein großes Messer. Der andere war mit einer Pistole bewaffnet, die in seinem Hosenbund steckte.
Er trat an ihnen vorbei, erreichte das Garagentor von der Seite und drehte sich mit der Schulter zuerst in den offenen Raum. Er hatte eine kleine Küche in die Garage gebaut und die noch funktionsfähigen Sanitär- und Gasleitungen des nicht mehr stehenden Haupthauses hierher verlegt. Die Küchengeräte hatte er in den letzten fünf Jahren nach und nach aus benachbarten, aufgegebenen Häusern geborgen.
Das Licht war aus. Nur schwach sickerte das Morgenlicht durch die Spalte zwischen den einzelnen Wellblechplatten, aus denen die Wände bestanden. In Marcus’ Nacken stellten sich die Haare auf. Er spürte, dass etwas Grauenvolles auf ihn wartete.
Mit dem Daumen öffnete er das Holster an seiner Seite, zog leise die Glock hervor und bewegte sich vorsichtig durch den gräulich vor ihm liegenden, nur spärlich erhellten Raum. Die Küche befand sich an der gegenüberliegenden Seite, der Stelle am nächsten, an der das Haus gestanden hatte.
Seine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Allmählich konnte er die Formen des kleinen Kühlschranks und des Gaskochfelds erkennen, das er auf Betonblöcken aufgebaut hatte. Er sah Lola erst, als er nur noch wenige Schritte von ihr entfernt war.
Sie lag mit dem Gesicht nach unten, eine Blutlache breitete sich um ihren Oberkörper aus. Ihr T-Shirt war zerrissen, sie lag mit nacktem Rücken da. Eines ihrer Beine war in einem merkwürdigen Winkel verdreht.
Marcus schluckte schwer, kniete sich neben sie und berührte sanft ihren Hinterkopf. Die Hand, die er wegzog, war blutig.
»Lola?«, brachte er mit krächzender Stimme nur hervor.
Er legte seine scharlachrote, blutgetränkte Hand sanft auf ihren Rücken und schloss die Augen. Sie atmete nicht. Marcus zog das AR-10 von seiner Schulter und legte es neben sich auf den Betonboden.
Er griff sie an den Schultern und rollte sie auf die Seite. Er zuckte zusammen und konnte nicht anders, als wegzusehen. Er schloss die Augen, aber das Bild ihrer toten Augen blieb.
Marcus knirschte mit den Zähnen. Der Kloß in seinem Hals fühlte sich an, als würde er ersticken. Sanft ließ er sie mit dem Gesicht nach unten wieder in die Position gleiten, in der er sie gefunden hatte, und hob das Gewehr auf. Er hielt es mit beiden Händen, am Lauf und am Griff, und ging mit schweren Schritten zum Ausgang der Garage. Seine Stiefel knallten auf den Betonboden, bis er schließlich durch die offene Tür stürmte. Das grelle Sonnenlicht blendete ihn für einen Moment, und er ging zwischen den hohen Grashalmen und den hochwachsenden Disteln in Deckung.
Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Helligkeit. Stück für Stück arbeitete er sich nach rechts vor, in Richtung Scheune. Wenn der Junge auf dem Pferd nicht gelogen hatte, waren noch drei Männer zu töten. Er musste sie finden, bevor sie Penny etwas antun konnten.
Marcus bewegte sich im Zickzack durch das Gras, das er unkontrolliert wachsen ließ, damit Fremde es schwieriger hatten, sie zu finden. Der Plan war, dass sein Eigentum verlassen aussah. Fünf Jahre lang hatte das gut funktioniert. Doch irgendwie hatten diese Monster sie gefunden.
Im Laufen sah Marcus nach links. Der Junge auf dem Pferd war verschwunden. Marcus bereute es, ihn nicht getötet zu haben. Er hatte ein Kind verschont. Wenn den Jungen nicht noch eine Infektion dahinraffte, war es ein Fehler gewesen. Sein Bauchgefühl sagte ihm das ganz deutlich.
Er erreichte den Rand der Scheune und ging hinter der Ecke in Deckung. Er überprüfte das Gewehr, legte es an und drückte den Schaft fest gegen seine Schulter. Er bewegte sich fast lautlos zum Eingang, die Ohren gespitzt nach allen Geräuschen, die die Position der Eindringlinge verraten könnten, aber er hörte nichts.
Die Tür war aufgebrochen. Marcus wich zurück, um Anlauf zu nehmen. Mit einer scheinbar einzigen, flüssigen Bewegung sprang er nach vorne, trat die Tür auf und warf sich mit dem Finger am Abzug in die Scheune.
Das Licht brannte im Inneren des Gebäudes, das sie zu ihrem Zuhause gemacht hatten. Direkt gegenüber von Marcus erstreckten sich entlang der ganzen Wand raumhohe Lagerregale. Sie waren nur zu einem Viertel gefüllt, was aber offenbar gut genug war für einen der Eindringlinge, um sich zu bedienen. Als Marcus auf den Mann mit dem roten Bart zielte, der verschiedene Packungen und Dosen in einen Leinensack stopfte, echote ein lauter Knall von links neben der Tiefkühltruhe. Bevor Marcus reagieren konnte, schlug ein Geschoss in seinen Körper ein. Trotz der sengenden Hitze des Treffers schaffte er es, drei Schüsse auf den Rotbärtigen abzugeben. Er verfehlte ihn und traf stattdessen ein großes Paket Toilettenpapier, das in einer Wolke aus weißen Papierschnipseln explodierte.
Ein weiterer Knall hallte von rechts wider, wo Marcus in einem Metallschrank die Reste dessen aufbewahrte, was einmal sein Waffenlager gewesen war. Unmittelbar riss ihn der schwere Treffer eines weiteren Geschosses zurück. Der Schock des Einschlags brachte ihn aus dem Gleichgewicht, und er ließ das Gewehr fallen. Die Schlinge verhedderte sich noch an seinem Unterarm, bevor die Waffe herunterfiel und nutzlos über den Boden schepperte.
Marcus griff nach seinem Holster und bemühte sich, den Griff der Glock zu finden, als sich ein weiterer Schuss in sein Fleisch bohrte und eine sengende Hitze mit sich brachte, die ein schmerzvolles Stöhnen tief aus seiner Kehle hervorzwang.
Marcus ging in die Knie und musste hart kämpfen, um die drei Männer zu fokussieren, die sich ihm näherten. Zuerst kam höhnisch lachend der Mann mit dem roten Bart auf ihn zu. Er war mit einem Paar Pistolen bewaffnet und hielt sie in Hüfthöhe vor sich, als wäre er ein Gunslinger aus dem alten Westen. Seine Handrücken zierten identische Tattoos, die jeweils ein schwarzes Dollarzeichen zeigten.
Das Atmen fiel Marcus zunehmend schwerer, und er griff sich mit beiden Händen an die Brust. Er schaffte es, eine Hand zur Glock an seiner Hüfte zu bewegen, aber er hatte nicht die Kraft, sie aus dem Holster zu ziehen. Von links hörte er ein tiefes, schepperndes Lachen. Er blickte auf und sah einen kleinen, gedrungenen Mann mit dickem Gesicht über sich, der eine Augenklappe über dem rechten Auge und ein Gewehr über der Schulter trug. Seine Zähne waren gelb und seine Lippen kräuselten sich wie zwei sich paarende Nacktschnecken. Der Mann griff nach unten, nahm die Glock und schleuderte sie über den Betonboden in Richtung der Regale an der gegenüberliegenden Wand.
»Das ist jetzt nicht gerade dein Tag, was?«, fragte der Mann mit der Augenklappe.
»Jedenfalls ist es sein letzter Tag«, kam eine Stimme mit starkem Akzent von rechts. »Und er wird es nicht einmal bis zum Mittagessen schaffen.« Er sprach mit dem unverkennbaren Southern Drawl eines Texaners.
Marcus senkte den Kopf und warf einen Seitenblick nach rechts, wo sich ein Mann mit einer langen Narbe, die sich quer über sein langgezogenes, kantiges Gesicht zog, vor ihn hockte. Der Mann kickte das Gewehr zur Seite, streckte eine behandschuhte Hand aus und berührte sanft Marcus’ Wange. Marcus wich zurück.
»Deine Frau hat uns einen besseren Kampf geliefert als du«, sagte er. »Ist es nicht so, Cego?«
Der Mann mit der Augenklappe lachte erneut, und seine tiefe Stimme kratzte dabei wie Nägel über eine Kreidetafel. »So gut sie eben kämpfen konnte«, knurrte er. »Ganz schön gekreischt hat sie dabei. Die Kleinen auch.«
Marcus biss sich auf die Unterlippe. Er ballte die Hände zu Fäusten und rieb sich vor Wut die Knöchel auf dem Beton auf, blieb aber stumm. Die Männer verspotteten ihn weiter, stießen ihn immer wieder mit dem Fuß an und empfahlen ihm fröhlich, endlich die kalte Umarmung des nahenden Todes zu erwidern. Stattdessen konzentrierte er sich auf ihre Gesichter und prägte sie sich genau ein, jede Falte, jede Pore, jede Unvollkommenheit. Er lauschte aufmerksam ihren Stimmen und atmete tief ihre muffigen Gerüche ein.
Der Rotbärtige kratzte sich am Kinn. »Der Typ ist erledigt«, sagte er mit einer kratzigen Stimme, die kaum menschlich klang. »Sollen wir es hinter uns bringen?«
»Nein«, antwortete Cego. »Ich will zusehen, wie er langsam stirbt. Kommt nicht oft vor, dass wir das Vergnügen haben.«
»Dafür haben wir keine Zeit«, gab der Südstaatler mit der Narbe scharf zurück. »Ich muss mich noch an anderen Orten ums Geschäft kümmern. Wir nehmen, was wir kriegen können und machen uns wieder auf den Weg. Wir haben einen langen Ritt vor uns.«
Cego sah ihn mürrisch an. »Du bist echt ein Spielverderber, Rasgado.«
Rasgado stemmte seine behandschuhten Hände auf die Knie, drückte seinen Oberkörper hoch und stand auf. Er ging zu dem großen Metallschrank, in dem sich die wenigen Waffen befanden, die Marcus geblieben waren, nachdem er das Kartell zurückgeschlagen hatte und dem Griff der Dweller entkommen war.
»Ich kümmere mich um den Rest der Vorräte«, sagte er. »Ihr zwei macht eure Säcke voll und geht zurück zu den Pferden.«
Marcus sank auf die Fersen. Er konnte die Männer sprechen hören, während sie sein Eigentum durchwühlten, verstand aber nicht, was sie sagten. Der Raum drehte sich wie eine Uhr, deren Sekundenzeiger immer wieder ins Stocken gerät, während er das Ziffernblatt umrundet. Er kippte nach hinten um, die Wand der Scheune neben der Tür fing ihn auf. Sein Körper zitterte, seine Sicht verengte sich, seine Atmung war flach und unregelmäßig.
Marcus schloss die Augen und konzentrierte sich auf die Schussverletzungen und die stechenden Schmerzen, die seinen Körper beinahe zu zerreißen drohten. Er biss sich auf die Innenseite seiner Wange, bis der warme, metallische Geschmack seines eigenen Blutes seinen Mund füllte.
Nach gefühlten Stunden, die aber wahrscheinlich nur Minuten waren, brachte der übelriechende Gestank der an ihm vorbeieilenden Männer Marcus dazu, die Augen zu öffnen. Der Mann mit dem roten Bart, der einen prall gefüllten Leinensack hinter sich herzog, blieb stehen und grinste ihn an.
Marcus schluckte schwer und bedeutete dem Mann mit einer Kopfbewegung, näherzukommen. Der Fremde beugte sich zu ihm herunter.
»Was gibt es?«, fragte er mit seiner kratzigen Stimme. »Hast du noch ein paar letzte Worte oder so was?«
Marcus flüsterte: »Name.«
Der Eindringling hob eine seiner dicken buschigen Augenbrauen. »Mein Name?«, fragte er. »Du willst den Namen des Mannes wissen, der dich getötet hat?«
Marcus antwortete nicht. Er riss die Augen auf und starrte den Mann an, bis ihm Tränen die Wangen herunterliefen.
Der Mann fuhr sich durch den Bart. »Barbas.«
Marcus hob schwach seine linke Hand und zeigte mit dem Finger auf ihn. »Tot«, murmelte er. »Barbas.«
Ein von gelbfleckigen Zähnen geprägtes Lächeln huschte über das Gesicht des Mannes. Er tätschelte Marcus mit dicken, schwieligen Fingern den Kopf. »Niedlich«, sagte er. »Du denkst, du hast noch Leben in dir.«
Der rotbärtige Barbas legte seine Handfläche an die Seite von Marcus’ Gesicht und schob, bis Marcus zur Seite fiel. Dann verpasste er ihm am unteren Ende seiner Wirbelsäule einen Tritt in den Rücken und verließ den Raum durch die offene Tür.
Marcus hustete und stöhnte. Er versuchte, seine Augen offenzuhalten. Er versuchte zu atmen. Ein und aus. Ein und aus. Aber er war dabei, den Kampf zu verlieren.
KAPITEL 2
20. Oktober 2042, 17:32 Uhr Jahr zehn nach dem Ausbruch Östlich von Rising Star, Texas
Marcus saß im Baumhaus und fuhr geistesabwesend mit seiner Hand über die glatte Fensterbank, die er vor mehr als einem Jahrzehnt mit der Hand geschliffen hatte. Er sah über sein Land zum Highway.
Die Sonne stand tief und drückte ihre Strahlen ab und an zwischen dichten, pausbäckigen Wolken hindurch, die an einem klaren, blauen Himmel über West Texas hingen. Eine beständige Brise strich wie mit sanften Fingern über die Spitzen des hohen Grases zwischen der Straße und dem Baumhaus. Das in Wellen wogende Gras verlor allmählich sein tiefes Grün zugunsten einer weniger lebendigen Farbe.
Marcus holte so tief Luft, wie es ihm in den letzten drei Wochen möglich gewesen war, und seufzte tief. Etwas in seinem Hinterkopf hatte ihn immer gewarnt, dass sein Glück nur vorübergehend sein würde, dass der Segen eines Lebens mit Lola, Sawyer und Penny nur ein Köder war. Ein Köder, der ihn an die Oberfläche locken sollte, bevor es ihn zurück in die Tiefen der Einsamkeit riss, in der er sein halbes Leben seit dem Ausbruch verbracht hatte.
Wie sich herausgestellt hatte, bestand die Apokalypse für Marcus nicht darin, dass zwei Drittel der Weltbevölkerung an einer unheilbaren Lungenentzündung erkrankt waren. Es ging für ihn auch nicht um das verdorbene Kartell mit seinem unstillbaren Hunger nach Gewalt und Macht oder um die Dweller, die das Reich des Kartells mit einem hoffentlich weniger dystopischen Texas ersetzen wollten. Für Marcus zählte allein der Schmerz. Der Schmerz, dass er seine Familie im Stich gelassen, seine Ausbildung vergessen und es geringeren Männern gestattet hatte, ihn zu besiegen. Der Schmerz, dass er würdelos alt wurde in einer Welt, die wenig wertschätzte, was er zu bieten gehabt hatte.
Sein Blick wanderte über das Land, das er nun die längste Zeit sein Zuhause genannt hatte. Er sah die blassgrünen Büsche, die gut gewachsenen Eichen, die er selbst gepflanzt hatte und die jetzt um das Überleben in der Dürre kämpften, den orangefarbene Kuss der Sonne über der goldenen Ebene hinter seinem Grundstück und die niedrigen, wellenförmigen Umrisse der fernen Hügel. Das alles machte ihm diesen Ort vertraut. Es war jetzt das einzig Vertraute, was ihm geblieben war.
Lola und die Kinder hatten ihm die Chance gegeben, zumindest damit anzufangen, seine Schuld zu tilgen und etwas wiedergutzumachen. Sie zu beschützen, sie zu lieben, ihnen etwas beizubringen. Irgendwie hatten sie es gemeinsam geschafft, einen Anschein von Normalität in ihrem versteckten Eden zu leben. Lola war eine gute Seele, die nie versucht hatte, Marcus’ tote Frau Sylvia zu verdrängen. Stattdessen hatte sie freudig das Leben angenommen, das Marcus vor dem Ausbruch der Seuche gelebt hatte. Immer wieder hatte sie ihn ermutigt, über seine Erinnerungen zu sprechen, die guten wie die schlechten. Sie hatte gewollt, dass er eines verstand: Es war in Ordnung, glücklich zu sein.
Sawyer, Lolas Sohn, war ein feiner junger Mann gewesen. Stark und ein guter Begleiter auf der Jagd. Er hatte mehr erfahren und war vernünftiger gewesen, als es für seine jungen Jahre gut war. Marcus hatte ihn lieben gelernt, wie er seinen eigenen Sohn Wes geliebt hatte.
Die kleine Penny war gerade sechs geworden, so hatten sie angenommen, obwohl es unmöglich war, es genau zu wissen. Ihre Mutter Ana war so unerwartet gestorben, dass sie keine Gelegenheit gehabt hatten, viel über das Baby zu erfahren, das sie dann im Grunde adoptiert hatten. Für Marcus sah Penny genauso aus wie ihre Mutter, zumindest soweit er sich an sie erinnern konnte. Aber in allem anderen war aus ihr eine Art Mini-Lola geworden. Wenn sie nicht geschlafen hatte, war Penny stets an Lolas Hüfte dabei gewesen. Mit ihren Gesten, dem Ton ihrer Stimme und ihrem Gesichtsausdruck hatte sie die Frau nachgeahmt, die sie Momma genannt hatte.
Marcus fuhr über das glattgeschliffene Holz und betrachtete seine Fingernägel. Unter ihnen hatte sich Dreck aus dem Garten angesammelt. Er versuchte, ihn herauszukratzen, und musste dabei an die grauenhafte Aufgabe denken, die den Dreck als furchtbare Erinnerung unter seine Nägel geschoben hatte.
Ein stärkerer Luftzug wirbelte durch das offene Baumhaus. Marcus zitterte und zog den Kragen seiner abgewetzten Jeansjacke hoch. Er schob sich zur Falltür und kletterte vorsichtig die Holzbretter hinunter, die er an den stabilen Stamm der Eiche genagelt hatte. Er übersprang das letzte Brett und landete mit einem dumpfen Schlag auf dem Boden. Die Überreste eines dunklen Flecks auf den Grashalmen, dort, wo er Sawyer gefunden hatte, winkten ihm zu.
Drei Wochen lang hatte Marcus jeden wachen Moment damit verbracht, eine von drei Aufgaben zu erfüllen. Er hatte seine Wunden gepflegt, er hatte um den Verlust seiner Familie getrauert und sich auf die Erinnerung an die Gesichter der drei Männer konzentriert, die ihn gezwungen hatten, Zeit in die beiden anderen Aufgaben zu investieren.
Da war der Mann mit dem roten Bart, Barbas. Seine Augen waren schwarz und sein Bart lang und strähnig. Das drahtige Geflecht spross wie eine Flamme aus seinem Kinn. Seine Stimme war rau.
Rasgado, so lautete der Name des Mannes mit der Narbe, die quer von unten nach oben sein ganzes kantiges Gesicht schmückte. Sein Südstaaten-Akzent verstärkte den Eindruck eines ungebildeten Mannes, der jedoch glaubte, mehr zu wissen als andere. Sein Atem hatte nach saurer Milch gerochen.
Der Fremde mit der Augenklappe hieß Cego. Er hatte es irgendwie geschafft, in einer Zeit fett zu bleiben, in der die meisten verhungerten. Seine tiefe, knurrige Stimme war unverkennbar.
Marcus spielte die Gesichter in seinem Kopf durch wie Karten, die er immer wieder mischte, neu zog und sich dabei einprägte. Er hatte keine Ahnung, wer sie waren oder warum sie gekommen waren. Er vermutete, dass sie nichts mit den Dwellern zu tun hatten. Sonst hätten sie ihm das unter die Nase gerieben. Dafür war genügend Zeit gewesen, während er vor ihnen im Sterben lag.
Sie hatten ihn verspottet, ausgeraubt und ohne Grund seine Familie getötet. Es war Marcus egal, wer sie waren und warum sie ihn ruiniert hatten. Auf seinem linken Bein humpelnd ging er langsam zurück zur Scheune. Er dankte ihnen, dass sie ihm einen Grund zum Überleben und ein Leben, in dem er nichts mehr zu verlieren hatte, gegeben hatten.
Während die Sonne hinter dem Horizont versank und mit ihrem letzten Licht den Himmel im Westen orange ausleuchtete, stieß Marcus das Scheunentor auf und ging durch den Raum zu einer der Gefriertruhen. Er zog den Deckel hoch und stützte ihn mit einem kurzen Kantholz ab. Er beugte sich in die leere Truhe hinein, wischte eine Frostschicht aus einer der Ecken und legte eine weiße Aufreißlasche frei. Er zog an der Lasche und riss einen falschen Boden heraus, den er zur Seite warf.
Marcus balancierte sein Gewicht auf dem Rand der Gefriertruhe aus und griff tief nach unten, bis er eine große, weiße PVC-Röhre mit Kappen an beiden Enden zu fassen bekam. Er zog sie aus der Gefriertruhe und lehnte sie an die Seite, bevor er zurück in die Kälte tauchte, um eine zweite, kleinere Röhre herauszuholen.
In jeder Hand eine Plastikröhre schlurfte Marcus über den Betonboden zu seiner Werkbank, auf der er immer seine Waffen vorbereitet, gereinigt und geladen hatte. Er legte die Röhren auf den Tisch und schraubte die Kappen ab. Als er die Röhren leicht neigte, rutschte der Inhalt heraus. Zum Inhalt gehörte jeweils ein Dutzend kleiner Päckchen mit Trockenmittel, um jegliche Feuchtigkeit aufzunehmen, die nach dem Verschließen in den Röhren geblieben sein mochte.
Auf der linken Seite des Tisches lag nun eine große Schachtel Munition im Kaliber .30-06. In der Schachtel befanden sich fünfhundert Patronen mit Stahlgehäuse und Berdanzündung. Jede von ihnen war so wertvoll wie ein Goldstück, ein vergrabener Schatz, den Marcus für den Fall versteckt hatte, das alles andere fehlschlug.
Rechts von der Schachtel mit der Munition befand sich ein Springfield M1903 in der A4-Konfiguration für Scharfschützen. Es war das gleiche Gewehr, mit dem Ernest Hemingway in Afrika auf die Jagd gegangen war. Marcus hatte es zwei Jahre vor dem Ausbruch der Seuche auf einer Waffenausstellung gekauft. Es war bemerkenswert genau und gut geeignet für großes Wild.
Sicher, es war kein Schnellfeuergewehr und auch keine Halbautomatik, aber es war die letzte Waffe, die er noch besaß. Sie würde genügen.
Der Zylinder und der Bolzen waren großzügig mit Waffenfett eingeschmiert. Diese Art Gewehr neigte sonst zum Rosten, insbesondere in einer extremen Umgebung wie einer Gefriertruhe.
Er fuhr über den Lauf des Gewehrs und strich mit den Fingern über den polierten Holzschaft. Dann zog er eine Schublade unter der Tischplatte auf und fischte eine Tube mit Waffenreiniger heraus.
Marcus schob die Sicherung in die obere Position, den Magazinhebel in die Mitte und zog den Schlagbolzen heraus. Er wog sein Gewicht in der Hand, drehte an der Rückseite des Bolzens und entfernte den Zündstift. Er musste definitiv gereinigt werden. Mit viel Liebe zum Detail pflegte Marcus seine Waffe und setzte sie mit Leichtigkeit wieder zusammen.
Er öffnete die Munitionskiste und holte einen silbernen Mauser-Ladestreifen heraus. Der Ladestreifen fasste fünf der großen Patronen im Kaliber .30-06 und ermöglichte ein einfaches Nachladen. Er bestückte den Ladestreifen, schob ihn in das Gewehr, verriegelte den Bolzen und sicherte die Waffe. Links vom Schlagbolzen stellte er mit dem Daumen den Magazin-Trennschalter auf »Ein«, wodurch er die fünf Patronen wie bei einem traditionellen Gewehr rasch hintereinander feuern konnte.
Das Springfield zeichnete das aus, was Marcus gerne als »butterweiche Mechanik« bezeichnete. Der Bolzen bewegte sich beinahe reibungslos, insbesondere für eine Waffe, die mehr als ein Jahrhundert zuvor entwickelt worden war. Das Gewehr war bis auf sechshundert Yards genau, vielleicht sogar etwas weiter, abhängig von den Fähigkeiten des Schützen. Die Waffe war weder modern noch technisch besonders raffiniert, aber das Springfield M1903 A4 war und blieb eine wunderschöne Killermaschine. Auf dem Springfield war ein fantastisches Zielfernrohr montiert. Es handelte sich um ein Trijicon Variable Combat Optical Gunsight, dessen Optik die Reichweite der Waffe noch übertraf. Aus näherer Distanz ließ sich das Zielfernrohr sogar ohne Zoom benutzen.
Marcus ließ die Waffe auf dem Tisch liegen und durchquerte den Raum, vorbei an dem Doppelfeldbett, das Sawyer und Penny fünf Jahre lang als Schlafstatt gedient hatte. Er vermied es, das Bett anzusehen. Es war noch immer so unordentlich wie an diesem tödlichen Morgen vor drei Wochen. Er hatte Penny reglos unter der handgeknüpften Decke gefunden, die Lola aus alten Sweatshirts gemacht hatte. Schon bevor er versucht hatte, sie hochzuheben, hatte er gewusst, dass es vergebens sein würde.
Marcus ging so schnell, wie seine Verletzungen es zuließen an den Feldbetten vorbei an das Ende des großen raumhohen Lagerregals, das er schon vor dem Ausbruch der Seuche installiert hatte. Es war jetzt fast leer, so gut wie keine Nahrungsmittel oder Vorräte des täglichen Bedarfs wie zweilagiges Toilettenpapier oder Küchenrollen waren mehr vorhanden.
Alles, was übriggeblieben war, waren Kartons mit Backpulver, Krüge mit weißem Essig, ein paar Werkzeuge, leere Plastikwasserflaschen und einige letzte Erste-Hilfe-Sets. Zwei Gläser Honig waren das einzige Essbare, das noch zu finden war.
Marcus holte einen großen Wanderrucksack aus einem der Regalfächer und öffnete den Reißverschluss. Er füllte ihn mit den Erste-Hilfe-Sets, ein paar Wasserflaschen, einem Plastikbeutel mit Aktivkohlegranulat, das er seit dem Ausbruch der Seuche aufbewahrt hatte, einem Auto-Werkzeugset im Plastikkoffer und den beiden Honiggläsern. In der Seitentasche verstaute er eine große Feldflasche. Dann zog er ein paar Blatt Papiertücher aus einer großen Schachtel und stopfte sie ebenfalls in den Rucksack.
Er lief das Regal entlang, fand ein großes Einmachglas und füllte es mit Essig. Am anderen Ende des Regals, in der Nähe der Gefriertruhe und den Feldbetten, auf denen er und Lola geschlafen hatten, fand er einige zusammengelegte Kleidungsstücke. Es waren hauptsächlich T-Shirts, Jeans und etwas Unterwäsche, die sie irgendwo gefunden und gereinigt hatten. Er stopfte, was er konnte, in den Rucksack.
Seine letzte Station war ein Brett auf Augenhöhe in der Mitte des Regals. Dort lag ein Schatz, den er für Notfälle aufgespart hatte: eine einzelne Dose Feuerzeugbenzin, ein Päckchen wasserdichter Camping-Streichhölzer und ein Feuerstein-Anzünder. Daneben lag ein Schlafsack, den er nicht mitnehmen würde, und ein Vier-Mann-Zelt, in dem bequem zwei Personen unterkamen. Er nahm das Feuerzeugbenzin, die Streichhölzer und den Anzünder, und während er dabei war, griff er auch noch nach einem faltbaren Campingtopf. Er presste den Topf in die letzte Lücke im Rucksack, setzte den Rucksack auf, holte sein Gewehr und verließ die Scheune zum letzten Mal. Er zitterte, als er nach draußen trat, und schlug seinen Kragen hoch. Die Wolken waren an Rising Star, Texas, vorbeigezogen. Nun fehlte die wärmende Decke, die die warme Luft gehalten hatte. Es war gegen Mitternacht, und die Mondsichel stand auf halber Höhe am schwarzen Himmel. Marcus atmete die Kälte tief ein und schob mit den Schultern den Rucksack auf seinem Rücken zurecht.
Mit schweren Schritten ging er durch das raschelnde, kniehohe Gras in den Garten. Seine Stiefel knirschten auf dem harten Boden. Er sog den Geruch der Kälte tief ein, rieb sich die eisige Nasenspitze und stieg über die abgerundeten Holzbretter, die das erhöhte Gartenbeet umrahmten. Hier bedeckte weiche, feuchte und fruchtbare Erde den Boden.
Die Möhren und der Sellerie waren reif, ebenso ein Teil des Spinats. Er zog ein halbes Dutzend Möhren aus der Erde und ließ sie in das mit Essig gefüllte Einmachglas fallen. Etwas Sellerie und Spinat wickelte er in eines der Papiertücher und verstaute die kleine Ernte in die Außentasche des Rucksacks.
Marcus wischte sich die Hände an der Hose ab und humpelte zu dem kleinen Friedhof, der nun auf doppelte Größe angewachsen war. Dort befanden sich jetzt fünf Gräber, in denen Menschen lagen, die Marcus geliebt und letztendlich im Stich gelassen hatte. Er überlegte, ob er sich hinknien und beten sollte. Er dachte darüber nach, Sylvia und Wesson wieder in sein Leben zu holen, und sei es als Stimmen in seinem Kopf.
Lola hatte ihn davon befreit, mit den Toten sprechen und seine Waffen wie Persönlichkeiten behandeln zu müssen. Sie hatte ihm beigebracht, dass das Leben den Lebenden gehörte und es nur dann wert war, gelebt zu werden, wenn man nach vorn blickte statt zurück. Sie hatte recht gehabt. Wie erleichternd war es für ihn gewesen, nicht länger an die Vergangenheit, an seine Fehler und seine Schwächen gefesselt zu sein. Er hatte die Hoffnung und die Vorfreude geliebt, die mit der Frage einhergingen, welche schönen Erlebnisse, wie eingeschränkt auch immer, die Zukunft für sie bereithielt.
Es wäre für Marcus ein Leichtes gewesen, alles zu vergessen, was Lola für ihn getan hatte. Nichts war einfacher, als sich in die Dunkelheit voller Selbstmitleid und Selbstzerfleischung zurückfallen zu lassen. Er tat es nicht. Leise verabschiedete er sich von den Frauen und den Kindern und verließ die Grabstätte, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Die Sonne stand inzwischen tief am Himmel und war kurz davor, hinter dem westlichen Horizont zu versinken. Er hatte länger gebraucht als geplant, um sich auf seine Reise vorzubereiten. Jetzt war die Zeit gekommen.
Marcus ging zur anderen Seite der Scheune. Die Schusswunde würde ihn für einige Zeit humpeln lassen, aber zum Glück hatte die Kugel seinen Oberschenkel glatt durchschlagen und Nerven, Blutgefäße und Knochen verfehlt. Die Wunde, die er fast zwanghaft immer wieder gereinigt hatte, um eine Infektion zu verhindern, heilte allmählich. Aber der Muskel war verletzt. Es würde eine Weile dauern, bis die Wunde seine Ausdauer und Geschwindigkeit zumindest nur noch wenig einschränkte.
Er erreichte die nordwestliche Ecke der Scheune, wo der mit Erdgas laufende Generator dem Brunnen am nächsten war, den er mit dem Bohrunternehmen zusätzlich ausgehandelt hatte. Der Brunnen hatte ihnen in mehrfacher Hinsicht das Leben gerettet. Was zunächst wie eine törichte zusätzliche Ausgabe ausgesehen hatte, um an etwas heranzukommen, das auch so im Überfluss vorhanden war, hatte sich nach dem Ausbruch der Krankheit als ein Segen erwiesen.
Marcus lehnte das Springfield an die Scheunenwand, nahm einen großen Schraubenschlüssel und steckte ihn auf den Anschluss, der den Generator mit der Scheune verband. Er drehte das hellgelbe Ventil senkrecht zum Rohr und stellte das Gas ab. Dann drehte er den Schraubenschlüssel mit aller Kraft gegen den Uhrzeigersinn, um das Verbindungsstück zu lösen.
Nach mehreren schwergängigen Umdrehungen löste sich die Verbindung. Marcus entfernte sie; übrig blieb ein offenes Rohr, das auf die Wand der Scheune zeigte. Dann öffnete er das gelbe Ventil, und erneut strömte Gas aus dem Generator. Der starke, faulige Geruch von Mercaptan kam aus dem offenen Rohr.
Er hängte sich das Gewehr über die Schulter und machte ein paar Schritte zurück. Marcus versuchte, nur durch den Mund zu atmen, um den immer stärker werdenden Gestank zu vermeiden.
Neben dem Generator hatte er einen großen Berg trockener Äste, Blätter und Unkraut aus dem Garten aufgehäuft. Fast eine Woche lang hatte er alles Brennbare hierher geschafft, was er tragen oder durch das hohe Gras ziehen konnte.
Er öffnete die schwarze Dose mit Feuerzeugbenzin, drehte sie auf den Kopf und drückte sie. Ein steter Strom der geruchlosen Flüssigkeit ergoss sich über das Brennmaterial und den Boden darum herum. Zuletzt richtete Marcus die Dose auf die Wand der Scheune, bis sie leer war.
Er warf die Dose auf den Stapel, zündete ein Streichholz an und warf es hinterher. Das Benzin ging in einer Stichflamme auf, das trockene Holz knisterte und flackerte, und nach kurzer Zeit loderten die Flammen so hoch, dass sie geradezu am Himmel selbst zu lecken schienen.
Rasch wich er zurück und eilte zum Zaun am westlichen Rand seines Grundstücks, während der Rauch immer schwärzer wurde und hoch in den Himmel stieg. Als er den Highway erreicht hatte, stand die Scheune lichterloh in Flammen.
Fünf Jahre zuvor, als sein Haus niedergebrannt war, hatte Marcus es als einen unwiederbringlichen Verlust empfunden. Diesmal betrachtete er es als einen Akt der Reinigung. Das Zuhause, das er gebaut hatte, um Obdach und Schutz zu bieten, hatte am Ende in beidem versagt.
KAPITEL 3
21. Oktober 2042, 06:32 Uhr Jahr zehn nach dem Ausbruch Östlich von Rising Star, Texas
Marcus konnte sich nicht erinnern, wann es das letzte Mal geregnet hatte. Seit Wochen drohten die Wolken es immer wieder an, aber dann war nicht ein Tropfen gefallen.
Die Straße war von Rissen durchzogen und von Schlaglöchern übersät. Die Asphaltdecke war so verfallen, dass er beinahe dankbar war, zu Fuß unterwegs zu sein. An ein Auto war ohnehin nicht zu denken, aber selbst für ein Pferd wäre der unebene Untergrund eine Gefahr. So gesehen war es geradezu zuvorkommend von den Mördern seiner Familie gewesen, seine Pferde mitzunehmen, nachdem sie ihn zum Sterben zurückgelassen hatten.
Die Sonne schien ihm auf den Rücken, als er auf dem Highway 36 nach Westen ging. Sie hing tief über dem hügeligen Horizont und milderte die Kälte kaum. Das Springfield hing über seiner Schulter, auf dem Rücken trug er einen großen Rucksack und in der rechten Hand seine Glock, die sie ihm aus Nachlässigkeit oder aus Leichtsinn gelassen hatten. Mehr war ihm nicht geblieben. Im Magazin der Pistole befanden sich nur noch acht Schuss.
Fünfzehn Meilen war Marcus jetzt von seinem Haus entfernt, noch ungefähr vierzig Meilen waren es bis zu seinem ersten Ziel. Er wusste nicht viel über diese Welt, die er schon zwei Mal hinter sich gelassen hatte, aber Abilene dürfte hier in der Gegend noch immer einer Stadt am nächsten kommen. Seine Suche konnte genauso gut dort beginnen.