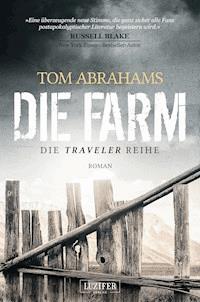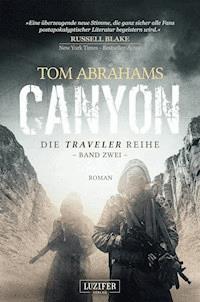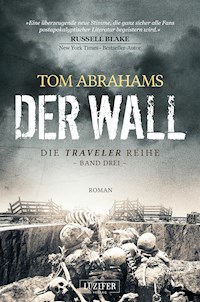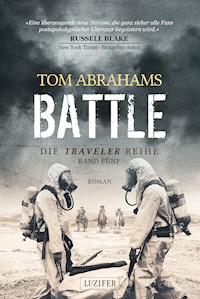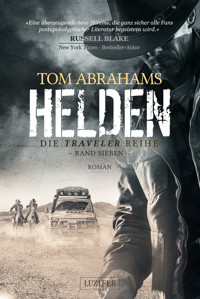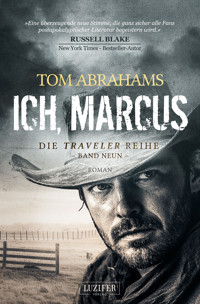Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Bar am Ende der Welt
- Sprache: Deutsch
Eine notleidende Stadt. Ein Schmuggler auf Abwegen. Und der Kampf um die Zukunft der Menschheit. Zeke ist ein übler Kerl. Unfreiwillig. Aber um in einer postapokalyptischen Welt zu überleben, in der Vertrauen ebenso rar ist wie Wasser, bleibt einem nichts anderes übrig. Doch nachdem er weit draußen im Ödland nur knapp dem Tod entrinnt, beschließt er, sein Leben nicht länger für irgendwelche gierigen Gangsterbosse aufs Spiel zu setzen. Gestrandet in einer Bar im Nirgendwo trifft er genau die richtigen Raubeine, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Bewaffnet mit einer neuen Bestimmung und einem ganz besonderen Auto macht sich Zeke auf, um Vergeltung zu üben, Erlösung zu finden, und – wo er schon mal dabei ist – vielleicht auch seine große Liebe zurückzuerobern. Tom Abrahams' neuester Roman ist ein wilder Ritt durch eine postapokalyptische Welt, die jedoch mit einer phantastischen Wendung aufwartet. Für Fans von Hugh Howey und Stephen Kings "Dunkler Turm"-Saga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Bar am Ende der Welt
Tom Abrahams
This Translation is published by arrangement with Aethon Books. Title: THE BAR AT THE END OF THE WORLD. All rights reserved.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: THE BAR AT THE END OF THE WORLD Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Elena Helfrecht Lektorat: Manfred Enderle
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-614-6
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Zeke Watson trat aufs Gaspedal. Der Motor seines 1970er Plymouth Superbird heulte zur Antwort auf. Das stählerne Fahrwerk vibrierte um ihn und brachte seine zusammengebissenen Zähne zum Klappern, als er die Maschine an ihre Grenzen trieb.
Mit der einen Hand hielt Zeke den Superbird auf Kurs, die andere presste er auf die klaffende Wunde unterhalb seiner Rippen. Sein Magen fühlte sich an, als wäre er nach außen gestülpt. Das war durchaus möglich. Nach allem, was er wusste, hielt nur seine Hand die Gedärme noch an ihrem Platz.
Der Highway vor ihm führte die beiden Teile der sonnenbeschienenen Ödnis wie ein schwarzer Reißverschluss zusammen. Zekes Aufmerksamkeit galt allerdings der grimmigen Truppe Männer, die hinter ihm her war. Helme und Bandanas verdeckten ihre Köpfe und Gesichter. Einige fuhren Motorräder, andere hockten auf dem Sozius oder auf den Dächern riesiger Pick-up-Trucks.
Sie holen auf.
Zeke stellte sich aufs Pedal und erhob sich vom zerschlissenen Fahrersitz. Er hatte die Polsterung reparieren wollen, irgendetwas war ihm jedoch ständig dazwischengekommen.
Die weite Ödnis sauste zu beiden Seiten an ihm vorbei. Der einzige Hinweis darauf, dass er sich bewegte, war die durchbrochene Mittellinie, die unter seinem Plymouth verschwand, sowie gelegentliche Felsbrocken, die über die kahle Landschaft gesprenkelt waren. Er nahm an, dass er im Ödland war, das diffuse Gebiet, das die Stadt umgab. Vielleicht waren das Ödländer, die hinter ihm her waren, die Außenseiter, die über die unzivilisierte Wüstenlandschaft herrschten.
Oder gehörten sie zur Unterwelt? Regierungsagenten? Kopfgeldjäger?
Es spielte keine Rolle. Das einzig Wichtige war, dass sie ihm direkt im Nacken saßen.
Ein greller Schmerz durchzuckte seine Organe. Der Schweiß brannte ihm in den Augen, als er sie zusammenkniff, um ihn wegzublinzeln. Sein Rücken, Hals und Gesicht waren vom Glanz aufkeimender Schweißperlen benetzt.
Er packte das Lenkrad fester und trieb sein Fahrzeug an. Die Bande kam näher. Näher. Immer näher.
Einer der Verfolger hatte sich von der Meute abgesetzt und stellte ihm auf seinem Motorrad nach. Es war eine tiefergelegte Harley, wie er sie aus alten Peter-Fonda-Filmen kannte und die er manchmal vor einer dieser Sportkneipen geparkt sah, deren Name in einer einfallsreichen Doppeldeutigkeit auf die weibliche Anatomie anspielte.
Der Biker trug ein schwarzes Bandana über Mund und Nase sowie eine reflektierende Sonnenbrille. Sein Schädel war kahlrasiert. Trotz der Größe seines Motorrads wirkte es im Vergleich zu dem Mann wie ein Zwerg. Es war jedoch nicht seine Größe, die Zeke immer wieder kurz von der Straße vor ihm ablenkte. Es war der gigantische .45er, den er in einer Hand hielt. Der stählerne Lauf der Waffe glänzte im Sonnenlicht.
Zeke dachte zuerst, er wäre das Ziel. Dann dämmerte ihm, das Gaspedal noch immer voll durchgedrückt, dass das Ungetüm seine Hinterreifen anvisierte. Zeke traf eine Blitzentscheidung.
Im Rückspiegel sah er die Horde nur ein paar Meter hinter sich. Er tippte die Bremse fest genug an, um langsamer zu werden, und riss das Lenkrad gleichzeitig nach links.
Die Räder des Plymouth qualmten, das Auto erzitterte.
Zekes Körper hielt dem plötzlichen Trägheitsmoment stand. Die Reifen hafteten auf dem kochend heißen Asphalt, er behielt seine Hand am Lenkrad.
Das reichte aus, um das Vorderrad des Motorrads zu schneiden, es von der Fahrbahn abzubringen und den Revolver aus der Hand des Riesen zu schlagen.
Der Mann verlor die Kontrolle über sein Motorrad, schlingerte und stürzte in ein paar andere Biker am linken Rand der Meute. Die Kettenreaktion setzte ein halbes Dutzend von ihnen außer Gefecht. Drei oder vier verschwanden unter den übergroßen Reifen eines höhergelegten Sattelschleppers. Rot spritzte aus der Massenkollision auf und Zeke richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Straße.
Dann sah er es.
Zu seiner Linken, mindestens zwei Kilometer voraus, stand ein einsames Gebäude, dessen Silhouette wie eine Fata Morgana zwischen den Hitzewellen über der sauren Erde flimmerte. Rauchschwaden stiegen aus dem Umriss empor und lösten sich im wolkenlosen Himmel auf.
Zeke überprüfte seinen Tacho. Er fuhr hundertsiebzig Kilometer pro Stunde, der Zeiger vibrierte am oberen Ende der Skala seines Muscle Cars. Das war gut. Allerdings hatte er nicht genug Sprit.
E? Wie lange steht die Anzeige schon auf E?
Er tippte die Benzinuhr mit dem Finger an. Nichts bewegte sich. Zeke schlug mit der flachen Hand gegen das Lenkrad und erhaschte dabei einen weiteren Blick auf das wabernde Abbild des Gebäudes. Jetzt war er nah genug, um die trüben Umrisse der Fahrzeuge zu erkennen, die davor geparkt waren. Da waren Leute.
Ein lauter Knall erregte Zekes Aufmerksamkeit und zwang ihn zu einem Blick in den Rückspiegel. Auf dem Dach eines Trucks stand ein Mann und zielte mit einem Gewehr auf ihn, aus dessen Mündung Rauch aufstieg. Ein weiterer Schuss blitzte auf und ließ die Heckscheibe explodieren. Scherben flatterten am Rahmen. Zeke kämpfte sich geduckt weiter, das vor ihm liegende Gebäude im Blick. Wenn er es nur erreichen konnte, vielleicht würde ihm jemand helfen.
Ohne die Heckscheibe dröhnte die offene Straße durch die Fahrerkabine des Plymouth. Der Wind peitschte. Die teuflisch trockene Hitze und der Geruch von verbranntem Gummi, vermischt mit den Abgasen, wirkten augenblicklich erstickend.
Er war noch immer mehrere hundert Meter davon entfernt. Das Ödland verzerrte Raum und Zeit.
Ein weiterer Knall, diesmal lauter und heftiger als der letzte, erschütterte seinen Körper im Superbird, gefolgt von einem brennenden Stechen in seiner Schulter. Sein rechter Arm fiel betäubt zur Seite.
Zekes Herz schlug schneller. Der Schweiß lief in Strömen. Sein Puls hämmerte in Hals und Schläfen. Mit jedem Pochen brannte seine Schulter mehr.
Er krümmte sich vor Schmerz, hielt den Atem an und steuerte den Plymouth mit seiner Linken, die Knöchel traten weiß am Lenkrad hervor. Das Muscle Car überquerte die Mittellinie. Die Felsblöcke seitlich des Highways wurden größer und verschwanden dann hinter ihm. Zekes Sicht verschwamm für einen Moment und er biss sich in die Wange, um sich zur Konzentration zu zwingen.
Ich verblute. Ich werd’s nicht schaffen.
Ein großer Truck rammte ihn von hinten. Erneut spannte Zeke seinen heilen Arm an, diesmal fester als vorher.
Er blickte nach vorn. Das Gebäude lag gut fünfzig Meter entfernt, der Parkplatz noch weniger. Zeke überprüfte den Seitenstreifen vor sich und entdeckte keinerlei Hindernisse. Keine Steine, keine Kakteen oder verrottete Pflanzen, keine Tiere. Er hatte freie Bahn.
Der Truck stieß ihn ein letztes Mal an, bevor Zeke das Lenkrad nach rechts riss. Quietschend verließ der Plymouth den Asphalt und setzte auf dem Wüstenboden auf. Die Radaufhängung hielt dem Aufprall stand und federte das unregelmäßige Terrain ab. Es war nicht so eben wie gedacht, aber der Parkplatz und das Gebäude lagen nun geradewegs vor ihm.
Zeke hüpfte in seinem Sitz auf und ab, die ausgeleierten Federn konnten gegen sein Körpergewicht und die Stärke seiner Bewegung wenig ausrichten. Sein rechter Arm fühlte sich elektrisiert an, als das Gefühl in ihn zurückkehrte. Er blickte nach unten und sah die rechte Seite seines Oberteils von Blut durchtränkt. Seine Sicht verschwamm erneut. Er starrte geradeaus und widerstand dem Drang, sich seinen Wunden zu widmen.
Der Motor heulte auf. Die Reifen wirbelten Steine auf, die gegen das Fahrgestell knallten und Dellen schlugen. Vielleicht würde er es schaffen.
Zekes konnte den Staub und die Hitze schmecken. Sein Kopf brummte und war vernebelt. Dann erstarb der Plymouth.
Der Motor stockte und hustete. Die Benzinuhr loderte auf und schlug zur linken Seite des kreisrunden Displays aus. Der Tacho zeigte eine rapide Verlangsamung an.
Zeke fluchte. Die Obszönitäten sprudelten aus seinem Mund wie das Blut, das aus der Schusswunde hinten an seiner Schulter lief.
Der kleine Vorsprung, den er sich gegen die Horde erarbeitet hatte, verpuffte sofort. Der Plymouth rollte im Leerlauf dahin, wurde langsamer und konnte seinen Kurs nicht mehr halten. Als dann die Vorderreifen über die abgeschlagene Betonkante zwischen dem brüchigen Asphalt des Parkplatzes und der Wüste rollten, die das Grundstück umgab, öffnete Zeke mit Schulter und Ellbogen die Tür und kugelte aus dem Auto.
Der Plymouth hielt erst an, als er in das Heck eines 85er Ford Bronco knallte. Zeke sah den Aufprall nicht, während er sich abmühte, auf die Beine zu kommen, aber das Geräusch der kollidierenden Fahrzeuge war unmissverständlich.
Ohne sich umzublicken, rannte Zeke los. Er war außer Atem, seine Beine wie Wackelpudding, sein rechter Arm hing schlaff herunter. Sein Magen fühlte sich an, als würde er mit jedem Schritt zum Gebäude weiter aufreißen.
Fast da.
Durch den aufsteigenden Nebel des Schockdeliriums sah Zeke die zweigeschossige Struktur aus Holz und Kalkstein, mit einer großen, überdachten Veranda, die drei Seiten umspannte. Eine blaue Flagge hing von einem Pfosten an der Vordertreppe und flatterte im heißen Wind. Auf der Mitte der Flagge prangte ein sechszackiger Stern mit Flügeln an den Spitzen und einer Flamme, die aus dem obersten Stachel wuchs.
Er taumelte vorwärts, schwer atmend und mit schwächer werdenden Beinen.
Hinter ihm wuchs das Rumpeln der Trucks zu einer ohrenbetäubenden Lautstärke an. Die verschwommenen Umrisse zweier Motorräder rasten auf ihn zu.
Er war nun so nah, nur Schritte von der Veranda entfernt.
Hinter ihm erschallte halbautomatisches Gewehrfeuer. Ein paar Schüsse schwirrten an seiner Linken vorbei. Zwei weitere verfehlten ihr Ziel nicht. Er spürte die kräftigen, glühend heißen Schläge, die sich in seine Seite bohrten, einer in seine Armbeuge, der andere in das Fleisch oberhalb seiner Hüfte. Zekes Körper machte eine Drehung und stolperte nach vorn. Er schrie vor Schmerz auf und verlor das Gleichgewicht. In einer makabren Pirouette landete Zeke auf der ersten Stufe der Veranda. Sein Kopf knallte mit einem dumpfen Schlag gegen den Pfosten und die Welt verstummte.
Der Wüstenwind raschelte leise in der Flagge über ihm. War er tot? War dies das Jenseits? Ein windgepeitschtes Ödland voller Banden und eine Sonne, die alles von oben versengte? Dann konzentrierte er sich auf das Geräusch von jemandem, der nach Luft schnappte. Nein. Etwas, das nach Luft schnappte. Ein Tier. Sein Atem schlug ihm heiß und feucht ins Gesicht. Es schnupperte an ihm und schnaubte. Eine warme, dicke Zunge verteilte zähflüssigen Schleim auf seiner Wange.
Ein Hund.
Eine starke Hand legte sich auf seine unversehrte Schulter. Die Finger packten ihn und hoben ihn von den untersten Stufen auf, stellten ihn erst auf die Knie und dann auf die Beine. Ein Arm legte sich um seinen erschlaffenden Körper und zog ihn auf die Veranda, dann wurde er von einem weiteren Paar Arme über eine Schulter gelegt.
Er war sich seiner Umgebung vage bewusst und konnte hinter der Veranda auf dem Parkplatz nur Licht und Schatten erkennen, als er die dröhnende Stimme des Mannes hörte, der ihn festhielt.
Dieser trug ihn über die Schwelle, wobei seine Stiefelabsätze dumpf auf den Holzbohlen der Veranda aufschlugen. Ein paar Lamellentüren schwangen vor und zurück, ihre Scharniere quietschten, als Zekes Retter ihn nach drinnen schleifte.
Dort waren noch andere Leute. Zeke spürte sie. Er hörte sie. Ihre Stimmen vermischten sich mit dem Klirren der Gläser und der Musik, welche die heiße, abgestandene Luft erfüllte. Staubig. Alt. Abgenutzt. Trotzdem irgendwie begrüßend, angenehm.
Zeke spürte die Trägheit seines baumelnden Körpers. Seine Schuhe schlugen gegen die knarrenden Flügeltüren. Der Mann sprach zur draußen versammelten Horde. Der Bass seiner Stimme vibrierte in Zekes Brust. Sie hörte sich tröstlich, väterlich an, dennoch lag darin ein ernster, belehrender Ton, eine unausgesprochene Drohung.
»Das ist alles, meine Herren«, sagte der Mann. »Ihr kennt die Regeln. Verzieht euch wieder in das Höllenloch, aus dem ihr gekrochen seid, und lasst uns in Frieden. Mein Kumpel hier hat genug.«
Kapitel 2
»Er ist wach«, sagte eine Stimme, die Zeke aus dem himmlischen Ort zwischen Schlaf und Bewusstsein riss. »Hat lange genug gedauert.«
Zeke blinzelte ins verschwommene Licht einer trüb-gelben Glühbirne. Sobald er wieder scharf sehen konnte, erkannte er diese über sich, im Zentrum eines sich langsam drehenden Ventilators, der in seiner Fassung schaukelte.
Als er versuchte, sich zu bewegen, zuckte ein pochender Schmerz durch seine Innereien, seine rechte Schulter und seine linke Körperhälfte. Dann erinnerte er sich daran, dass er angeschossen wurde. Eine überwältigende Dringlichkeit, fast schon Panik, erstickte den Schmerz. Er musste woanders sein. Jemand war in Gefahr.
»Immer langsam«, sagte der bärtige Mann mit den stählernen Augen, der über ihm stand. »Dein Körper weiß nicht, was er mit sich anfangen soll.«
Zeke sank in das dünne Federkissen zurück, das seinen Hinterkopf auffing. Er starrte den Deckenventilator für einen Moment an, beobachtete die einzelnen Flügelblätter dabei, wie sie sich um die einsame Glühbirne drehten.
»Wir haben dich jetzt grob zusammengeflickt«, sagte der Mann. »Nimm dir ’ne Minute oder drei und komm dann zu uns runter. Du hast alle Zeit der Welt.«
Er tätschelte Zekes Schenkel, wie ein Vater bei seinem Sohn, und wandte sich zum Gehen um.
»Warte mal«, sagte Zeke und erkannte seine raue Stimme kaum wieder. Sie klang wie Schmirgelpapier auf Holz.
Der Mann steckte die Hände in die Taschen. Er trug eine Lederweste so braun wie ein abgenutzter Sattel. Sein weißes Leinenhemd war über die Ellbogen hochgekrempelt und in den verzierten Bund einer locker sitzenden, dunklen Jeans gesteckt. Eine große Messingschnalle zierte seinen Gürtel.
Der Mann war gut in Form, aber alt. Altersflecken bedeckten seine starken Hände. Seine eisblauen Augen waren von Krähenfüßen umrahmt, die von Äonen in der Sonne zeugten. Sein dichtes, dunkles Haar und sein drahtiger Bart waren von weißen und gelben Strähnen durchzogen. Seine gebräunte Haut war ebenso ledrig wie die Weste, was ihn wie jemanden wirken ließ, der sein Leben als Arbeiter verbracht hatte. Jemand, der sich jeden Cent hart mit Schneid und List erarbeitet hatte.
»Danke«, sagte Zeke.
»Kein Ding.« Die Mundwinkel des Mannes zuckten. »Sonst noch was?«
»Ich bin Zeke.«
Der Mann entblößte perlweiße Zähne, die sich von seiner olivgrünen Haut besonders hell abhoben.
»Weiß ich. Ich bin Pedro.«
»Wo bin ich?«
»Bei mir. Du bist in einem der oberen Zimmer. Die Leute brauchen Orte, an denen sie eine Weile bleiben können, bis sie sich zurechtfinden. Ich helfe. Unter uns ist mein Saloon. Komm runter, wenn du magst. Ich geb dir einen aus.«
Mithilfe seiner Ellbogen zog Zeke sich im Bett hoch und setzte sich aufrecht hin. Das Kissen rutschte zu seinen Schultern, aber er stützte sich genug ab, um zu sehen, wie Pedro die Tür öffnete und um die nächste Ecke verschwand. Durch die offene Tür strömten Musik und Gesprächsfetzen in sein Zimmer.
Es kostete ihn mehr als eine halbe Stunde, bis er sich traute, gerade zu sitzen. Weitere fünfzehn Minuten, um seine Füße auf den Boden zu stellen und zu sehen, ob sie sein Gewicht tragen konnten. Vom Staub waren die Holzbretter glatt und rutschig. Mit einer Hand am Bett, um sein Gleichgewicht zu halten, lief Zeke zaghaft zu einem Standspiegel an der Wand neben der Tür. Er erkannte sich nicht wieder.
Seine Farben erschienen ihm falsch. Seine Augen sahen irgendwie seltsam aus. Selbst die Art, wie er seine Schulter hielt, war anders. Dennoch war er es. Zeke kannte den Halunken. Der markanteste Beweis war die hässliche Narbe über seiner Brust und die zwei fehlenden Fingernägel an seiner Rechten. Er zeichnete die Wulst auf seiner Brust mit dem Finger nach und erinnerte sich daran, wer ihm diese beigebracht hatte.
Wo auch immer er gerade war, und dessen konnte er sich im Umkreis von zweitausend Kilometern nicht sicher sein, er verdiente es, in Einsamkeit zu leiden. Das hatte er sich eingebrockt. Eine Welle der Schuld rollte über ihn hinweg und er schalt sich.
Wo war die Schuld davor? Warum fühlt sie sich jetzt so viel stärker an? Warum fühlt sich alles außer dem Schmerz intensiver an?
Bis auf Boxershorts und Wundverbände war er nackt. Er beäugte die weiße Mullbinde, durch die formlose, gelbe Eiterflecken sickerten. Nach der unerklärlichen Abwesenheit der Schmerzen hatte er vergessen, wie übel ihm der Gewehrschuss durchs Schulterblatt zugesetzt hatte. Er konnte seinen Arm bewegen. Es fühlte sich gut an, wenn nicht sogar besser als vorher.
Die größte Wundauflage lag auf seinen Innereien. Er berührte sie in Erwartung eines reflexiven Schmerzes, der jedoch ausblieb.
Die Wunden auf seiner linken Seite störten ihn nicht mehr als ein Bienenstich. Die brennende Hitze war verschwunden, genauso wie der durchdringende, ausstrahlende Schmerz.
Wie lange hab ich geschlafen?
Er erinnerte sich daran, wie er die Stadt verlassen und die Grenze erreicht hatte, bevor er den Soldaten an den Toren begegnet war. Dann war er in die Dunkelheit gefahren, bis sich diese in der hellen, dunstigen Hitze der Mittagszeit aufgelöst hatte.
Einige Erinnerungsfetzen schienen unzusammenhängend. Er seufzte und versuchte, nicht weiter zu rätseln, wohl wissend, dass ihn das sein letztes bisschen Energie kosten würde.
Zekes Haar war ungekämmt, fettig und zur Seite gescheitelt. Sein Kinn war stoppelig. Unter seinen Augen zeichneten sich dunkelviolette Ringe ab. Seine Lippen waren so blau wie die Haut unter seinen Nägeln. Während er so dastand und tief einatmete, fühlten sich seine Beine gleich etwas kräftiger an.
Je weiter der Schmerz jedoch verschwand, desto stärker wurde der Durst.
Unglaublicher Durst. Er öffnete seinen Mund weit, um die käsige Zunge hervorzustrecken. Sie sah ekelerregend aus, und er schloss den Mund mit einem Grunzen.
Zeke beobachtete den Raum hinter sich in der Spiegelreflexion. Es gab einen hölzernen Schaukelstuhl, über den ein paar sauber gefaltete Klamotten gelegt waren, die nicht seine waren. Auf dem Boden befanden sich ein Stiefelpaar aus schwarzem Leder, ein Paar Socken und ein brauner Ledergürtel, der zusammengerollt auf den Stiefeln lag. An der Stuhlkante hing ein braunes Filzhemd. Daneben, über der Rückenlehne, lagen ein paar Jeans. Auf dem Sitzkissen befand sich ein Stetson-Hut.
Er zog sich an und zupfte die Klamotten an seinem verheilten Körper zurecht. Sie passten wie angegossen. Die Stiefel waren so bequem wie die, die er vorher getragen hatte. Mehr als das. Die Kleidung war sauber. Ihnen fehlten der Gestank von getrocknetem Schweiß und die Sandkörner in jeder Falte. Ihr Geruch war fast wie nicht von dieser Welt. Zeke dachte nach, wann er zuletzt ein sauberes Hemd, Hosen oder Socken getragen hatte. Er konnte sich nicht daran erinnern. Er war sich nicht sicher, ob der Grund dafür seine vernebelte Erinnerung oder die Tatsache war, dass er niemals wirklich saubere Kleidung getragen hatte. Komfort war für Zeke ein unbekanntes Konzept. Jetzt, an diesem Ort, in diesen Klamotten, erschien ihm alles fremd. Er fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und setzte den Hut auf, den er so gut wie möglich glattzustreichen versuchte, dann trat er aus seinem Zimmer in den Flur.
Er stand im zweiten Stock, der sich mittig zum darunterliegenden Saloon hin öffnete. Das erinnerte ihn an eines dieser altertümlichen Hotels, die er aus Bildern kannte und deren Zimmer an eine hohe Vorhalle grenzten.
Zeke tastete nach dem Hut auf seinem Kopf und fuhr mit Daumen und Zeigefinger an dessen Vorderkante entlang. Er ging einen Schritt aufs Holzgeländer zu und griff nach dem Eichenbalken, spürte die Robustheit unter seinen schwieligen Fingern und lehnte sich an, um einen Blick auf den Schauplatz darunter zu werfen.
Dieser Ort steckte voller Gegensätze. Die blanken Holzböden wirkten genauso abgenutzt wie das Geländer unter seiner Hand. Die Wände waren mit grobem Zedernholz getäfelt, aber die Lampen waren eindeutig LEDs. Sie erstrahlten in einem hellen Blauton, der den großen Raum wirken ließ, als wäre er in Eis getaucht.
Ebenso modern wie die Beleuchtung war auch die blinkende digitale Jukebox, die den Schwingtüren des Eingangs gegenüberstand. Neben der Jukebox hing ein elektronisches Dartbrett. Zekes Blick schweifte von der Scheibe zu dem hellen Bodenfleck drei Meter weiter, der von den Spielern ganz ausgetreten war.
Das Herzstück des Saloons war eine massive Bar aus Eichenholz, die Wand an Wand stand. Die Oberfläche war vom Verschleiß unzähliger Jahre eingekerbt und abgenutzt, genauso wie die ornamental verzierte Fassade. Das Ding wirkte älter als der ganze Saloon. Dahinter war eine spiegelverglaste Wand, deren Ecken schwarz gesprenkelt waren. Zu beiden Seiten des Spiegels hingen Holzbretter, die als Spirituosenregale dienten.
Alkohol.
Pedro stand hinter der Theke, ein gelber Putzlappen über der Schulter und ein leeres Glas in der Hand. Er schaute zu Zeke und winkte ihn herunter. Dann nahm er den Lappen von der Schulter, stopfte ihn ins Glas und drehte ihn darin herum.
Die Barhocker waren leer, aber die umliegenden Tische im Raum waren von einer Vielzahl schillernder Persönlichkeiten besetzt, die aussahen, als wären sie einem Groschenroman entsprungen.
Die Männer und Frauen wirkten so verstaubt wie die Oberflächen im Gebäude. Sie spielten Karten, nuckelten an ihren Longdrinks, hoben Gläser und Tassen. Sie sprachen gedämpft. Manche kicherten oder lachten laut auf. Andere schauten mürrisch oder resigniert drein.
Er blickte auf und ließ die Finger am Geländer entlanggleiten. Was war das für ein Ort? Er entfernte sich von seiner Zimmertür. Die Dielen ächzten unter seinem Gewicht und die Stiefel hallten dumpf auf dem robusten Holzboden.
Die Tür neben seiner war geschlossen, aber aus dem dahinterliegenden Raum erklang Gelächter und gedämpfte Musik. Ist das Jazz? Ein Saxofon quäkte weiche, melancholische Akkorde. Eine Frau kicherte. Ein Mann mit tiefer Bassstimme machte eine Bemerkung und sie kicherte erneut.
Zeke bewegte sich weiter zum nächsten Raum. Die Tür stand offen. Staubflocken tanzten im hellen Lichtstrahl, der durch ein einzelnes Fenster fiel.
Mit einer Hand am breiten Türrahmen trat er über die Schwelle und spähte in ein Zimmer, das genau wie seines möbliert war. Es war ordentlich, verströmte aber den Geruch von Verwahrlosung. Das Bett wirkte auf Zeke so, als hätte darin schon eine ganze Weile niemand mehr geschlafen. Die Kanten der Laken waren sauber unter die schmale Matratze geschoben. Eine dünne Schicht Staub, der nicht länger durch die Luft wirbelte, bedeckte den Boden. Keine Fußspuren.
Er machte kehrt, um die restlichen Zimmer im zweiten Stock unter die Lupe zu nehmen. Alle hatten die gleichen Türen, manche offen, manche zu. Zeke entschied, dass es an der Zeit war, nach unten zu gehen und sich ins Getümmel zu stürzen.
Er folgte dem Geländer zum Treppenaufgang im vorderen Bereich. Schritt für Schritt stieg er zum Erdgeschoss hinunter. Seine Stiefel klapperten dumpf über die Dielen und zerstörten die Stille, mit der er sich zu bewegen versuchte. Er musste zurück zu seinem Auto, wo auch immer das gerade war, musste es volltanken und einen Weg nach Hause finden. Die Zeit lief ihm davon. Koste es, was es wolle, ganz egal, welche Hindernisse oder Horden sich ihm in den Weg stellten. Zekes Gewissen nagte an ihm.
Er konnte die Blicke der Gäste auf sich spüren und starrte stur geradeaus, zu Pedro und der Bar. Das Gerede ließ nach und der Raum verstummte, bis nur noch das Geräusch seiner Stiefel auf dem Boden übrig blieb. Die Aufmerksamkeit, die er zu ignorieren versuchte, trieb ihm die Röte ins Gesicht, und er ballte die Fäuste fester. Er setzte sich auf einen der Barhocker. Die Gespräche setzten wieder ein. Zeke atmete aus. Bis eben hatte er nicht bemerkt, dass er den Atem angehalten hatte. Obwohl er den Drang hatte, diesen Ort, was auch immer der war, zu verlassen, hatte er dringende Fragen, auf die er Antworten wollte.
Wo bin ich? Was für ein Ort ist das? Wie lange bin ich schon hier?
»Morgen«, sagte er zu Pedro.
»N’Abend«, erwiderte der Barkeeper mit einem schiefen Grinsen. »Wie ich sehe, hast du die Klamotten entdeckt. Passen gut.«
Zeke schaute an sich herunter und nickte. »Danke. Die Stiefel gefallen mir.«
Pedros Grinsen wurde breiter. »Dachte ich mir. Die bequemsten, die du je haben wirst. Hab auch ein Paar. Schätze mal, dass ich irgendwann damit begraben werde.«
Zeke berührte die Krempe des Stetsons, den er aufhatte. Er zupfte sie zurecht, um Form und Komfort zu verbessern. »Der Hut auch. Danke.«
»Steht dir gut. Was kann ich dir bringen?«
Zeke zuckte mit den Schultern. »Was schulde ich dir für die Klamotten? Sieht aus, als sollte ich erst mal dafür bezahlen, bevor ich anfange zu trinken.«
Pedro zwinkerte ihm zu. »Warum lässt du’s nicht einfach anschreiben? Wir führen so ziemlich für jeden, den du hier siehst, eine Liste.«
Zecke blickte sich zu beiden Seiten um. Er fragte sich, wer von den Versammelten dem Barkeeper kein Geld schuldete. Dann verlagerte er sein Gewicht auf dem Barhocker nach vorne und stützte sich mit den Ellbogen auf dem Tresen ab, sagte aber nichts.
»Wie wär’s mit einem Whisky?«, schlug Pedro vor. Es war mehr eine Aussage als eine Frage. »Hab hier alles von Rebel Yell bis Macallan. Sag an.«
Der Barkeeper lief zum obersten Regal links vom Spiegel, schob das Buch darauf beiseite und zog eine langhalsige Flasche hervor, die mit einer honigfarbenen Flüssigkeit gefüllt war. Auf ihrem Label prangte in großen, roten Zahlen die Nummer sechzehn.
»Ich hab keine Zeit«, sagte Zeke. »Ich hab was getan, das ich … ich muss zurück. Ich schätze deine Gastfreundschaft, aber ich muss wirklich …«
»Du hast Zeit. Entspann dich. Ich versprech dir, was auch immer dir so dringend vorkommt, wird auch dann noch da sein, wenn wir hier fertig sind.«
Zeke begann aufzustehen, aber der Blick des Barkeepers hielt ihn fest. Er war wie ein Traktorstrahl, der ihn an der Theke hielt.
Er seufzte. »Na gut, aber nur einer.«
Seine Augen wanderten über die Bar, über die juwelenfarbenen Flaschen und die dicken Bargläser. Dann fiel sein Blick auf das abgenutzte Buch, das mit seinem dicken, zerfledderten Rücken nach vorn auf dem Regal stand. Die vergoldeten Buchstaben hoben sich vom schwarzen Leder des Einbands ab. Drei davon konnte er lesen: E, O und H.
»Was ist das für ein Ort?«, fragte Zeke. »Wer bist du?«
Pedro stellte die Flasche vor Zeke auf den Tresen und zog ein großes Glas unter der Eichenplatte hervor. Das stellte er neben die halbvolle Flasche und zeigte mit seinem dicken Finger auf Zeke. »On the rocks?«, fragte er und ignorierte Zekes Fragen.
Zekes Mund fühlte sich trockener als vorher an. Die Brust verkrampfte sich. Sein Magen zog sich zusammen. Die Angst durchbohrte ihn wie ein Pfeil, übermannte ihn mit einem Schlag. Sein Ausdruck musste ihn verraten haben, denn Pedros Ausdruck wirkte besorgt. Er runzelte die Stirn.
»Was?«, fragte Pedro und legte die Hände flach auf die Theke. »Hab ich was Falsches gesagt?«
Zeke war unsicher, was er darauf antworten sollte. Langsam warf er einen Blick über die Schultern, erst über die eine, dann über die andere.
Niemand lauschte. Die Gäste an den Tischen waren mit ihren eigenen Spielen und Konversationen beschäftigt. Eine schlanke Frau und ein statuenhafter, hochgewachsener Mann spielten jetzt Dart. Ein langbärtiger Typ mit einer federbesetzten, grauen Melone auf dem Kopf lehnte an der Jukebox.
Zeke wandte sich wieder Pedro zu. Er schüttelte den Kopf. »Du hast mich gefragt, ob ich Eis will.«
»Richtig. Wenn das ein Problem ist, kannst du’s ohne haben. Wär’ vielleicht sogar …«
»Du gehörst nicht zu denen, oder?« Zeke verlagerte sein Gewicht weiter auf die Ellbogen und schob sein Gesicht näher in Richtung des Barkeepers. Er schaute wieder über seine Schultern.
Pedro zog seine drahtigen Augenbrauen zusammen. Er lehnte sich nach vorn und imitierte Zekes ängstliches Flüstern. »Zu wem?«
»Zu den Tic.«
»Die Tic?« Pedro fragte, als hätte er noch nie etwas von dem Schwarzmarkt-Kartell gehört, was Zeke schwerfiel zu glauben.
Zeke lehnte sich misstrauisch zurück. Jeder kannte die Tic. Sie kontrollierten den Handel mit allem, was auch nur ansatzweise aus Wasser bestand. Sie waren der Grund, warum er hier war, wo auch immer hier sein mochte, und warum er zurück musste.
Zeke beugte sich noch näher zu Pedro, dessen Augen geweitet waren. »Das Aquatic Collective«, zischte er. »Du weißt schon, die Tic.«
Pedros Augenbrauen entspannten sich und er zuckte mit den Schultern. »Nie davon gehört.«
Zeke beäugte das leere Glas auf dem Tisch. Dann funkelte er Pedro an. Er wusste nicht, ob er ihm glauben sollte. Er wollte ihm glauben. Er glaubte ihm. Ein bisschen Wahrheit würde ihn vielleicht erden, ihm etwas geben, woran er sich festhalten konnte, solange er in dieser surrealen Situation feststeckte.
»Wie kannst du dann Eis haben?«, fragte er.
Pedro hob die Flasche auf, die in seinen Händen winzig wirkte, und entkorkte sie. Er hielt sie sich unter die Nase und sog das Aroma ein. »Ich hab Plastikformen. Die füll ich mit Wasser und stell sie in den Gefrierschrank. Die allertollsten Sachen passieren, wenn Wasser null Grad Celsius oder zweiunddreißig Grad Fahrenheit erreicht, was auch immer dir lieber ist.«
Pedro griff unter die Theke. Als er seine Hand zurückzog, hielt er zwei große Eiswürfel fest. Die ließ er mit einem Klick ins Glas fallen, das Zeke seit Ewigkeiten nicht mehr gehört hatte.
Der Barkeeper senkte die Flasche an den Rand des Glases und ließ die bernsteinfarbene Flüssigkeit auf die Eiswürfel gluckern. Sobald das Glas voll war, schob er es Zeke hin, wobei der Inhalt teilweise auf die Theke schwappte.
»Also, erzähl mir mehr von dieser Tic-Tac-Gruppe, die du erwähnt hast.«
»Tic«, korrigierte Zeke. Er hatte das Getränk noch nicht angerührt. Es war, als würde er einen faustischen Pakt besiegeln, sobald er einen Schluck vom Glas nahm. Er legte seine Hände flach auf den Tresen, sein Gewicht auf den Ellbogen.
»Tick also«, sagte Pedro, »wie die Zecke.«
Zeke schmunzelte. »Ich schätze, das passt.«
Pedro hob den Finger. »Oh, fast vergessen.«
Er griff unter die Theke und zog eine abgenutzte, braune Lederbörse hervor. Die Ecken waren ausgefranst und das Leder durchgescheuert, die Form hatte sich seinem rechteckigen Inhalt angepasst. Er klatschte sie auf den Tisch und schob sie Zeke zu.
Der griff nach seinem eigenen Geldbeutel. »Das hatte ich vergessen.«
Er stand auf, um ihn zurück in seine Hintertasche zu stecken, hielt aber inne. Dann entnahm er einen zerknitterten Geldschein und hielt ihn Pedro hin.
Der Barkeeper winkte ab. »Oh nein, dein Geld taugt hier nichts, Zeke. Pack’s weg, kannst du dir schenken. Ich will mehr von den Parasiten hören, die deine neuen Stiefel zum Zittern bringen.«
Zeke schob den Schein zurück in die Geldbörse, faltete das Leder und steckte sie in die Hintertasche. Dann nahm er wieder auf dem Barhocker Platz, lehnte sich nach vorn und legte die Hand um das Glas, das nun feucht vom Tauwasser war.
Ein kalter Drink. Kostenlos. Nichts davon fühlte sich richtig an. Das war zu schön, um wahr zu sein. Er sollte gehen. Er hatte anderswo zu tun.
Doch er war am Verdursten. Obwohl er es besser wusste, hob er letztendlich das Glas an den Mund und ließ die süße Flüssigkeit seinen Hals hinabrieseln. Er ließ sich den Nachgeschmack auf der Zunge zergehen und genoss das elektrisierende Summen, das ihm zu Kopf stieg.
»Danke«, prostete er Pedro zu, »schmeckt gut.«
Pedro verneigte sich. »Schön, dass du’s magst. Stets zu Diensten.«
Zeke atmete tief ein. Er musterte den Barkeeper.
Bevor er antworten konnte, wurde er von einem statischen Knistern unterbrochen. Das Geräusch wich den Klängen eines Saxofons. Die Töne des Holzblasinstruments tanzten durch den Raum, erfüllten ihn mit Wärme.
Zeke drehte sich auf dem Hocker um und beobachtete, wie der Langbärtige mit Melone an einen leeren Platz am Tisch neben der Jukebox zurückschlenderte. Abwesend ließ er eine Münze zwischen seinen Fingern vor- und zurückgleiten.
»Das ist Phil«, erklärte Pedro, »er ist Stammgast. Und er liebt Jazz.«
Für Zeke war der Jazz, den er hörte, einer der vielen Anachronismen an diesem Ort.
Er nahm einen weiteren kräftigeren Schluck Whisky. Sein Kopf summte erneut. Die Anspannung in seinen Schultern ließ nach. Sein Muskelkater löste sich.
Er betrachtete das Glas, das nun bis auf ein paar abgerundete Eisklumpen auf dem Boden leer war. Bevor er etwas sagen konnte, goss Pedro drei Fingerbreit Whisky nach.
»Ich sollte wirklich gehen«, sagte Zeke. »Ich verschwende Zeit. Hab ja gesagt, ich sollte woanders sein, muss was gradebiegen.«
Zeke wusste, dass er gehen sollte, aber irgendetwas hielt ihn hier. Sein Körper schien unabhängig von seinem Verstand zu agieren. Das erinnerte ihn an das Gefühl, das er manchmal hatte, wenn er aus einem Albtraum erwachte, wenn er seinen Körper nicht bewegen konnte. Die Paralyse hielt an, bis er ganz erwacht war und sich wieder im Griff hatte.
Ist das ein Traum?, fragte er sich. Für einen Traum fühlte es sich zu real an, für sein Leben zu surreal.
»Genieß es einfach.« Der Barkeeper wies auf das Getränk.
Einem solchen Luxus konnte Zeke nicht widerstehen. Er legte die Hand um das kühle Glas und wischte das Kondenswasser mit dem Daumen beiseite. Sein Kopf schwirrte. Der hochprozentige Alkohol, das reichlich vorrätige Eis und Pedros Ignoranz kämpften als drei Kräfte in seinem Verstand gegeneinander.
»Du hast wirklich noch nie von den Tic gehört?«, fragte Zeke erneut. »Ganz sicher?«
Pedro schürzte die Lippen und schüttelte den Kopf. »Nö. Noch nie.«
Nichts davon ergibt irgendeinen Sinn.
Jeder, der im Besitz von Wasser, ganz zu schweigen von Eis war, bezog es über eine von zwei Stellen. Ein Saloon wie dieser, mitten im absoluten Nirgendwo, der eine plündernde Horde in Schach halten konnte, musste mit den Tic unter einer Decke stecken. Außer …
Zeke blickte auf, er hatte einen Geistesblitz. »Du bist bei den Aufsehern?«
Pedro starrte mit der gleichen Ahnungslosigkeit zurück wie bei seiner Erwähnung der Tic.
Der Barkeeper legte den Kopf schief. »Aufseher? Was ist das?«
»Die Aufseher sind die Regierung«, erklärte Zeke, »oder zumindest so was Ähnliches. Sie rationieren das Wasser. Sie rationieren alles. Die Tic sind entstanden, weil die Aufseher ihrer Meinung nach zu geizig waren.«
Pedro nahm den Lappen von seiner Schulter und wischte eine Pfütze auf der Theke vor Zeke weg, dann warf er ihn sich wieder über. Er rieb sich das Kinn, wobei die Finger in seinem Bart ein kratzendes Geräusch erzeugten.
»Ich bin weder Aufseher noch ein Tic«, sagte Pedro, »noch steh ich in irgendeiner Beziehung zu ihnen. Ich bin allein hier.«
Zeke rutschte auf seinem Hocker umher und scannte den Saloon noch einmal. Da saßen zwanzig bis fünfundzwanzig Leute. Keiner von ihnen beachtete ihn gerade. Niemand außer einer Frau, die auf die Bar zukam.
Wie kann ich sie nicht bemerkt haben?
Sie schlich mehr, als dass sie lief, und das auf eine Art, die Zeke signalisierte, dass sie mit ihrem Körper umzugehen wusste. Er wandte sich wieder Pedro zu. »Wo ist hier?«, fragte er.
Bevor Pedro antworten konnte, schlängelte sich die Frau neben Zeke an den Tresen. Der blumige Geruch ihres Parfüms umnebelte seine Sinne. Ihr angenehmer Duft stand in starkem Kontrast zu ihrer Erscheinung.
Ihre Kleidung saß wie angegossen. Enges, schwarzes Leder verbarg die Teile ihres Körpers, die sie den Leuten nicht zeigen wollte, und farbenfrohe Körperkunst bedeckte den Rest. Nur Handflächen, Gesicht und Kopfhaut waren nicht tätowiert, soweit Zeke das erkennen konnte. Das prominenteste Tattoo zierte ihre Hüfte, die Stelle zwischen dem niedrig sitzenden Hosenbund und dem kurzen Ledertop. Es war ein brennendes Schwert, das diagonal zu ihrem Bauchnabel verlief, umrahmt von einer Scheibe, die wie eine vereinfachte, zweidimensionale Sonne aussah.
Ihr Kopf war an den Seiten rasiert, aber über die Mitte verlief eine kastanienbraune Mähne, die ihr bis über den Rücken reichte. Der geflochtene Zopf wurde von einer pinkfarbenen Schleife zusammengehalten.
An einem ihrer Handgelenke hing eine Sammlung aus geknoteten Fäden, ähnlich denen eines Freundschaftsarmbandes. Am anderen befand sich ein Armband aus Paracord mit einem Metallverschluss.
Ihre Augen waren von atemberaubendem Grün, sie leuchteten beinahe. Ihre hellen Wimpern waren lang, die Nase spitz. Zeke hatte einst gehört, dass man so etwas als Römernase bezeichnete. Sie war keine klassische Schönheit, aber sie war faszinierend. Hinter diesem Aussehen verbarg sich eine Geschichte. Zeke war sich sicher, dass diese umfassend sein musste.
Sie war eine Ansammlung von Widersprüchen, genau wie die Bar selbst. Ihre Stimme klang so selbstsicher wie weiblich. Da war eine rohe, beherrschte Kraft, wenn sie sprach.
»Das ist Pedros Cantina«, sagte sie, »und ich nehm’ das Gleiche wie er.«
Pedro zog ein weiteres Glas unter der Bar hervor, als sich die Frau auf dem Hocker zurechtsetzte. Dabei streifte sie Zeke, und er hätte schwören können, dass Strom durch seinen Körper funkte.
Er versuchte, sie nicht anzuschauen. Stattdessen starrte er in sein Glas. Das Eis schrumpfte in der Umgebungshitze, genauso wie Zeke.
»On the rocks?«, fragte Pedro.
»Klar, wieso nicht?«, antwortete sie.
Pedro setzte die Flasche ans neue Glas und füllte es zur Hälfte. Er hielt inne, beäugte die Frau, die ihn mit gehobenen Augenbrauen anschaute, und machte das Glas ganz voll. Pedros Hund watschelte zu ihr herüber und drückte sich gegen ihr Bein, als wäre er eine Katze. Sie machte ein paar Kussgeräusche und streichelte den Kopf des Hundes, bis er genug Aufmerksamkeit hatte und zu seinem Herrchen zurücktrottete.
Sie hob ihr Glas. »Wer ist der Frischling?«
Zeke wusste, dass sie ihn meinte, hatte aber nicht vor, zu antworten. Er war nicht mehr so eingeschüchtert von einer Frau seit – daran wollte er nicht denken. Er legte seine Finger fester um das Glas und nahm einen kräftigen Schluck. Das Eis schwappte, und er widerstand der Versuchung, es im Mund mit den Zähnen zu zerknirschen.
»Das ist Zeke«, sagte Pedro. »Zeke, das hier ist meine Freundin Uriel.«
Uriel drehte sich, um Zeke anschauen zu können, aber ihr Blick ruhte weiterhin auf Pedro. Sie schmunzelte und gestikulierte mit ihrem Glas zum Barkeeper. »Also sind wir Freunde, ja?«
»Hab nie einen Fremden getroffen«, sagte Pedro. Er kappte die Flasche, nahm den Lappen von seiner Schulter, wischte die Abdrücke der beiden Gläser auf und trat zurück, um die Flasche im Regal zu ersetzen.
Uriel richtete ihre Aufmerksamkeit auf Zeke. Ihre Augen wanderten zu seinen Stiefeln und wieder nach oben, wo sie seinen Blick wie ein Magnet festhielt.
Zeke konnte nicht wegschauen, selbst als sein Puls beschleunigte und ihm die Hitze ins Gesicht stieg. Er war von ihr hypnotisiert.
Sie setzte den Drink auf dem Tresen ab, stieß ihre Zunge in die Wange und zwirbelte das Ende ihres Zopfes. Dabei trat sie mit einem Absatz unruhig auf und ab. »Zeke, hm?«, sagte sie. »Hat dich deine Mama nicht liebgehabt?«
Zeke zog verwirrt die Brauen zusammen. Er musste schlucken.
Uriel lachte und klatschte ihm mit der Hand auf den Schenkel. Er bemerkte ihre langen Fingernägel. Sie waren zu dünnen Spitzen gefeilt und mit dem gleichen Pink wie ihre Haarschleife lackiert. In die Daumennägel waren Diamantnieten eingelassen.
»Entspanne dich, Zeke.« Sie sprach die vier Buchstaben seines Namens überdeutlich aus. »Ich zieh dich bloß auf.«
»Oh, o. k. Verstehe.« Insgeheim verfluchte er sich. Wer war der Typ, der sich seines Körpers bemächtigt hatte? Warum war er nicht der selbstbewusste, fast schon großspurige Typ wie damals? Er war sich selbst fremd.
Uriel nahm die obere Hälfte des Glases und ließ es kreisen, ohne es von der Theke zu nehmen. Es kratzte rhythmisch über die Oberfläche, die Flüssigkeit schwankte darin umher, umspülte die Innenseiten.
»Von allen Kaschemmen der Welt kommt er ausgerechnet in meine«, sagte Uriel und paraphrasierte damit eindeutig ein bekanntes Zitat. Er konnte es nicht zuordnen, schätzte aber, dass es aus einem Film oder Buch stammte.
»Bist du ein Schurke, der gegen das Gute kämpft, oder ein anständiger Kerl, der das Böse bekämpft?«, fragte sie.
Pedro antwortete vor Zeke. »Sind wir nicht alle ein bisschen von beidem, Uriel? Ich denke, darauf kann man sich einigen. Also, du hast Zeke hier ganz schön in Beschlag genommen. Ich hab ein paar Dinge mit ihm zu besprechen. Warum gehst du nicht ’ne Runde mit Phil tanzen oder mit Gabe Dart spielen?«
Uriel grinste Zeke anzüglich an, trank den Rest des Whiskys auf ex und dachte über ihre Optionen nach. »Tja«, wandte sie sich an Pedro, »Gabe hat sich für die Runde schon ’ne Partnerin geschnappt und Phil ist nicht grade leichtfüßig. Ich schätze, ich werde eine oder drei Runden mit Raf und Barach spielen.«
Zeke beobachtete den Tisch, an dem die Männer Karten spielten. Er wusste nicht, wer wer war, aber einer hatte einen hohen Stapel Jetons vor sich. Die anderen schienen frustriert zu sein und zappelten unruhig auf den Stühlen.
Als er sich zur Bar umgedreht hatte, war Uriel bereits aufgestanden. Sie strich ihr Oberteil glatt, zupfte an dem Leder, dass ihre Brüste nur teilweise bedeckte, und erwischte Zeke dabei, wie sein Blick auf ihren Bemühungen verweilte.
Sie streckte ihren Zeigefinger aus und berührte die Unterseite seines Kinns mit dem Fingernagel. Ihre Augen blitzten kokett auf. »Definitiv ein böser Junge. De. Fi. Ni. Tiv.«
Zekes Mund war wieder trocken. Er gluckste nervös. Uriel ließ ihn mit einem Zwinkern vom Haken und schlenderte von ihm weg. Zeke atmete laut aus.
»Mit Uriel ist nicht zu spaßen«, sagte Pedro und ließ den Blick durch sein Etablissement schweifen, »so wie mit jedem hier.« Sein Blick fiel wieder auf Zeke und blieb an ihm hängen. Sein Gesichtsausdruck wurde ernst. »Das schließt dich ein, Ezekiel Watson.«
»Woher wusstest du …?«, begann Zeke, dann hielt er inne und erinnerte sich an den Geldbeutel in seiner Gesäßtasche. »Mein Ausweis?«
Pedro nickte. »Warum denkst du denn, dass du hier bist?«
Zeke musterte seinen Gastgeber und versuchte, die unterschwellige Bedeutung der Frage zu verstehen. Er räusperte sich. »Äh«, setzte er zur offensichtlichsten aller Möglichkeiten an, »weil die Tic mich hierher verfolgt haben. Du hast mich aufgenommen. Mir aus der Patsche geholfen.«
Pedro durchbohrte Zeke regelrecht mit seinen eisblauen Augen. Sein Blick deutete an, nein, er bestätigte, dass Zekes Ankunft kein Zufall war. Pedro korrigierte ihn jedoch nicht. Stattdessen entspannte sich sein Gesicht.
»Warum sind die Tic hinter dir her? Was hast du angestellt?«
Zeke senkte den Kopf. »Ist ’ne lange Geschichte«, murmelte er. »Und Pedro, so dankbar ich dir auch bin, hier zu sein, ich muss los. Jemand braucht mich.«
»Das weiß ich. Andernfalls wärst du nicht hier. Aber ganz ehrlich, wir haben alle Zeit der Welt, mein Junge.«
Zeke hielt inne und dachte darüber nach. »Es muss reichen, wenn ich dir sage, dass ich ein paar Sachen verbockt hab. Keine Details. Ich hab Menschen zurückgelassen … na ja … eine Person … die ich nicht hätte zurücklassen sollen. Sie steckt in Schwierigkeiten. Ich muss zu ihr zurück.«
»Was hast du verbrochen?«, fragte Pedro.
»Vieles. Manches war unvermeidbar.«
»Wen hast du zurückgelassen?«
»Mein Mädchen. Adaliah.«
»Adaliah«, wiederholte Pedro melodiös.
»Li in Kurzform.«
»Was war unvermeidbar?«
Zeke zuckte mit den Schultern. »Vieles.«
»Zum Beispiel?«
Zeke wollte nicht antworten, aber irgendetwas Unsichtbares veranlasste ihn, zu reden. Er war wie in Trance, unfähig, sich der einlullenden Wirkung von Pedros Stimme zu entziehen, die so weich wie der Whisky war, den er trank. »Mich den Tic anzuschließen.«
»Und was hat sich vermeiden lassen?«
Zekes Magen drehte sich um. Sein Kopf schwirrte. An seinen Schläfen bildete sich Schweiß. Je länger er hier war, desto … falscher fühlte es sich an. Er wollte hier raus. Er musste Dinge erledigen, Leute finden. Er fühlte sich, als müsste er sich übergeben.
»Sie zu verlassen«, sagte er.
»Adaliah«, korrigierte Pedro.
»Ja.« Zeke atmete tief ein, die blumigen Duftreste von Uriels Parfüm krochen in seine Nase. Adaliah war diejenige, die ihn zu einem besseren Mann gemacht hatte. Sie hatte ihn so akzeptiert, wie er war. Er hatte sie mit sich in den Abgrund gerissen, wie ein Ertrinkender, der sich so lange an seinen Retter klammert, bis auch der unter Wasser gezogen wird und nicht mehr atmen kann.
Pedros nächste Frage riss ihn aus seinem Tagtraum. Der alte Mann hatte sich so weit zu ihm vorgebeugt, dass sein Süßholz-Atem das Parfüm überdeckte. Der Stoff seiner Lederweste spannte sich quietschend hinter der Theke.
»Also ist es deine Aufgabe, sie aus den brutalen Fängen der Tic zu retten, bevor sie’s an ihr statt dir auslassen?«, fragte er und hob dabei eine Augenbraue.
Zeke setzte sich aufrecht hin und rutschte ein Stück von Pedro weg. »Ich schätze schon. Ja. Das schulde ich ihr.«
»Hättest du dabei gern ein bisschen Hilfe?«
Zeke musterte Pedros leeren Gesichtsausdruck. Der Mann machte keine Witze. Zumindest wirkte er auf Zeke nicht so.
»Äh, okay?«, stammelte er. »Aber wie willst du …«
Plötzlich schaute Pedro an ihm vorbei. Zeke spürte eine Präsenz hinter sich und drehte sich um. Er sah, dass Uriel zurück war, die Hände in die Hüften gestemmt. Ihre Finger tippten das Flammenschwerttattoo an. Ihr Dauergrinsen ließ sie wirken, als wüsste sie etwas, das sie eigentlich nicht wissen sollte.
Aber sie war nicht alleine.
Sie stand zwischen vier anderen Bargästen, die sich allesamt an Zeke herangeschlichen hatten. Da war Phil, Gabe und zwei der Männer vom Kartentisch, die Raf und Barach sein mussten.
Phil fasste sich an den Bart. Er hatte die Melone auf seinem Kopf hochgeschoben, die eine hohe Stirn und ein paar Locken freigab.
Gabe verschränkte seine muskulösen Arme vor der fassförmigen Brust. Die Adern, die sich unter der Haut seiner Vorderarme abzeichneten, betonten die Kraft seines definierten Körpers. Auf seinen Nacken war »Do Not Fear« tätowiert. Zeke fragte sich, ob das ironisch gemeint war.
Der andere der beiden, der auch den Stapel Jetons vor sich hatte, streckte sich und reckte das Kinn hoch.
Er hatte pechschwarzes, welliges Haar. Ein paar Stirnfransen verdeckten ein Auge und kaschierten dabei fast eine lange, dünne Narbe, die über eine Gesichtshälfte verlief. Um seinen Hals hing so etwas wie ein Stethoskop.
Der andere Spieler war kleiner als die anderen. Sein Kopf war glattrasiert. Er hielt ein angebissenes Stück Brot in den Händen und kaute vermutlich auf dem Rest davon herum. Trotz seiner Statur wirkte er wie der Anführer der Gruppe. Er war Zeke am nächsten.
Zeke stand vom Hocker auf und wich in Richtung Bar zurück. Seiner Erfahrung nach verhieß eine zwielichtige Gruppe, die sich an einen anschlich, nichts Gutes.
»Was wird das?«, fragte er.
»Das sind die Leute, die dir helfen werden«, antwortete Pedro.
Kapitel 3
Adaliah Bancroft sah Zeke am Ende eines langen, hell erleuchteten Tunnels. Oder war es ein Korridor? Sie war sich nicht sicher. Das blendend helle Licht erschwerte es, die Umgebung wahrzunehmen, aber sie wusste, dass Zeke dort war. Seine Arme waren ausgestreckt. Er versuchte, sie zu erreichen, sie zu sich heranzuziehen. Sie konnte sich nicht bewegen. Sie steckte fest, ihre Füße waren in den Boden einbetoniert.
»Zeke«, rief sie, »kannst du mich sehen? Siehst du mich?«
Er rief ihr etwas zu, aber seine Worte waren verworren und unverständlich. Warum kam er nicht zu ihr? Warum war sie so weit weg?
Dann stürzte das Wasser von den Gangwänden wie aus einem gebrochenen Damm. Tosendes Wasser flutete den Raum kalt und unnachgiebig. Es stieg bis über ihre Fußknöchel. Jetzt zitterte sie. Zekes Abbild löste sich auf. Das Wasser stand ihr bis zur Brust. Das Licht ließ nach. Ihr Körper bibberte in der Kälte. Das Wasser, metallisch und sauer, erreichte nun ihren Mund und stieg über ihre Nase. Sie klebte am Boden fest, unfähig, zu schwimmen oder fortzutreiben. In ihrer Brust machte sich Panik breit und eine Welle der Angst erfasste ihren müden, schmerzenden Körper. Ihre Knie wurden schwächer, trotz ihrer Bewegungsunfähigkeit. Sie steckte fest.
Adaliah Bancroft schnappte nach Luft, als sie wieder zu Bewusstsein kam. Sie lag auf dem Rücken an eine Bank festgekettet. Ein durchtränktes Tuch, das nach Kochfett roch, bedeckte ihr Gesicht. Sie fühlte keinen Schmerz, aber ihr Körper zitterte unkontrolliert.
Eine schemenhafte Gestalt beugte sich über sie, ein vager Umriss vor dem diffusen Licht, das durch den Stoff auf Adaliahs Augen schien. Dann spürte sie ein Gewicht auf ihrem Körper, als würde sich die Frau auf sie setzen.
»Wo steckt er, Li?«, fragte Brina. Ihr heißer, abgestandener Atem drang durch den Stoff. Ihre Stimme klang rau, angestrengt vom jahrelangen Kettenrauchen. Sie hörte sich androgyn an, und hätte Adaliah die Frau nicht gekannt, sie hätte sie für einen Mann gehalten. Aber sie kannte sie. Sie kannte die monströse Vollstreckerin namens Brina. Jeder kannte sie. Selbst die, die sie nie getroffen hatten, die niemals ihrem leeren, reptilienhaften Blick begegnet waren, kannten die sadistische Informationsbeschafferin der Tic aus Erzählungen.
Li schüttelte leugnend den Kopf. Sie versuchte, ihre Beine zu bewegen. Sie waren festgebunden, genauso wie ihre Handgelenke. »Ich weiß es nicht«, hustete sie, »Ich hab’s dir schon gesagt. Ich weiß es nicht.«
»Wo ist er?«, fragte Brina erneut. »Ich werd nicht aufhören, bis du’s mir verrätst. Das hier ist was Persönliches, auch für dich. Wo ist er?«
Das war die einzige Frage, die sie Li über die endlosen Stunden hinweg gestellt hatte, in denen sie dort war, wieder und wieder. Wo war ihr Freund? Wo war der Mann, der die Tic hintergangen und sie ihrem Schicksal überlassen hatte?
Eine verwirrende Mischung aus Trauer, Sorge und Wut wirbelte durch ihre unzähligen Gedanken, Gefühle und Sinneseindrücke. Ein Teil von ihr begriff. Er war erwischt worden. Er musste gehen. Aber hätte er ihr nicht von seinen Plänen erzählen können?
Vielleicht nicht. Vielleicht war es ihre beste Chance, alles glaubhaft abstreiten zu können. Er hatte an sie gedacht. Als sie jedoch gefesselt auf der Bank lag, gefoltert für etwas, das sie nicht wusste, gab es keine Entschuldigung für das, was er getan hatte.
»Ich. Weiß. Es. Nicht«, sagte Li trotzig und spuckte jedes Wort mit der gleichen Kraft aus, mit der sie am liebsten auf Brina losgegangen wäre.
»Er hat mich verlassen. Der Feigling hat mich hier zurückgelassen. Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich weiß es nicht.«
Brina nahm den Lumpen von Lis Gesicht. Sie quetschte das übrige Wasser heraus und bespritzte dabei Li. Dann schleuderte sie den Lappen beiseite und zog einen Stuhl heran. Die Stuhlbeine schrammten und quietschten über den Zement, bis Brina innehielt und ihr Gewicht auf die Sitzfläche plumpsen ließ.
Li kniff die Augen im Licht zusammen und versuchte, die Tränen und das Wasser wegzublinzeln, die ihre Sicht trübten.
Brina legte eine Hand auf den Bauch von Li, die instinktiv vor der Berührung zurückzuckte.
»Ich glaube dir«, sagte Brina. »Ich glaube dir, dass du nicht weißt, wo Ezekiel hin ist. Hättest du’s gewusst, dann hättest du’s mir gesagt. Meine Erfahrung, und ich versichere dir, die ist umfassend, sagt mir, dass du nicht der Typ bist, der Geheimnisse unter Androhung von Schmerzen behält. Du hättest alles, was du weißt, längst ausgeplaudert.«
Das Seltsame war, dass es keine Schmerzen gab. Um genau zu sein, war die Folter völlig schmerzlos. Die wiederholte Androhung des Ertrinkens war schlimmer als das Ertrinken selbst.
Li hatte alle vier Versuche überlebt, Informationen aus ihr herauszubekommen, die sie gar nicht hatte. Trotzdem hielt ihr Kopf den Tod für absehbar.
Jedes Mal, wenn sie das Bewusstsein verloren hatte, war es, als wäre sie auf dem Weg woandershin, an einen Ort zwischen Leben und Tod. So weit war es allerdings nie gekommen. Jedes Mal war sie in diese Hölle zurückgekehrt und wünschte sich mehr und mehr, sie wäre ertrunken.
Sie wusste, dass das jederzeit möglich war. Die Tic waren für ihre Brutalität bekannt, mehr noch als die Aufseher. Sie begegneten der brutalen Unterdrückung mit ebenso brutalen Tricks. Wasser als Strafe zu missbrauchen war besonders grausam, denn davon gab es nur noch wenig auf der Welt. Es war ein so kostbarer Rohstoff, der Mittelpunkt des legalen und illegalen Handels. Trotzdem benutzte Brina es literweise, um die Wahrheit aus ihr herauszuspülen. Li verstand das als doppelte Folter, die ebenso psychisch wie physisch war. Schon vorher hatte sie dasselbe Vorgehen bei anderen beobachtet. Sie war danebengestanden und hatte dabei zugesehen, ohne je den Zweck zu begreifen.
Machten sie das, um Informationsfetzen und Hinweise zu extrahieren, die die Reichen reicher und die Mächtigen mächtiger machten? Oder war das einfach nur ein krankes Spiel, das diejenigen, die das Untergrundreich der Tic regierten, ganz unabhängig von seiner Effizienz trieben? Egal, was es war, Li wusste, dass Gewalt nun ein fester Bestandteil dieser Welt war. Sie war ein ebensolches Verbrauchsgut wie das Wasser, nur verfügbarer, und, zumindest für manche, wertvoller.
Dennoch hatte sie nie erwartet, das aus erster Hand zu erleben. Wenigstens nicht von Brina. Nicht auf diese Art.
In ihrer Beziehung zu Zeke war Li einem der wertvollsten Mitglieder der Tic zugetan. Als also die maskierten, anonymen Vollstrecker vor Sonnenaufgang in ihr bescheidenes Apartment gestürmt waren, hatte sie noch gedacht, sie hätten sich in der Wohnung getäuscht. Tatsächlich war sie sich dessen damals sicher gewesen.
Irgendwo im Nebel zwischen Schlaf und Bewusstsein war sie auf das Hämmern an der Wohnungstür hin aus dem Bett hochgefahren. Sie hatte neben sich gefasst, hatte die vertraute Wärme von Zekes Körper erwartet. Stattdessen hatte sie nur ein kühles Baumwolllaken in der Hand und ihr Herz hatte bis zum Hals geschlagen.
»Zeke?«, hatte sie gerufen. Keine Antwort.
Sie hatte sich hingestellt und war auf dem kalten Travertinboden zum Bad gelaufen. Ihre Nackenhaare hatten sich aufgestellt, als das Hämmern an der Tür zunahm. Männer hatten geschrien.
»Aufmachen! Mach die verdammte Tür auf!«
Das Bad war leer gewesen. Die Küche ebenfalls. Das beengte Wohnzimmer, vollgestopft mit Souvenirs aus dem Leben, das sie mühsam aufgebaut hatten, war in dem Zustand, in dem sie es am Abend zuvor verlassen hatte. An einer Wand stand eine Sammlung von Büchern, altertümliche Schinken von Homer, Shakespeare und Goethe. Zwischen seltene Bücher von Autoren wie Obama, Trump und Kennedy, waren eselsohrige Seiten aus dem Bauernkalender gestopft. Da war ein Buch von einer Frau namens Clinton, ein anderes von einer Mata Hari. Das waren die Dinge, die das Haus in ein Zuhause verwandelt hatten.
»Zeke?«, hatte sie gerufen, dabei langsam begriffen, dass er fort war. Sie hatte das Hämmern an der Tür ignoriert und war zum Fenster gehuscht, wo sie die weißen Gardinen zurückgeschoben hatte, die vom Alter ganz vergilbt waren.
Li hatte sich nach vorn gelehnt und ihre Stirn gegen die Fensterscheibe gedrückt, die von ihrem Atem beschlagen war. Auf der Straße unter ihr war die Stelle, an der Zeke sonst immer seinen Plymouth parkte, leer. Der rissige Asphalt und die ausgeblichenen Parkmarkierungen hatten höhnisch gewirkt. Er hatte sie verlassen. Sie hatte ihn verflucht und ihre Hände gegen das Glas gedrückt, hatte mit den Fingern daran gekratzt, während sie auf den leeren Parkplatz starrte. Mit geballten Fäusten und angespanntem Kiefer war sie zurück ins Schlafzimmer marschiert.
Dann hatte sie das Nachtschränkchen neben ihrem Bett geöffnet, in dem sich ein biometrischer Safe versteckte. Sie hatte mit ihrem Zeigefinger über den Sensor gewischt. Die Safetür war aufgeschnappt, das hydraulische Scharnier zischte.