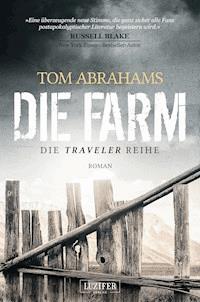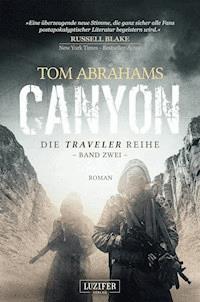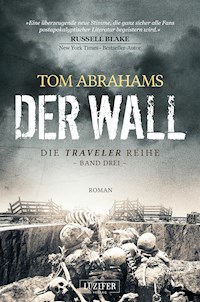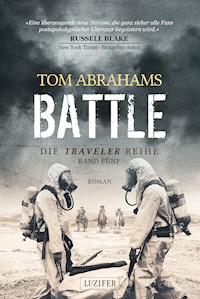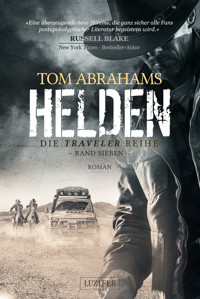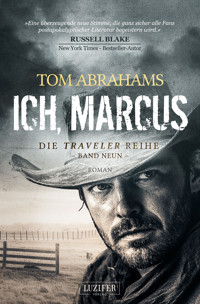Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Traveler
- Sprache: Deutsch
Niemand ist eine Insel. Doch Marcus Battle ist verloren in einem Meer aus Gewalt. Im letzten Teil der Amazon-Bestseller-Reihe versucht der unfreiwillige Held Marcus Battle, seine Freunde vor dem Zugriff eines gnadenlosen Regimes zu retten. Ein geheimes Schleusernetzwerk, das sich die "Underground Railroad" nennt, soll ihnen helfen, einen sagenumwobenen Zufluchtsort zu erreichen – den Hafen. Doch die Gruppe ist in der Unterzahl, das Land voller Plünderer und die Verfolgen ihnen dicht auf den Fersen. Wird Battle endlich den Frieden finden, der ihm nach dem Tod seiner Familie nicht vergönnt war? Oder werden ihn die Sünden seiner Vergangenheit einholen und zu einem ruhelosen Leben auf der Flucht verdammen? ★★★★★ »Eine überzeugende neue Stimme, die ganz sicher alle Fans postapokalyptischer Literatur begeistern wird.« - Russell Blake, New York Times Bestseller Autor Die TRAVELER-Reihe – das sind actionreiche Endzeit-Abenteuer mit einem Schuss Neo-Western.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DER HAFEN
Traveler-Reihe – Band 8
Tom Abrahams
übersetzt von Peter Mehler
Für Courtney, Luke und Sam Ohne euch bin ich nichts. Und für die Fans Ohne euch ist Marcus Battle nichts.
»Einsamkeit und Isolation sind schmerzhafte Dinge, die der Mensch nicht ertragen kann.«
– Jules Verne –
Impressum
Deutsche Erstausgabe Originaltitel: HARBOUR Copyright Gesamtausgabe © 2025 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Peter Mehler
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2025) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-899-7
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Kapitel 1
20. April 2054, 15:15 Uhr 21 Jahre, 7 Monate nach dem Ausbruch Atlanta, Georgia
Der Captain der Bevölkerungswache, Greg Rickshaw, knackte nacheinander mit den Fingerknöcheln. Er tat dies nicht nur, um den Druck und die Steifheit in seinen Gelenken zu lindern, sondern auch, um den Mann vor ihm einzuschüchtern.
Jedes Knacken hallte in der Betonzelle wider und ließ den anderen Mann wie ein verängstigtes Hündchen blinzeln. Schweißperlen standen ihm auf der Oberlippe.
Rickshaw beobachtete ihn aufmerksam. Sein Gesichtsausdruck war dabei ausdruckslos, ohne jede Emotion. Er atmete langsam durch seine abnorm großen Nasenlöcher, die sich dabei blähten.
Diese Nasenlöcher und seine großen, knorrigen Hände waren die dominierenden körperlichen Merkmale, die Rickshaw auszeichneten. Er nutzte beides zu seinem Vorteil, und sein Ruf eilte ihm voraus.
Er war kräftig gebaut und sah viel jünger aus als seine fünfundsechzig Jahre. Er hatte die Zeit nach dem Ausbruch besser überstanden als die meisten anderen, und so wie er die Gelenke in seinen Fingern bearbeitete, hatte er es auch mit den Machtstrukturen getan, die in den darauffolgenden Jahren zusammenbrachen und sich neu formierten. Rickshaw war gut darin gewesen, sich mit den richtigen Leuten zu verbünden, bevor er sie für das nächstbeste Angebot und das Versprechen auf noch mehr Macht wieder verriet.
Als Captain der Bevölkerungswache der Regierung wurde er für seine Hartnäckigkeit und schnelle Entscheidungsfindung bewundert und für seine rücksichtslose Anwendung der Gesetze gefürchtet.
Vor ihm, angekettet an den Edelstahltisch, der die beiden trennte, war sein Opfer kurz davor zu wimmern, als Rickshaw endlich das Wort ergriff. Der Captain war seit gut zehn Minuten in der Zelle, ohne auch nur ein Wort zu sagen oder ein anderes Geräusch als seinen Atem und das Knacken seiner Knöchel von sich zu geben.
»Vor dem Ausbruch«, sagte Rickshaw, »als du noch nicht einmal ein schmutziger Gedanke in Daddys Kopf warst, kannte ich diesen Hundezüchter. Weißt du, was ein Hundezüchter ist?«
Der Mann blinzelte zweimal und überlegte, ob dies vielleicht eine Fangfrage war. Er schüttelte den Kopf.
Rickshaw verschränkte die Finger auf dem Tisch. »Das ist jemand, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, Hunde zu zwingen, schwanger zu werden. Und wenn die Hunde dann so weit sind, verkauft er sie.«
Obwohl die Luft in der Zelle kühl und trocken war, stank sie nach dem nussigen Geruch von getrocknetem Urin. Rickshaw blähte seine Nasenlöcher wieder auf und rümpfte die Nase gegen den Geruch. »Wie heißt du?«, fragte er. »Woher kommst du?«
»Nennen Sie mich … Booth«, antwortete der Mann. »Aus Warner Robins.«
Rickshaw hob eine Augenbraue. »Warner Robins?«, wiederholte er. »Netter Ort. Ich war vor dem Ausbruch einmal dort. Ich habe auf dem Stützpunkt ein paar Aufträge erledigt. Habe ein Haus an der Huber Road gemietet.«
Booth reagierte nicht. Er bewegte sich auf seinem Sitz, die Handschellen drückten gegen seine Handgelenke, und die Ketten scharrten über die rostfreie Tischplatte.
Rickshaw lächelte. Er löste seine verschränkten Finger und legte die Handflächen flach auf den Tisch. »Aber das tut nichts zur Sache, nicht wahr, Booth? Ich habe von Hundezucht gesprochen.«
Booths Schultern sackten in sich zusammen und er beugte sich vor. Sein Blick huschte in der Zelle umher und musterte die beiden bewaffneten Wachen, die auf beiden Seiten der massiven Metalltür standen. Sie waren wie Statuen, unbeweglich und scheinbar desinteressiert an dem Gespräch.
»Das kam mir schon immer seltsam vor«, sagt Rickshaw. »Hunde werfen unentwegt Welpen, einen nach dem anderen. Die kleinen Mamas bringen die Welpen zur Welt, lecken sie, damit sie atmen und sich bewegen, und säugen sie dann wochenlang. Dann kommt jemand und nimmt die Babys mit. Einer nach dem anderen werden sie gekauft, verpachtet oder was auch immer.«
Rickshaw hob eine seiner Hände und winkte damit, als würde er eine Fliege verscheuchen. Er beobachtete Booths verwirrte Reaktion, die Ungewissheit, wohin das Ganze führen sollte.
»Wir haben die Welt mit all diesen Designerwelpen bevölkert«, sagte Rickshaw. »Viel zu viele, wenn man bedenkt, dass es viele Hundezwinger voller heimatloser Hunde gab.«
Das Licht im Raum war hell und steril. Die LED-Leuchten über den Köpfen waren so gestaltet, dass sie ein Krankenhauszimmer imitierten, Leuchtstoffröhren aus der Zeit vor dem Ausbruch, die die Farben aus ihrer Reichweite wuschen.
Booth war blass, seine Haut fahl. Vielleicht lag es an dem Licht. Vielleicht war es aber auch die Angst, die seinen Körper durchzog, der jetzt zitterte. Seine Zähne klapperten.
Rickshaw benutzte beide Hände, während er sprach. Große, ausladende Gesten unterstrichen seine Botschaft. »Aber es war in Ordnung, dass die Menschen diese Hunde, die die Welt nicht wirklich brauchte, nahmen und sie sich zunutze machten. Sie trainierten. Sie zu dem machten, was die Käufer haben wollten. Das war akzeptabel.«
Außerhalb des Zimmers schlug eine Tür zu, und jemand schrie, flehte um Hilfe. Ein Poltern war zu hören, von Fäusten, die auf Metall schlugen. Booths Augen huschten an Rickshaw vorbei. Seine Nase zuckte.
»Ich kannte sogar einmal einen Züchter, der die Welpen vor dem Verkauf einem Wesenstest unterzog«, erzählte Rickshaw. »Sie versetzten den Welpen in eine stressige Situation und testeten ihn. Wie würde er auf einen offenen Regenschirm oder ein lautes Geräusch reagieren? Was würde er tun, wenn man ihn auf den Rücken legte oder ihn mit baumelnden Beinen in die Luft hielt? Kannst du dir das vorstellen, Booth?«
Booths Aufmerksamkeit galt dem Poltern jenseits seiner Zelle. Sein Blick war auf die Tür gerichtet, die zwischen den beiden bewaffneten Wachen eingezwängt schien.
Rickshaw streckte die Hand nach Booths Gesicht und seinem abwesenden Blick aus und schnippte mit den Fingern. »Booth? Hast du mich verstanden? Ich habe von Temperament gesprochen.«
Blinzelnd kehrte Booth ins Hier und Jetzt zurück. Er nickte schwach, und sein Kiefer hing schlaff herunter.
Rickshaw legte sich eine Hand auf die eigene Brust und klopfte auf sein Hemd. Er trug ein hochgeschlossenes Hemd unter einem schwarzen Ledermantel, der an beiden Seiten seines Stuhls herunterhing. Die Farbe des langen Mantels passte zu dem spanischen Bolero aus schwarzem Leder auf seinem Kopf.
»Das ist für mich die nächste Stufe«, sagte Rickshaw. »Wesenstests? Wir nehmen der Mutter nicht nur ein neugeborenes Baby weg, sondern wir testen es auch noch, um sicherzustellen, ob es zu den Fremden passt, denen wir es verkaufen. Findest du nicht auch, dass das die nächste Stufe ist?«
Die Muskeln in Booths Kiefer spannten sich an, als würde er versuchen, das Klappern seiner Zähne zu unterdrücken. Er zuckte mit den Schultern und zog die Schultern übertrieben lang in Richtung seiner Ohren hoch, bevor er sie wieder senkte.
Rickshaw lächelte wieder. Die Grübchen auf seinen schmalen Wangen vertieften sich. »Ich fasse das als ein Ja auf. Die nächste Stufe. Das systematische Kaufen und Verkaufen von Babys. Die sorgfältige Unterbringung in einer Umgebung, in der sie am ehesten gedeihen können. Es war ein System, das funktionierte. Ein Geschäftsmodell, das funktionierte. Das heißt, es funktionierte, bis es nicht mehr funktionierte. Bis der Ausbruch und die Dürre dafür sorgten, dass es für Hunde keinen anderen Platz mehr gab als auf Spießen und in Töpfen.«
Booths Augen waren jetzt glasig, sein Kinn bebte, und er selbst zitterte ebenfalls. Rickshaw nahm den Hauch von etwas wahr, das deutlich an Exkremente erinnerte.
»Verstehst du, worauf ich hinaus will, Booth?«, fragte er rhetorisch. »Ich will damit sagen, dass das, was wir als Bevölkerungswache tun, eine notwendige Arbeit ist. Und es unterscheidet sich nicht von dem, was einst ein vollkommen akzeptables System von Geburt, Verkauf und Beschäftigung war.«
Booths Gesicht errötete selbst in dem grellen Oberlicht, und Tränen rannen ihm lautlos über beide Wangen. Sie tropften von seinem Kinn und trafen auf dem Tisch auf.
»Vergleiche ich Menschen mit Hunden?«, fragte Rickshaw. »Ja und nein. Das kannst du sehen, wie du willst. Ich erkläre dir lediglich, dass es in der westlichen Gesellschaft ein Vorbild gab.«
Rickshaw wusste, wie verrückt er sich anhören musste. Genau das war der Punkt. Er glaubte nicht wirklich, dass Menschen wie Hunde waren. Er mochte Hunde lieber. Er wünschte, er hätte noch den Köter, den er als Kind am Straßenrand gefunden hatte.
Sein Ziel war es, Booths Verstand ins Taumeln, ihn aus der Fassung zu bringen und den armen Trottel glauben zu lassen, dass ihm menschliches Leben nichts bedeutete. Das würde in den nächsten Minuten als nützlich erweisen, wenn er sich daran machte, Informationen aus Booth herauszuholen.
Wenn er ein Märtyrer werden wollte, wie das Pseudonym, das er benutzt hatte, dann nur zu. Aber Rickshaw bezweifelte, dass er schweigen würde. Was immer Booth wusste, er würde es preisgeben. Wie wenig er auch immer geheim hielt, er würde es in den Äther entlassen. Das hatte schon einmal funktioniert, also würde es auch jetzt funktionieren.
Rickshaw faltete seine Hände und legte sie vor sich auf den Tisch. Er stützte die Unterarme darauf und drehte seinen Hals hin und her. Eine Reihe kurzer Knackgeräusche hallte durch den massiven Raum. »Ich sage das alles, weil ich auf Folgendes hinaus will«, dröhnte Rickshaw. »Hast du jemals einen geprügelten Hund gesehen, einen, der nicht in der richtigen Situation gelandet ist?«
Booth zog die Stirn in Falten. Das ließ seine Tränen nur noch schneller über sein Gesicht rinnen. Er schüttelte den Kopf.
Rickshaw grinste breit und klatschte mit beiden Händen auf den Tisch. Booth sprang auf seinem Stuhl auf. Ein weiterer fauliger Hauch drang in Rickshaws Nase, aber er schluckte ihn hinunter. »Natürlich nicht. In deinem Alter hast du vielleicht noch nie einen Hund gesehen. Aber das macht nichts. Der Punkt bleibt derselbe. Du verstehst, worauf ich hinaus will.«
Das Poltern im Flur hörte auf. Jetzt war es still, bis auf das Klirren von Booths Ketten auf der harten Oberfläche des rostfreien Tisches.
»Ein geprügelter Hund fängt irgendwann an zu beißen«, erklärte Rickshaw. »Er versucht, sich zu rächen. Aber nicht, bevor er nachgibt. Nicht, bevor er sich zusammenkauert und seine Wunden leckt. Nicht bevor er das Verhalten aufgibt, das ihn in die Enge getrieben und in Schwierigkeiten gebracht hat.«
Rickshaw stand auf und schob mit einem Stiefel seinen Stuhl zurück. Die Stuhlbeine scharrten über den Betonboden. Er fuhr mit den Fingern über den rostfreien Stahl und ging langsam um die Tischkante herum zu Booth. »Ich brauche Antworten. Ich will, dass du ein guter Junge bist. Hast du verstanden?«
Booth schluckte schwer und wich vor Rickshaw zurück. Die Fesseln gruben sich in seine Handgelenke, die Ketten zogen sich straff.
Rickshaw schlug den Schoß seines schweren Ledermantels zurück und offenbarte ein passendes Holster. Er ließ seine Hand auf den abgenutzten Holzgriff eines Revolvers gleiten und klappte den Verschluss des Holsters auf.
Booths Augen starrten auf die Hand, die Waffe. Er krächzte protestierend, ein Flehen.
Rickshaw zog die Waffe hervor und ließ sie in seiner Hand kreisen. Sie drehte sich um seinem Abzugsfinger. Das Lächeln verschwand aus Rickshaws Gesicht. Die Grübchen verschwanden. Seine grauen Augen verdunkelten sich und seine Miene verhärtete sich.
»Wirst du ein guter Junge sein?«, fragte er und drückte die Mündung des Revolvers gegen das Fleisch auf Booths rechtem Handrücken.
Kapitel 2
20. April 2054, 15:30 Uhr 21 Jahre, 7 Monate nach dem Ausbruch Gun Barrel City, Texas
Für Marcus war es das Beste, Abstand zu halten. Er lehnte sich an einen VW-Käfer, die Beine übereinandergeschlagen und die Arme vor der Brust verschränkt. Die Frau neben ihm war schlank, zierlich sogar, und trug eine Jeanslatzhose, ein schmutziges graues T-Shirt und hohe Converse-Basketballschuhe aus Leder. Von der ursprünglichen Farbe der Schuhe war nichts mehr zu sehen. Sie waren mit dem rötlich-braunen Schmutz überzogen, der in Gun Barrel City überall zu finden war.
Einige Meter entfernt und außer Hörweite umarmten sich Lou und Dallas. Er hatte seine Hände auf ihren Bauch gelegt, seine Lippen auf ihre Stirn gedrückt. Sie lehnte sich an ihn, das Kinn gesenkt und die Augen geschlossen. Eine Hand hatte sie um Dallas' Seite, die andere auf Davids Schulter gelegt. Der Junge klammerte sich an ihre Beine.
Es fiel ihm schwer, zuzusehen und doch nicht hinzusehen. Ein so privater Moment mitten in einem rissigen Seebett voller Leichen und werdender Müttern.
Die Frau neben ihm bewegte sich unbehaglich und wandte ihren Blick ab. Sie fuhr sich abwechselnd mit den Händen durch ihr schulterlanges schwarzes Haar oder kaute an ihrer Nagelhaut. Die Haut um ihre Nagelbetten war bereits entzündet und geschwollen.
Der VW gehörte ihr. Sie nannte sich selbst eine Schaffnerin und wollte keine Namen nennen. Wenn die Familie Stoudemire mit ihrer emotionalen Zusammenführung fertig war, würden sie in das Spielzeugauto steigen und zurück zu dem Leichenbestatter fahren.
Nicht weit von ihnen entfernt, immer noch am Ufer und den Fremden gegenüber misstrauisch, befand sich die Gruppe schwangerer Frauen und ihrer Kinder. Sie blieben, wo sie waren, und warteten auf Anweisungen, was sie als Nächstes tun sollten.
Weder die Schaffnerin noch Marcus wollten den Stoudemires zuhören, als die anfängliche Erleichterung in emotionale Zweifel umschlug. Dallas war wütend und erleichtert zugleich. Lou war defensiv und dankbar. David schien verwirrt zu sein.
»Du hast ihn zurückgelassen«, sagte Dallas zum dritten Mal. »Sie hätten ihn töten können.«
»Aber das haben sie nicht«, sagte Lou. »Es geht ihm gut. Das ist die Hauptsache.«
»Ihm geht es nicht gut«, fuhr sie Dallas an. »Er hat einen Mann getötet. Mit einem Messer. Er kann noch nicht mal Fahrrad fahren, und jetzt ist er ein Killer.«
Lou kochte jetzt innerlich. Ihr Gesicht lief rot an und ihre Körperhaltung verspannte sich. Die Muskeln in ihrem Nacken waren sichtbar, als sie ihrem Mann einen Finger entgegenstreckte. »Sag so etwas nie wieder. Nenne ihn nie wieder so. Er hat sich verteidigt. Er hat getan, was ich ihm beigebracht habe. Bin ich eine Mörderin? Siehst du mich so?«
Marcus sympathisierte mit Dallas. Er verstand seinen Standpunkt. Lou hatte die Entscheidung getroffen, einen Haufen Fremder zu retten, möglicherweise auf Kosten ihres Sohnes. Es war sowohl egoistisch als auch selbstlos gewesen, das Paradoxon einer Entscheidung.
Genauso gut verstand er, warum Lou es getan hatte. Es war ehrenhaft gewesen. Es war menschlich. Und in dieser Welt gab es so viele unmenschliche Entscheidungen, die man treffen musste, um am Leben zu bleiben, dass der bloße Versuch, etwas Vernunft walten zu lassen und das Undenkbare in einer Welt nach dem Ausbruch zu tun, zweifellos das Richtige war.
Vor allem aber war Marcus froh, nicht das Objekt von Lous Zorn zu sein. Er hatte ihre scharfe Zunge schon in mehr Momenten zu spüren bekommen, als er zählen konnte. Sie war leidenschaftlich und kompromisslos. Er beobachtete, wie sie vor ihrem Mann einen Schalter umlegte und innerhalb eines Wimpernschlags von defensiv auf angriffslustig umschaltete. Sie hatte immer noch etwas Wildes an sich, und er fragte sich, wie viel davon von ihrem Vater stammte und wie viel davon er selbst zu verantworten hatte.
Lou stieß mit ihrem Finger in die Luft. Genauso gut hätte sie damit auch ein Loch in Dallas' Brust bohren können. »Wir sind am Leben«, sagte sie und nickte in Richtung Wasser. »Sie sind am Leben. Ihre Kinder sind am Leben. Unser Kind ist am Leben.«
Dallas hob kapitulierend die Hände. Die Anspannung in seinem Gesicht und seinen zusammengekniffenen Augen ließ jedoch nicht nach. »Gut. Ich werde nicht weiter darüber reden. Nicht hier und nicht jetzt. Wir haben Wichtigeres zu tun, als darüber zu streiten, was hätte passieren können.«
Kluger Mann, dachte Marcus. Lebe, um weiterkämpfen zu können.
Dallas und Lou traten näher an den VW heran. Beide sahen zuerst Marcus, dann die Schaffnerin an.
»Wie geht es weiter?«, fragte Lou. »Wohin gehen wir?«
»Ich werde euch zurück auf die andere Straßenseite bringen«, sagte sie. »Als ich David und Dallas aufsammelte, sagten sie, ihr hättet etwas Ausrüstung auf die Pferde geschnallt.«
»Das haben wir«, antwortete Lou. »Und was dann? Und was wird mit all diesen Frauen? Ihren Kindern? Wir können sie nicht hier lassen.«
Die Schaffnerin kaute einen Moment lang auf ihrem Nagel. Sie betrachtete die Flüchtlinge, denn nichts anderes waren sie. »Ich werde mich um sie kümmern. Ich werde dafür sorgen, dass sie es gut haben werden. Aber ich kann sie nicht alle auf einmal transportieren. Die größte Gruppe, die wir bewältigen können, sind sechs. Alles, was darüber hinausgeht, wird zu kompliziert, zu schwer zu transportieren.«
Marcus stellte die Beine nebeneinander und richtete sich auf. Er deutete mit dem Daumen auf den VW hinter sich. »In dieses Auto passen sechs Personen? Das bezweifle ich. Und unser Truck taugt nichts. Kein Reserverad, und außerdem gibt es ein Problem mit der Vorderachse.«
Der Gesichtsausdruck der Schaffnerin veränderte sich. Sie kaute auf etwas in ihrem Mund, die Lippen zusammengepresst. Es war, als wäre ihr das erst jetzt aufgefallen. »Ich bin nicht die einzige Schaffnerin«, sagte sie. »Es gibt noch andere. Sie verfügen über andere Transportmittel.«
»Wie viele andere?«, fragte Marcus.
Die Schaffnerin zupfte mit ihrem Daumen an ihrem Zeigefinger. »Andere was?«, fragte sie. »Schaffner oder Transportmittel?«
Marcus kratzte sich an einer juckenden Stelle an seinem Kinn. »Beides, denke ich.«
»Das darf ich dir nicht sagen.«
Marcus runzelte die Stirn. »Was? Wie viele Schaffner oder wie viele Transportmittel es noch gibt?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Beides, denke ich.«
Marcus blickte nach Westen zum Horizont. Die Sonne stand jetzt tiefer am Himmel. Sie warf längere Schatten. Der Himmel war wolkenlos, aber das Blau war blass und gedämpft. Erschöpfung kroch in seine Gelenke, während er dort stand. Das Adrenalin, das ihn durch den Staub angetrieben hatte, vom Lastwagen zum Pferd, und ihm genug Kraft gegeben hatte, um den Kampf zu beenden, hatte sich längst verflüchtigt.
Er löste seine Arme und bewegte die Finger. Sie waren an den Fingerknöcheln steif. Er drehte seine Handgelenke, um sie zu lockern. »Ich möchte dich Folgendes fragen«, sagte er. »Wo genau fahren wir hin?«
»Ich kann dir nur den ersten Halt nennen«, sagte der Schaffner. »Dann übergebe ich euch an jemand anderen. Kommt, genug geredet. Wir müssen euch zurück zum Leichenbestatter bringen.«
»Ich werde zu Fuß gehen«, sagte Marcus. »Ich muss noch etwas überprüfen. Fahrt ihr schon vor.«
Die anderen warfen ihm merkwürdige Blicke zu, aber keiner widersprach.
Lou trat näher an die Schaffnerin heran. »Da er zu Fuß unterwegs ist, können wir Andrea und ihren Jungen mitnehmen?«
»Wen?«, fragte die Schaffnerin.
Lou trat noch näher heran. »Sieh sie jetzt nicht an, aber sie ist die Dunkelhaarige, die neben dem toten Pferd sitzt. Sie hat einen kleinen Jungen. Sie hat mir geholfen.«
Dallas trat zu ihnen. »Warum sollten wir das tun? Sie mitnehmen, meine ich.«
»Wir haben Platz«, sagte Lou. »Die Schaffnerin sagte, wir könnten sechs Leute mitnehmen. Dich, mich, David, Marcus, Andrea und ihr Sohn. Das sind sechs.«
»Nicht, wenn du entbindest«, sagte Marcus. »Für mich sah es so aus, als ob du in den Wehen lagst, als ich hier ankam.«
Dallas' Augen weiteten sich. »Du liegst in den Wehen?«
Lou legte ihre Hände auf ihren Bauch und schüttelte den Kopf. »Nein. Ich habe ständig Vorwehen. In den letzten paar Tagen hatte ich drei davon. Ich bin nah dran, aber noch ist es nicht so weit.«
»Was ist mit ihr?«, fragte die Schaffnerin und reckte Andrea ihr Kinn entgegen. »Steht sie euch nahe? Sie sieht aus, als würde sie gleich platzen.«
Lou runzelte die Stirn. »Großartig«, sagte sie sarkastisch. »Und ich weiß es nicht. Aber wir können sie mitnehmen.«
Der Schaffner zuckte mit den Schultern. »Von mir aus. Aber jemand muss auf dem Schoß von jemand anderem sitzen. Ich habe nur vier Plätze.«
»David kann auf Dallas' Schoß sitzen«, sagte Lou. »Und Andrea kann ihren Jungen halten.«
»Ich werde es ihr sagen«, sagte Marcus. »Ihr springt alle rein. Ich treffe euch beim Leichenbestatter.«
»Besser noch«, sagte die Schaffnerin, »ich setze sie ab und lasse sie in das Gebäude. Dann komme ich zurück und hole dich. Dann bleibt dir noch genug Zeit, um zu tun, was immer du tun musst.«
Marcus nickte dankend. Er lehnte sich auf sein rechtes Bein und steckte die Hände in die Taschen. Andrea beäugte ihn misstrauisch, als er sich näherte, und drückte ihren Jungen fester an sich. Wie ein Baseball-Fänger ging Marcus vor ihr in die Hocke und sprach leise zu ihr.
»Mein Name ist Marcus«, sagte er. »Ich habe gehört, du bist Andrea. Wie heißt dein Junge?«
Andreas Augen huschten zu dem VW und dann wieder zu Marcus. Sie musterte ihn, ohne ihm zu antworten.
»Hör zu«, sagte er und gestikulierte mit den Händen, »Lou da drüben hat Gefallen an dir gefunden. Sie sagt, du hast ihr geholfen. Sie will euch helfen, dir und …« Marcus ließ seinen Blick auf dem Jungen ruhen und ließ den Satz in der Luft zwischen ihnen hängen.
»Javi«, sagte Andrea. »Sein Name ist Javier. Wir nennen ihn Javi.«
Marcus sah den Jungen an und tippte sich an den Hut. »Schön, dich kennenzulernen, Javi.« Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf Andrea. »Wir sind auf dem Weg in die Sicherheit. Ich schätze, es wird eine harte Reise. Wird sicher nicht einfach werden. Vielleicht treffen wir auf mehr von der Garde, oder Kojoten, wer weiß? Aber ihr könnt gern mit uns kommen. Wir, das sind Lou, ihr Sohn David, ihr Mann Dallas und ich. Wir haben auch einen Führer. Jemand von der Railroad.«
Andrea runzelte die Stirn vor Verwirrung. »Der Railroad?«
»Der Underground Railroad«, sagte Marcus. »Es ist eine geheime Bewegung zur Freiheit von der Regierung, wie während des amerikanischen Bürgerkriegs im neunzehnten Jahrhundert.«
»Welcher Bürgerkrieg?«
Marcus presste seine Lippen zu einer flachen Linie zusammen und schüttelte den Kopf. »Das ist jetzt egal«, sagte er. »Der Punkt ist, dass du Hilfe bekommst, wenn du sie willst.«
Andrea rieb sich mit dem Handrücken die Nase und drehte sich um, um das Wasser zu betrachten. Die anderen Frauen waren mit sich selbst beschäftigt. Keine von ihnen schien das Gespräch zwischen den beiden zu bemerken.
»Willst du nun Hilfe?«, drängte sie Marcus.
Sie nickte. »Okay, aber was ist mit den anderen? Ich bin auch nicht besser als die anderen. Es gibt auch ein Neugeborenes.«
»Sie werden Hilfe bekommen«, sagte Marcus, »aber sie werden nicht mit uns kommen. Die Railroad wird sich um sie kümmern. Sie werden in kleineren Gruppen aufgeteilt. Fünf oder sechs Leute auf einmal, höchstens. Aber sie werden Hilfe bekommen. Okay?«
»Okay.«
Marcus stand auf, half Andrea auf die Beine und führte sie zum VW. Die anderen saßen bereits im Innenraum. Andrea ließ sich auf den Beifahrersitz sinken und winkte dann Javi in den Raum zwischen ihrem Bauch und dem Armaturenbrett.
Die anderen begrüßten sie und sie bedankte sich. Marcus schloss die Tür und klopfte auf das Dach. Die Schaffnerin startete den Motor, raste zurück durch das Seebecken und wirbelte dabei Staub in die Luft.
Marcus zog seinen Hut vom Kopf und fächelte sich den Schmutz aus dem Gesicht. Er hustete und ging auf den Lastwagen zu. Von der Ladefläche nahm er seinen Rucksack. Nacheinander hob er die Benzinkanister an und prüfte ihr Gewicht. Einer von ihnen war voll. Ein anderer war noch reichlich gefüllt. Unbeholfen und ohne seine Beine zu benutzen, zog er die Kanister von der Ladefläche und stellte sie auf den Boden. Zweifellos konnte der VW den Sprit gut gebrauchen.
Er überquerte die Weite in Richtung des Wassers, während sein Schatten zu seiner Linken fiel, und lief nach Süden. Er rückte den Rucksack auf seinem Rücken zurecht und holte zwei Gläser mit Honig heraus. Er forderte die Frauen auf, ihm entgegenzukommen. Es waren vier Frauen, fünf Kinder und ein Säugling. Alle bis auf eine, die den Säugling hielt, kamen näher an ihn heran. Sie blieb zurück und stand knöcheltief im Wasser, unweit von den Stiefeln eines toten Mannes, der mit dem Gesicht nach unten lag und dessen Rücken mit Blut befleckt war.
Marcus räusperte sich. »Okay, ihr werdet es alle schaffen. Die Frau im Auto, die gerade weggefahren ist, wird zu euch zurückkommen. Sie und ihre Freunde werden einen Weg finden, euch und eure Kinder in Sicherheit zu bringen.«
Er musterte ihre Gesichter. Sie erinnerten ihn an die Frauen, die er in Syrien gesehen hatte, deren Ehemänner gestorben waren, deren Häuser im Krieg zerstört worden waren. Ihre Gesichter waren hager, ihre Kleider hingen an ihnen, als wären sie für jemanden gemacht, der zwei oder drei Nummern größer war. Ihre Kinder klammerten sich an ihre Seiten, mit knorrigen Knien und aufgeblähten Bäuchen, die nur etwas kleiner waren als der Schwangeren, die ihr Kind mit gewölbten Rücken und gemessenen Humpelschritten trug. Keiner von ihnen reagierte auf das, was er ihnen gesagt hatte, und er fragte sich, ob sie Englisch sprachen oder verstanden.
Schließlich sprach die Frau im Wasser zu ihm, die den Säugling an ihrer Brust trug. Sie hob ihr Kinn und blickte misstrauisch über ihre Nase hinweg an. »Warum sollten wir dir glauben? Woher sollen wir wissen, dass du nicht so bist wie sie?«
Sie ließ ihr Kinn wieder sinken und deutete damit auf die Leiche vor ihr, dann auf die mit dem Loch im Hals, die näher bei Marcus lag. Sie grinste. Eigentlich, so erkannte Marcus, war es kein Grinsen. Sie gehörte zu jenen Menschen, deren Mund nie ganz geschlossen war. Die Zähne waren immer sichtbar.
Marcus zuckte mit den Schultern. »Das kannst du nicht wissen. Und nichts, was ich tue oder sage, wird dir beweisen, dass ich keine bösen Absichten hege. Aber welche Wahl hast du denn?«
»Was haben Sie da in der Hand?«, fragte die Frau, ohne die Frage wirklich zu beantworten, aber sie deutete an, dass sie ihm einen Vertrauensvorschuss geben würde.
Marcus wog das Gewicht in seinen Händen, sah nach unten und fuhr mit dem Daumen über das geprägte Glasmuster auf den Seiten der Einmachgläser. »Das ist Honig. Ziemlich frisch. Er enthält etwas Zucker, was euch allen einen kleinen Schub geben könnte. Er besitzt auch einige andere, gesundheitsfördernde …«
»Wir wissen, was Honig ist«, sagte die Frau mit dem Kleinkind. »Gibst du ihn uns?«
Marcus ignorierte die spitze Bemerkung. Er konnte nicht wissen, welche Hölle die Frauen durchgemacht hatten. Und angesichts der Tatsache, dass diejenige, die einen Säugling in den Armen hielt, auch noch schwanger war, stellte er sich vor, dass es da eine Geschichte gab, die er nicht wissen wollte. Also lächelte er.
»Das werde ich«, sagte er. »Ich lasse ihn hier für dich liegen. Teilt es auf, wie ihr wollt. Die Frau mit dem VW wird euch abholen, bevor es dunkel wird. Versprochen.«
Er ging so weit in die Hocke, dass er die beiden Krüge auf den Boden stellen konnte. Er drehte sie so, dass das, was er für die Vorderseite des Gefäßes hielt, die geprägte Seite, in Richtung Wasser zeigte. Seine Knie protestierten, als er aufstand, und sein Rücken verkrampfte sich für einen Moment, aber er tippte sich an seinen Hut und begann, den Strand nach Munitionsresten und Waffen zu durchsuchen.
Er schulterte vier Gewehre und stopfte weitere sechs Magazine in seinen Rucksack. Seinem Körper gefiel das zusätzliche Gewicht nicht, als er den Rückmarsch zum Lastwagen antrat. Es fühlte sich an, als ob die obere Hälfte seines Körpers wie eine Teleskopstange auf die untere Hälfte drückte.
Bevor Marcus den Lastwagen erreichte, raste der VW wieder zu ihm zurück. Der Motor heulte auf und die Reifen ratterten über den Boden, bis er neben ihm anhielt. Er deutete auf die Benzinkanister. »Kannst du die gebrauchen?«, fragte er und drückte auf das VW-Logo, um den Kofferraum zu öffnen.
Er verstaute die Gewehre und seinen Rucksack in dem ansonsten leeren Kofferraum. Sie passten hinein, obwohl der Kofferraumdeckel offenbleiben musste.
»Sicher«, antwortete die Schaffnerin durch die offene Fahrertür. »Ich werde sie bei meiner letzten Runde mitnehmen. Ich dachte mir, dass ich zuerst dich mitnehme. Euer nächster Schaffner wartet schon auf euch. Er wird euch nach Tyler bringen.«
Marcus lief zur Beifahrerseite und stieg ein. Seine Knie stießen an das Armaturenbrett, und obwohl er versuchte, den Sitz nach hinten zu schieben, war nicht genug Platz vorhanden.
»Tyler?«, fragte er. »In Texas?«
Die Schaffnerin legte den Gang ein und trat das Gaspedal durch. Der Wagen wirbelte in einem Halbkreis herum, als sie ihn wendete. »Ja. Tyler, Texas.«
»Wieso?«
»Dort werdet ihr euch mit dem Schaffner treffen, der euch in die Nähe der Mauer bringt«, sagte sie und schaltete in den zweiten und dann in den dritten Gang. »Was danach passiert, weiß ich nicht. Ich bin überrascht, dass sie mir überhaupt so viel erzählt haben.«
Das Auto holperte und heulte eine Steigung hinauf in Richtung Highway. Die Waffen klapperten im Kofferraum. Marcus überprüfte den Seitenspiegel, um sicherzustellen, dass nichts herausfiel.
»Dann bringst du uns also nicht nach Tyler?«
Die Schaffnerin schüttelte den Kopf. Ihr Haar peitschte ihr ins Gesicht und sie strich den Pony zur Seite. »Nein, ich statte euch aus. Ihr werdet die Pferde nehmen.«
»Alle?«
»Alle bis auf das, das ihr bei den Frauen am See zurückgelassen habt«, sagte sie. »Es gibt vier Pferde im Leichenschauhaus. Du wirst eines nehmen. Dallas ebenfalls. Lou wird es sich ihres mit David teilen, so wie sie es bisher getan hat. Und Andrea wird ihr Pferd mit Javier teilen.«
Sie schaltete in den zweiten und dann in den ersten Gang und ließ den Wagen in den Leerlauf gleiten, als sie auf den Parkplatz bog. Die Pferde waren immer noch an dem Telefonmast angebunden. Die Eingangstür des Gebäudes stand offen.
»Wohin als Nächstes?«, fragte Marcus.
»Nach Tyler«, sagte sie. »Und dann nach …«
»Nein, mit den Pferden. Du sagtest, es sei nur ein kurzer Weg bis zum nächsten Schaffner.«
»Purtis Creek State Park«, sagte sie und hielt den Wagen an. Sie zog die Handbremse an, die an der richtigen Position einrastete. »Das ist nicht weit von hier.«
Sie öffnete die Fahrertür mit einem metallischen Knall, der sich anhörte, als würde die Tür nicht richtig in ihrem Scharnier sitzen. Die Schaffnerin glitt aus dem VW und marschierte auf den Eingang des Bestattungsinstituts zu. Marcus saß auf dem niedrigen Sitz, die Knie gegen das harte Armaturenbrett gepresst, und ließ sich einen Moment Zeit. Er blies die Backen auf und sammelte Kraft, um aufzustehen.
Wie jemand, der durch eine Luke kletterte, drehte er sich auf die Seite und zog sich bei geöffneter Tür mithilfe des Rahmens aus dem niedrigen Sitz. Es war kurz vor der goldenen Stunde. Die Sonne stand noch hoch genug, um viel Licht zu spenden, aber tief genug, um die Farben der Landschaft nicht zu trüben. Alles schien zu leuchten. Die Luft hatte sich abgekühlt, war aber immer noch warm. Er ging hinten um den VW herum und überprüfte die Reservegewehre, dann hielt er auf den überdachten Eingang des Bestattungsunternehmens zu.
Im Inneren des Gebäudes war es dunkler. Die Luft war stickiger, abgestanden und muffig. Staub trieb träge durch den Raum.
Marcus musste deswegen husten, während sich seine Augen an die schwache Beleuchtung in dem Bereich gewöhnten, den er als Empfangsraum betrachtete. Der bordeauxfarbene Teppichboden war auf einem Weg ausgelegt worden, der von der Tür zu zwei gegenüberliegenden Torbögen abzweigte. Aufwändige Verzierungen aus dunkel gebeiztem Holz rahmten beide Bögen ein. Zu Marcus' Linken befand sich eine Sitzecke mit zwei großen Ohrensesseln und einem runden Tisch. Auf dem Tisch stand eine einzelne gelbe Rose in einer Vase. In der Vase befand sich kein Wasser. Die Rose war eine Fälschung.
Auf der rechten Seite befand sich ein Korridor. Marcus konnte nicht mehr als ein paar Meter in den Korridor sehen. Dafür war es zu dunkel.
Er ging noch ein paar Schritte ins Innere des Gebäudes, ließ die Tür hinter sich offen und bewegte sich auf den Bogen auf der rechten Seite zu. Gedämpfte Gespräche und flackerndes Kerzenlicht drangen aus diesem Raum. Der Zwillingsbogen auf der linken Seite war dunkel und still.
Bevor er den Bogen erreichte, erschien die Schaffnerin in dem Durchgang, mit hochgezogenen Augenbrauen und einem fragenden Blick in ihrem schmalen Gesicht.
»Kommst du?«, fragte sie. »Wir haben nicht viel Zeit.«
Steif betrat Marcus den Raum. Er war größer, als er erwartet hatte. Am Ende des Raumes befand sich eine rechteckige Plattform, wie ein fester Katafalk.
An den Wänden hingen gerahmte Ölgemälde von Wasserfällen und mit Laub bedeckten Holzwegen. Sie erinnerten ihn an die billigen Kunstwerke, die früher über den durchhängenden Betten in billigen Motels hingen. Er erinnerte sich an sie aus seiner Kindheit, von den langen Autofahrten mit seinen Eltern, die gleichzeitig als Urlaube und Besuche bei der Großfamilie dienten.
An diese Reisen hatte er schon lange nicht mehr gedacht. Das Einzige, was fehlte, waren die laminatgetäfelten Wände, die wie Eiche oder Mahagoni aussahen, und die billigen Fernseher, die HBO versprachen, aber nur selten lieferten. All das war vor dem Ausbruch gewesen. Bevor er Sylvia getroffen hatte. Bevor er auf der gepunkteten Linie unterschrieben und seinem Land gedient hatte. Bevor er Menschen getötet hatte. Vor all dem, was ihn jetzt auf eine Art und Weise definierte, die ihm nicht besonders gefiel.
Er dachte gerade an ein besonders billiges Motel in Hardee, South Carolina, nahe der Staatsgrenze, wo sich seine Mutter über das fehlende heiße Wasser in der Dusche beschwert hatte, als die Schaffnerin seine unpassende Träumerei unterbrach.
Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter. »He, Oldtimer«, sagte sie, »hast du mich gehört?«
Marcus blinzelte sich zurück in die Gegenwart. »Ja«, sagte er und ignorierte den albernen Spitznamen. »Ich habe dich gehört. Wie geht es weiter?«
Die Schaffnerin deutete mit dem Daumen über ihre Schulter und lenkte damit Marcus' Aufmerksamkeit auf seine Begleiter. Sie saßen auf Stühlen und stopften sich und ihre Rucksäcke mit Verpflegung voll.
Lou schob zwei Finger in ein Glas Erdnussbutter, schöpfte etwas aus und schob sie sich in den Mund. David knabberte an Keksen oder Crackern, während Dallas immer wieder lange Züge aus einer Wasserflasche nahm, in der anderen Hand ein schartiges Stück Dörrfleisch. Andrea hielt eine Feldflasche in ihrem Schoß. Sie befand sich direkt neben dem Kopf ihres Sohnes. Er schlief, die Beine auf dem benachbarten Stuhl angezogen. Es sah nicht im Entferntesten bequem aus. Der Junge musste genauso erschöpft sein wie Marcus, wenn nicht noch mehr. Wer wusste schon, was er in den Händen der Schmuggler erlitten hatte?
»Nimm dir etwas zu essen«, sagte die Schaffnerin. »Und packe dir ein, was du nicht schaffst. Du wirst es unterwegs brauchen. Wir haben noch etwa fünfzehn Minuten Zeit, dann müssen wir mit ihnen aufbrechen. Ich muss zurück zu den Frauen am Stausee.«
»Hey«, fragte Marcus, »warum ist die Stadt verlassen? Ich hätte gedacht, dass ein Ort mit leicht verfügbarem Wasser ein Anziehungspunkt sein würde. Man sollte meinen, die wäre überfüllt.«
»Sie liegt auf der anderen Seite des Stausees«, sagte die Schaffnerin. »Auf der Nordseite ist es ziemlich voll und auf der Westseite, näher an Dallas, auch.«
Marcus beobachtete, wie Lou sich einen weiteren Klecks Erdnussbutter auf die Finger schmierte, wie ein Kind, das die Speisekammer plünderte, während die Eltern weg waren.
»Aber wieso nicht hier?«, fragte Marcus.
»Es war hier voll, relativ voll zumindest. Aber es gab ein paar Vorfälle in Gun Barrel. Es bekam den Ruf, unsicher zu sein, und die Leute zogen weg. Das war vor ein paar Jahren. Niemand ist zurückgekommen. Das werden sie aber. Irgendwann.«
»Vorfälle?«
»Grundlose Gewalt«, sagte sie. »Familien wurden angegriffen. Stammeskarawanen.«
»Haben sich hier keine Banden niedergelassen?«
»Sie bleiben in den Städten«, sagte sie. »Es gibt gelegentlich Nomaden, die hier vorbeikommen. Schlimmstenfalls bekommen wir es mit einer Stammeskarawane zu tun, die zwischen den Städten umherzieht, aber das ist alles. Im Moment ist der Ort ein gut gehütetes Geheimnis. Die Railroad wird ihn so lange nutzen, wie wir können.«
Marcus dankte ihr für die Erklärung und ging zu Lou. Er hob einen umgestürzten Plastikstuhl auf und stellte ihn neben ihr ab. Er ließ sich rückwärts darauf sinken und stützte sich dabei mit den Unterarmen auf der Lehne ab.
Sie leckte sich die Erdnussbutter von den Zähnen und bearbeitete die Innenseiten ihrer Wangen. Sie war sich bewusst, dass Marcus sie dafür verurteilte, und starrte ihn mit halb geschlossenen Augen und einem leeren Blick an. »Was?«
»Erdnussbutter?«
»Das habe ich seit Jahren nicht mehr gegessen«, sagte sie. »Es ist himmlisch.«
Marcus rieb sich mit dem Daumen das Kinn. »Du hast den Himmel vor dir. Vielleicht hebst du es dir für später auf?«
»Ich werde mich nicht für den Genuss von Erdnussbutter entschuldigen. Nicht einmal ein kleines bisschen.«
Sein Blick wanderte zu ihren Fingern, die als Löffel gedient hatten. Dann grinste er. »Wann hast du dir das letzte Mal die Hände gewaschen?«, fragte er. »Ich meine, ich bin sicher nicht Mr. Penibel, aber großer Gott, Lou. Das ist eklig.«
Sie starrte ihn einen Moment lang ausdruckslos an. Dann hob sie ihre mit Erdnussbutter bestrichenen Finger, den Zeige- und Mittelfinger ihrer rechten Hand, und ließ den Zeigefinger sinken. Ein Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus, bevor sie den Mittelfinger nahm und die Reste der Erdnussbutter von ihm ablutschte.
»Das war jetzt das zweite Mal«, sagte Marcus.
»Das zweite Mal was?«
»Der Finger. Das war das zweite Mal. Ich nehme an, deine passiv-aggressive Natur ist geblieben?«
»Ist das eine Frage?«
»Eine Beobachtung«, sagte Marcus.
»Daran ist nichts Passives«, sagte sie und reichte Marcus das Glas.
»Das habe ich nicht vermisst«, meldete sich Dallas.
Marcus nahm das Glas und kippte es an, um den Inhalt zu betrachten. Es war mit Fingerabdrücken durchzogen. Er überlegte, ob er ablehnen sollte, aber er war hungrig. »Was hast du nicht vermisst, Dallas?«
»Die Streitereien«, sagte Dallas. »Das ständige Hin und Her. Das wird langsam alt.«
»Nicht so alt wie Marcus«, sagte Lou.
Marcus schnaubte, steckte einen Finger in das Glas und belud ihn mit der weichen, süß-salzigen Paste. Wie lange war es her, dass er Erdnussbutter gegessen hatte? Er konnte sich nicht erinnern. Er war sich nicht einmal sicher, ob er sich noch an den Geschmack erinnern konnte.
»Woher hast du die Erdnussbutter?«, fragte Lou die Schaffnerin.
Die Schaffnerin saß auf der Kante der Katafalk-Plattform. Sie trank einen Schluck Wasser aus einer Feldflasche und wischte sich mit dem Handrücken den Mund ab. Marcus bemerkte zum ersten Mal das Funkgerät an ihrer Hüfte.
»Atlanta«, sagte die Schaffnerin. »In der Nähe der Stadt werden immer noch Erdnüsse angebaut. Das und Mais.«
»Trotz der Dürre?«, fragte Dallas.
»Sie sind modifiziert«, erklärte die Schaffnerin. »Sie brauchen viel weniger Wasser.«
Marcus lutschte die Erdnussbutter von seinem Finger und gab sich dem Geschmack hin. Erinnerungen strömten zu ihm zurück. An seine Kindheit, als er auf der Veranda des Hauses seines Freundes Erdnussbutter-Honig-Sandwiches aß und dabei die interessierten Bienen verscheuchte, die um sie herumschwirrten, während sie aßen. Er erinnerte sich an Wes, der seine Sandwiches an vier Ecken aufgeschnitten hatte, und an das Himbeergelee, das aus den Rändern des durchtränkten Weißbrotes tropfte.
Er schluckte die Erdnussbutter hinunter und nahm an dem Gespräch teil. »Das Gleiche in Virginia«, sagte er zu der Schaffnerin. »Dort wird auch angebaut, hauptsächlich Tabak. Und alles ist gentechnisch verändert, um der Trockenheit zu trotzen. Eigentlich sollte ich mir Sorgen über die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen all dieser veränderten Lebensmittel machen, tue ich aber nicht.«
Dallas schüttelte den Kopf und gluckste. »Das ergibt keinen Sinn.«
»Genetik?«, fragte Marcus. »Die macht wohl Sinn.«
»Nein«, erwiderte Dallas. »Du ergibst keinen Sinn.«
Dallas räusperte sich. In seiner besten Marcus-Imitation senkte er die Stimme, zog das Kinn an und verströmte mit steifem Nacken und hochgezogenen Schultern eine Aura der Wichtigtuerei. »Ich mache mir Sorgen über Dinge«, sagte er, »aber ich mache mir keine Sorgen über Dinge. Ich sage Dinge. Aber ich spreche sie nicht aus. Ich esse nicht mit meinen Fingern, außer wenn ich mit meinen Fingern esse.«
»Bist du jetzt auf Lous Seite?«, fragte Marcus.
»War ich doch schon immer«, schoss Dallas zurück. »Ich habe damit angefangen.«
Marcus lächelte. Er nahm noch einen Fingerbreit Erdnussbutter. Bevor er ihn aß, deutete er auf Dallas. »Meine Argumentation macht Sinn, auch wenn du sie nicht verstehst.«
»Das ist die Logik des alten Mannes«, sagte Lou. »Er hat nur noch drei Gehirnzellen, und zwei von ihnen sind dabei, sich aufzulösen. Die Dritte kann nichts dafür.«
Das Funkgerät an der Hüfte der Schaffnerin knisterte, was die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Sogar Javier öffnete seine Augen und setzte sich auf. Das Funkgerät knisterte erneut. Statisches Rauschen erfüllte den Raum.
Die Schaffnerin riss das Funkgerät ab und hielt es sich vors Gesicht. Sie warf einen Blick auf das Display und drehte an einem Regler an der Oberseite des Geräts. Mit dem Daumen drückte sie eine Reihe von Tasten auf der Vorderseite des Geräts. Dann hob sie das Funkgerät an ihren Mund und drückte eine Sendetaste an der Seite. »Hier ist Schaffnerin 416. Statusreport, bitte.«
Sie ließ die Taste los. Sie blickte wieder auf das Display und kniff die Augen zusammen. Sie las etwas auf dem Display ab. Das Funkgerät knisterte wieder. Ihr Gesicht zuckte, und ihre Augen reagierten auf das, was sie sah.
»Was ist los?«, fragte Marcus. »Alles in Ordnung?«
Die Schaffnerin sah auf und schüttelte mit ernstem Gesichtsausdruck den Kopf. »Wir müssen gehen. Eine Stammeskarawane ist auf dem Weg hierher.«
»Wieso?«, fragte Lou.
Dallas stand auf und half David mit seinen Sachen. Lou folgte seinem Beispiel und stand ebenfalls auf, wobei sie sich die Hand auf den Rücken legte. Sie zuckte zusammen, als sie aufstand.
Die Schaffnerin befestigte das Funkgerät wieder an ihrem Gürtel.