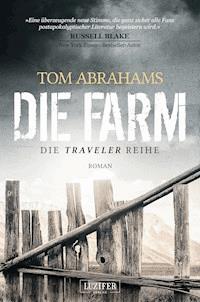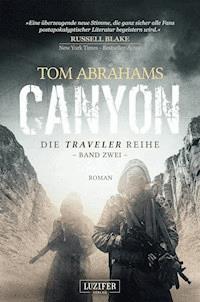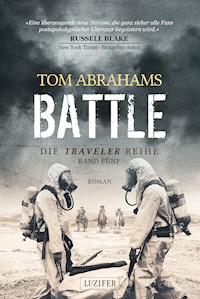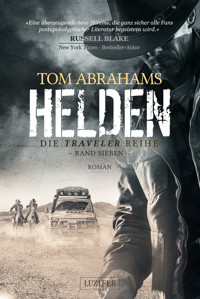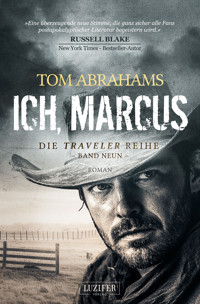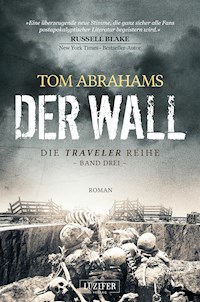
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Traveler
- Sprache: Deutsch
ER ÜBERLEBTE DIE APOKALYPSE UND ENTKAM DEM KARTELL. DOCH NUN KEHRT ER ZURÜCK. Nach dem Zusammenbruch der Weltordnung begann die Herrschaft des Bösen. Die Regierungen stürzten, das Kartell gelangte an die Macht, und aus guten Menschen wurden Sklaven. "Eine überzeugende neue Stimme, die ganz sicher alle Fans postapokalyptischer Literatur begeistern wird." - Russell Blake, New York Times Bestseller Autor Um die Gefahr aus dem Ödland zurückzuhalten, wurde ein Wall errichtet. Doch nun strebt eine Widerstandsgruppe nach Veränderungen. Sie sind bereit, dafür zu kämpfen und notfalls auch zu sterben, und sie bitten Marcus Battle um Hilfe. Battle hat genug Blutvergießen miterleben müssen, aber wenn Krieg das einzige Mittel ist, die Freiheit und eine sichere Passage auf die andere Seite des Walls zu erlangen, dann wird er diesen Krieg führen … Die TRAVELER-Reihe – das sind actionreiche Endzeit-Abenteuer mit einem Schuss Neo-Western.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DER WALL
Traveler-Reihe – Band 3
Tom Abrahams
Übersetzt von Raimund Gerstäcker
Copyright © 2016 by Tom Abrahams
All rights reserved. No part of this book may be used, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the written permission of the publisher, except where permitted by law, or in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews.
Für Don.
»Aus dem Herzen des Leidens selbst werden wir die Mittel der Inspiration und des Überlebens schöpfen.«
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: WALL Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Raimund Gerstäcker Lektorat: Astrid Pfister
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-479-1
Folge dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte
unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf deinem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn du uns dies per Mail an [email protected] meldest und das Problem kurz schilderst. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um dein Anliegen und senden dir kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Eine noch warme Leiche über den Boden des Canyons zu schleifen, war nicht Teil des Plans gewesen. Überhaupt war in der Woche seit seiner Ankunft kaum etwas so gelaufen, wie Charlie Pierce es erwartet hatte. Aber es gab nun mal einen Job zu erledigen.
Egal welche Hindernisse oder unvorhergesehene Umstände auftauchen würden: Pierce musste liefern, denn General Roof war für den bevorstehenden Angriff auf die Ergebnisse seiner Aufklärungsmission angewiesen.
Pierce schlurfte tief nach vorne gebeugt rückwärts und zog dabei die Leiche durch Gestrüpp, über Felsgestein und durch ausgetrocknete Flussläufe. Er wusste nicht, wie weit er noch gehen musste, bis er am richtigen Ort war. An dem Ort, an dem er die Leiche des Mannes entsorgen würde, den er hatte töten müssen. Er würde es wissen, wenn er ihn erreicht hatte.
Ein Blitz zuckte über den Himmel und erleuchtete die steilen, schroffen Wände des Canyons. Donner folgte kurz darauf und hallte durch das weite Tal von Palo Duro. Pierce blieb kurz stehen und ließ die Leiche zu Boden sinken. Er stellte sich aufrecht hin und stemmte die Hände in die Hüften. Er war außer Atem und schwitzte trotz der fast eisigen Temperaturen so sehr, dass sein Hemd bereits nass war. Er spürte die Verdunstungskälte, als ihm der Schweiß vom Nacken aus über den Rücken lief.
Eine weitere gezackte Gabel aus Licht stieß in den schwarzen Himmel und pulsierte. Donner krachte und hallte von den Felswänden wider, bevor das Nachglühen des Blitzes erloschen war. Der Sturm rückte offenbar immer näher.
Pierce überlegte kurz, ob das aufziehende Unwetter nicht vielleicht auch seine guten Seiten hatte, denn ein ordentlicher Regen würde die Spuren wegwaschen, die er zwangsläufig hinterlassen hatte.
Er hatte dem Mann während eines kurzen Handgemenges das Genick gebrochen. Es war ein Wachposten der Dweller, denen es noch immer gelang, sich dem Zugriff des Kartells zu entziehen, und er hatte einfach zu viele Fragen gestellt und sich zu sehr dafür interessiert, wer Pierce war und was er hier suchte. Pierce hatte versucht, sich aus der Zwickmühle herauszureden, aber ohne Erfolg.
Ganz unten im Canyon hatte Pierce nämlich einen Kommunikationsbunker entdeckt, zwei Meilen vom großen Lager der Dweller entfernt.
Der Bunker war nicht viel mehr als eine Höhle gewesen, die die Natur in die Felswände geschnitten hatte. Es gab mehrere Funkstationen, deren orangefarbene Displays ein warmes, an Feuer erinnerndes Leuchten an die blassen Wände geworfen hatte. Das Rumpeln und Summen eines Generators hatte Pierce letzten Endes dorthin geführt. Die Wüstennacht trug jegliche Geräusche nämlich über weite Entfernungen und das Poltern war noch aus einer halben Meile Entfernung deutlich zu hören gewesen.
Ein dünner, getarnter Draht, der als Verlängerung der Antenne diente, verlief die steile Wand hinauf, soweit Pierce das im Dunkeln hatte erkennen können. Über das Kommunikationssystem der Dweller zu stolpern war für den Spion ein glücklicher und entscheidender Fund gewesen. Selbst, wenn es ihm nicht gelang, das komplette Funksystem während des Angriffs zu deaktivieren, konnte er doch zumindest die Frequenzen an das Kartell weiterleiten, damit diese ab sofort über die taktischen Entscheidungen der Dweller im Bilde waren. Der Wachposten hatte ihn überrascht, als er gerade die Frequenzen überprüft hatte.
»Hey«, hatte der Mann gerufen, der plötzlich aus dem Dunkel des Eingangs aufgetaucht war. Seine Stimme war durch die kleine Höhle gehallt. »Was machen Sie hier? Hier ist absolutes Sperrgebiet.«
»Ich bin nur durch Zufall hier reingestolpert«, hatte Pierce gelogen. »Ich wollte nur eine kleine Abendrunde drehen …«
Der Wachposten hatte daraufhin die Höhle betreten und eine Taschenlampe genau in Pierces Gesicht gerichtet. Denn abgesehen von den Displays der Funkgeräte war es absolut dunkel gewesen. »Es ist zwei Uhr nachts.«
»Das ist mir klar.« Pierce hatte lapidar mit den Schultern gezuckt, bevor er seinen tödlichen Zug gemacht hatte. Dafür durfte er jetzt eine Leiche über den Felsboden des Canyons schleppen.
Dieser war absolut riesig, siebzig Meilen lang und an seiner weitesten Stelle zwanzig Meilen breit. Seine Wände ragten fast neunhundert Fuß in den Himmel hinauf. Bei seinem kurzen Aufenthalt hier, hatte Pierce erfahren, dass die Dweller Experten darin waren, im Canyon zu navigieren und ihn zu schützen. Pierce hatte alles darangesetzt, so viele Informationen wie nur möglich aufzusaugen. Er hatte ihren Gesprächen zugehört, ihre Bewegungs- und Verhaltensmuster beobachtet und die bizarre philosophische Verdrehung dieser kriegerischen Pazifisten bestaunt, die sich in einem durchgeknallten Ritual Hindi-Namen gaben, das nach Pierces begrenzter theologischer Bildung keinerlei Ähnlichkeit mit dem Hinduismus aufwies.
Pierce hatte seine Arbeit absolut unsichtbar erledigt … solange, bis er auf den Wachposten gestoßen war. Daraufhin hatte er genau das getan, was der General ihm befohlen hatte.
»Sie sind die Fliege an der Wand«, hatte General Roof in der Nacht vor dem Beginn seiner Mission zu ihm gesagt. »Lernen Sie so viel wie möglich darüber, wie die Dweller arbeiten, und dann, wenn wir sie schließlich angreifen, sabotieren Sie so viele ihrer Verteidigungssysteme wie nur möglich und verschwinden.«
Es waren Befehle mit einer geringen Überlebenswahrscheinlichkeit gewesen, doch Pierce hatte die Herausforderung dennoch gern angenommen, denn er hatte keine Familie und war seines monotonen und bitteren Lebens überdrüssig geworden, das er nach dem Ausbruch der Seuche zu führen gezwungen war. Dies hier sollte ein letztes Abenteuer werden. Ein Abenteuer, das zugleich ein Versprechen auf Größeres barg, sollte er Erfolg haben und wider Erwarten überleben. Pierce kniff wegen eines weiteren grellen Blitzes die Augen zusammen und zitterte aufgrund der ersten eisigen Regentropfen, die seinen Kopf und seine Schultern trafen. Der Sturm kam immer näher.
Die Zeit war zu knapp, um die Leiche so zu entsorgen, dass der Tod des Wachmanns wie ein Unfall aussah. Er musste sie schnell loswerden und ins Lager zurückkehren, bevor er selbst vermisst wurde.
Pierce sah sich aufmerksam in seiner Umgebung um. In der Dunkelheit konnte er nur wenige Fuß weit sehen, abgesehen von den kurzen Momenten, in denen ein Blitz die Umgebung erhellte. Er entschied schließlich, dass dieser Ort so gut wie jeder andere war. Der Schmerz in seinem unteren Rücken hatte an der Entscheidung allerdings ebenso großen Anteil wie sein Gehirn.
Er zog sein Hemd hoch und griff in seine schweiß- und schmutzbefleckte Hose. An seinem Bein festgeschnallt war das Geschenk, das General Roof ihm in besagter Nacht gegeben hatte. Er klappte es auf und drückte nun eine Reihe von Tasten, bevor er das Satellitentelefon an sein Ohr hob. Es dauerte einige Minuten, bis der Satellit sein Signal empfangen hatte. Als die Verbindung stand, hörte er eine Reihe verzerrter Klingeltöne.
Der General antwortete mit einer Stimme, die noch finsterer klang als gewöhnlich. »Es ist zwei Uhr nachts«, waren seine ersten Worte.
Der Regen nahm noch weiter zu. Die Tropfen waren jetzt schwerer und fühlten sich noch eisiger an. Pierce wischte sich das Wasser aus den Augen. »Ich habe ihre Kommunikationszentrale gefunden. Sie arbeiten mit klassischen Funkgeräten. Ich habe die Frequenzen.«
»Her damit«, sagte der General schon deutlich wacher. »Geben Sie sie mir.«
»Vier siebenundsechzig Punkt achtundfünfzig fünfundsiebzig«, antwortete Pierce. »Vier zweiundsechzig achtundfünfzig fünfundsiebzig. Vier vier sechs null null vier sechsundvierzig fünf.«
»Nur so wenige Frequenzen?«
»Soweit ich das mitbekommen habe, ja.«
»Sie müssen also eine Reichweite von ungefähr zwei Meilen haben.«
»Das weiß ich nicht.«
»Und die Geräte funktionieren?«
Pierce hockte sich hin und verlagerte sein Gewicht auf seine Fersen. Er hielt sich eine Hand vor sein Gesicht, um es etwas vor dem Regen zu schützen und versuchte mit der anderen Hand, das Telefon fester an sein Ohr zu pressen. Die Regengeräusche übertönten das Gespräch beinahe. »Wie bitte?«
»Die Geräte funktionieren?«
»Sieht ganz so aus«, sagte Pierce. »Sie haben einen Generator, der die Batterien auflädt.«
Das Signal begann bereits, schwächer zu werden. »Sind Sie schon aufgeflogen?«
Pierce wandte den Windböen, die durch den Canyon fegten, den Rücken zu. »Nein.«
»Sind Sie sicher?«
»Ich musste einen Mann töten«, gab Pierce daraufhin zu. Sein Körper zitterte unwillkürlich vor Kälte.
»Das ändert die Lage.«
»Ich kriege das schon hin«, stammelte Pierce. Seine Zähne klapperten jetzt so heftig, dass sein Kiefer anfing zu schmerzen. Innerhalb von wenigen Sekunden war die Temperatur um gefühlt fünfzehn Grad gefallen. Der Regen prasselte hinab und traf Pierces Hals und Arme mit kalten Stichen.
Die Stimme des Generals hallte ihm digital verzerrt entgegen. »Hallo? Sind Sie noch dran?«
Pierce nahm das Telefon von seinem Ohr und sah auf das Display, doch es zeigte kein Signal mehr an. Er schaltete das Gerät aus, trocknete den Bildschirm mit einem Hemdzipfel und stand dann auf, um es wieder in seine Hose zu stopfen.
»Pierce?«, rief plötzlich eine Stimme hinter ihm.
Pierce fuhr erschrocken herum und gleichzeitig durchfuhr der Hall des in diesem Moment losbrechenden Donners seinen zitternden Körper. Ein Blitz offenbarte ihm eine dunkle Gestalt, die ein paar Fuß von ihm entfernt stand. Pierce konnte die Gesichtszüge des Mannes nicht erkennen, aber er wusste dennoch, wen er vor sich hatte … und er sah auch die Waffe in dessen Hand.
»Was machen Sie hier, Pierce?« Marcus Battle stellte diese Frage, als ob er die Antwort bereits wüsste.
Pierce ballte die Hände zu Fäusten. Er stellte seine Füße schulterbreit auseinander und machte sich bereit für die bevorstehende Konfrontation. »Was denken Sie denn, was ich hier mache?«, fragte er. Der Regen lief ihm in die Augen, während er versuchte, die rechte Hand von Battle im Blick behalten.
»Für das Kartell arbeiten.«
Pierce lachte. »Sie haben die Neuigkeit ja schnell mitbekommen«, sagte er. »Ich arbeite bereits für das Kartell, seit Sie so gnädig waren, mich aus dem Jones-Stadium mitzunehmen. Sie sind also bei Weitem nicht so schlau, wie Sie denken.«
»Sie waren also das Kuckucksei.«
»So in der Art.«
Battle deutete mit seiner Waffe auf den leblosen Körper am Boden. »Haben Sie diesen Dweller hier getötet?«
Pierce nahm den Blick nicht von der Waffe. »So in der Art.«
»Ohne Grund? Einfach so?«
Pierce schauderte vor Kälte. Regenwasser sprühte von seinen Lippen, als er ausspuckte: »Wer zum Teufel sind Sie denn, dass Sie darüber urteilen, welche Seite die richtige und welche die falsche ist? Sie sind doch nicht mehr als ein obdachloser schießwütiger Einzelgänger. Sie …«
Das kehlige Dröhnen des Donners, der durch die Wände aus Gips, Schiefer und Sandstein hallte, verbarg den Schuss aus Battles Neunmillimeter, aber die Patrone drang direkt in Pierces offenen Mund ein und tötete ihn so unmittelbar, dass er sofort zu Boden sackte.
»Ein obdachloser schießwütiger Einzelgänger?«, fragte Battle. Er machte einen Schritt auf die beiden Leichen zu, die auf dem überfluteten Boden des Canyons lagen, und ging in die Hocke. Er sah Pierce intensiv in die Augen. »So in der Art.«
Kapitel 2
Battle warf das Satellitentelefon auf den mit Holz beschlagenen Tisch, der vor Juliana Paagal stand. Es rutschte bis knapp vor die Kante und blieb dann zwischen ihren Ellenbogen liegen. Paagal saß nach vorn gebeugt da, ihr Kinn ruhte auf den Knöcheln ihrer ineinander gefalteten Hände.
Sie war eine Frau mit königlicher Ausstrahlung, die sich ruhig und würdevoll zu bewegen wusste. Ihre tintenschwarzen kurzen Haare verliehen ihr ein jugendliches Aussehen, das über ihr tatsächliches Alter hinwegtäuschte. Ihre kaffeefarbene Haut verschmolz fast mit dem hellbraunen ärmellosen Oberteil, das über ihre schmalen Schultern drapiert war.
Paagal, die Battle gebeten hatte, sie nur mit ihrem Nachnamen anzusprechen, hatte die abgekämpften Reisenden, ohne nachzufragen willkommen geheißen. Sie vertraute dem Urteil von Baadal, der ebenfalls zu den Dwellern gehörte, wie ihrem eigenen.
Sie und Battle waren gerade allein in ihrem großen Zehn-Personen-Zelt. Der Regen trommelte unablässig und ohrenbetäubend gegen die roten Nylonwände. In der Mitte des großen Raums, den Paagal ihr Zuhause nannte, hing eine einsame Lampe. In der Ecke stand ein Bettgestell mit einer unbezogenen Matratze und einem klumpigen Federkissen darauf, in einer anderen ein fadenscheiniges Sofa. Ein orangefarbenes Verlängerungskabel schlängelte sich über den nackten Erdboden und lieferte gerade genug Strom, um die Lampe und eine Kochplatte, die am Rand des Tisches stand, mit Strom zu versorgen.
»Sie hatten also recht«, sagte sie, und ihre eisblauen Augen starrten Battle, ohne zu blinzeln, und ohne den Blick auf das Satellitentelefon zu senken, an. »Er war tatsächlich ein Spion.«
»Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich ihn hierher gebracht habe«, sagte Battle. »Es ist meine Schuld.«
Paagal schüttelte den Kopf und lächelte. Ihre Augen wurden schmal, als sie weitersprach. »Es war nicht Ihre Schuld, Marcus. Ich bin diejenige, die euch gestattet hat, zu bleiben. Die Schuld liegt also ganz bei mir.«
»Er hat eine Ihrer Wachen getötet«, erklärte Battle jetzt. »Ein paar Meilen von hier entfernt in einem Kommunikationsbunker. Ich bin ihm leider nicht nahe genug auf den Fersen gewesen, um ihn daran zu hindern.«
»Ah«, sagte sie, senkte die Arme und nickte. »Das muss Sahaayak gewesen sein. Er war ein guter Helfer. Wir werden seine Güte und seine Seele vermissen.«
Battle nickte in Richtung des Telefons. »Sehen Sie sich das genau an«, sagte er. »Pierce hat es benutzt, um das Kartell anzurufen. Ich vermute mal, er hat ihnen Informationen über euer Funksystem gegeben.«
Das Lächeln verschwand daraufhin aus Paagals Gesicht. »Wo ist Pierce jetzt?«, fragte sie. »Ich kann ihn selbst fragen, was er getan hat. Ich möchte lieber keine Vermutungen anstellen.«
Battle zögerte und biss sich auf die Innenseite seiner Wange. »Er ist tot.«
Paagal hielt sich eine Hand hinter das Ohr und brachte damit unwillkürlich den großen Holzring zum Schwingen, der an ihrem Ohrläppchen hing. »Er ist was?«
Das Geräusch des auf Nylon prasselnden Regens machte es schwierig, das Gespräch fortzusetzen, besonders angesichts der Tatsache, dass Battle gut darauf verzichten konnte.
»Ich habe ihn getötet«, sagte er laut, um das Umgebungsgeräusch zu übertönen.
Paagal nickte. »Ich verstehe.«
»Ich habe ihn erschossen. Er liegt neben Saya…«
Paagal sprach langsam, eine Silbe nach der anderen betonend. »Sa-ha-a-yak.«
»Sahaayak«, wiederholte Battle. »Sie sind vielleicht eine Viertelmeile vom Bunker entfernt.«
»Nun …« Paagal seufzte, »dann spreche ich jetzt mal eine Vermutung aus: Ich gehe davon aus, dass Ihr Leben in Gefahr war und Sie keine andere Wahl hatten, als sich zu verteidigen, denn andernfalls wäre Pierce zu töten eine rücksichtslose und grausame Tat gewesen, die einem Mann, den ich bis jetzt sehr respektiert habe, nicht gut zu Gesicht stehen würde. Sie waren schließlich beim Militär. Sie kennen daher den Wert eines Gefangenen, der Informationen hat, die er freiwillig weitergeben kann … oder auch unfreiwillig. Vor allem angesichts der zusätzlichen Patrouillen des Kartells, die sich in letzter Zeit immer wieder dem Rand des Canyons nähern.«
Battle zog nun einen Stuhl hervor und setzte sich Paagal gegenüber an den Tisch. Er beugte sich vor, seine Unterarme ruhten auf dem rauen Holz. »Mein Leben war nicht in Gefahr. Ich wünschte, ich könnte sagen, es wäre Selbstverteidigung gewesen. Ich glaube, ich habe diesen Mechanismus, meine Impulse zu kontrollieren, einfach schon vor langer Zeit verloren.«
Paagal lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und verschränkte die langen schlanken Arme vor der Brust. Ihr Bizeps bewegte sich, als sie ihre Position änderte. »Ich sollte nicht auf die gleiche Weise über Sie urteilen, wie Sie über Pierce geurteilt haben«, sagte sie mit nur einem Hauch Ironie. »Wir alle lernen zu funktionieren und auf unterschiedliche Art und Weise damit umzugehen. Ihre ist es anscheinend, schon der kleinsten Bedrohung mit einem Angriff zu begegnen. Ich sehe hier einen Mann, der mit seiner eigenen Dunkelheit kämpft. Sie sehen das Licht, sie wollen im Licht leben, aber die Dunkelheit ist angenehmer für Sie, also schlüpfen Sie bei jeder Gelegenheit in ihre Umarmung.«
Battle lachte. »Sie waren in Ihrem früheren Leben bestimmt eine Seelenklempnerin, oder?«
Paagal nickte. Ein Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. »Man könnte sagen, dass ich das immer noch bin«, sagte sie. »Eine Anführerin zu sein erfordert nun mal den effektiven Einsatz von Psychologie.«
Battle runzelte die Stirn. »Und jetzt?«
»Ich denke, diese Frage sollte ich Ihnen stellen«, sagte Paagal. »Sie sind vor einer Woche hier angekommen, Sie haben sich von Ihren Verletzungen erholt und Ihre Frau Lola ist …«
»Sie ist nicht meine Frau«, sagte Battle nachdrücklich.
Paagal zog zweifelnd die Augenbrauen in die Höhe. Sie hob in einer abwehrenden Geste die Hände. »Was auch immer Sie meinen, Ihre Freundin Lola läuft wieder, ohne zu hinken, und auch ihr Sohn scheint wieder gesund zu sein.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Wir haben noch nicht über Ihre Pläne gesprochen«, antwortete sie. »Sie sind so lange unser Gast, wie Sie wollen«, sagte sie jetzt mit leiser werdender Stimme.
»Aber …?«
»Aber«, fuhr sie fort, »uns steht ein Krieg bevor und Sie sind nun mal Soldat.«
»Ich war Soldat.«
»Bloße Semantik, Mr. Battle«, antwortete sie. »Werden Sie uns helfen? Immerhin klopft unser gemeinsamer Feind an unsere Tür.«
Battle kniff die Augen zusammen und rieb sich mit Daumen und Zeigefinger die Nasenwurzel. »Ich will ehrlich zu Ihnen sein«, sagte er. »Ich muss auf die andere Seite des Walls.«
»Der Wall.«
»Der Wall«, wiederholte er. »Lola und Sawyer brauchen einen Neuanfang, so neu wie man ihn in dieser Einöde eben bekommen kann.«
»Und Sie?«
Battle zuckte mit den Schultern. »Ich habe keine Ahnung, was aus mir wird, aber ich muss sie dorthin bringen.«
»Für mich klingt das so, als suchten Sie nach einer Allianz auf Gegenseitigkeit«, sagte Paagal. »Sie helfen uns, wir helfen Ihnen. Ich weiß, dass Baadal mit Ihnen über den Wall und das, was dahinter liegt, gesprochen hat.«
»Er hat mir nicht gesagt, was auf der anderen Seite ist«, erwiderte Battle. »Ich weiß nur, dass das Kartell weder nördlich, östlich noch westlich dieses Walls existiert.«
Juliana Paagal starrte Battle einige Minuten lang an, ohne etwas zu sagen. Battle hatte das Gefühl, als würde sie eine Art psychisches Inventar erstellen und sich ohne Erlaubnis geistige Notizen machen. Er saß da, starrte zurück und versuchte, nicht die kleinste Kleinigkeit preiszugeben.
»Hören Sie zu, Marcus Battle«, sagte sie schließlich. »Sie helfen uns, das Kartell zu besiegen oder sie wenigstens so zu schwächen, dass sie es nicht wagen, uns erneut anzugreifen, dann werden wir Ihnen helfen, Ihren Weg zum Wall und darüber hinaus zu finden.«
Battle schüttelte den Kopf. »Sie können sie nicht besiegen«, sagte er. »Sie sind nicht nur hier aktiv, sie sind überall. In Abilene, Houston, Dallas, San Antonio, Austin und Galveston. Das wissen Sie besser als ich.«
»Dieser Mann, Pierce, der, den Sie hierher gebracht haben, ist nicht der einzige Spion«, erklärte sie. »Auch wir sind in der Lage, den Feind zu infiltrieren.«
»Tatsächlich?« Es war weniger eine Frage als vielmehr ein ironischer Ausdruck seines Zweifels.
»Seit dem Waffenstillstand haben wir Widerstandszellen gebildet«, erklärte sie. »Sie haben inmitten des Kartells gelebt und gearbeitet – in allen von den von Ihnen aufgezählten Städten. Sie haben sorgfältig weitere Verbündete rekrutiert, und sie alle sind bereit, aktiv zu werden, wenn wir ihnen ein Zeichen geben. Wir können das Kartell vernichten! Sie sind genau zur richtigen Zeit gekommen.«
»Oder zur falschen Zeit.« Er seufzte. »Sie sprechen da von einem Krieg.«
Paagal presste die Lippen aufeinander, kratzte sich am linken Bizeps und nickte. »Ich nenne es allerdings lieber einen Aufstand oder eine Revolution.«
»Bloße Semantik«, sagte er.
»Touché.«
»Also sind Sie überzeugt davon, dass Sie das Kartell vernichten können?«
»Wir glauben fest daran«, sagte sie. »Die Zeit dafür ist reif.«
»Nun ja, wenn das Kartell vernichtet ist«, meinte Battle und beugte sich vor, »werde ich Ihre Hilfe nicht mehr brauchen.«
»Doch, das werden Sie«, antwortete sie. »Denn das Kartell ist die größte und niederträchtigste aller organisierten Gruppen, die nach dem Ausbruch der Krankheit aufgetaucht ist. Aber sie ist nicht die einzige. Es gibt Dutzende Banden von Dieben und Mördern, die entlang des Walls leben, sich wie Parasiten von einer Seite zur anderen fressen und sich von denen ernähren, die passieren wollen. Sie werden also unsere Hilfe brauchen.«
Battle lehnte sich zurück und nickte. Er wusste, dass er keine andere Wahl hatte. »Dafür, dass Sie immer betonen, Pazifistin zu sein, sind Sie aber ganz schön begierig darauf, in den Kampf zu ziehen«, stellte Battle fest. »Das macht irgendwie einen scheinheiligen Eindruck auf mich.«
»Ist das so?«, fragte Paagal mit unverändertem Gesichtsausdruck.
»Gewalt ist mein Instrument, weil ich Gewalt mag«, erklärte er. »Auch wenn es mir nicht gefällt, das zuzugeben. Doch dieses Kreuz muss ich nun mal tragen.« Battle wurde bewusst, dass er, schon seit Tagen nicht mehr gebetet hatte. Er war dabei, seine Religion in der Wildnis der ungezähmten Landschaft, die ihn umgab, zu verlieren. Es war nicht so, dass er vergessen hatte, wie es war, zu beten, er hatte nur kein Bedürfnis mehr danach.
»Interessante Selbsterkenntnis«, antwortete Paagal. »Ich würde entgegnen, dass ich Gewalt nur anzuwenden bereit bin, wenn Gewaltlosigkeit bedeutet, die Lösung eines Problems weiter aufzuschieben.«
»Sie zitieren gerade Malcolm X, oder?«, fragte Battle.
Ein Grinsen huschte über Paagals Gesicht, wobei ihre wundersam weißen Zähne im rötlichen Licht des Zeltinneren förmlich leuchteten. »Sei friedlich, sei höflich, befolge das Gesetz, respektiere alle; aber wenn jemand Hand an dich legt, dann schicke ihn auf den Friedhof«, sagte sie. »Und zwar mit allen Mitteln.«
Kapitel 3
Ana Montes war spät dran. Sie eilte die kaputte Rolltreppe hinunter und glitt mit der rechten Hand über das Gummigeländer, während sie in die Dunkelheit hinabstieg. Ihre Schuhe klapperten über die Aluminiumstufen. Selbst in der Dunkelheit des unterirdischen Tunnels wusste sie genau, wo sie war und wo sich ihr Ziel befand. Zwanzig Fuß unterhalb der Überreste der Innenstadt von Houston, Texas, stieg Ana von der Rolltreppe und ging fünfzehn Schritte geradeaus, bevor sie sich um neunzig Grad drehte und nach rechts abbog. Ihre Schritte hallten an den Wänden des sechs Meilen langen Tunnelsystems wider. Ein weiteres Mal bog sie neunzig Grad nach rechts ab.
Sie konnte jetzt die gedämpften Stimmen der anderen hören. Sie hatten also offensichtlich ohne sie angefangen. Sie holte tief Luft und betrat den Raum. Im Licht der LED-Taschenlampen waren die Gesichter von einem Dutzend Männer und Frauen zu sehen, die sich um eine Karte auf einem Tisch drängten. Alle sahen zu ihr auf, als sie den Raum betrat.
»Du bist zu spät«, knurrte der Mann in der Mitte der Gruppe. »Wir mussten deshalb ohne dich anfangen.«
»Ich habe es leider nicht eher geschafft, mich loszueisen«, erwiderte sie außer Atem und nahm ihren Platz am Tisch ein. Von ihrem Blickwinkel aus lag die Karte auf dem Kopf. Sie stand also gegenüber von dem Mann, der hier das Sagen hatte.
Er hieß Sidney Reilly. Aber alle nannten ihn Sid. Er war derjenige, der die meisten von ihnen rekrutiert und dazu gebracht hatte, sich dem Widerstand der Dweller anzuschließen.
Sein Blick blieb auf Ana gerichtet, als er weitersprach. »Wie ich schon sagte«, schnaubte er, »wir sind kurz davor. In ein oder zwei Tagen ist es soweit. Unsere Aufgabe ist es …«
»So bald schon?«, unterbrach ihn Ana. »In ein oder zwei Tagen bereits? Ich denke nicht …«
Sid kniff die Augen zusammen. Die Schatten, die das Licht der Taschenlampen warfen, vertieften seine gerunzelte Stirn. »Ich habe nicht danach gefragt, was du denkst. Wir beginnen, wenn wir beginnen. Entweder du bist dabei, oder du bist es nicht, Ana.«
Ana wich vom Tisch zurück und versuchte das brennende Gefühl zu lindern, das zwei Dutzend sie wütend anstarrende Augen in ihr auslösten. Sie nickte und biss sich auf die Unterlippe. »Ich bin dabei.«
Sid nickte und setzte das Briefing fort, doch Ana hörte nicht mehr zu. Sie sah die Männer und Frauen an, die sie umgaben. Einen nach dem anderen hatte Sid davon überzeugt, dass die Herrschaft des Kartells sich dem Ende zuneigte. Alles, was es brauchte, waren genügend Menschen, die den Aufstand wagten. Diejenigen, die jetzt um den Tisch herumstanden, hatten ihm seine Version der Zukunft abgekauft.
Jeder von ihnen hatte anschließend eine eigene Gruppe rekrutiert. Diejenigen wiederum rekrutierten nun ihrerseits neue Gruppen. Es war eine schnell wachsende Revolution, die wie das Schneeballsystem eines Multilevel-Marketing-Unternehmens organisiert war. Das System vieler kleiner Zellen bot außerdem eine gewisse Chance, dass sich der Schaden begrenzen ließ, sollte eine einzelne Zelle tatsächlich vom Kartell entdeckt werden.
Sid schätzte, dass ihnen insgesamt bis zu fünftausend Menschen angehörten. Sie alle wussten, dass das verdammt wenig war im Vergleich zu den Anhängern des Kartells, aber unter den richtigen Umständen waren sie dennoch stark genug, um den Despoten, die momentan über ihre Städte herrschten, verheerende Schläge zu versetzen.
Neben Sid stand Nancy Wake. Sie arbeitete als Buchhalterin für das Kartell. Damit hatte sie Zugang zu all ihren Depots und wusste genau, wie es um ihre Vorräte bestellt war und über welche Bestände von illegalen Drogen, Waffen und Transportmitteln sie verfügten. Ihr Ehemann Wendell war der desillusionierte Kartell-Boss einer kleineren Gruppe. Nancy und Wendell waren am tiefsten von allen in die Struktur des Kartells in Houston eingedrungen.
Die anderen an dem Tisch waren eine Mischung aus Arbeitern, urbanen Farmern und Geschäftsleuten. Sie vereinten daher eine Vielzahl von Fähigkeiten und Kenntnissen, die die Revolutionäre benötigen würden, um überhaupt eine Chance auf Erfolg zu haben, wenn die Zeit reif war. Die Zeit reifte allerdings gerade schneller, als Ana Montes lieb war.
Ana sah auf die Karte von Texas. Sie war mit sich kreuzenden blauen und roten Linien überzogen. Pfeile kennzeichneten die Richtung von geplanten Vorstößen. Große und kleine Kreise zeigten die zahlenmäßige Stärke der Revolutionäre an den verschiedenen Orten an. Unmittelbar vor Ana, in einem Gebiet in der Nähe von Amarillo, war der Palo Duro Canyon mit fluoreszierendem Gelb hervorgehoben worden.
Das alles wurde ihr viel zu viel. Sie hatte sich der Bewegung ursprünglich mit der Überzeugung angeschlossen, dass der Aufstand gegen das Kartell ein nebulöser Wunschtraum war, der wahrscheinlich niemals Wirklichkeit werden würde. Sie hatte damals eingewilligt, Dinge zu tun, von denen sie nie gedacht hätte, dass sie diese tatsächlich einmal würde tun müssen. Doch jetzt hatte sie die brutale Realität der bevorstehenden Aktionen vor Augen. Ihr Puls beschleunigte sich, ihre Knie fühlten sich wie aus Gummi an, und Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn und ihrer Oberlippe.
»Alles okay bei dir, Ana?«, fragte Nancy Wake und unterbrach damit Sids Ausführungen. »Du siehst gar nicht gut aus.«
Ana lehnte sich an den Tisch, stützte sich mit den Ellenbogen ab und nickte. Sie spürte, wie sich alle Blicke erneut auf sie richteten. »Mir geht es gut«, sagte sie. »Ich …«
Nancys Augen wurden schmal. »Was ist los?«
Ana atmete tief ein und aus und wischte sich mit dem Handrücken über die Oberlippe. »Ich … das ist doch reiner Selbstmord, oder nicht? Ich verstehe nicht, wie wir sie schlagen könnten. Es sind einfach zu viele, und sie haben viel zu viele Waffen.«
»Was willst du damit sagen?«, fragte Sid und legte den Kopf schief. Einige murmelten besorgt. Sie teilten Anas Zweifel offenbar. Sid hob energisch die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen.
»Ich fürchte, sie werden uns abschlachten«, gab sie zu. »Ich möchte nicht sterben oder als Sklave enden.«
Sid lachte herablassend. »Sklaven sind wir doch schon längst, Ana. Das Kartell bestimmt bereits die meisten Aspekte unseres Lebens. Wir haben uns diese Menschen schließlich nicht als unsere Herrscher ausgesucht.«
»Sie haben uns unsere Freiheit genommen«, ergänzte Nancy. »Sie haben uns belogen. Wir haben geglaubt, sie würden für Sicherheit und die notwendigen Strukturen sorgen, die wir zum Überleben brauchen, doch dann haben sie uns unsere Rechte genommen, eins nach dem anderen. Sie herrschen nun über uns, als wären wir ihre Knechte. Ich kann so nicht mehr leben. Lieber sterbe ich im Kampf!«
Viele der Umstehenden nickten zustimmend. Einige bezweifelten sogar Anas Loyalität und stellten die Frage, ob man ihr überhaupt noch vertrauen könnte. Sid brachte sie alle erneut zum Schweigen.
»Du kanntest die Gefahren, als ich dich für unsere Sache gewonnen habe«, sagte er. »Du wusstest, dass das Endspiel irgendwann kommen würde. Du hast deiner Aufgabe zugestimmt … deiner für uns überlebenswichtigen Aufgabe. Nichts davon kam überraschend.«
»Ja, du hast recht.« Sie blickte auf die Karte hinab und verfolgte ausdruckslos die farbigen Linien. »Ich bin auch nicht überrascht. Ich habe einfach nur Angst.« Sie blickte auf und Tränen rannen ihr über das Gesicht.
Als Ana sich bereit erklärt hatte mitzumachen, hatte sie noch keinen Grund gehabt, den Tod zu fürchten, denn da war sie noch keine Mutter gewesen. Doch jetzt hatte sie eine neun Monate alte Tochter. Was würde aus ihrem Kind werden, wenn sie starb? Wer würde sie großziehen? Was für eine Frau würde aus ihrer Tochter werden, falls sie überhaupt überlebte?
Nancy sprach leise. »Wir alle haben Angst, Ana, aber ich habe mehr Angst davor, was mit uns passieren wird, wenn wir nichts tun. Unsere Zukunft ist vielleicht ungewiss, wenn wir handeln, aber unsere Zukunft ist sehr düster, wenn wir es nicht tun.«
Ana schluckte und spürte einen dicken Knoten in ihrem Hals. Nancy hatte recht und auch Sid hatte recht. Sie mussten handeln. Sie mussten kämpfen. Sie mussten das Kartell besiegen.
Kapitel 4
General Roof saß auf der Bettkante und starrte aus dem großen Panoramafenster seines derzeitigen Zuhauses. Es zeigte nach Osten und jeden Morgen, wenn die Sonne aufging, riss ihn das hellorange Licht, das sein Zimmer erfüllte, aus dem Schlaf.
Heute Morgen jedoch hatte er auf die Sonne gewartet, denn seit seinem Telefonat mit Pierce hatte er nicht mehr schlafen können. Der Spion hatte ihm wertvolle Informationen geliefert, die er seitdem immer wieder in seinem Kopf abspielte, als würde er Schafe zählen, die über einen Zaun springen. Es hätte ihm helfen sollen, sich zu entspannen und die dringend benötigte Ruhe zu finden.
Doch stattdessen musste er an den Mann denken, den Pierce getötet hatte. Es war ein bedauerlicher Fehler gewesen, der Pierces Untergang bedeuten würde. Der Anruf über Satellit war wahrscheinlich sein letztes Lebenszeichen gewesen. Die Dweller waren nicht dumm. Sie würden eins und eins zusammenzählen und Pierce anschließend auf die eine oder andere Weise ein ungemütliches Ende bereiten.
Roof rieb sich die Augen und setzte die Füße langsam auf den kalten Betonboden. Vorsichtig belastete er sein krankes Bein und spürte sofort den dumpfen, vertrauten Schmerz, der ihn so ungelenk hinken ließ. Aufmerksam verglich er seine beiden Beine. Das eine war muskulös und gesund. Es war behaart, so wie es das Bein eines Mannes sein sollte, und die Haut war von gleichmäßiger Farbe. Das andere war deutlich dünner und sah schon äußerlich krank aus. Unterhalb des Knies waren große rosafarbene Flecken, so leuchtend und unbehaart wie die Füße eines Neugeborenen. Die Flecken transplantierter Haut, die nun für immer sein Bein schmückten, sahen aus wie eine Ansammlung ehemaliger Sowjetstaaten.
Es verging kein Tag, an dem Roof nicht daran zurückdachte, wie sein Bein verstümmelt worden war. Wie in Technicolor hatte es sein Gedächtnis für immer gespeichert. Jener Tag hatte sich als der Tag herausgestellt, der sein Leben am nachhaltigsten bestimmen sollte. Einer seiner Kameraden hatte sich geopfert und sein eigenes Leben für ihn riskiert. Die Selbstlosigkeit dieses Handelns hätte Roof nach seiner Rückkehr aus Syrien eigentlich auf einen anderen Weg bringen müssen. Er hätte seine Schulden gegenüber dem Schicksal zurückzahlen und anderen dabei helfen sollen, zu überleben. Doch stattdessen hatte ihn das Schuldgefühl verzehrt. Er konnte es an keiner passenden Stelle in sein Leben einsortieren, dass ausgerechnet er die selbst gebaute Bombe und den Hinterhalt, in dem vier Männer getötet worden waren, überlebt hatte. Roof, der schon zuvor über weite Strecken seines Erwachsenenlebens Drogen und Alkohol konsumiert hatte, war daraufhin kopfüber in die Sucht getaucht. Immer wieder war er in Veteranen-Krankenhäusern und Obdachlosenunterkünften gewesen, und immer wieder war er aus ihnen geflohen.
Letzten Endes war er in Houston gelandet und hatte dort Hilfe in einem Heim gefunden, in dem sie Existenzen wie ihn wieder zu normalen Menschen machen wollten. Sie hatten ihm geholfen, von den Drogen und dem Alkohol loszukommen, ihm kaufmännische Fähigkeiten beigebracht und ihn mit neuem Selbstvertrauen auf den Weg geschickt.
Leider hatte sich herausgestellt, dass ein humpelnder, abstinenter Drogen- und Alkoholabhängiger nicht sonderlich weit oben auf der Wunschliste personalsuchender Arbeitgeber stand. Also hatte Roof dort gearbeitet, wo er Arbeit gefunden hatte, und war so irgendwann in die kriminelle Unterwelt von Bayou City abgerutscht. Er hatte mit Drogen und Frauen gehandelt und sich schnell einen Namen als skrupelloser Lieferant von illegalen Waren und minderjährigem Fleisch gemacht. Rasch war er in der Stadt, die als Highway für den illegalen Handel von Lateinamerika in die Vereinigten Staaten bekannt war, an die Spitze aufgestiegen.
Seine Hundemarke vom Militär hatte er stets gut sichtbar über seinen hautengen T-Shirts getragen, was ihm schließlich den Kampfnamen General eingebracht hatte. Seine Vorliebe, ahnungslose Frauen unter Drogen zu setzen, und sein wirklicher Vorname Rufus hatten einige dazu gebracht, ihn schließlich Roofie zu nennen. Er hatte den Namen gekürzt, die beiden Spitznamen kombiniert und schließlich bestimmt, dass er von nun an mit General Roof anzureden war. Seine Lebenskraft wuchs und der sich um ihn herum entwickelnde Personenkult zog ihn unwiderstehlich in seinen Bann.
Der Ausbruch der Seuche war schließlich seine Befreiung gewesen. Er war aus den Schatten aufgetaucht, hatte sich mit früheren Konkurrenten zusammengetan und nach monatelanger Arbeit unterschiedliche Banden zu einem Kartell geformt. Er hatte zugestimmt, die Macht mit zwei anderen Männern zu teilen, aber sie wussten genau, dass er der Mächtigste des Triumvirats war. Er war so furchtlos wie Pablo Emilio Escobar Gaviria und Jorge Luis Ochoa Vásquez, die beiden Männer, die ein halbes Jahrhundert zuvor das Medellín-Kartell gegründet hatten, und er hatte sich schnell den Ruf erarbeitet, ebenso rücksichtslos zu sein wie die aus El Salvador stammende Mara-Salvatrucha-Bande, die in den frühen Jahren des einundzwanzigsten Jahrhunderts Mittelamerika verwüstet und sich bis in den Südwesten der Vereinigten Staaten verbreitet hatte.
Durch rohe Gewalt und schieren Willen hatte sich General Roof bei einem Treffen mit den Bossen der Sureños, dem Sinaloa-Kartell, dem Golfkartell, der Familia Michoacana, der mexikanischen Mafia, der Yakuza und Los Zetas durchgesetzt. Es hatte dabei nicht geschadet, dass seine Mutter aus Panama stammte und Spanisch daher seine zweite Muttersprache war.
So mächtig sie auch geworden waren, so sehr sie die überlebende Bevölkerung durch Angst und Terror beherrschten, und trotz der Tatsache, dass sie die Regierung aus ihrem neuen Territorium vertrieben hatten – Roof beschlich immer wieder das eigenartige Gefühl, minderwertig zu sein. Vielleicht lag es an der ständigen Mahnung, die ihm seine äußeren Wunden jeden Morgen bescherten. Vielleicht waren es auch eher die inneren Verletzungen, allen voran die Wahrheit, dass ein besserer Mann als er sein Leben gerettet und er dennoch beschlossen hatte, dieses Geschenk auf dem einfacheren, dunkleren Weg zu verschwenden.
Er rieb sich mit den Handflächen die Oberschenkel und zwang sich, aufzustehen. Roof balancierte einen Moment auf den Fersen, bevor er sein Gewicht komplett auf die Zehenspitzen verlagerte. Er trat ans Fenster. Über dem flachen Horizont des südlichen Endes des Llano Estacado ging gerade die Sonne auf. Er biss sich auf die Unterlippe und dachte darüber nach, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, Marcus Battle am Leben zu lassen. Gegenüber dem Kobold auf seiner Schulter konnte er es ja ruhig zugeben. Er hatte es in einem Moment der Schwäche getan. Er hatte es als eine Art Ausgleich betrachtet. Er verschonte ein Leben, weil ein anderes gerettet worden war. Aber darüber hinaus war es wahrscheinlich ein fataler Fehler gewesen.
Denn so herzlos er auch geworden war, seit er den Drogen und dem Alkohol abgeschworen hatte, war er doch nie so unnachgiebig und unerbittlich gewesen wie Marcus Battle. In diesem Augenblick wurde ihm das schmerzlich bewusst. Ein Schauer lief ihm über den Nacken und er zitterte. Er nahm ein Gummiband von seinem Handgelenk und fixierte damit sein Haar zu einem drahtigen, schulterlangen Pferdeschwanz.
Dann kratzte Roof sich an seinem dichten Bart und wandte sich vom Fenster ab. Seine Füße schlurften über den Betonboden, als er sich zu seiner Kleidung bewegte, die über der Rückenlehne des Schreibtischstuhls hing. Er hatte gerade Hose und Unterhemd angezogen, als es laut an der Tür klopfte.
»Einen Moment noch«, rief er und schob einen Arm in das langärmelige karierte Baumwollhemd. Er ging zur Tür und spähte durch das Guckloch. Es war Cyrus Skinner.
Roof schloss die letzten Perlmuttknöpfe an seinem Hemd und öffnete die Tür. Skinner nahm seinen weißen Hut ab und hielt ihn vor seine Brust.
»Es tut mir leid, dass ich Sie so früh stören muss, General«, sagte er und betrat den Raum. »Aber ich wollte Ihnen nur kurz ein taktisches Update geben.«
»Kein Problem«, sagte Roof. »Ich war ohnehin schon wach. Ich habe heute Nacht um zwei Uhr einen Anruf von Pierce erhalten.« Er sah auf die Uhr neben seinem Bett. Sie blinkte. Der Strom war also zwischendurch ausgefallen und inzwischen wieder da.
»Der Spion?«
Roof humpelte zu seinem Stuhl zurück, um seine Stiefel zu holen. »Ja.«
»Und was wollte er?«
»Er hatte nützliche Informationen für uns«, sagte Roof. »Er hat ihren Kommunikationsbunker gefunden und mir ihre Frequenzen übermittelt.«
»Und wir wissen schon jede Menge über ihre Sicherheitsvorkehrungen, ihre Waffen und die Positionen der Männer am Rand des Canyons«, sagte Skinner. Eine noch nicht angezündete Zigarette hüpfte zwischen seinen Lippen auf und ab, während er sprach. »Sie waren ein Genie, das so einzufädeln. Ich muss sagen, General, ich hatte ja zuerst meine Zweifel, aber Sie hatten recht.«
Roof ließ sich auf den Stuhl fallen und zuckte zusammen, als er den schlimmen Fuß in einen der Stiefel schob. »Vielleicht.«
»Was meinen Sie damit?«
Roof holte tief Luft, bevor er den anderen Stiefel anzog. »Er hat dabei einen Dweller getötet.«
Skinner zuckte mit den Schultern. »Na und?«, fragte er und verschränkte die Arme vor der Brust. »Seit wann ist es denn ein Problem, jemanden umzubringen?«
Roof lachte. »Damit habe ich in der Tat kein Problem«, erwiderte er. »Ich wäre bestimmt nicht da, wo ich jetzt bin, wenn das der Fall wäre. In den meisten Fällen halte ich eine schöne spontane Hinrichtung sogar für den besten Weg, Ordnung und Kontrolle aufrechtzuerhalten. Aber nicht dieses Mal. Mit dem Tod dieses Dwellers hat sich Pierce selbst enttarnt. Er ist nun erledigt dort.«
»Damit verlieren wir also unsere Augen und Ohren im Canyon«, begriff Skinner.
»Ja, die Sache beschleunigt unseren Zeitplan«, erwiderte Roof und stand auf. »Seine Informationen werden in Kürze wertlos sein. Wie schnell können wir zuschlagen?«
Skinner nahm die Zigarette zwischen zwei Finger und zupfte sie von seinen trockenen Lippen. Er benutzte sie als Zeigestock, während er sprach. »Deshalb habe ich so früh an Ihre Tür geklopft«, erklärte er. »Ich wollte Sie wissen lassen, dass wir früher fertig geworden sind als geplant. Ich habe Soldaten und Bosse, die sich momentan von überall her dem Canyon nähern. Die Männer aus San Antonio sind auch schon unterwegs. Wir können in anderthalb Tagen angreifen, maximal in zwei. Wir werden die Dweller ein für alle Mal fertigmachen.«
»Sehr gut«, sagte General Roof, »sorgen Sie dafür.«
Kapitel 5
Kurz bevor er den Garten erreichte, hielt Battle inne und lehnte sich gegen eine Schwarzpappel. Lola pflückte gerade Gurken von großgewachsenen Ranken und ließ sie in einen Korb fallen, den sie in der Armbeuge trug.
Der nächtliche Sturm war vorbei und hatte einen klaren Himmel und frische Windböen hinterlassen, die sich durch das Tal kräuselten. Battle zitterte vor Kälte und steckte die Hände tief in die Hosentaschen. Der Garten beeindruckte ihn immer noch. Er maß ungefähr einen viertel Acre und wurde mit großzügig verlegten PVC-Rohren und Tropfschläuchen bewässert, die von einer Metallzisterne am Rand des Grundstücks gespeist wurden. Der Regen aus der Nacht zuvor war ein Geschenk Gottes.
Die Herbstfrüchte waren reif und bereit, geerntet zu werden, und Lola hatte sich freiwillig gemeldet, um zu helfen. Sie arbeitete mit drei Dwellern zusammen. Konzentriert durchkämmten sie die Ranken und Stiele. Sawyer folgte ihnen und hielt nach Gurken Ausschau, die sie möglicherweise übersehen hatten.
In Lolas Augen strahlte eine Helligkeit, die Battle noch nie zuvor gesehen hatte. Sie schien glücklich zu sein. Ihr Hinken war verschwunden und das helle Sonnenlicht brachte ihr rotes Haar zum Leuchten. Battles Blick wurde geradezu magnetisch von ihr angezogen.
Du solltest ihr sagen, was du denkst, flüsterte Sylvias Stimme. Es wäre bestimmt gut für dich.
Battle schloss die Augen und atmete tief ein und aus. Ich sage ihr gar nichts, antwortete er der Stimme in seinem Kopf. Er schob die Kieferknochen nach vorn, seine Schultern spannten sich.
Doch Sylvia gab nicht nach. Ich habe es dir gesagt, flüsterte sie, und ihre Stimme erfüllte seinen Kopf. Du brauchst jemanden. Sonst verlierst du dich.
Ich habe mich schon längst verloren. Letzte Nacht habe ich einen unbewaffneten Mann ohne guten Grund getötet. Ich bete nicht mehr, nicht um mich, nicht um irgendjemanden. Mein Glaube …
Mein Glaube an dich ist so stark wie immer, sagte Sylvia, und eine weitere Stimme mischte sich in das Gespräch ein.
Meiner auch. Das war Wesson. Dad, sagte er, sie hat einen Sohn. Er braucht einen Mann wie dich, der ihm hilft. Er hat doch sonst keinen Vater, der ihm etwas beibringen könnte.
Battle zitterte erneut. Dieses Mal war nicht die kalte Brise, die durch das Tal wehte, dafür verantwortlich, es war die Stimme seines Sohnes, die er so klar hörte, als würde Wes genau vor ihm stehen und mit seinen winzigen Armen seine Beine umschlingen. Battle konnte sogar das Baby-Shampoo im Wind riechen.
Seine Lippen formten ein unerwartetes Schmunzeln, als er daran zurückdachte, wie Sylvia immer darauf bestanden hatte, dass Wes das Baby-Shampoo nahm, obwohl er stets lautstark dagegen protestierte. Doch sie hatte ihm erklärt, es sei viel gesünder als die anderen, mit Chemikalien überladenen Shampoos. Wes und Marcus hatten gewusst, dass es einfach nur ihre Art und Weise gewesen war, die Kindheit ihres einzigen Sohnes noch ein wenig zu verlängern.
Battle kicherte leise und lehnte sich mit der Schulter gegen den Stamm der Schwarzpappel. Seine Augen waren in die neblige Ferne gerichtet. Du hast das Shampoo zwar gehasst, sagte er, aber der Geruch war wirklich toll.
Eine dritte Stimme mischte sich jetzt in das Gespräch in seinem Kopf ein. »Marcus?« Es war eine Frauenstimme. »Marcus Battle? Geht es dir gut?«
Battle schüttelte sich kurz, die Erinnerungen verstoben und machten wieder dem Hier und Jetzt Platz. Lola stand direkt vor ihm und kniff besorgt die Augen zusammen.
Er räusperte sich. »Äh, na klar«, sagte er und blinzelte, bis er Lola scharf sehen konnte. »Alles prima. Wieso?« Er stellte sich aufrecht hin und verschränkte die Arme vor der Brust.
Lola machte einen halben Schritt auf ihn zu und wechselte dabei den Korb auf den anderen Arm. »Du hast schon wieder diese merkwürdige Sache gemacht«, sagte sie leise. »Du warst in einer vollkommen anderen Welt.«
Battle schaute auf seine Stiefel, die von dem roten Schlamm des Canyons verkrustet waren. Sein Gesicht rötete sich. Er zuckte zusammen, als sie ihre Hand auf seinen Arm legte und ihn sanft drückte. »Es ist schon okay«, sagte sie. »Mich stört es nicht, aber die anderen haben dich komisch angesehen, und ich möchte nicht, dass sie dich komisch ansehen.«
Battle blickte über Lolas Schulter nach vorn. Die anderen hatten sich nun wieder ihren Aufgaben zugewandt. Nur Sawyer starrte ihn an. Battle lächelte den Jungen vorsichtig an und bemerkte dann, wie Lola ihn aufmerksam musterte.
»Es ist mir egal, was sie denken«, sagte er. »Wir werden sowieso nicht mehr lange hier sein.«
Lola trat zurück und verlagerte das Gewicht des Korbs, den sie nun auf ihre Hüfte gestützt trug. »Werden wir nicht? Was weißt du? Was hast du uns noch nicht gesagt?« Sie blickte über ihre Schulter hinweg zu den Dwellern und wieder zurück zu Battle.
»Der Krieg steht jetzt unmittelbar bevor«, entgegnete er leise. »Die Dweller sind bereit, zu kämpfen, und ich bin mir sehr sicher, dass das auch für das Kartell gilt.«
Lola blickte ihn durchdringend an. »Woher weißt du das?«
»Es gibt deutliche Anzeichen«, erklärte Battle. »Paagal ist bereit, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um das Kartell zu vernichten. Sie hat in jeder größeren Stadt Spione, die jeden Moment angreifen könnten.«
»Und was ist mit dem Kartell?«, fragte sie und suchte in seinem Gesicht nach einer Antwort. »Woher willst du wissen, wie ihre Pläne aussehen?«
Battle kratzte sich an der Stirn. »Charlie Pierce war einer von ihnen«, sagte er. »Er hat ihnen die ganze Zeit über Informationen geliefert. Letzte Nacht hat er einen Dweller getötet, woraufhin ich ihn ebenfalls umgebracht habe.«
Lolas Mund klappte auf, ihre Arme fielen herunter und der Korb stürzte zu Boden. Die Gurken rollten durch den roten Staub. »Pierce?« Tränen sammelten sich in ihren Augen. Ihre Lippen zitterten. »Wir können nicht entkommen. Egal wohin wir auch gehen. Wir können niemals entkommen.«
Battle wollte seine Arme um sie legen. Er wollte sie trösten und ihr versprechen, dass eine Flucht möglich war … dass sie einen Ort außerhalb der Reichweite des Kartells finden würden … einen Ort, zu dem das Böse keinen Zutritt hatte, das die Welt in seinen Fängen hielt. Er bemühte sich, auf Sylvia und Wesson zu hören und seinem immer stärker wachsenden Bedürfnis nach menschlichem Kontakt und nach einer emotionalen Verbindung, nachzugeben.
Doch stattdessen rückte er jetzt die SIG Sauer in seinem Hosenbund zurecht. »Wir haben zwei Optionen«, erklärte er und kniete sich hin, um die Gurken wieder in den Korb zu legen.
Lola biss sich auf die Unterlippe, während sie sich bückte, um ihm zu helfen. Sie zog den Korb zu sich.
Er warf drei Gurken auf einmal in den Korb und hob dann den Zeigefinger. »Wir können jetzt sofort aufbrechen«, sagte er. »Du, Sawyer und ich. Wir finden schon einen Weg zum Wall und auf die andere Seite.«
»Oder?«
Er hielt Zeige- und Mittelfinger nach oben. »Wir bleiben hier und kämpfen. Wir schlagen das Kartell zurück, und danach hilft Paagal uns, auf die andere Seite zu gelangen.«
Sie standen nun beide auf. Lola wischte sich mit dem Handrücken über die Augen und verschränkte die Arme vor der Brust. Dabei hielt sie den Mund fest geschlossen und kaute auf der Innenseite ihrer Unterlippe.
»Paagal sagt, dass gerade Plünderer das Gebiet am Wall unsicher machen«, fügte Battle hinzu. »Wir könnten ihre Hilfe wahrscheinlich gut gebrauchen.«
Lola holte tief Luft und presste sie dann mit aufgeblasenen Wangen wieder heraus. Es schien so, als wolle sie die Luft aus ihrem ganzen Körper ablassen. »Wir müssen kämpfen«, sagte sie. »Diese Menschen haben uns geholfen. Wir kämpfen, dann gehen wir.«
Battle neigte überrascht den Kopf zur Seite, zog seine Schultern nach hinten und richtete sich auf. Ihre Entschlossenheit gefiel ihm. Sie war nicht mehr länger die besiegte Frau, die er vor dreizehn Tagen kennengelernt hatte.
»Einverstanden«, antwortete Battle. »Wir kämpfen, und dann machen wir uns auf den Weg zum Wall.«
»Was ist denn auf der anderen Seite des Walls?« Sawyer hatte sich unbemerkt an sie herangeschlichen.
»Das ist eine wirklich gute Frage«, erwiderte Battle. »Ganz ehrlich … ich weiß es nicht.«
Sawyer nahm seiner Mutter den Korb ab. »Was, wenn es dort schlimmer ist als auf dieser Seite des Walls?«, fragte er. »Was, wenn wir es hier besser hätten als dort?«
Lola schnaubte. »Ich weiß nicht, was noch schlimmer sein könnte, als unter der Knute des Kartells dahinzuvegetieren«, stieß sie bitter hervor. Ihre Augen blitzten vor Wut, bevor sie sich mit Traurigkeit füllten. »Du weißt, was ich tun musste, damit wir am Leben bleiben.«
Sawyer zuckte zusammen und machte unwillkürlich einen Schritt zurück. Offenbar war er überrascht von ihrer heftigen Reaktion. »Ich habe doch nur gesagt …«
»Wir wissen, was du meinst«, sagte Battle leise. »Deine Frage ist auch durchaus berechtigt, Sawyer. Wir könnten vom sprichwörtlichen Regen in die Traufe kommen. Aber hier können wir auch kein gutes Leben führen.«
Sawyers Blick wanderte zwischen seiner Mutter und Battle hin und her. »Warum nicht?«
Battle hatte keine Antwort darauf. Er hatte keine Ahnung, wie er einem Dreizehnjährigen erklären sollte, warum sie nicht bei den Dwellern im Canyon bleiben konnten. Aber er wusste instinktiv, dass dies nicht der richtige Ort für sie war.