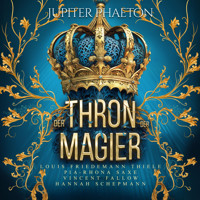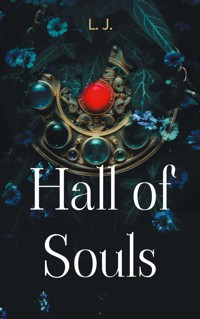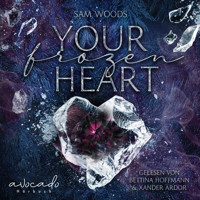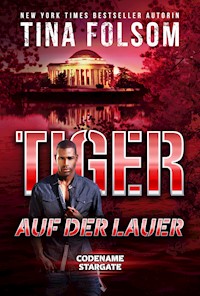Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kampf gegen die Xenlar
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die lebendige Adelsrepublik Montzien wird von den Xenlar unterwandert, einem archaischen Feind aus einer anderen Welt, und in die Diktatur getrieben. Sentry de Bonbaille, ein junger Buchhalter, Adliger und Lord der Energien, der nach einer Denunziation durch seinen brutalen Bruder verschleppt worden ist, muss seine übermenschliche Seite annehmen, um zu überleben. Auf seiner Flucht in die Freiheit findet er Gleichgesinnte – Frauen und Männer, Telepathen und Symbionten aus unterschiedlichen Kulturen – die für den Widerstand kämpfen. Nur gemeinsam haben sie eine Chance, das parasitäre Kollektiv hinter die Schranken von Raum und Zeit zurückzudrängen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Kampf gegen die Xenlar
Band 1 – Die Bedrohung
S. P. Dwersteg
Impressum
Deutsche Erstausgabe Copyright Gesamtausgabe © 2023 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2023) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-802-7
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
Inhaltsverzeichnis
Shift
Shift. Flirren … Mir ist etwas schwindlig. Shift ist mehr als nur übel, aber heute muss es mich retten. Es ist die einzige Hoffnung, die mir noch bleibt, und das ist besser als nichts. Es muss Wochen oder Monate her sein, dass sie mich eingesperrt haben – in die Kälte, Dunkelheit und Enge. Die Wände um mich stehen unter Spannung, doch das wird gleich vorbei sein. Ich sehe Verdoppelungen, ich spüre Verschiebungen. Mal sind zwei Wirklichkeiten da, mal eine, dann zwei. Es ist verwirrend, immer aufs Neue, aber auch das kenne ich längst. Alles muss ich aufnehmen, weil es in wenigen Minuten sein wird, als wäre nichts passiert. Jeder Prozess umfasst eine kurze, entscheidende Zeitspanne, in der sich eine neue, veränderte Welt wie eine Kontinentalplatte über das Gegenwärtige schiebt, das unter ihr versinkt.
In den Verließen nennen sie mich den Merker, als wären mein Name und meine ganze Existenz in der Außenwelt zurückgeblieben. Die Wachmänner halten mich für irre. Sie lachen über mich, und doch weiß ich, dass unsere Wirklichkeit angegriffen wird. Shift zielt auf die Köpfe der Menschen, Gedanken und Gefühle verändern sich. Manchmal sogar Materie, aber ob das gewollt ist? Erinnerungen werden blockiert und umgeschrieben, und mit jedem Shift schreitet es fort wie eine sich ausbreitende, geistige Krankheit. In einer Kaskade werden Menschen versklavt, Stück für Stück. Viele haben sich dem Usurpator längst überlassen und sind Teil seines Systems geworden, andere befinden sich auf dem Weg. Doch wer lenkt es? Was steht dahinter? Es sind zu viele Zufälle. Dieser Angriff wurde von langer Hand geplant.
Dunkelheit und Hunger machen mich krank, und von dem Dreck hier unten mag ich nicht reden. Das Alleinsein ist schlimm. Leise! Ich horche in die Schatten – das ist etwas, was ich tun kann. Angespannt folge ich den Geräuschen der Wächter mit den Ohren. »Keinen Mucks, Merker!«, ermahne ich mich in Gedanken und versuche, so leise wie ein Toter zu sein, damit sie nicht aufmerksam werden. Ich habe mich an den Namen, mit dem sie mich rufen, gewöhnt. Er ist weit ungefährlicher als mein eigener, und alles in allem ist er nicht falsch. »Du hast es bis heute geschafft«, rede ich mir gut zu, »also kein Grund zum Aufgeben.« Ich ermutige mich jeden Tag, jede Minute, immerzu. Durchhalten kann unheimlich schwer sein.
Zwischendurch kommt das Hadern. Warum ich? Hätte ich nicht so werden können wie meine älteren Brüder? Ich wollte mit dem Schwarm schwimmen, mein Leben genießen und in der Menge untergehen. Niemals etwas anderes. Dennoch bin ich ein Lord geworden, ein Adept. Ich bin jemand, den es nicht geben dürfte, und noch halten sie mich für einen untreuen Untertan. Sie fahnden nach Menschen wie mir – es ist nur Instinkt, der mich warnt. Ich bin ihr Counterpart, weil ich Shift, ihrer Waffe, mit Leichtigkeit widerstehen kann. Ein lebendiges Archiv, schon jetzt, und das ist noch die harmloseste meiner mysteriösen Eigenschaften. Es werden mehr. Wie wird das alles enden?
Dies ist der Anfang einer Geschichte und nicht ihr Ende, trotz meiner Gefangenschaft. Wer am Anfang steht, der lässt viel hinter sich und hofft. Das hat Monokel gerade zu mir gesagt. Ich muss unbedingt Gleichgesinnte finden. Wie lange sitze ich in diesem Loch fest? Vergeht die Zeit oder steht sie still? In Murud, wie sie den unheilvollen Ort nennen, gibt es nichts als Finsternis und Qualen. Irgendwie muss ich es nach draußen schaffen. Also schiebe ich mein Elend beiseite. »Befreie dich!«, fordere ich mich auf. »Tu es einfach, Sentry!«
Rechts neben mir war gestern eine nackte, schmierig-dreckige Wand. Auf dem Boden und über mir befanden sich hart gebrannte Lehmziegel in einer Art Gewölbebogen: feucht, voller Ausblühungen, Salpeter und Schimmel. Das Gebäude muss ein ungepflegtes, abgelegenes Gemäuer sein, und ich vermute, dass es groß ist. Denn woher käme sonst so ein alter Kerker? Wie andere Gefangene habe ich Ziegel gezählt, meine Finger blutig gewetzt und Nägel in dem hoffnungslosen Unterfangen abgebrochen, lockere Klinker zu finden. Vergeblich. Meine menschliche Seite steckte fest. Eine schwer beschlagene Eichentür mit einem Gitterfensterchen, außen von eisernen Riegeln verschlossen, sperrte mich ein. Sie ging auf einen unbeleuchteten Gang. Einen Eimer hatte ich, ein wenig Wasser, einen schmutzigen Metallnapf. Bis zum Shift war das so. Was ist jetzt?
In der Feste Murud
Sentry de Bonbaille war ein Gefangener. Soldaten des Usurpators hatten ihn vor etwa sieben Wochen in eine geheime Festung verschleppt, und seitdem ertrug er die Isolationshaft. Er wusste weder, auf welchem Weg er hergelangt war, noch, was man ihm vorwarf. Der Merker hatte keine Ahnung, ob er sich noch in Montzien befand oder nicht, und selbst was Zeitabläufe anging, war er verunsichert. Die Gefangennahme hatte ihn kalt erwischt, und er war öfter nicht bei Bewusstsein gewesen. Doch seine ganze Misere war in diesem einen Moment nebensächlich, weil er eine Chance zu entkommen witterte. Dass sich die Bedingungen seiner Haft dank Shift verändert hatten, hoffte er inständig. Ja, vor allem brauchte er jetzt Glück.
Aus der Sicht eines Außenstehenden war alles gleich. Seine Zelle war klein, lichtlos und die Tür fest verriegelt. Die Mauern waren erdrückend, die Luft verbraucht und von üblen Gerüchen verpestet. Doch Shift könnte etwas für ihn Entscheidendes verändert haben und die Karten ganz neu gemischt. Sein menschlicher Teil kam hier nicht weiter, aber der Merker war mehr als das, und seine verzweifelte Lage machte ihn ungewohnt mutig. Kein Shift-Prozess konnte so vollkommen sein, überlegte er, dass nicht auch Lücken und Fehler nebenher entstanden. Die Feinde schienen nach Perfektion zu streben, aber noch waren sie davon entfernt, und ihre Waffe musste ungeheuer komplex sein. Möglicherweise war sie nicht ganz kompatibel mit dem, was sie vorfand, und der Fokus des Angriffs hatte sicherlich nicht auf ihm gelegen. Niemand an diesem abgelegenen, vom Gott der Ideen verlassenen Ort wusste, dass er ein Lord war, und dadurch ergaben sich Chancen.
Was war ihnen diesmal misslungen? Was hatten sie übersehen? Sentry hatte noch nicht ergründen können, was Shift war oder wer es auslöste, aber er studierte das Phänomen sei Jahren. Energetische Wellen, die Informationen zu transportieren schienen und in fast alles eindrangen, hatte er entdeckt. Vor fünf Jahren hatte er dieses verwirrende Shift-Gefühl zum ersten Mal gehabt, und es war ein Flackern zwischen Realitäten gewesen. Sämtliche Veränderungen, die er hatte ausmachen können, hatte er heimlich in einem langen Buchhalterjournal notiert. Vor allem Menschen wandelten sich, hatte er festgestellt: ihre Charaktere, ihre Wünsche und Loyalitäten. Manchmal sogar Orte oder die Beschaffenheit von Dingen, aber das war seltener, und öfter hatte er den Eindruck gehabt, dass es versehentlich passierte. Sentry war in zwei parallelen Welten gleichzeitig gewesen, hatte für eine kurze Zeitspanne das Alte und das Neue erlebt. Der Merker hatte versucht, seine Eindrücke abzugleichen und natürliche Erklärungen zu finden, die es nicht gab. Schließlich hatte er klein beigegeben und akzeptiert, dass ein Teil ihrer Lebenswelt vernichtet worden war und ein fremder, tendenziöser hinzugefügt. Ein schleichender Austausch war im Gange, und Menschen verloren sich selbst.
Für wen auch immer der Usurpator arbeitete, man musste Respekt vor ihm haben. Die Angreifer bewiesen Ausdauer und Raffinesse. Sie attackierten ihre Opfer nicht einfach aus dem Stegreif und für alle offensichtlich, sondern beeinflussten sie mit Methode und einer dunklen, mächtigen Energiequelle, die irgendwo versteckt sein musste. Niemand war auf so etwas vorbereitet gewesen. Keiner hatte das erwarten können. Bis zu seiner Inhaftierung hatte der Merker die Existenz dieses seltsamen Feindes selbst nicht wahrhaben wollen und die Sache kleingedacht. Erst jetzt gab er den Angriff zu. Sein ganzes Leid war für diese Einsicht notwendig gewesen, und das würde er nicht vergeben. Sentry hatte sein Leben als Buchhalter am Hof von Fürst Bagalysh gemocht, er hatte es sich mühsam aufgebaut, und er konnte es nicht wiederhaben. Sein Verzeichnis hatten sie ihm zuerst genommen, doch was niemand ahnte, war, dass er enorme Wissensmengen speichern konnte und Papier gar nicht brauchte. Er hatte es verwendet, um die Veränderungen für andere festzuhalten und weil das Aufschreiben etwas Menschliches war. Der junge Lord kannte sich selbst gut genug, um zu wissen, dass alles, was er wahrnahm, auch tatsächlich wahr war. Er hatte keine Zweifel mehr.
Um beweglicher zu werden, begann er, seine Gelenke zu lockern, die ihm aus irgendeinem Grund schrecklich wehtaten. Er streckte seine Beine und beugte sie wieder, dann streckte er sie erneut. Er reckte die Arme über seinen Kopf zum Himmel hoch, der irgendwo sein musste, und lockerte danach seine seitlichen Muskeln. Zwischendurch nahmen die Schmerzen überhand, und er ließ es erst mal bleiben. Dann ging er vier Schritte auf und wieder ab, einige Male, denn mehr gab seine Zelle nicht her. Vorsichtig dehnte er Oberschenkel und Unterschenkel, und er versuchte ein paar klägliche Liegestütze. Die Handgelenke wollten nicht halten, es war nicht so wichtig. In der Enge seines dunklen Lochs war nicht viel möglich, und so setzte er sich schließlich hin. In den vergangenen Wochen hatte der aschblonde, junge Mann mit den freundlichen, haselnussbraunen Augen viel über sich gelernt. Er war zäher, als er für möglich gehalten hatte, anpassungsfähiger als gedacht. Und er hatte erstaunlich viel Bartwuchs. In seinem früheren Leben hätte ihn das zum Lachen gebracht, weil er so lange darauf gewartet hatte, aber lustig war hier leider gar nichts.
Gedankenvoll tastete Sentry im Futter seines schmierigen Umhangs nach Monokel. Der Überwurf war eine Art Uniform, er hatte einen silbernen Streifen quer über der Brust. Das war das Standeszeichen der höheren Buchhalter von Bagash, aber neuerdings war der Merker nichts als ein eingesperrter Verräter. Seine Entführer waren nicht besonders hell im Kopf gewesen, überlegte er. Sie hatten sein Monokel nicht gefunden, weil die Seitentasche ein Loch zum Innenfutter hatte, durch das es gerutscht war. Das schlichte Einglas ließ sich durch nichts verändern: nicht, wenn es runterfiel, und auch nicht durch Shift. Die energetischen Wellen konnten sie beide nicht aufspüren und glitten an ihnen vorbei, als wären sie gar nicht da. Wie der Merker widerstand Monokel sogar der Zeit, wobei auch Sentry älter wurde. Langsamer als andere, zugegeben, er sah immer noch aus, als wäre er nicht ganz volljährig, obwohl er es seit Jahren war.
Als Kind hatte er Monokel in dem prächtigen Gebäude gefunden, in dem er aufgewachsen war. Es hatte unter einem zertretenen Parkettboden gelegen, den man hatte erneuern müssen, und seine Neugierde geweckt. Neun Jahre war er damals alt gewesen. In einem Ring aus Silber mit ein paar seltsamen Schlagzeichen steckte ein halbdurchsichtiger Bergkristall, gewölbt wie eine Pupille, und als der kindliche Conte damals hindurchgeblickt hatte, hatte Monokel ihn viel mehr sehen lassen, als normale Augen es vermochten. Sentry hatte sich mit der Linse eng verbunden gefühlt, als hätten sie stabile Karabiner ineinander verhakt, und er hatte es für sich behalten. Im Laufe der Jahre war Monokel zu der einzigen wirklichen Konstante in seinem Leben geworden. Die Linse begleitete ihn von Kindheit an und würde wohl bis zu seinem Ende bei ihm bleiben. »Wir zwei gegen Shift«, murmelte der 23-Jährige leise und konzentrierte sich auf die bevorstehende Flucht. Das Einglas und der Adept waren eins, irgendwie, sie waren Familie. Denn es lehrte ihn in vielem, was nicht menschlich an ihm war.
Wellenfragmente glitten an ihren vorüber, obwohl der Angriff schon Minuten her war. Sie waren zäh, dachte Sentry, der sie beobachtete, diese Wellen waren verbissen. Durch Monokel erblickte er Millionen zarte, zielstrebige Werkzeuge der feindlichen Invasion, die nach und nach verblassten. Zu Anfang hatte er die Schwingungen für dunkles Licht gehalten, und sie hatten tatsächlich eine faszinierende Ästhetik, in deren Muster man sich verlieren mochte.
Plötzlich schrak er zusammen. Da waren Schritte. Zwei Personen, und sie näherten sich. Mit hastigen Bewegungen verstaute er sein Einglas, danach warf er sich eilig auf den Boden. Durch angsterfüllt zusammengekniffene Lider erspähte der Merker nun das Flackern einer Fackel, gleich darauf zwei schattenhafte Gestalten. Da war ein Gitterfenster in seiner Tür. Sah es anders aus als zuvor? Es war zu dunkel, seine Augen kein Licht gewöhnt, er konnte es nicht richtig sehen. Handin, sein üblicher Wächter, und ein weiterer Mann steuerten in ihren Militärstiefeln auf ihn zu. Sein Aufseher trug die Fackel und in der anderen Hand einen Schlagstock. Wie immer zog er einen Fuß nach, und Sentry hörte diesen schleifen. Dann erkannte er die Silhouetten ihrer Oberkörper. Handin war ein breitschultriger Kerl, den würde der Merker überall wiedererkennen. Dessen Begleiter war hochgewachsen und sehr schlank. Er wirkte jünger und bewegte sich geschmeidig wie eine Raubkatze. Ein Elitesoldat, erkannte der Adept voller Schrecken. Aus Vorsicht schloss er jetzt seine Augen ganz. Solche Leute konnten sich leicht provoziert fühlen.
»Von mir aus könnt ihr den haben, da ihr nach ihm fragt«, hörte der Merker Handin sagen, als die Schergen direkt vor seiner Zelle ankamen. Er hatte eine raue Stimme, weil er oft herumbrüllte und viel trank. Manche Aufseher führten sich wie Herrscher über Murud auf, wenn sie unter sich waren, aber heute wirkte sein Wächter nervös. Mit seinem Schlagstock malträtierte er Käfigtüren.
»Das Schwein verpestet die Luft wie die anderen«, brummte er und spuckte geräuschvoll auf dem Gang aus. »Stinken tun sie alle, Trankin, aber der hier hält sich für was Besonderes. Hochgeboren, wenn ihr versteht.« Er lachte grausam. »Vertreibt euch die Zeit mit dem Merker, falls ihr Lust habt. Lasst ihn singen. Aber lasst ihn am Leben – hört ihr mich? Ich möchte nicht mit leeren Händen dastehen, falls noch jemand fragt, und ich kenne eure Vorlieben nicht.«
Der Sprecher leuchtete in die finstere Zelle. Handin war grobschlächtig und brutal, aber bisher hatten er und die anderen Sentry in Ruhe gelassen. Zumindest glaubte er das.
»Eine verlockende Einladung, Handin«, antwortete der zweite Mann anerkennend, »aber ich möchte Ryshuar nicht in die Quere kommen.« Trankin lachte ebenfalls, und er schlug Handin auf die Schulter, aber Sentry konnte beiden anhören, dass mit dem Dritten nicht zu spaßen war. Während des Gesprächs musterte der Fremde Sentry eingehend aus schräg sitzenden Augen. Er hatte etwas über schulterlange, dunkle Haare, die in einem Zopf zusammengebunden waren. Seine Pupillen reflektierten im Dunklen, als der Lord unauffällig zu ihnen linste, um sich ein Bild zu verschaffen. Obwohl der Vorgesetzte von Handin keinerlei Reaktion zeigte, hatte der Merker doch das ungute Gefühl, durchschaut worden zu sein.
»Dann lassen wir ihn hier. Weglaufen wird er schon nicht«, knurrte der Aufseher ergeben. »Habt ihr noch Zeit für ein Spielchen, Trankin?« Die Stimmen entfernten sich, und Sentry atmete auf. Für diesmal war er davongekommen.
Seine Finger folgten den Fugen in den Wänden, fieberhaft und akribisch, dem Mörtel, jedem Hubbel. Auf zwei große Unebenheiten waren gestern fünf kleine gefolgt, die letzte länglich. Nichts davon konnte er jetzt wiederfinden, und auch die Steine fühlten sich anders an, rund und nicht eckig. Die Kerkerwand bestand nicht länger aus Ziegeln, sondern aus Findlingen, kindskopfgroß und aus uraltem Granit. Erschrocken zog der Merker seine Hände zurück. Er hielt inne, um nachzudenken. Anschließend wischte er sich über das Gesicht, seine zu langen Locken nach hinten. Der Wille zur Flucht und Entschlossenheit begannen die Angst, die sich hinter seinen Augen eingenistet hatte, zu vertreiben. Beinahe lächelt er. Aber immer langsam, hielt er sich dann zurück, denn da war noch die Tür. Er musste sich unbedingt unauffällig verhalten.
Sentry tastete sich vor. Behutsam, falls etwas im Weg sein würde, und sehr, sehr leise wegen der Wärter. Aber da war nichts, und auch die Zellentür fand er verändert vor. Seit Shift war sie eine Konstruktion aus Eisen mit einem Gitterfenster, durch das er seine Hände stecken konnte. Das Fenster hatte senkrechte Sprossen in einem Rahmen und würde bestimmt niemanden rauslassen. Die Kerkertür aber hatte nun ein richtiges Schloss, in den ein Bartschlüssel passen würde.
»Na so was«, murmelte der Merker tonlos, der sein Glück jetzt kaum fassen konnte. Die einfachen Riegel, die ihn eingesperrt hatten, waren ausgetauscht, und damit war er so gut wie frei.
Er wollte einen ersten Schritt in Richtung Freiheit wagen, als er erneut etwas vernahm und innehielt. War da ein gurgelndes Geräusch gewesen? Der Merker spitzte seine Ohren, aber alles blieb still. Es rauschte wohl nur das Blut in seinem Kopf, oder ein anderer Gefangener hatte gepinkelt. Jetzt zögerte er nicht mehr und legte seine Hände auf die kindskopfgroßen Findlinge, aus denen die Wände bestanden. Sentry konzentrierte sich auf sie und auf sich selbst, fühlte ihre Formen, ihre Oberflächen, ihre Kühle und wunderbare Rauheit. Darauf wagte er etwas für ihn Ungewohntes, etwas, das er sein Leben lang verdrängte und nicht tat, obwohl es zu ihm gehörte. Der junge Adept öffnete sich, ungeübt und eigentlich auch zu abrupt, für die elementaren Kräfte, die das Material ihm anbot.
Mit einem Mal flutete ihn Kraft. Sie pulsierte durch seine Adern und raubte ihm den Atem. Kaum auszuhalten war diese energetische Welle nach über 50 Tagen voller Schwäche, Bewegungslosigkeit, Hunger und Durst. Unfähig, sich zu rühren, hing er am Gemäuer aus Granit und seine menschliche Realität trat zurück. Müdigkeit und Frust begannen zu verblassen, sie wurden unbedeutend, und er fühlte das Wesen des steinernen Materials, das einst flüssiges Magma gewesen war, feurig und glühend. Stein als Teil eines unterirdischen Meeres aus pulsierendem, fließendem Feuer. Heißes Magma war nach außen gelangt und innerhalb der Erdkruste unter höchstem Druck kristallisiert. Stolzes, plutonisches Tiefengestein war entstanden und steckte in seiner Kerkermauer samt Quarzen, Feldspat und Glimmer. Der Merker hing an diesen von Zeit, Sand, Wasser und Wind geschliffenen Formen, mal rund, mal scharf, mal flach. Durch sie stand ihm die Kraft allen anfangs zur Verfügung, weshalb er zitterte und bebte, denn der Übergang von menschlicher Schwäche zu urenergetischer Stärke war heftig. Sentry de Bonbaille war ein Lord der Energien, und er kannte keinen zweiten. In dem Moment der Energieaufnahme war er verletzlich, und all das war sein Geheimnis. Geschichten über Lords wie ihn waren in der Bevölkerung Tradition, sie wurden kleinen Kindern erzählt, belächelt und nicht ernst genommen. Manchmal wurden Leute wie er auch als Felsenadepten bezeichnet. Mythen aus grauer Vorzeit sollten sie sein – und doch gab es ihn, und er lebte. Leider wusste er nicht viel über diese Seite seines Ichs, und er hatte auch nie einen passenden Lehrer gefunden. Monokel hatte sich abgemüht, aber die Linse war anders, nicht so mächtig und Sentry de Bonbaille noch immer einsamer Anfänger.
Seine Feinde hätten ihn töten sollen, als sie die Gelegenheit dazu hatten – wie wenig sie doch über ihn wussten! Misstrauisch waren sie, ja, aber sie hatten keine Ahnung. Mit natürlichen Mineralien konnte man ihn nicht einsperren, mit Tonziegeln und Holz hingegen schon. Niemals hätte die dunkle Macht ihn einschließen dürfen. Lerne deine Feinde kennen, dachte er wütend. Ihr Aussehen, ihre Facetten, ihre Absichten, ihre Macht und Stärken. Ihre Vorlieben und vor allem ihre geheimen Ängste und Schwächen. Studiere sie, breite ihren ganzen Geist und ihre Art vor dir aus, und dann, wenn du sie begriffen hast, schlag sie zurück!
Der junge Lord und Buchhalter war genau. Er würde herausfinden, wer sie waren und wo sie ihren Sitz hatten. Um was ging es ihnen im Kern? Fragen über Fragen, aber zunächst müsste er hier raus. Sentry war bisher nicht böse noch gut gewesen, sondern einfach ein junger Mann mit buchhalterischen Ambitionen. Er würde ein ebenbürtiger Gegner werden, das schwor er auf Knien dem fernen Gott der Ideen, dem er sich jetzt gerade nahe fühlte, und sei es nur, um vor irgendjemandem oder irgendetwas zu schwören.
Trankin
Eigentlich hatte er über eine Außenwand fliehen wollen. Doch gerade hatte er erfahren, dass die Wand 800 Meter tief ins Meer stürzte. Das war zu gefährlich, selbst für einen erfahrenen Kletterer, und das war er nicht. Sentry war mehr geschickt als ausdauernd. Weil er in den letzten Jahren am Schreibtisch gearbeitet hatte, hatte er Kraft und physisches Durchhaltevermögen lange nicht trainiert. Das war unmöglich gewesen, selbst wenn er gewollt hätte, weil Buchhalter am Hofe des Fürsten Bagalysh keine Krieger sein sollten. Der Merker hatte sich unauffällig eingefügt, nicht gut genug, wie er inzwischen wusste.
Die Kommunikation mit Mineralien lief nicht verbal, sondern bildhaft ab und nicht unbedingt konkret. Sentry hätte viel dafür gegeben, das besser zu beherrschen, aber er hatte nie üben können, sich nicht getraut, und von nichts kam eben nichts. Natürlich wusste jeder Stein eine Menge Dinge und hatte sich ihm mitgeteilt. Im Gegenzug wussten sie jetzt auch von ihm, dem Merker, sie kannten seine Geschichte und würden sie hüten, bis jemand kommen würde, der sie auslesen könnte. Ein weiterer Felsenadept, wenn es noch einen geben sollte. Es war unwahrscheinlich.
Sentry setzte sich direkt vor die Tür seiner Zelle und konzentrierte sich auf das eiserne Schloss. Nichts außer dem einen Gedanken an den Schließmechanismus und seine Funktionsweise durfte seinen Geist füllen. Er würde dieses kleine Rätsel lösen, sofern es in sich logisch und nachvollziehbar war, und bei einem Schloss hatte er keine Zweifel. Durchschaute er etwas, so konnte er mal befehlen, manchmal bitten, und fast immer bekam er eine Antwort oder eine Reaktion. Ganz genau tastete er das Käfigschloss mit seinen geschickten, fast schon zärtlichen Händen ab. Anschließend nahm er sein Monokel heraus und blickte damit in das Schloss hinein. Sentry wusste nicht, wie die alte Linse funktionierte. Monokel war ein Sichtgerät für die Dunkelheit und für große Entfernungen. Manchmal konnte er mit dem Monokel auch durch Dinge hindurchschauen oder Feinheiten in nächster Nähe sehen. Es war ein sehr praktisches Ding und ein für ihn nicht lösbares Mysterium. Allerdings war es heikel, die Linse zu verwenden, denn es könnte sein, dass die Gegenseite Spuren, die er und Monokel hinterließen, lesen könnte. Der Merker beeilte sich. Ganz klar konnte er jetzt sehen, wie ein Bartschlüssel, den Handin hütete, in das Schloss passte. Es war recht einfach konstruiert und Sentry fühlte was? Enttäuschung? Hielten sie ihn für dumm? Ein einfacher Dietrich hätte hier ausgereicht, allerdings hatte er keinen. Der Merker konzentrierte sich auf den Schließmechanismus, überredete das Schloss, und es sprang auf.
Der Freude und Erleichterung über die offene Zellentür folgte ein Schock. Zwei helle Flecken durchbrachen die schützende Dunkelheit des Ganges und schimmerten ihm kühl und grau entgegen. Schnell duckte Sentry sich um die Ecke in den fast schwarzen Flur – Zurückgehen kam nicht infrage. Und plötzlich konnte er die irritierenden Lichter einordnen, und sein Herz klopfte ihm bis zum Hals. Es war Trankin, sein zweiter Aufpasser, der aus irgendeinem Grund auf ihn gewartet hatte. Jetzt leuchteten seine Augen merkwürdigerweise selbst, aber in seiner schwarzen Uniform war er dennoch kaum zu erkennen. Die Absicht des Merkers, leise und unbemerkt zu entkommen, war gescheitert. Er drückte sich in die Schatten und wusste nicht weiter. Derweil saß sein Wächter auf eine bedrohlich anmutende Weise auf einem einfachen, dreibeinigen Holzschemel im Gang. Er hatte keine seiner Waffen gezogen und schien ihn abwägend zu betrachten. Seine entspannte Haltung, die Unterarme auf den Knien, stand merkwürdigerweise in keinem Widerspruch zu der Gefahr, die von ihm auszugehen schien, und vor dem Fremden auf dem Boden sah der Merker das überflüssig gewordene Schlüsselbund. Der Wächter bewegte sich nicht, sondern taxierte sein Gegenüber ganz offen, und Sentry hatte sogar den Eindruck, dass der andere Mann im Dunklen weit besser sehen konnte als er selbst. Auch seine an Gelassenheit grenzende Körperbeherrschung erinnerte den Merker spontan an ein Raubtier in der Nacht. War Trankin Freund oder Feind? War er gefährlich oder hilfreich?
»Ich habe mich gefragt, ob du das kannst, Türen öffnen«, sagte der Fremde mit den auffälligen Augen ohne den Blick vom Merker abzuwenden oder sich zu rühren. Sentry wartete ab, schweigend. Was wollte dieser Mann von ihm, einem Buchhalter mit ein paar besonderen Fähigkeiten, von denen er selbst nie gesprochen hatte? Wie viel wusste der Fremde über ihn? Der Merker fühlte sich ausgebremst, er war misstrauisch und unentschieden. »Wir müssen uns beeilen«, drängte Trankin jetzt leise und eindringlich, während er ihm forschend in die Augen blickte. Dann stand er ganz langsam auf, als wollte er Sentry auf keinen Fall provozieren. Seine Art zu reden war zugewandt, ernst und freundlich, und der Adept konnte wirklich einen Mitstreiter brauchen, aber Vertrauen kam in seiner Lage nicht infrage. Doch der uniformierte Soldat mit den hellen Augen wartete die Reaktion des Merkers nicht ab. »Wir müssen den Wächter herschaffen und die Zellentür von außen verschließen«, sagte er, »Handin liegt im zentralen Wachraum.« Er ging vor und drehte Sentry den Rücken zu, was dieser irritierend fand. Dennoch zögerte er weiter. War das eine Falle? Versuchten seine Peiniger auf diese Art, ihn zu gewinnen oder zu demoralisieren? Mit Hoffnung? Da wären sie nicht die ersten. Andererseits – was hatte er in seiner Situation schon zu verlieren? Das würde Trankin natürlich auch wissen. Der Merker überlegte einen Moment, den anderen niederzuschlagen, aber er hatte das sichere Gefühl, dass er dazu nicht kommen würde, bevor der quasi Unbekannte ihn überwältigt hätte. »Worauf wartest du?«, fragte dieser, weil Sentry stehengeblieben war, und nun folgte der Merker.
Die Wachstube war von drei Fackeln schummrig erleuchtet. Gegenstände warfen lange Schatten auf den Boden, die sich überschnitten. Auf dem rohen, zerkratzten Holztisch stand noch der offene Schnapskrug mit einfachen Tonbechern daneben. Außerdem sah der Merker zwei Hocker, die aussahen wie der, auf dem Trankin gesessen hatte. Einer davon war umgestürzt. Trankin richtete diesen nun wieder auf, verkorkte den Krug und stellte die benutzten Becher an ihre üblichen Plätze. Sein Kollege lag tot oder bewusstlos neben dem Tisch. In merkwürdiger Haltung auf der Seite, und er rührte sich nicht. Kein Blut war auf dem Boden zu sehen. Dennoch lief Sentry ein Schauder über den Rücken, und er blieb stehen. Er würde sich an ein anderes als sein geordnetes Leben gewöhnen müssen, dachte er, als er wieder einen Gedanken fassen konnte. Denn dieser eine Tote änderte alles in seinem Leben und stellte alles auf den Kopf.
Trankin hingegen bewegte sich überlegt und der Situation angemessen. Erfahren, konnte man denken. Er griff den Leblosen an den Händen und bedeutete Sentry, die Füße zu packen. Handins Kopf kippte sofort schlenkernd nach hinten um, und sein Torso gab ein fauchendes Geräusch von sich, als Luft aus seinen Lungen entwich. Gemeinsam schleppten sie ihn zurück, den nachtschwarzen Gang entlang und zur Zelle. Sie mussten einige vergitterte Löcher passieren, aber niemand achtete auf sie, keiner wollte Aufmerksamkeit erregen und hier sterben. Sentry fiel es schwer, leise zu atmen, leise zu gehen, leise zu sein. Die schlappe Körpermasse des Wächters war verdammt schwer zu tragen, und seine Gelenke schrien unter dem Gewicht geradezu auf. Handins Füße wollten ihm die ganze Zeit entgleiten, einer davon ein Klumpfuß, doch der junge Buchhalter biss sich durch. Angekommen, ließen sie den Wächter fallen. Plump und massig, wie er war, schlug er auch auf, und der Merker hörte ein knackendes Geräusch aus der Halsgegend. »Das stört den nicht mehr«, kommentierte Trankin trocken. »Tot«, dachte Sentry erneut, und er erinnerte sich an das gurgelnde Geräusch, das er aus dem Raum der Wächter gehört hatte. Trankin hatte ihn dort erdrosselt. Angst wallte in ihm auf, sie formte einen Klumpen in seinem Hals, der ihm die Kehle zudrücken und ihn zu unsinnigem Handeln treiben wollte. Doch das würde nicht helfen. Der Merker wehrte sich gegen diese treibende Furcht, er konzentrierte sich und stemmte seine geballte Willenskraft gegen den Reflex zu Flucht oder Widerstand. Sentry schuf in Windeseile ein Gerüst gegen den drohenden Zusammenbruch, Ständer an Ständer, Verschraubung an Verschraubung, Stütze an Stütze, um bloß nicht handlungsunfähig zu werden. So drängte er die Angst in eine Ecke seines Geistes, wo sie weiter rumoren konnte, jedoch weitgehend unbeachtet. Dieses Gerüst würde halten müssen. Er war noch voller Energie und hätte jedem Stein um ihn herum befehlen können, dem anderen Mann den Kopf einzuschlagen. Und wenngleich er so etwas niemals tun wollte, so wäre es doch möglich. Angegriffen könnte er sich verteidigen. Das machte er sich klar, mehrfach und noch einmal. Noch nie hatte er so viel Energie aus Gestein in sich aufgenommen wie heute, und selten hatte er sich so bedroht gefühlt oder ein Interesse daran haben können, jemanden zu verletzen. Alles erschien ihm jetzt möglich. Die großen Kiesel des Mauerwerks waren wie eine Herde oder ein Rudel, das seinen Befehlen folgen würde, denn er hatte sie aufgeweckt und war ihr Meister. Der Adept riss sich zusammen und hoffte, dass er im richtigen Moment lockerlassen könnte, um sein Leben zu retten. Sentry war ein harmloser, freundlicher Mensch, und eigentlich war er am Ende seiner Kräfte, aber niemand war ganz harmlos.
Noch war keinem in der alten, fast fensterlosen Festung etwas aufgefallen, aber das könnte sich jeden Moment ändern. Trankin und er hatten sich zu beeilen, wenn sie unbemerkt aus dem Kerker entkommen wollten, denn die Wachablösung stand vermutlich kurz bevor. Der Merker konnte Tag und Nacht nicht mehr auseinanderhalten, aber er hatte eine Art alternatives Zeitgefühl entwickelt in dieser ewigen Nacht. Aus Not schob er alle Befürchtungen beiseite und alle wirren Gedanken. Eine echte Allianz mit dem Fremden musste her: eine auf Zeit, weil es sein musste, oder auf Dauer, wenn das gut gehen würde. Der selbstsichere, drahtige Mann in der schwarzen Uniform konnte schnell tödlich werden, aber in ihrer Situation erschien es dem Merker gut, fast schon beruhigend.
Sentry blickte aus der knienden Position, in der er – er wusste nicht wie – gelandet war, hoch. Der Jäger, wie er ihn insgeheim nannte, lehnte nahezu entspannt in der Tür zum Gang und beobachtete ihn durch die Dunkelheit. Sentry schätzte ihn auf Mitte dreißig. Der Fremde verhielt sich rätselhaft, und er war offenbar seinetwegen hier. Konnten sie einander vertrauen? Jetzt stand er auf, weil er zu dem Unbekannten nicht aufsehen wollte, zu niemandem mehr. Das war in einem anderen Leben gewesen, es war vorbei. Er war kleiner als Trankin, aber kräftiger gebaut, auch wenn er gerade abgemagert war, und er war mit seinen 23 Jahren offenbar der Jüngere. Vielleicht hätten sie unter normalen Umständen etwa das Gleiche gewogen, überlegte er, während sie sich gegenseitig musterten. »Verdienst du mein Vertrauen?«, hörte der Merker sich in die Stille hinein leise fragen. Er traute seinen Ohren kaum, aber gesagt war gesagt. Vielleicht war er doch mutiger oder dümmer, als er gedacht hatte. War er tatsächlich selbst auf diesen Wortlaut gekommen? »Wir müssen jetzt gehen«, antwortete Trankin schlicht. Entweder hatte er ihn nicht gehört, oder er fand es sinnlos, zu antworten. Denn was auch immer er vorbringen würde, es könnte gelogen sein.
Während der Mann die Leiche auf dem nackten Boden in eine Art Schlafposition drückte, zog Sentry seinen Umhang aus und bedeckte sie damit. Die Totenstarre setzte langsam ein, und Handin war jetzt schwerer zu bewegen. Die silberne Bordüre seines einst edlen Umhangs schimmerte über dem Toten wie zu einem Abschiedsgruß. Der Streifen reflektierte das wenige Licht, das Trankins Augen aussandten. Sentry griff sich die schmutzig-schwarze Uniformjacke des Wächters, die er zuvor voller Ekel beiseite geworfen hatte. Er zog sie über, obwohl sie nach Handin und Alkohol roch, und steckte sein Monokel in eine der Seitentaschen, die er mit zwei Häkchen sicher verschloss. Die Jacke war ihm viel zu groß, sie schlackerte um seinen geschundenen Körper. Rechts auf der Brust hatte sie ein schwarzglänzend eingesticktes Abzeichen, das Sentry wohlbekannte Wappen des Usurpators. Es war ein fünfeckiges Emblem, aber das Fünfeck stand auf dem Kopf, und es hatte Strahlen in alle Richtungen. Der dunkelhaarige Mann ihm gegenüber, der seinen Bewegungen mit den Augen gefolgt war, nickte Zustimmung. Er verließ die Zelle nach dem Merker und schloss sie sorgfältig ab. Den Schlüsselbund nahm er mit, den dreibeinigen Hocker stellte er zurück in den Wachraum, und der düstere Gang wirkte wie vorher.
Die Katakomben
Als sie erneut zur Wachstube kamen, war alles noch so, wie sie es zurückgelassen hatten. Trankin griff sich ein ledernes Bündel, das er zuvor in einer Ecke platziert haben musste, und band es sich über den Rücken. Doch zuvor stopfte er noch graues Brot aus der Stube als Proviant hinein. Der Merker hatte einen Bärenhunger und hoffte, dass es nicht steinhart war, während er den Bewegungen des Fremden mit gierigen Augen folgte. Aber auch das war ihm letztlich egal, er hätte fast alles gegessen. Anschließend erhielt auch er einen Beutel, der zwei Wasserflaschen sowie Trockenobst enthielt. Außerdem etwas, von dem er annahm, dass es getrockneter und eingesalzener Fisch war. Trankin hatte tatsächlich vorgehabt, mit ihm zusammen zu fliehen.
Angewidert griff Sentry sich nun noch den Dolch des Toten, der in seiner Scheide an einem ledernen Gürtel an der Wand hing. Die schwarzglänzende Waffe war unten am Heft etwa sechs Zentimeter breit, und sie lief in einer leichten Kurve spitz zu. Der Griff war ebenfalls mit dem fünfeckigen Zeichen des verhassten Herrschers versehen. Es war eine Waffe zum Schwingen, weniger zum Stechen, bemerkte der junge Mann, und das würde er üben müssen. Er band sie sich um die Hüfte, musste mehrere Knoten in den ledernen Gürtel machen, weil dieser zu weit war. Anschließend schwang er sich seine Tasche mit Wegzehrung über die Schulter. Die Aufregung hatte eine Menge Adrenalin in seine Adern gepumpt, und das verlieh ihm mehr Kraft, als er eigentlich hatte. Sentry fühlte sich zum Aufbruch bereit, Unsicherheit und lähmende Angst fielen teilweise von ihm ab. Wie ein Buchhalter sah er sicherlich nicht mehr aus, ging ihm durch den Kopf. Er war schmutzig und bärtig, und er hatte längere Haare als sonst, sodass ihm einzelne aschblonde Locken über die braunen Augen fielen. Dann waren da die unförmige Militärjacke von Handin, und seine eigene abgenutzte Hose, die ursprünglich flaschengrün gewesen war. Sie starrte jetzt vor Dreck, die Farbe war kaum noch zu erkennen. Die Slipper aus feinstem Rindsleder, die er im Kontor getragen hatte, würden ihm in Kürze von den Füßen fallen, aber die Stiefel von Handin hatten ihm nicht gepasst. Trotz allem hatte er den Eindruck, weniger gebeugt zu stehen als früher, und das lag vermutlich an der ganzen Energie, die er vorhin aufgenommen hatte.
Trankin war mit einer langen, schmalen, ein wenig gebogenen Machete bewaffnet. Sie war ebenso um seine Hüfte geschnallt wie ein Dolch mit einem silbernen, verzierten Griff und einem Stein am oberen Ende. Er musste die Waffen ausgetauscht haben, denn normalerweise trugen usurpatortreue Soldaten montzische Eineinhalbhänder, und seine Waffen sahen fremd und in Sentrys Augen ungewöhnlich aus. Für den Fall der Fälle steckte der vorsichtige Mann sich ein Messer in einen Militärstiefel, der ein Futteral dafür zu haben schien. Anschließend warf er dem Merker mit einem sparsamen Lächeln einen kleinen, halben Brotlaib zu, den Sentry dankbar auffing. Das Brot war älter und etwas eingetrocknet, aber nicht geschimmelt. So verließen sie den verwaisten Wachposten, der Adept kauend und beide mit einer Fackel aus den Gefängnisgängen in der Hand. Die Fackeln der Wachstube beließen sie dort, damit der Raum unverändert wirken würde, wenn die Ablösung käme. Sie gingen so schnell wie möglich, aber an zügiges Laufen war für Sentry nicht zu denken.
Er hatte den Eindruck, dass der Jäger einem Plan folgte, und schloss sich ihm an. Sie nahmen keinen Weg durch bevölkerte Gänge und bewachte Räume, was den Merker aufatmen ließ, sondern eilten durch das Gefängnis und über Treppen nach unten und danach tiefer in den Felsen der Steilküste hinein. Dort war ein Labyrinth aus Gängen und alten Verließen, ehemals wichtigen Hauptrouten und toten Sackgassen. Die verlassenen Stollen waren mehr oder weniger gut erhalten und unterschiedlich breit. Dort, wo es möglich gewesen war, waren grobe Lichtschächte in den Stein geschlagen worden, die tagsüber immer noch der Beleuchtung und Belüftung dienten. Es mochte etwa früher Abend sein, schätzte der junge Adept anhand des Lichteinfalls. Aber wo Schächte fehlten, war die Luft abgestanden, und es wurde stickig, denn auch die Fackeln verbrauchten Sauerstoff. Trankin und Sentry begannen zu schwitzen. Entweder hatte der Felsen Sonnenwärme gespeichert, oder der Sauerstoffmangel trieb ihnen den Schweiß aus den Poren, und das war leider wahrscheinlicher. Je tiefer sie kamen, desto verlassener wirkten die Kammern und desto mehr quietschten rostige Schlösser, Türen und Tore in ihren Angeln. Immer begleitete sie die Sorge, entdeckt zu werden, und jedes Geräusch, das sie nicht selbst verursachten, ging ihnen durch und durch. Sie blickten sich um, Sentry viel häufiger als Trankin, aber auch der Unbekannte wirkte angespannt. An dem Bund, das der Jäger verwahrte, hingen Schlüssel mit unterschiedlichen Formen, die zu einigen Pforten und Türen gepasst hatten. Sie hatten beim Einstieg in diese Unterwelt geholfen, aber nach und nach wurden sie nutzloser. Manche Mechanismen rührten sich trotz eines vermeintlich geeigneten Schlüssels nicht, und der Merker musste sie auf seine Art davon überzeugen nachzugeben. Es kostete ihn Kraft und sie beide wertvolle Zeit. Aber jedes Mal trennten sich die festgerotteten Türflügel – es quietschte und Rost fiel zu Boden –, und dann gaben sie neue Räume frei, die hoffentlich in die Freiheit führen würden. Türen und Tore, die sie durchschritten hatten, schlossen sie sorgfältig wieder, Fußspuren und andere mögliche Hinweise verwischten sie, so gut es ging. Leben war hier ungewohnt, Bewegung gab es kaum. Sie hofften, dass die Wächter keine Hunde hatten, was Trankin nicht einschätzen konnte, und sie beeilten sich nach Kräften, so leise wie möglich, so umsichtig wie machbar. Beide tranken nur wenig und in kleinen Schlucken, und nirgendwo stießen sie auf Wasser.
Nach drei Stunden ruhten sie sich ein wenig aus. Sie löschten die Fackeln, um ihre Reste für später aufzusparen. Sentry brach unter seinem eigenen Gewicht fast zusammen und ließ sich an die Wand gelehnt zu Boden gleiten. Sie aßen etwas von dem Proviant aus ihren Beuteln. Durch einen Schacht schien graues Licht herein, den Himmel konnten sie aber leider nicht sehen. Der Durchbruch zur Außenwelt ging um eine Ecke. Trankin hatte ebenfalls zwei Wasserflaschen sowie scharfen, gelben Käse und zwei Ringe harte geräucherte Wurst von einem Wildtier dabei. Außerdem förderte er zwei dünne Laken zutage, die bei genauerem Hinsehen und Fühlen aus einem wärmenden Wollstoff waren. Der Merker war sehr dankbar für die Verpflegung und das weiche Tuch, wickelte sich hinein und fiel sofort in einen kurzen, traumlosen Schlaf. So gut hatte er seit Wochen nicht mehr gegessen. Sein Kopf fiel auf die Seite, mit einem Ohr berührte er den harten Fußboden, aber das war er gewohnt.
Plötzlich hörte er Schritte und wachte auf. Sehr, sehr leise Schritte waren es, doch waren sie in der Nähe. War es ein Tier oder wurden sie verfolgt? Als Sentry etwas flüstern wollte, hielt Trankin, der ihn im Blick hatte, den Finger an seine Lippen und bedeutete ihm, leise zu sein. Licht fiel inzwischen kaum noch herein, der Tag schien sich seinem Ende zuzuneigen. Der andere Mann war, abgesehen von seinen glimmenden, schrägen Augen, nur schemenhaft zu erkennen. Er hatte Wache gehalten, anstatt zu ruhen, und Sentry die zweite dünne Decke unter den Kopf geschoben. Außerdem hatte er die nähere Umgebung abgesucht und dabei ungewöhnliche Spuren gefunden. Ob Mensch, ob Tier, er konnte es nicht sagen. Unruhig packten sie ihre Sachen und machten sich leise wieder auf den Weg. Sie mussten ihre nahezu aufgezehrten Fackeln wieder entzünden, weil Sentry kaum noch sehen konnte. Die Schritte von vorhin hörte der Adept nicht mehr, aber er meinte die Nähe eines anderen Bewusstseins zu spüren.
Sie gelangten an eine mineralische Tür, die sich in der Felswand nur durch einen Umriss abzeichnete. Der graue Stein war hier von weißen Adern durchzogen und marmoriert wie ein Stück Fleisch. Eine Art antikes Zahlenschloss war in ihn eingelassen worden, und die Tür selbst schien fast ganz mit der Wand verschmolzen zu sein. Ein Kunstwerk aus alter Zeit, bewunderte Sentry, der Sinn dafür hatte, tief beeindruckt. Dies war kein gewöhnliches Tor, und es verlangte ein gewisses Maß an Ehrfurcht. Vor der Tür befand sich ein kleiner, ornamental gepflasterter Platz, den er sofort als Zeugnis einer antiken Hochkultur identifizierte. Der Adept ging auf das Schloss zu und blieb dann stehen, Trankin direkt hinter ihm. Zuerst wischte der Merker den Staub von der Oberfläche ab, um den Drehmechanismus und die vielen Zeichen darauf besser erkennen zu können. Es waren fremde Symbole, die er nicht lesen konnte, er hatte so etwas noch nie gesehen. Intuitiv konnte er sie nicht verstehen, und dabei hatte er sich über seine bisherigen Erfolge, was das Öffnen von Türen anging, gefreut. Aber es gab unterschiedliche Niveaus, und er hatte bisher nur mit einfachen Schlössern zu tun gehabt, die kaum zählten. Schön und abweisend wie eine Amazone kam ihm dieses Tor vor. »Versuch’s einfach.« Trankin hatte ihn gespannt von hinten beobachtet und deutete auf das Schloss. »Auf der anderen Seite dieser Tür soll es einen Ausgang geben. Es gibt alte Berichte darüber, wenige zugegebenermaßen. Unser Weg führt hier nach unten oder nach oben zurück.«
»Ja, bitte«, hörte Sentry plötzlich eine helle Stimme von weiter hinten. Sie war glockenklar und kam von einer jungen Frau. »Bitte mach uns die Tür auf!«, ermunterte sie ihn ebenfalls. Erschrocken drehte er sich um und erblickte eine relativ kleine, nahezu weißblonde Person mit hellblauen Augen und ungeheuer langen Haaren, die ihr offen bis auf die Hüfte fielen. Sie war schlank und hatte ein sauberes, wenngleich ziemlich ausgewaschenes, langes Blümchenkleid an. Neben sich hatte sie einen alten, angeschlagenen Wasserkrug abgestellt, der ein dickes Trageband aus Jute hatte, sowie ein Tuch mit ein paar schrumpeligen Beeren und Wurzeln. Ein zweites Kleid hatte sie ordentlich zusammengelegt unter den Arm geklemmt, und das war ihr ganzes Gepäck. Sie trug Schuhe, die selbstgenäht und einfach wirkten, und diese hatten ihn und Trankin, was das Spurenlesen anging, ziemlich verwirrt. Sie waren aus jeweils einem einzigen Stück Leder gefertigt und zum Fußgelenk hin gerafft. Die weichen Schuhe ließen ihre Füße nach Tatzen aussehen und sorgten dafür, dass sie beim Gehen kaum Abdrücke hinterließ und wenig Geräusch machte. Sentry, der so etwas nur von Pferden kannte, wenn man das Hufgeräusch dämpfen wollte, betrachtete die Frau oder das Mädchen – er wusste nicht so recht –, und er achtete naturgemäß auf jedes Detail.
Trankin reagierte blitzschnell. Längst hatte der Jäger seinen Fackelrest in eine Spalte der Wand gesteckt, um beide Hände frei zu haben. »Wer bist du?«, verlangte er drohend zu wissen. »Bist du allein?« Trankin war gefährlich, und Sentry hatte es während der gemeinsamen Wanderung fast vergessen gehabt. Seine befehlende Stimme klang plötzlich gar nicht mehr vertrauenerweckend. Das zierliche Mädchen aber schien auch nicht gerade aus Zucker zu sein. Sie machte ein paar kleine Schritte rückwärts und blieb dann unbeirrt stehen. »Eshandra Marí, und ich möchte dort hindurch auf die andere Seite.« Sie deutete auf das Portal. »Ich bekomme das Tor nicht auf.«
»Sag, warum bist du uns gefolgt?«
»Ich bin schon länger als ihr hier«, antwortete Marí. »Es ist wirklich nicht leicht, dieses Tor aufzumachen, das könnt ihr mir glauben. Ich habe es wochenlang versucht. Kann er das?« Sie deutete auf den Merker und ging vorsichtshalber noch etwas weiter nach hinten, um dann erneut stehenzubleiben. Eines war klar: Sie hatte nicht vor, wieder zu gehen. Die schräg stehenden Augen des Jägers blitzten nun zornig. Diese junge Frau provozierte ihn. Sie durchkreuzte seine Pläne, und das gefiel ihm nicht. Er schoss in einer schnellen Bewegung nach vorn, um sie zu packen, doch das Mädchen machte ein paar noch schnellere seitliche Bewegungen, drehte sich um sich selbst und entglitt ihm mühelos. Anschließend stand sie wieder wie zuvor. War das Tanz oder Angriff und Verteidigung, wunderte sich Sentry. Auch Trankin zog erstaunt die Augenbrauen hoch und passte seine Geschwindigkeit dann an. Für ihn war diese Auseinandersetzung jetzt eine Frage der Ehre. Er bewegte sich flink, fließend und kraftvoll. Erstaunlich gewandt. Vor sich sah der Merker ein Raubtier bei dem Versuch, einen seltenen Vogel fangen, doch dieser wusste sich knapp zu entziehen. In gewisser Weise war es ein Kräftemessen. Die vom Jäger gestellten Fallen verließ das Mädchen immer in der allerletzten Sekunde. Sie schien die Figuren zu kennen, und nach und nach glich das Ganze eher einer sportlichen Übung. Trankin hätte sein Schwert ziehen können, analysierte der Merker, aber das wollte er offenbar nicht. Ganz abrupt blieb er dann stehen. Das hellblonde Mädchen, das nun vor Aufregung oder Anstrengung rote Wangen hatte, machte noch zwei etwas unsichere Schritte, weil kein Angriff mehr folgte, und kam dann auch zum Stehen. Eine offene Stille entstand, in die alle drei hinein atmeten. Die Kräfte der jungen Frau hatten nachgelassen. »Ich möchte da einfach nur durch!«, beteuerte sie heftig. Beiden war klar, dass Trankin sie in Kürze überwältigt hätte, weil seine Kondition viel besser war. Er betrachtete sie ungläubig. »Als hätten wir den gleichen Lehrer gehabt …«, murmelte er und warf seinen dunklen Zopf, der nach vorn gerutscht war, wieder in den Nacken. »Von wem hast du das gelernt?«, fragte er darauf mit einer Spur Neugier. Ihre Kampfkunst entsprach nicht der seiner Feinde, sondern eher seiner eigenen, und obwohl sie schwieg, wartete er nicht lange auf eine Antwort. Wohl ahnend, dass er keine bekommen würde, wenn ihre Kultur der seinen ähnlich wäre. »Du kannst deine Geheimnisse vorerst für dich behalten, Marí«, meinte Trankin lässig, »aber auf Dauer wird das nicht gehen, wenn du uns begleiten willst.« Er wandte sich Sentry zu: »Wie sieht’s aus?«
Weil ihm nichts anderes übrigblieb, musste der Merker die Zeichen des ungewöhnlichen Schlosses einfach hinnehmen. Hier war ein fremder Code, den irgendjemand einmal gekannt hatte, der Sinn gehabt hatte, und der inzwischen zur Geheimschrift geworden war. Vielleicht war er es auch immer schon gewesen. Sentry hockte sich neben die Tür und untersuchte eilig und mit fieberndem Eifer das Schließsystem aus einem harten, mattgolden schimmernden Metall, das er nicht kannte. Eine ungewöhnliche Legierung, überlegte er. Kurz nahm er sein Monokel zur Hand. Mit ihm konnte der Merker auch in tiefere Schichten sehen. Stäbe tauchten vor ihm auf, die Zahnräder blockierten. Und diese wiederum griffen in ein weiteres System aus Rädchen und Hebeln ein. Letztere würden vermutlich die Pneumatik der Tür in Gang setzen. Sentry versuchte Symbol-Kombinationen, die ihm sinnvoll erschienen, drehte sie auf verschiedenste Positionen. Aber alles schlug fehl, und die Tür rührte sich nicht. Müdigkeit und Frust machten ihm zu schaffen. Sein Körper hatte die sieben Wochen Einzelhaft nur zeitweise verdrängt und nicht vergessen. Jetzt, wo er nicht mehr in Bewegung war, fielen sie ihm wieder ein. Der junge Adept bat die anderen um Zeit. Und sie sollten aufhören, ihm zuzusehen, denn das lenkte nur ab und machte ihn nervös. Noch eine Situation ohne Zurück, dachte er, weil Aufgeben nicht infrage kam. Das sollte besser nicht zur Gewohnheit werden. Er trank einen Schluck schales Wasser aus einer seiner Flaschen. Da er das System nicht verstand, konnte er es nicht bedienen. Das war einfach und klar. Deshalb konnte er auch nicht mit dem Mechanismus in Kontakt treten und ihn überreden, wie er es bei den anderen Schlössern getan hatte. Der Merker hatte fast das Gefühl, dass das Schloss eine Art Sicherung gegen Leute wie ihn hatte. Wer hatte es erschaffen? Wer hatte auf der anderen Seite gewohnt? Dieser Mechanismus war extrem gut durchdacht. Sentry trank mehr Wasser. Vermutlich würde er das nachher bereuen, wenn er etwas von dem salzigen Fisch essen würde … Eigentlich eine gute Idee, fand er dann. Er hatte Hunger und holte den Fisch raus. Bloß nicht schlapp machen. Intensiv kauend – das Zeug war zäh und bestand wirklich überwiegend aus Salz – saß er auf dem gepflasterten Steinboden und starrte die unnachgiebige Tür an. Aber Starren half auch nicht, und im Verlauf einer halben Stunde änderte sich nichts. Der Jäger und das Mädchen taten derweil so, als würden sie sich in einer ganz normalen Situation befinden. Das beobachtete der Merker nebenher aus dem Augenwinkel. Vielleicht fanden sie die Situation auch gewöhnlich, vielleicht lebten sie gern gefährlich. Immerhin ließen sie ihn in Ruhe.
Und dann hatte er sie, die Lösung ihres Problems, und wie zu erwarten, war sie aus Stein. Überall um sie herum war graue Wacke, teilweise auch mit weißen Marmor-Einschlüssen, und dieser Felsen würde ihm gehorchen, weil er nicht anders könnte. Allerdings müsste Sentry im Verlauf des Prozesses das beeindruckende Schloss beschädigen, und das tat ihm sehr leid, weil es in seinen Augen ein erstaunliches Kulturdenkmal war. Der Felsenadept plante, mit der Grauwacke Kontakt aufzunehmen, eine energetische Verbindung aufzubauen und den Stein dann kleinteilig zu bewegen. So etwas hatte er noch niemals versucht, unmöglich war es aber sicher nicht. Allerdings wäre er seiner Umgebung währenddessen hilflos ausgeliefert, und dieser Gedanke bereitete ihm Bauchschmerzen. Was, wenn noch mehr Leute auftauchten, und er könnte sich weder verteidigen noch fliehen? Sentry konnte bei komplexen Prozessen immer nur in einem System aktiv sein, entweder war er dann Felsenadept oder Mensch. Er hoffte, dass irgendwann beides zugleich gehen würde, aber das war etwas, was er lernen müsste, und vielleicht ging es auch gar nicht. Der Raum, in dem er sich befand, und sein Körper traten komplett in den Hintergrund, sobald er mit einem Gestein zusammenging. Übel war auch, dass er kräftemäßig kaum noch Reserven hatte, falls etwas schieflief. Und die nachfolgende Müdigkeit würde ihn wahrscheinlich umhauen, aber das war ein Problem für nachher. Sentry hatte nur wenig mit seinen Begabungen experimentiert, doch dass er erschöpft sein würde, wusste er ziemlich sicher. Der Merker spähte zu Trankin und der seltsamen, hellblonden Frau herüber und stellte fest, dass sie sich noch unterhielten. Er fragte sich, ob Trankin überhaupt viel mit anderen Leuten redete, Smalltalk wohl eher nicht. Andererseits, wenn Frauen involviert waren, wusste man ja nie.
Doch der immer aufmerksame Mann bemerkte ihn sofort und drehte sich um. »Nun?«, fragte er, während er Sentry auf die ihm eigene Art intensiv betrachtete. Trankin und Marí standen ebenfalls unter Strom. Auch sie hofften darauf, dass er endlich diese verdammte, alte Tür öffnete, ging Sentry auf. Er räusperte sich umständlich, weil er ungern etwas von sich preisgab, was andere besser nicht wissen sollten. Jahrelang hatte er seine Fähigkeiten vor allen versteckt, sich selbst eingeschlossen. Er hatte keine Übung darin, andere um ihre Hilfe oder Unterstützung zu bitten, und das fand er jetzt fast am schlimmsten. Sentry erledigte seine Angelegenheiten üblicherweise allein. Andererseits wusste der Jäger ohnehin schon viel zu viel – zurückdrehen ließ sich das nicht mehr. Also überwand er sich. »Ich mache das Portal jetzt auf«, sagte er zu den anderen, »falls ich es hinkriege.« Er machte eine Pause und sammelte sich kurz, weil er nun den unangenehmen Teil preisgeben müsste. »Dabei wird sich mein Bewusstsein eine Zeitlang von meinem Körper trennen und mit dem Felsen zusammengehen«, spuckte er unglücklich aus. »Ich steuere den Stein, aber dafür muss ich in ihn hinein. Besser aufteilen kann ich mich nicht, und von außen steuern kann ich ihn auch nicht.« Sentry hatte die Luft angehalten, und jetzt atmete er aus. Er kam sich wie ein kleiner Junge vor, der eingestanden hatte, dass er nicht über den großen, hölzernen Bock würde springen können. Doch der Jäger nickte bloß und zog die Augenbrauen hoch. »In Ordnung«, erwiderte Trankin, der begriffen hatte, worum es ihm eigentlich ging, »dann weiß ich Bescheid. Ich werde währenddessen auf dich aufpassen.« Seine Stimme klang wie vorher, aber da waren Besorgnis und Mitgefühl in seinem Blick, weil er sich ihnen ausliefern musste. Sentry hätte gern gewusst, ob der Jäger ihn, Sentry de Bonbaille, sympathisch fand, und ihm war fast so. Es konnte selbstverständlich auch sein, dass er ihn einfach als ein wertvolles Werkzeug betrachtete.
Nachdem er sich kurz gesammelt hatte, stellte Sentry sich vor die Torzarge an der Wand und legte eine Hand darauf sowie die zweite auf das steinerne Tor selbst. Daneben war das antike Zahlenschloss, das er nicht hatte öffnen können. Behutsam berührten seine Fingerspitzen die harten, glatten Oberflächen, die gleich darauf zu vibrieren begann, weil er als Lord erkannt wurde. So weit, so gut, dachte der Merker aufgeregt. Das gehörte wohl so, und seine Kuppen kribbelten wie verrückt. Darauf öffnete er sich vorsichtig und langsam für das matte Gestein, dem er für einen Moment lang ein Bewusstsein schenken würde. Meistens war es ein Geben und Nehmen, denn durch einen Lord wie ihn konnte ein Mineral lernen, wer oder was es war. Die lange Geschichte der Grauwacke und seiner glänzenden, weißen Adern breitete sich offen vor ihm aus. Sand, Feldspat und winzige Bruchstücke vulkanischen Ursprungs waren in grauer Vorzeit vom Land erodiert und über einen nahen Fluss auf den Schelf der Kontinentalplatte und weiter ins Meer gelangt. Zeitalter schmolzen zu Momenten zusammen. Die Sedimentschicht war in die Tiefe abgerutscht in einem großen Trübestrom und dort zusammengepresst worden durch das Gewicht und die Kraft von Wasser und Erdanziehungskraft. Grauwacke war entstanden, ein Konvolut aus Teilchen, die einmal etwas anderes gewesen waren, zerrieben und neu zusammengefügt vom Druck und vom Zahn der Zeit. An die Oberfläche war das neue Gestein gelangt, als ein im Entstehen begriffenes, junges Gebirge es mit sich in die Höhe genommen hatte, dem Pressen der Kontinentalplatten nachgebend. Die Grauwacke war alt, und sie war ein Vieles. Sie hatte die Kraft der Jugend nicht mehr und reagierte langsam. Dennoch bedeutete sie Rettung, sollte sie jetzt sein Werkzeug werden. Nach und nach nahm Sentry ihre Energie auf, sehr bedacht, denn der Stein konnte dadurch an Stabilität einbüßen. Wie ein Rinnsal, das in einer Schale aufgefangen wurde, füllte sie ihn mit ihrer elementaren Kraft. Sentry wollte diesen Vorgang eigentlich genießen, vor allem, weil es ihm vorher nicht gut gegangen war, aber die Kraft fiel unerwartet stark aus. Die Grauwacke hatte bereits ein eigenes Bewusstsein, das sie niemals hätte haben dürfen, und sie griff ihn jetzt an. Diesmal bebte Sentry nicht, während die Energie in ihn strömte, aber er bekam Gänsehaut und all seine Härchen an den Armen stellten sich auf. Auf einmal fühlte er sich gepackt und in den dunkelgrauen Felsen hineingezogen. War er ein Mann? War er Stein? Wie alt war er eigentlich? Seine Gedanken verwirrten sich. Sein Geist wurde träge und entfernte sich von seinem Selbst, seine Augen flatterten und wollten sich schließen. Dann ließ die Muskelspannung seines Körpers nach, und er glitt in Richtung Boden, die Hände ausgestreckt zum Stein.
Und plötzlich spürte er eine Art Alarm. Leise, aber enorm durchdringend, und dieser kam aus seinem eigenen Inneren, als bestünde Sentry aus mehreren Charakteren, die unterschiedlich wach geblieben waren. Unter größter Willensanstrengung gelang es ihm jetzt, sich zusammenzureißen. Er musste raus aus dem Gesäusel, das ihn einlullte wie eine weiche Decke, die ihn ersticken wollte. Das Schloss … sie mussten das … Schloss … öffnen. In seinem Geist sah er nun einen winzigen Augenblick lang eine hagere Gestalt mit sehr hellen, schräg stehenden Augen auftauchen und wieder verschwinden. Diese Figur sah ihn an, aber das Bild flackerte stark, als käme es nicht richtig durch. Gerade noch rechtzeitig kam er ganz zu sich, und er rebellierte und raffte sich gegen den erneuten Versuch, ihn einzukerkern, auf. Er war nicht einem Verlies entronnen, um in einem anderen zu verschwinden, wehrte sich Sentry. Voller Zorn fing er an, die Wacke, die keine Gegenwehr mehr erwartete, zu attackieren und ihren Angriff zu blockieren. Hatte das graue Zeug gerade versucht, ihn zu übertölpeln? Nun zitterte Sentry doch noch, aber diesmal vor Entbehrung, fast schon vor Schmerz, als er den Energiestrom gewaltsam und gegen sein tiefstes Sehnen umkehrte und dem Felsgestein befahl, ganz bestimmte Bereiche der Mechanik des Schlosses zu bewegen. Es war die Kraft der Wacke selbst, die die Bolzen verschieben musste, weshalb der Merker sie gegen den Stein richtete und sich selbst auch gleich freier fühlte. Seine eigene Kraft hätte im Moment nicht ausgereicht. Sentry projizierte zwingende Bilder und verausgabte dabei einen Teil seiner eigenen, energetischen Reserve, die ohnehin schon reduziert war. Das tat ihm nicht gut – er spürte es sofort –, aber im Augenblick war es der einzig gangbare Weg. Er griff nun voll auf die Grauwacke zu, aber sie war nicht besiegt. Sie gehorchte zu zögerlich. Sentry war ein Lord, ein geborenes Oberhaupt von Fels und Stein, und kein natürliches Mineral sollte ihm widerstehen können. Dennoch geschah es. Das war eben verdammt eng gewesen, fluchte er innerlich, es war viel zu knapp! Die Grauwacke gab nach, sie tat jetzt, was er wollte, aber es war zu kräftezehrend. Sentry stand vorgebeugt, die Hände an die Tür und die Zarge gepresst. Sein Mund war eine entschlossene Linie, und er atmete kaum und wenn, dann stoßweise. Dann, fast schon unerwartet, klickte das Schloss ganz leise, und – Stück für Stück – schwang die schwere Tür auf. Er hatte es irgendwie geschafft. Sofort zog er sich zurück, befahl das Gestein in die ursprüngliche Form und ließ die Verbindung fahren. Das war alles nicht normal. Er wusste nicht genug. Woher war dieser Angriff gekommen? Neben der Tür sank der Adept bewusstlos zu Boden.
Als er die Augen wieder aufschlug, sah er sich Auge in Auge mit dem Jäger, der sich über ihn gebeugt hatte und ihm eine Hand auf die Stirn legte. Prüfend sah er in Sentrys Augen, und er fühlte dessen Puls. Er stellte dem Merker ein paar einfache Fragen. Sentry atmete flach und antwortete mehr schlecht als recht, aber wohl ausreichend. Immerhin reagierte er überhaupt auf so einen Mist, dachte er, der nach der Erfahrung eben nicht in bester Stimmung war. Ein paar nassgeschwitzte Locken kräuselten sich auf seiner Stirn, ihn schwindelte, ihm war schlecht und er wusste eigentlich gar nicht so genau, wie ihm war. Grauwacke war über ihm, unter ihm und neben ihm. Er lehnte an der nackten Felswand, natürlich Grauwacke, die nun zum Glück harmlos war. Der Jäger betrachtete ihn ernst, vielleicht auch anteilnehmend, aber das war im spekulativen Bereich, denn Trankin hatte wenig Mimik. Man musste viel aus seinen Handlungen schließen, und jetzt schien er mit dem einverstanden zu sein, was er sah. Möglicherweise hatte der junge Adept einen Achtungserfolg bei dem harten Mann errungen. Die fremde, junge Frau im Blümchenkleid stand neben ihm. »Du hast es geschafft!«, sagte sie ungläubig und voller Anerkennung. Sie lächelte strahlend und erleichtert. Auch ihr konnte man eine gewisse Mattigkeit ansehen, denn sie hatten beide mit Sentry gehofft, und sie selbst hatte sich an dem Tor die Zähne ausgebissen. Nur der Jäger sah nicht müde aus, und das erlaubte er sich sicherlich auch nicht.
Sentry stand auf und ging zu seinen Sachen. Er wankte stark, seine Gelenke wollten nachgeben und ihn im Stich lassen, ausgerechnet jetzt. Ungeschickt hob er den Beutel auf, um dann eilig die Tür zu passieren. Fast wäre er über seine eigenen Füße gestolpert und zu Boden gefallen, doch Trankin war gleich an seiner Seite und hielt ihn aufrecht, während das Mädchen ihm flugs sein Bündel abnahm. So traten die drei durch das offene Tor.