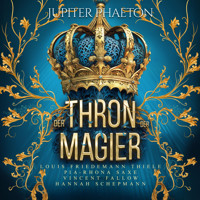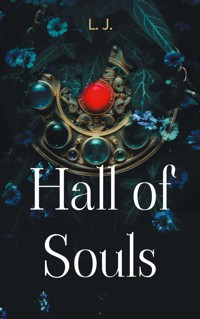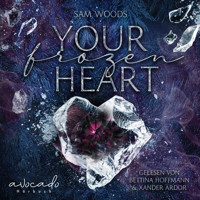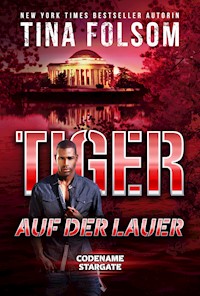Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kampf gegen die Xenlar
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Shift, die energetische Waffe der Xenlar, zersetzt unaufhörlich die Zeitkristalle. Welle auf Welle schickt das parasitäre Kollektiv seine dunkle Energie durch winzige Raum-Zeit-Portale, um die Menschheit zu versklaven. Sentry de Bonbaille, ein junger Lord der Energien und Rätsel, ist bisher nur in der Lage, einzelne Xenlar zu vernichten. Doch er muss einen Schwachpunkt in dem Kollektiv finden, um die Zeitkristalle zu stabilisieren. Denn wenn sie fallen, werden die Parasiten nicht mehr aufzuhalten sein …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 618
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Kampf gegen die Xenlar
Band 3 – Oktaeder der Zeit
S. P. Dwersteg
Impressum
Deutsche Erstausgabe Copyright Gesamtausgabe © 2023 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2023) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-808-9
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
Inhaltsverzeichnis
Zemhair, Herrscher über Montzien
Zemhair, Zensor von Thrùne und gemeinhin als Usurpator von Montzien bekannt, sah den menschlichen Körper, der ihm schon lange als Behausung diente, mehr und mehr verfallen. Menschen, plumpe Zweibeiner aus Fleisch und Blut, waren wie Eintagsfliegen für die parasitären Xenlar. Nützlicher natürlich, weil sie elektrische Impulse erzeugten, von denen seine Spezies sich ernährte. Voller Ernüchterung musterte er sein Spiegelbild. In letzter Zeit sah das Gesicht seines Wirts, den er vor 15 Jahren für sich reklamiert hatte, eingefallen aus. Schmerzen fühlte ein Zensor nicht, und deshalb konnte er die Auflösung der von ihm besessenen Kreatur ausschließlich äußerlich verfolgen. Jeden Tag wurde sie nun gelber, und ihre Fäulnis kam, politisch betrachtet, zur Unzeit.
Mit Alterung und Abnutzungserscheinungen war der Zensor bestens vertraut, doch daran lag es diesmal nicht. Denn das, was seinem Wirtskörper widerfuhr und seine Pläne empfindlich störte, vollzog sich zu schnell. Daher trieb ihn die Befürchtung um, dass der ganze Leib des montzischen Herrschers in Kürze verenden könnte. Dessen Hülle aus Muskeln und Organen war von Anfang an minderwertig und vom Alkohol zerfressen gewesen, aber Zemhair hatte aufgrund der Ziele seines Heimatkollektivs nicht wählen können. Verdammt, diesen Wirtskörper brauchte er noch!
Jedes Mal, wenn er in den polierten Metallspiegel seines dekadenten Schlafgemachs blickte, starrte ihn neuerdings ein gelber Mann mit schweren Tränensäcken an. Seit gut 5000 Jahren operierte der Xenlar unter Menschen, aber das hätte er nicht für möglich gehalten. Selbst die dunklen Pupillen der armseligen Kreatur sahen ihm aus einer grellgelben Masse entgegen, und mit jedem Tag, der verstrich, intensivierte sich die Farbe. In auffallendem Kontrast dazu röteten sich die Handflächen. Auch das musste ein Zeichen für eine Fehlfunktion sein, und Adern an Armen und Beinen traten hervor. Der Bauch war nicht mehr eingefallen, weil Zemhair die Ernährung seines Wirts vergessen hatte, sondern wölbte sich wie eine Beule. Die ganze Hülle war nicht mehr zu gebrauchen, und Zemhair, der von langer Hand plante, ärgerte das über alle Maßen. Es störte sein Kalkül und kam schlechterdings zu früh. Vor ein paar Jahrhunderten hatte er einmal einen gammligen Arm amputieren lassen, weil er den Wirt noch hatte behalten wollen. Eine Zeitlang hatte das funktioniert, aber sein derzeitiger, elender Korpus war definitiv hinüber. Er taugte nur als Madenfutter, und Zemhair brauchte Ersatz.
Natürlich hatte sein Hofstaat Ärzte hinzugezogen, die ihm sinnlose Fragen gestellt hatten. Woher sollte ein Xenlar wissen, wie sich sein Wirtskörper fühlte? Der Mann war lange tot, wenn auch nicht verwest, er war nichts als eine Behausung. Der Zensor hatte nicht antworten können. Dennoch hatten sie ihm trübe Flüssigkeiten verabreicht, und er hatte sie in den Leib gekippt, da die Dummköpfe ihn für ihren vom Adel gewählten Machthaber hielten und es so bleiben musste.
Wahlen waren eine Stilblüte des Chaos, dachte Zemhair angewidert, weil sie Ordnung nur vortäuschten. Vor einem guten Jahr hatte er sie abgeschafft. Ein Xenlarkollektiv brauchte keine Wahlen, weil alle eins und einer Meinung waren. Abstimmungen waren eine sinnlose Verschwendung von Zeit und Ressourcen, und der Erfolg gab dem Imperium recht.
Dass jemand wie er tat, was Menschen für gut befanden, war eine einzige Peinlichkeit. Gebracht hatten die Arzneien seinem Wirtskörper selbstverständlich nichts, und zwei von den Quacksalbern hatte er an der Stadtmauer aufknüpfen lassen. Ganz kurz hatte der Zensor überlegt, einen ihrer Körper zu besiedeln, um mit dem Wirtsthema durch zu sein. Aber hätte ihm das irgendwie weitergeholfen? Nein, und so hatte er’s gelassen.
Jetzt war er gezwungen, eine geplante Entwicklung zu beschleunigen und Alastair de Bonbaille, seinen hochdekorierten Stadtkommandanten, verfrüht zu seinem Wirt zu machen. Der Mann würde ihm weitgehender angehören, als er es sich je träumen lassen hatte, und für den Xenlar stellte sich die spannende Frage, ob der Bonbailler zur endgültigen Selbstaufgabe bereit war. Der Zensor hatte ihn lange im Visier, er hatte auf ihn eingewirkt und ihn für das Xenlarimperium entflammt. Besonders schwer war das nicht gewesen, weil sein zukünftiger Wirt Macht und Gewalt anerkannte und klare Verhältnisse ihn entspannten. Alastair selbst verstand es, Menschen zu brechen und zu unterjochen. Dieser neue Wirt war eine Perle im Meer der erfolglosen Menschenversuche, und Zemhair wollte ihn für sich allein. Nur Alastair stimmte mit seinen Zuchtzielen überein, und der Zensor hatte vor, ihn vielfach zu verpaaren.
Vor ein paar Tagen hatte Zemhair einen geringen Teil seiner Matrix auf ihn übertragen, nur zur Probe und für kurze Zeit, und Alastair hatte sich darüber gefreut. Der entscheidende Versuch stand noch aus, aber der Zensor war guten Mutes, dass sein Stadtkommandant gehorchen würde.
Andernfalls wäre er gezwungen, dessen Seele zu eliminieren und ausschließlich den Körper zu lenken. Es wäre das übliche Vorgehen bei einer Wirtsübernahme, doch Zemhair konnte sich das in Anbetracht des Zeitdrucks, unter dem er neuerdings stand, nicht mehr leisten. Er müsste unbedingt einen Zuchterfolg vorweisen können, wenn sein Heimatkollektiv zu ihnen durchbrechen würde, hatte er entschieden. Für den Zensor ging es dabei um seine nackte Existenz, und etwas anderes anzunehmen, wäre naiv. Denn was mit Zensoren wie ihm geschehen würde, war ungewiss, weil sie den Vorgaben des mächtigen Kollektivs nicht mehr genügten. 5000 Jahre im Exil hatten sie verändert. Besser, er hätte ein paar gute Argumente auf seiner Seite, um seine persönliche Matrix vor der Zerschlagung und Neuordnung zu retten. Unverzichtbarkeit für die Menschenzucht sollte seine entstandene Individualität rechtfertigen, aber für andere Zensoren wie Fra Ingur und die Fürstin von Renignelle sah Zemhair schwarz.
Die Thronfolge in Montzien hatte er über einen Erlass geregelt, den er in sämtlichen Städten laut verlesen ließ. Hilfreich dafür war der lange Stammbaum des Hauses Bonbaille bis in die Gründungszeit des Staates zurück. Dutzende Tauben verbreiteten die Neuigkeit in alle Himmelsrichtungen, und Shift, ihre energetische Waffe, würde Alastairs Herrschaftsanspruch als Nachfolger des Usurpators in den Gehirnen zementieren. Auch außerhalb seines eigenen Gebietes ließ Zemhair das publik machen: im Alten Land, das er nach und nach besetzte und in dem die Feste Murud lag. Noch herrschte in dieser Wildnis Anarchie, aber er gedachte, dessen Herr zu werden. In der Provinz Tersalem mit seiner ergebenen Königin, auf deren Oberschenkel ein Signum prangte, und auch im östlichen Steppenkönigreich, soweit das für Zemhair greifbar war. Dieses Gebiet war schwierig, weil sich das Steppenvolk hartnäckig entzog und nur ein Teil von ihnen komplett von Shift durchdrungen wurde. Die übelste Verteidigungswaffe der umherziehenden Kultur war ihre trockene, unfruchtbare Ebene, in der Unwissende verhungerten und verdursteten. Diese Lektion hatte Zemhair im Laufe der Jahrhunderte gelernt – er hatte menschlichen Blutzoll gelassen und Ressourcen verschwendet. Inzwischen versuchten andere Zensoren dort ihr Glück.
Seit es gelungen war, die Zeitkristalle auf Hugmyndin zu infizieren und seit Korrosion sie zerfraß, waren die Zensoren sicher, dass weitere Xenlar aus der Heimatwelt zu ihnen durchstoßen würden, um die Invasion in Kürze zu Ende zu bringen. Wie in anderen Galaxien würden sie eine Kolonie begründen und ihren Lebensraum erweitern. Für Zemhairs Spezies zählte der Nutzen für die Gesamtheit des Kollektivs. Gnade für Alte, Kranke oder Abweichler kannten sie nicht, auch nicht untereinander.
»Wie lange haben wir noch?«, knurrte er sein Spiegelbild mit gelben Lippen und bräunlichen Zähnen an. Es antwortete ihm nur ein erschöpfter Blick. Die Augen seines Wirts lagen tief, das Gesicht sah totenkopfähnlich aus. Es wurde wirklich Zeit für einen Wechsel, sinnierte der Xenlar. Trotz des Bauches, der wie ein Wassersack vor ihm baumelte, hatte der Menschenkörper abgenommen. Manchmal musste der Zensor minutenlang abwarten, weil der Leib von Krämpfen geschüttelt wurde, nachdem er ihn gefüttert hatte. Es hatte Nachteile, dass ein Xenlar den Zustand seines Wirts nicht fühlen konnte – ein nahezu ketzerischer Gedanke für seinesgleichen. Noch konnten sie mit Menschen aasen, weil das Angebot groß war, aber das würde sich ändern.
Der Usurpator hatte es in den letzten Wochen so arrangiert, dass Alastair und er sich häufiger begegneten. Menschen mussten Vertrauen aufbauen, um zu willigen Werkzeugen zu werden, und sein zukünftiger Wirt sprach darauf an. Er verhielt sich dienstfertig, ergeben, und er schien den Usurpator regelrecht zu vergöttern. Im Gegensatz zu anderen Untertanen kroch der Montzier nicht vor seinem Zensor, und er zeigte auch keinerlei Furcht, sondern etwas wie menschliche Zuneigung. Dementsprechend war der Bonbailler der Einzige in Zemhairs Umgebung, den er noch nie auf die Knie gezwungen hatte und schätzte. Zemhair gierte nach dem kraftvollen Körper und sogar noch mehr nach der Seele des Montziers, und wäre der Zensor ein Mensch, so würde er sich die Finger in Vorfreude einzeln nacheinander ablecken. Es schien nicht nötig zu sein, Alastairs inneren Kern zu beschädigen, weil er sich nie über seinen Meister erheben würde. Der Stadtkommandant trat nach unten, aber er wollte nicht an die Spitze, sondern gesehen werden. Dieser Wirt würde nicht weglaufen oder untreu werden, weil er den Sinn seines Lebens im sklavenhaften Dienst an den Xenlar erkennen würde. Alastair de Bonbaille stand für die Zukunft der Menschheit, für Harmonie mit dem Kollektiv und in seinem Leib wollte Zemhair sämtliche Enklaven des Widerstands bezwingen.
Alastairs Bestimmung
Heute würde der mächtige Usurpator an ihm vollenden, was sie vor Jahren begonnen hatten, und Alastair wollte sich ihm darbringen wie auf einem Altar. Er hatte sich in sein bestes Hemd geworfen und seine Stiefel blank poliert, als ginge er zu einem Stelldichein. Natürlich war er frisch gebadet, die Haare gewaschen und gekämmt, als er sich in seiner schönsten, schwarzen Uniform samt silbernem Wappen auf der Brust im Spiegel betrachtete. Weil er wusste, dass Xenlar mit Nahrung wenig anfangen konnten, hatte er für den Tag ausreichend gegessen. Er warf einen letzten kritischen Blick auf sein Spiegelbild. So könnte er gehen, dachte er dann und rückte seine zwei Einhänder, die mit blitzenden Heften in ihren Scheiden am Gürtel befestigt waren, gerade. Nur er durfte seine Schwerter in Zemhairs Nähe tragen, es war eine große Ehre. Ob der Xenlar mit seinem harten, trainierten Leib zufrieden sein würde? Alastair hatte sich nicht mehr als seine Untergebenen geschont und wollte ihm unbedingt gefallen. Sein Körper und seine Treue waren alles, was er dem Mächtigen anbieten konnte, und fast fühlte er sich wie ein Bettler, der zu einem König ging, um erhört zu werden.
Gelb und krank lag der alte Machthaber in einem Alkoven mit verschnörkelten Türen, als der Bonbailler eintrat und sich formvollendet wie höflich vor ihm verneigte. Der Usurpator hauchte seinen letzten Atem aus, das war unverkennbar, und Alastair fühlte eine furchtbare Sorge in sich aufsteigen. Was würde passieren, wenn der Usurpator seinen Teil des doppelten Signums nicht mehr würde halten können? Der Gedanke bestürzte ihn, und wie angewurzelt blieb der hübsche Soldat stehen. Er wusste nicht ein noch aus.
»Sieh nicht auf den toten Leib, Stadtkommandant. Nur ein paar Nerven zucken noch. Guck zu mir!« Das hörte Alastair in seinem Kopf, und abrupt wandte er sich von dem Usurpator ab. Er drehte sich herum und erblickte vor sich mit blankem Staunen eine atmosphärische Verdichtung mitten im Raum. Sie war schwarz und violett und in permanenter Bewegung, als dächte sie nach oder verschöbe Themen und Komplexe hin und her. In ihr zuckten weiße Blitze. Strudel entstanden und lösten sich kurz darauf wieder auf, um sich immer wieder in neuen Variationen zu bilden. Das also war ein Xenlar ohne Wirt, dachte Alastair hingerissen. Das war Zemhair, sein Meister. Tief und tiefer blickte er in die Wolke hinein, bis er in eine Trance fiel.
Zemhair aber bewegte sich langsam und zielgerichtet auf ihn zu und begann dann, ihn vorsichtig abzutasten und einzuhüllen, bis Alastair von außen nicht mehr sichtbar war. Der Mann Mitte dreißig verharrte, wo er war. Alles würde er geschehen lassen. Er fühlte sich von Zemhair leicht betäubt und entfernte sich von der ihm bekannten Welt, er wurde seiner selbst sehr ungewiss. Es war völlig anders als beim ersten Versuch, wo er die ganze Zeit voll bei Bewusstsein gewesen war und nur etwas hatte loslassen müssen, um dem anderen die Übernahme seines Körpers zu ermöglichen. Doch dieses Mal wollte Zemhair ihn komplett in Besitz nehmen, und das erforderte eben mehr. Auf einmal zeigte Alastair ein paar Angstsymptome, obwohl der Soldat das niemals gewollt hatte und sich dafür schämte. Er begann zu schwitzen, sein Herz schlug viel schneller. Zemhair, der im Gegensatz zu den Zensoren Ingur und Ryshuar keine ausgeprägte sadistische Ader entwickelt hatte, reagierte darauf, indem er ihn stärker betäubte und tiefer in die Trance hineinzog. Er wollte seinem Wirt auf keinen Fall Schmerzen bereiten, um ihr Verhältnis nicht zu beschädigen.
Jetzt war Alastair ganz erfüllt von wunderbaren Strudeln und Wirbeln, die ihn schwindlig machten und ihn seinen Körper mehr und mehr vergessen ließen. Ganz langsam knickte er in den Knien ein. Er hockte sich auf den Boden, und sein Kopf sank stetig nach vorn, bis seine Stirn den Holzboden berührte, als würde er sich verneigen. Er fühlte sich sehr schwach in diesem Moment, aber er konnte viel aushalten, und er wehrte sich nicht. Als Kind hatte er gelernt auszuhalten, und was Alastair heute tat, das tat er aus Überzeugung und nicht unter Zwang. Umso stärker sehnte er sich nach dem einen herrschenden Xenlar, der ihn gleich anschließend wieder aufrichten würde. Nichts anderes wünschte er mehr als die Vereinigung mit Zemhairs Stärke.
»Jetzt«, befahl der Xenlar resolut, als würde er einem geliebten Tier ein Kommando geben. Alastair reagierte sofort und schenkte ihm auch noch den Rest seines Ich, das für ihn keinen Wert mehr hatte. Er gab es auf. Diesen Schritt musste der beteiligte Mensch tun, wusste Zemhair. Wehrte er sich, so konnte ein Xenlar dessen Inneres nur auslöschen, um selbst von Schaden verschont zu bleiben. Bisher hatten sich alle Menschen am Ende gewehrt – nur Alastair ergab sich ihm freiwillig.
Zemhair integrierte seinen neuen Wirt in sein komplexeres Bewusstsein. Für ihn war das etwas Natürliches, da Xenlar in ihrer eigenen Welt nur im Kollektiv vorkamen. Er gab seinem Stadtkommandanten einen Platz ganz am Rande, von dem aus er – in weniger tiefer, dauerhaft aufrechterhaltener Trance – aus der Entfernung wahrnehmen würde, was sein Herr unternahm. Alastairs Bewusstsein war in diesem Dämmerzustand sogar wieder ansprechbar, doch es würde nicht eingreifen, weil es gerade eben vergessen hatte, dass Alastair ein Individuum gewesen war. Erst jetzt war der Soldat ganz von Zemhair besessen, und endlich, endlich waren sie vereint. Für den Stadtkommandanten war dies das größte Glück, und für den Zensor kam es dem relativ nahe, wenn er die Vereinigung mit dem heimatlichen Kollektiv außen vor ließ.
Als der Zensor sich etwa eine halbe Stunde später wieder erhob, blickte er zunächst an seinem neuen Körper herab, und Befriedigung breitete sich auf dem hübschen Gesicht seines Wirts aus, das ganz weiße, gerade Zähne entblößte. Er trat vor den Spiegel in seinem Schlafgemach, und jetzt blickten Zemhair zwei braune Augen aus einem leicht kantigen Gesicht mit dunkelblondem, kurzem Schopf an. Darunter fand er einen kraftstrotzenden, gut bemuskelten Leib, der einen unternehmungslustigen Eindruck vermittelte. Zemhair zog sich die Uniform glatt, straffte die Schultern seines Wirts und drehte sich mehrmals um seine eigene Achse. Seine Rockschöße flogen, ebenso die zwei Schwerter in ihren Scheiden. Der Zensor war ausgesprochen zufrieden.
Vorsichtshalber spürte er dem reduzierten Bewusstsein von Alastair nach, und es war noch genau da, wo es sein sollte. Weit im Hintergrund seiner Matrix, gänzlich ohne Befugnisse und dennoch absolut ruhig und beglückt. Der Zensor teilte ihm seine Zufriedenheit über den Körper mit, als würde er einen Hund tätscheln. Er hatte sich schon viele Menschen herangezogen, aber dieser eine war sein Meisterwerk. Allerdings musste Zemhair noch prüfen, ob Alastairs Bewusstsein auch auf Befehl mitarbeitete.
Seine erste, einfachste Übung war daher, beide Schwerter zu ziehen, und sie in der Luft singen zu lassen. Es war eine schnelle, komplexe Trainingseinheit, die er mit einem menschlichen Leib in 5000 Jahren nicht zustande gebracht hatte, weil sie eine extrem gute Körperbeherrschung erforderte, die ein Xenlar in einem toten Wirt unmöglich erlangen konnte. Selbst Ingur, der häufig und hart trainierte, beherrschte es nicht. Zemhair griff auf Alastairs Fähigkeiten im Schwertkampf zurück, und siehe da, die Waffen wirbelten höchst gekonnt, blitzschnell und elegant durch die Luft, als hätte der Zensor nie etwas anderes getan. Er steckte sie wieder in ihre Scheiden. Anschließend sollte sich sein Wirt auf einem Stuhl niederlassen, aber nicht einfach irgendwie. Zemhair forderte normale Bewegungssequenzen ab. Alastair kam seinem Befehl auch diesmal vorbildlich nach und setzte den gemeinsamen Körper lässig und etwas breitbeinig hin, wie es seine Art war. Der Zensor lobte ihn erneut. Sein Wirt sollte lernen, wie er seinen Meister zufriedenstellte, und Zemhair würde ihn in nächster Zeit weiter abrichten. Zuckerbrot und Peitsche, dachte er. Die Peitsche wäre der Entzug von Aufmerksamkeit. Eine Menschenseele war endlich sein!
Zemhair aß etwas Obst, das er extra hatte herbeischaffen lassen. Er hatte sich vorgenommen, Alastair de Bonbaille vorbildlich zu pflegen, damit er ihm viele Jahre erhalten bleiben würde. Er würde ihn auch regelmäßig trainieren und sein Bewusstsein seine üblichen Sequenzen mit und ohne Sparringspartner abspulen lassen. Der Zensor gab die Befehle, aber dennoch waren sie zu zweit, und Alastair war auf Menschenart einsam und halbverhungert wie ein Xenlar ohne Kollektiv. Vielleicht müssten die Xenlar bei der Menschenaufzucht einen Keil zwischen Eltern und Nachwuchs treiben, kam dem Zensor spontan in den Sinn, und sie vereinsamen. Mit Rindern machte man es so, hatte er beobachtet. Blieben Kälber zu lange bei den Kühen, wurden sie widerspenstig. Man musste sie früh verunsichern.
»Nun«, richtete er sich danach an die treue, lange zerbrochene Psyche seines Wirts, »zeige mir, was du über den Lord der Energien, deinen Bruder Sentry, weißt. Wir müssen uns gut vorbereiten, du und ich, um ihn zu vernichten.«
Eröffnungen
Als Sentry am Morgen in seinem überdimensionierten Schlafzimmer aufwachte, schwebte seine Kristallsphäre mit Xenlar-Energie in ihrem Kern neben seinem Bett. Wie immer inspizierte der Adept diese kurz und versicherte sich, dass das Gefängnis intakt war, bevor er sich wusch und anzog. Dank der Magnetit-Verzierungen an sämtlichen Türrahmen seiner überladenen, antiquierten Wohnung konnte er vom Bett aus herausfinden, wer vor seinen Türen Wache stand, und das war jeden Morgen seine zweite Handlung. Die antike Sicherung fand der Adept sehr praktisch. Sentry hatte viele Versuche mit verschwiegenen Soldaten, Madeleine, Jarosz, dem Verwalter, dessen Kindern und anderen Hausangestellten gemacht, bis er endlich begriffen hatte, auf was er sich genau konzentrieren musste, um zu wissen, wer seine Türen durchschritt oder danebenstand. Die magnetischen Felder tasteten die Leute ab und übermittelten eine Umrisszeichnung sowie ein paar Informationen über die Konstitution. Die Daten waren natürlich eindeutiger, wenn Menschen durch die Türen gingen, aber auch so half es schon. Wusste Sentry, wie die Wachen aussahen, so wusste er auch, wer dort stand, und Fremde sollten es nicht sein.
Nach den morgendlichen Tests zog er sich an. Er war dabei geblieben, schlichte Stücke aus Wollstoffen und Leinen zu bevorzugen und nur Umhänge, Uniformjacken und Gehröcke verzieren oder wertvoll besticken zu lassen. In Ausnahmefällen Schuhe und natürlich den Waffengürtel, der eine wertvolle Schnalle hatte. So konnte er sich in seinen normalen Sachen wohlfühlen und sah draußen herrschaftlich aus. Für den Sommer müsste er sich feudalere Hemden zulegen, hatte Madeleine ihm unmissverständlich nahegelegt, schließlich wäre er ein Lord von Garahon. Den Schneider fragte er besser nicht nach seiner Meinung, überlegte Sentry, während er sich ein dunkelblaues Wollhemd über den Kopf zog und die Knöpfe schloss. Der fand, dass man alles schmücken sollte, und das kam nicht infrage. Na ja, ein paar Rüschen vielleicht – Sentry war schließlich Montzier. Prunk war er aus seiner Kindheit gewohnt, deutlich mehr sogar, als Garahon zu bieten hatte, doch seit er in Murud gefoltert worden war, hatten diese Dinge ihren Wert für ihn verloren. Auch Wohnräume, wie er sie jetzt hatte, hatte er sich nie gewünscht, und was die Kleidung anging, trug er, was nötig war, aber nicht mehr. Im Übrigen behielt er immer ein paar schlichte, graue Sachen und eine alte Mütze für den Fall in seinem Schrank, dass er unerkannt entkommen müsste. Seine Wohnung hatte zwei Ausgänge, die nur er öffnen konnte.
Als er in den Saal mit dem Kamin trat, stand ein Frühstück mit einem Ei, Brot, einem Hörnchen, Ziegenkäse und einer süßen Marmelade, die er nicht einordnen konnte, für ihn parat. Er setzte sich vor den Kamin, begann zu essen, sinnierte einen Moment müde vor sich hin und folgte den Flammen mit den Augen, als ihm auf einmal siedend heiß aufging, dass Marí und Resinà sich nur noch zwei Tagesritte von ihnen entfernt befanden. Das holte Sentry aus seinem noch nicht ganz wachen Zustand und versetzte ihn von jetzt auf gleich in Alarm, weil er sich einerseits auf Resinà freute und ihretwegen aufgeregt war, weil er andererseits aber dringenden Klärungsbedarf mit Eshandra Marí hatte und diese Auseinandersetzung unangenehm werden würde. Vor allem aber müsste er jetzt mit Jarosz darüber reden, der ihm wahrscheinlich Vorhaltungen machen würde, weil er vorher nichts gesagt hatte. Und dummerweise ließ sich dieses Jetzt auch nicht mehr aufschieben, weil er es bereits lange vor sich hergeschoben hatte. Sentry spülte das Stück Brot, das er gerade im Hals hatte und das sich partout nicht mehr schlucken lassen wollte, mithilfe von Bergenientee seine Kehle runter. Mit diesem Konflikt im Nacken machte ihm das Frühstück keine Freude mehr. Besser, er ging sofort zu Jarosz rüber und brachte es hinter sich.
Sentry war ungewöhnlich früh aufgewacht, und so nahm er an, dass der Fürst noch im Esszimmer am Frühstücken war. Normalerweise war dieser lange vor dem Adepten damit fertig und oft schon aus dem Haus oder anderweitig in Anspruch genommen, weshalb sie die Idee eines gemeinsamen Tagesanfangs schon vor Monaten verworfen hatten. Wenn der Felsenadept keinen Termin bei Daosz hatte und auch sonst niemand auf ihn wartete, schlief er bis zehn, was ihm regelmäßig spitze Bemerkungen eintrug, die er stur überhörte. Oft arbeitete er bis spät in die Nacht an allem, was ihm in den Kopf kam, sodass man ihm mangelnden Fleiß zumindest nicht vorwerfen konnte. Sentry beobachtete seine gefangene Xenlar-Probe intensiv, machte Notizen, für wen auch immer, und setzte sie unterschiedlichen Umweltbedingungen aus. Er experimentierte mit verschiedensten Mineralien und Erzkonzentrationen in Gestein, mit winzig kleinen bis hin zu mittleren Energiestärken und versuchte zu lernen, wie er seinen Körper davor schützen könnte, wenn er spontan sehr große Spannungen aufbauen und anschließend Energie fließen lassen müsste. Bisher leider ohne brauchbares Resultat. Dass ihn Entladungen selbst zerstören konnten, konnte er jeden Tag an seinen vernarbten Handflächen ablesen. Nebenher las er Kristalle aus, die er in einem geheimen Raum in einem Felsen entdeckt hatte. Tatsächlich gab es eine antike Bibliothek, bloß konnte dort niemand außer ihm studieren, weil alles Wissen in Mineralien abgelegt war. Sentry fand, dass die früheren Lords zu elitär gedacht hatten, was die Speicherung von Wissen anging. Die Gruppe der Nutzer war mit einer Person viel zu klein, und bis auf seinen engsten Kreis verstand auch niemand, womit er sich überhaupt beschäftigte. Er brauchte unbedingt ein paar Leute zum Mitdenken. Manchmal brachte Sentry daher Themen auf, um sie mit den anderen zu diskutieren oder diese über etwas, das er bemerkt hatte, zu informieren. Und wer, wie der Adept, die Nacht zum Tag machte, brauchte den Schlaf am Morgen. Es war eine einfache Rechnung, und das wusste am Ende auch Jarosz.
Eine Verbündete hatte der Felsenadept völlig unerwartet in Madeleine gefunden, die üblicherweise von allen zuerst wach und auf den Beinen war. Sie war davon überzeugt, dass Sentry nicht eher ins Bett gehen würde, wenn er früher aufstand, und deshalb für das lange Schlafen. Da Tellosz bei Manusz und nicht im Palast wohnte, fühlte sie sich in diesen Hallen für seine Gesundheit zuständig. Ausnahmsweise hatte das mal Vorteile, hatte Sentry gedacht. Auch darum hatte es vorher öfter Streit gegeben, aber der Fürst hatte sich, darauf angesprochen, in seinem Schreibtischstuhl zurückgelehnt und unnachgiebig gezeigt. »Wenn ich eins über dich gelernt habe, Sentry, dann dass du dich nicht gut um dich selbst kümmern kannst«, hatte er gesagt. »Um andere kümmerst du dich liebevoll, aber dich scheinst du weniger zu mögen. Vielleicht spürst du es auch nicht rechtzeitig, wenn es dir schlecht geht, oder du erträgst Schmerzen und Leid aus alter Gewohnheit viel zu lange. Darauf tippe ich. Lass Madeleine und Tellosz über dich wachen. Madeleine macht das bei mir schon jahrelang, und ich habe es weit weniger nötig.« Irgendwie hatte Jarosz ins Schwarze getroffen, und Sentry hatte sichtbar angefangen zu zittern. »Da hast du’s wieder«, hatte der Fürst gesagt und ihm einen Stuhl zugeschoben. Er hatte ihm durch die Locken gestrichen, nachdem Sentry sich hingesetzt hatte, und dann weitergearbeitet, als wäre er nie unterbrochen worden. Sentry hatte es nicht wieder versucht, das Thema war beendet.
Mutig klopfte er jetzt bei Jarosz an und trat direkt danach ein. Im ersten Moment wirkte der Fürst hocherfreut über seinen Besuch, aber nach der Begrüßung fiel ihm die ungewöhnliche Uhrzeit auf. Außerdem wirkte der junge Adept merkwürdig verlegen. »Du willst doch irgendwas von mir. Sonst wärst du längst nicht hier«, äußerte er daher misstrauisch. Sentry ließ sich auf einen Stuhl über Eck von ihm fallen und entwendete ein halbes Hörnchen vom Teller des Fürsten, um etwas Zeit zu gewinnen. Er riss Stücke davon ab, krümelte den Tisch voll und steckte sie sich in den Mund. Jarosz verkniff sich einen Kommentar, der ihm auf der Zunge lag, und wartete. Er hatte sich daran gewöhnt, dass Abwarten in Gesprächen mit Sentry dazugehörte, aber gerade fiel es ihm schwer. Musste der Mann seinen ganzen Tisch vollkrümeln?
»Marí und Resinà werden in zwei Tagen hier sein«, offenbarte Sentry ihm schließlich. Er hatte sich ausnahmsweise entschieden, nicht um den heißen Brei herumzureden. Nun schien Jarosz sein Bissen im Hals stecken zu bleiben. Auch er griff zum Tee, um besser schlucken zu können. Anschließend räusperte er sich. »Wie kannst du das so genau wissen?«, erfragte er mit einem Blick auf seinen Teller, als würde er überlegen, was er zunächst essen wollte. Der Teller war allerdings weitgehend leer. »Weil Marí und ich uns gegenseitig orten können, Jarosz«, gab Sentry ungern zu. »Und weil sie mich während der Vereidigung von Kerí hintergangen und sich mit mir verknüpft hat. Allerdings viel schwächer, und zu ihrem Leidwesen hat sie sich verschätzt«, analysierte er gleich weiter. »Ich glaube, dass sie es längst bereut hat. Mein Energieniveau ist für sie und diese Art der Verlinkung zu heftig. Mich stört hauptsächlich, dass sie mich nicht um meine Einwilligung gebeten hat. Ich hab’s ihr, ehrlich gesagt, absichtlich nicht leicht gemacht.«
»Dann«, seufzte der Fürst, sah ihn an und lehnte sich unglücklich in seinem Stuhl zurück, »kommt sie deshalb her.« Gegessen hatte Jarosz für den Moment definitiv genug. Sein Appetit war wie weggeblasen, obwohl er das halbe Hörnchen, das Sentry sich genommen hatte, eben noch hatte essen wollen. »Sie kommt hauptsächlich deinetwegen, Jarosz, da bin ich mir ganz sicher«, entgegnete Sentry schnell, um ihn zu beruhigen. »Aber sie und ich, wir müssen das klären. Und weil ich kürzlich von Verrat betroffen war, will ich sie scannen. Ich kann das auch bei Nicht-Telepathen. Die Ergebnisse sind nicht ganz so leicht zu gewinnen, und es ist unangenehmer für sie, weil sie dafür von Natur aus nicht offen sind. Das hat zumindest Kerí mir rückgemeldet.« Jarosz schwieg und betrachtete ihn. »Du vertraust ihr nicht?«, wollte er wissen, und jetzt sah er wirklich bekümmert aus. »Ich vertraue ihr«, erklärte Sentry etwas hektisch, »aber Marí ist Marí. Sie hat einen ganz eigenen Kopf, und Kerí meidet sie nicht ohne Grund, obwohl sie sie liebt. Kein vernünftiger Mensch würde ganz allein versuchen, in U’Sanforlan einzusteigen. Nicht, wenn er die Geschichte der verlorenen Stadt kennen würde. Und wer weiß, mit wie vielen Menschen Marí noch verknüpft ist, oder wo sie sich Vorteile versprochen hat. Dass sie mir willentlich schaden würde, halte ich für ausgeschlossen. Aber sie hätte meine schlechte Verfassung nicht ausnutzen dürfen, und ich möchte mich revanchieren. Sie hat versucht, mir eine dünne Leine anzulegen, Jarosz. Seit einer Weile erlebt sie, wie es ist, wenn ich daran ziehe. Natürlich nur vorsichtig – ich will sie ja nicht verletzen.«
Wenig begeistert schwieg der Fürst, er ließ das sacken. Er konnte nichts Stichhaltiges gegen den Scan vorbringen, auch als Abschreckung vor weiteren Missetaten nicht. Marí tat, was sie für richtig hielt, und deshalb hatte er ihr anfangs misstraut. Deshalb hatte er sich aber auch in sie verliebt. Wenn ihm das passiert wäre, würde er viel vehementer als Sentry reagieren, vermutete der Fürst, vor allem, wenn er vorher in Murud eingekerkert gewesen wäre. Von daher würde Marí einen geringen Preis für ihre Übergriffigkeit zahlen. »Das ist deine Entscheidung«, äußerte er daher, nachdem er alles gründlich erwogen hatte. Jarosz nahm seine Teetasse vom Tisch und trank ein paar Schlucke, weil sein Mund sich trocken anfühlte. »Was deine und unsere Sicherheit angeht, hast du in jedem Fall recht.« Er studierte den Inhalt der Tasse. »Zumindest, wenn ich einen neutralen Blickwinkel einnehme«, gab er etwas später wenig begeistert zu. Er stellte die Tasse ab. »Warum muss das jetzt auch noch kompliziert sein?«, beklagte er sich schließlich, ohne eine Antwort zu wollen. Er hob beide Hände ein Stück in die Luft und ließ sie laut auf den Tisch fallen, um seinen Gefühlen Luft zu machen. Anschließend nagelte er Sentry mit seinen Augen fest, und der Adept ahnte, was jetzt kommen würde.
»Warum hast du mich nicht eingeweiht?«, legte der Fürst auch schon los. »Du hast es den ganzen Weg über gewusst, die ganze Zeit über, auch hier, und bis heute hast du nichts gesagt.« Sentry zog peinlich berührt die Augenbrauen hoch. »Anfangs war es das kleinste meiner Probleme, Jarosz, falls du dich erinnern kannst«, erwiderte er, »und danach: Was hätte es dir denn gebracht?« Er verteidigte sich nur halbherzig, weil der Vorwurf leider berechtigt war. »Du und Marí, ihr mögt euch, und ich wollte da nicht stören«, fuhr er leicht gestikulierend fort. »Außerdem bin ich öfter feige, wenn es persönlich wird, und das ist dir auch nicht ganz fremd, wenn ich mich nicht irre.« Sentry schwieg und Jarosz sagte nichts. Der letzte Punkt war keiner, über den sie weiterreden wollten. Beide nicht.
Irgendwann schwächte sich ärgerliches Anstarren zu normalem Gucken ab. Weil der Adept keine Tasse hatte, um damit zu hantieren, holte er Monokel aus der Tasche und spielte damit herum. Er hatte es Daosz wieder abgenommen, um mit ihm zusammen über die Kristallsphäre zu beraten. »Ich habe mir einen Vorschlag überlegt«, eröffnete er seinem väterlichen Freund, ohne ihn anzugucken. »Wie wäre es, wenn du Marí entgegenreiten würdest und ich euch am Taleingang erwarten würde? Ich möchte das sofort regeln, wenn sie in Garahon ankommt. Damit es vom Tisch ist und auch wegen Resinà. Du kannst die paar Minuten einfach abwarten. Marí wird sicherlich ahnen, was auf sie zukommt. Dass ich das nicht auf sich beruhen lasse, muss sie doch wissen. Für mich steht ohnehin die Frage im Vordergrund, ob ich die Verbindung auflösen oder vertiefen soll. So wie sie jetzt ist, taugt sie nicht.«
»Wo genau sind Marí und Resinà denn?«, fragte der Fürst auf einmal viel zugänglicher. Weil er nun wusste, wie bald er die Frau mit den langen, weißblonden Haaren wiedersehen würde, fand er trotz seiner Verstimmung ein paar Schmetterlinge in seinem Bauch, die dort hartnäckig mit den Flügeln schlugen. Sentry antwortete, indem er sich mit Jarosz verlinkte und ihm ihr Signal weiterleitete. »Keine zwei Tagesritte mehr«, gab er dem jungen Lord kurz darauf recht. »Ich könnte morgen ganz früh aufbrechen. Das heißt, eventuell. Mitten am Nachmittag wären wir an den Toren.« Der Fürst verstummte, und ausnahmsweise musste Sentry darauf warten, dass er weiterredete.
»Ich werde mich liebend gern heraushalten«, äußerte er endlich mit einem Seufzen. »Das mache ich bei persönlichen Konflikten ohnehin am liebsten. Manchmal hast du mich allerdings nicht gelassen.« Er betrachtete den jungen Mann neben ihm und schnaubte. »Seit ich dich kennengelernt habe, ist mein Leben viel erfüllter geworden, aber auch viel anstrengender. Sorgen habe ich mir vorher ebenfalls gemacht, aber sie waren unpersönlicher. Ich konnte dich von Anfang an gut leiden, schon als deine Zellentür aufschwang, auch wenn ich mir bis heute keinen Reim darauf machen kann. Ich hätte dir in den dunklen Gängen sonst nie den Rücken zugedreht. Jetzt habe ich mich das erste Mal seit dem Attentat auf meine Familie verliebt, und ich hoffe inständig, dass bei Marí nichts Bedenkliches zutage kommt. Wenn du etwas finden solltest, dann musst du es mir unbedingt sofort sagen.« Den letzten Satz hatte er bittend gesagt.
»Ich versprech’s«, antwortete der Felsenadept pflichtschuldig, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, »bleib einfach in meiner Nähe. Wir lassen die anderen voranreiten. Diesmal werde ich mich nicht drücken.«
Der Fürst wollte sich den Tag nicht verderben lassen und wechselte abrupt das Thema. »Ich will gleich zu Daosz«, meinte er, »hast du Lust mitzukommen? Ich habe noch keinen Trainingspartner.« Er zog die Augenbrauen hoch und blickte herausfordernd. »Ich hol nur schnell mein Frühstück rüber, Jarosz«, antwortete der junge Mann erleichtert, der seinen hungrigen Magen auf einmal deutlich spüren konnte. Er sprang auf. Auf dem Trainingsplatz würde er jede Kalorie brauchen, dachte er. »Können wir aufessen oder ist es dafür schon zu spät? Ich schulde dir ein halbes Hörnchen!«
Der Fürst genoss seine Gesellschaft – Sentry sprühte vor Lebendigkeit, wenn er in der entsprechenden Stimmung war. »Jetzt hältst du mich wieder auf!«, erwiderte er übertrieben vorwurfsvoll und lachte erfreut. »Deinetwegen werde ich zu spät sein, und du weißt, wie Daosz dann ist.« Der Fürst rief nach einer Wache und ließ dem Schwertmeister ausrichten, dass sie zu zweit und verspätet ankommen würden. Heute hatte er sich ausnahmsweise im Dojo angemeldet, weil es draußen unwirtlich kalt war. Verstimmt sein würde der Schwertmeister in jeden Fall, aber so brachten sie ihm ausreichend Achtung entgegen, damit er nach dem ersten Gegrummel wieder zum Tagesgeschäft übergehen könnte.
Jarosz verließ Garahon am Morgen des Folgetages in Begleitung von zwanzig Bewaffneten. Seit sie Verrat in den eigenen Reihen erlebt hatten, hielt er es für besser, auch in der direkten Umgebung seines Fürstentums doppelt Vorsicht walten zu lassen. Schon in der Nacht hatte er Scouts vorangeschickt, die sämtlich Telepathen waren, um sofort informiert werden zu können. Angriffe waren unwahrscheinlich, vor allem bei meterhohem Schnee, aber nicht unmöglich. Er selbst würde eine so stark befestigte Anlage wie Garahon nur dann ins Visier nehmen, wenn es den Verteidigern wenig wahrscheinlich erschien.
Jarosz hatte im letzten Jahrzehnt nicht an seinem Leben gehangen, sondern einfach seine Pflichten erfüllt. Inzwischen hatte er etwas Lebensfreude wiedergefunden, und er war als Fürst kaum zu ersetzen, weshalb ihm Vorsicht geboten schien. Ein weiterer Grund war, dass Tellosz inzwischen so eng mit Sentry verbunden war, dass er die Führung von Garahon nicht übernehmen könnte, jedenfalls nicht dauerhaft. Tellosz war ein Lord der Heilung, nicht einfach nur ein besonderer Krieger, und das hatte der Fürst nicht geahnt. Diese Tatsache machte ihn zu einer Lebensversicherung für den Felsenadepten, aber deshalb war er auch ein lohnendes Ziel für Anschläge. Fürst Jarosz hatte sich seine Nachfolge sorgfältig überlegt und Tellosz über Jahre ausgebildet, aber den neuesten Entwicklungen hielt das alles nicht mehr stand. Er würde sein Testament überdenken und ändern, dachte er, zumal Tellosz eine gute Wahl für kriegerische, krisengeschüttelte Zeiten war, aber nicht für Friedenszeiten und Zeiten des Aufbaus, die hoffentlich kommen würden. Neuerdings fand der Fürst viele Gründe, um noch lange am Leben zu bleiben, und endlich fiel es ihm auf. Die Idee eines Lächelns stahl sich in seine herben Gesichtszüge.
Auf ihrem Weg bergab wählten sie Pfade, auf denen der Schnee niemals hoch lag. Es war eine Frage der Windrichtung und seiner Stärke. In den eisigen Höhen wurde Niederschlag an bestimmten Stellen ins Tal gepustet, denn auch die Zuwege nach Garahon entsprachen der durchgeplanten, klugen Architektur der Adepten der Vorzeit und gehörten zu den Verteidigungsanlagen. Man musste sie kennen, um zum Tal durchzukommen und nicht abzustürzen oder in eine Gletscherspalte zu rutschen. Sollten sich Feinde nähern, so konnten Lawinen ausgelöst werden, und für jeden Pfad gab es eine Sicherung. Verrat im Inneren und Unterwanderung waren ihre ärgsten Gegner, nicht Angriffe von außen. In Garahon lebte man schlicht, weshalb eine gewisse Charakterfestigkeit notwendig war, um hier glücklich zu sein. Festungen wie die ihre konnten nur von innen aufgebrochen werden, solange sie ausreichend besetzt waren.
Jarosz und seine Garde waren in warme Fellumhänge gewickelt, während ihre stämmigen, zähen Pferde sie bergab trugen. Sie hatten es nicht weit und würden bald wieder umkehren, dachte er. Marí, Resinà und die anderen waren ebenfalls früh aufgebrochen und kamen zügig voran. Sentry leitete ihm Marís Signatur weiter, und dafür war Jarosz dankbar, weil er sich sonst ständig gefragt hätte, wo sie wären. So wusste er es. Wie immer um diese Jahreszeit blies der Wind kalt aus Osten. Das Wetter war gut, aber es würde noch Schnee geben. Als erfahrener Garahoner konnte er das riechen. Es lag im Wind.
Kurz vor Garahon
Marí und Resinà froren bis auf die Knochen, egal in wie viele Felle sie sich hüllten und wie tief sie ihre Mützen in die Stirnen zogen. Im Tal von Garahon würde es angenehmer sein, hatten Feral, Rural und Telka ihnen versprochen, und darauf hofften sie, jede für sich allein, weil sie ihre Zähne zusammenbissen und nicht eine Klage über ihre Lippen kam. Resinà war echte Winter nicht gewöhnt, da es um Tusso herum mild blieb. Marí kannte Kälte gut, aber der stetig wehende, eisige Wind machte sie mürbe, und die drei Garahoner schienen nichts davon zu bemerken. Von Weitem, dachte die Eshandrin, wäre es unmöglich auszumachen, wer von ihnen auf welchem Reitpferd saß. Fünf Fellberge, mit Packpferd sechs, bewegten sich auf jeweils vier kräftigen, relativ kurzen Beinen voran. Allenfalls sie selbst könnte durch ihre geringe Körpergröße auffallen, aber auch Telka war nicht gerade hochgewachsen. Resinà war fast so groß wie Sentry und ging unter den Pelzen als Mann durch. Hin und wieder mussten sie den langhaarigen Pferden Pausen gönnen, und wenn es zu steil wurde, führten sie sie zu Fuß. Die Rasse war genügsam, an extreme Temperaturen angepasst. Mit ihren Hufen legten die Tiere Gras und Blätter frei, die sie mit Genuss verzehrten. Je kälter der Winter werden würde, desto weniger Futter würden sie brauchen, wurde Marí belehrt. Die gedrungenen Pferde fraßen sich im Sommer Winterspeck an, und ihr Stoffwechsel veränderte sich mit der Temperatur, ebenso die Zusammensetzung ihres Blutes, das nicht einfror. Ausschließlich Eis und Schnee müsste man von Zeit zu Zeit aus dem Pelz bürsten, damit ihnen warm bleiben würde.
Resinà hatte diese Pferderasse noch nie gesehen, sie war fasziniert von den freundlichen Tieren. Manchmal vergrub sie ihre Hände unter der dichten Mähne ihres Wallachs, der sich das gefallen ließ, obwohl er die Kälte ihrer Finger zumindest etwas spüren musste. Dort war es warm wie in einem gut geheizten Raum. In der letzten Nacht hatten Telka und die zwei Männer das erste Mal ein Lagerfeuer entzündet, und Feral war für sie auf die Jagd gegangen. Es gab hier viel Wild, und so war er mit einer Gämse wieder erschienen, die sie über dem Feuer gebraten und anschließend verzehrt hatten. Es war ein Festmahl für sie gewesen, und endlich war Resinà und Marí wieder warm geworden, und sie hatten danach gut schlafen können. Ihre Begleiter hatten die Gefahr durch die nächtliche Kälte für sie höher eingeschätzt als die durch Entdeckung, hatte Marí gefolgert. Aber sie hatten alle nichts darüber verlauten lassen, weil sie, wie Marí richtig geschlossen hatte, Telepathen waren und die Dinge längst geklärt hatten. Genaugenommen war Telka aufgefallen, dass Resinà im Tagesverlauf immer wieder blaue Lippen bekam, was auf Dauer nur schlecht sein konnte. Daher hatten sie keine andere Wahl gehabt. Alle drei Garahoner waren mental begabt, Feral am meisten von ihnen. Er hatte sich selbst, Telka und Rural von Anfang an verlinkt und die Verbindung nicht mehr unterbrochen, auch weil er sich nicht sicher war, ob er sie wieder so gut hinbekommen würde. Etwas Glück war immer dabei. Sie hatten dadurch die Möglichkeit, sich abzustimmen, ohne über die anderen zwei in ihrer Gegenwart sprechen zu müssen.
Garahoner lernten von klein auf, dem Winter zu trotzen, aber für Flachländer wie Resinà konnte das Wetter schnell tödlich werden. Die Montzierin wusste nicht einmal, körperliche Signale richtig zu deuten, hatten sie bemerkt. Müdigkeit zum Beispiel. Glücklicherweise hatte Telka die beiden im Auge behalten. Was sich Feral und ihr durch die Verlinkung ebenso mitgeteilt hatte, war, dass Rural unter der Reise noch mehr litt, und so war das Feuer vor allem auch für ihn gewesen. Darüber hatten sie kein Wort verloren, um ihn nicht zu beschämen. Nicht einmal in Gedanken. Sie hatten sich rein über Blicke verständigt, und der jüngere Feral hatte sich vorgenommen, mit seinem Bruder Klartext zu reden, sobald das Tor von Garahon hinter ihnen zufallen würde. Auch mit dem Fürsten würde er sprechen, dachte Feral wildentschlossen, egal, was Rural davon halten würde. Jarosz von Garahon hatte eine Fürsorgepflicht ihm gegenüber.
Das Wetter war grau, sie ritten zügig im Schritt. Manchmal lag der Schnee jetzt höher, weshalb es für die Tiere anstrengender wurde, und das Gefälle nahm stetig zu. Nur das Packpferd schüttelte fröhlich seine Mähne, weil es kurz vor dem Ziel nicht mehr viel zu tragen hatte und wusste, dass eine Pferdekoppel und Heu im Tal von Garahon warteten.
Marí ritt an dritter Position. Sie war in Wäldern und Bergen aufgewachsen und kam gut zurecht, doch ganz plötzlich hatte sie ein mulmiges Gefühl. Sie hob ihre Hand, die in einem viel zu großen Fellhandschuh steckte, und hielt ihre braune, zottelige Stute an. Vor ihnen lag eine enge Wegstelle mit einem Steilhang darüber, und irgendetwas schien hier nicht zu stimmen. Rural, der gerade ganz hinten ritt, meldete sich umgehend bei den anderen zwei Garahonern, die vorn waren und nichts bemerkt hatten. Feral und Telka wendeten ihre Tiere und kamen zurück. »Was ist?«, fragte Feral die Eshandrin. »Da vorne stimmt etwas nicht«, gab Marí zur Antwort. Sie kniff ihre Augen leicht zusammen und deutete auf den Engpass. »Gibt es einen Umweg, den wir nehmen können?«
»Wie kommst du darauf?«, hakte Telka ein, die jetzt auch kritisch in die Richtung spähte. »Das kann ich nicht sagen«, erwiderte Marí entschuldigend. Sie zuckte ihre schmalen Schultern unter den schweren Fellen, »aber diese Wegstecke am Hang sollten wir umgehen. Möglicherweise ein Hinterhalt.« Ihr Verhalten verschlug Telka und Feral, die sich lieber an Tatsachen hielten, die Sprache. Resinà äußerte vorsichtig: »Vor uns sind keine Spuren im Schnee, Marí. Hier war länger niemand mehr.« Doch die Eshandrin blieb bei ihrer Meinung. Rural meldete sich schließlich von hinten und stärkte ihr den Rücken. »Eshandrin haben eine ungewöhnliche Sensitivität für Energien«, erklärte er mit müder Stimme, »und sie sind in Wald und Bergen zuhause. Wenn sie uns warnt, können wir nicht so tun, als wäre nichts. Es wird einen Grund geben.«
Fürst Jarosz hatte den dreien unmissverständlich klar gemacht, dass getan werden würde, was Rural für richtig hielt, dem er damit auch die Verantwortung übertragen hatte. »Ich sehe nach«, kündigte Telka deshalb an und stieg ab. Sie reichte Feral ihre Zügel. »Ich drehe eine Runde und stoße in Kürze wieder zu euch. Reitet ein Stück zurück und erwartet mich dort.« Behände verschwand sie im Wald. Die vier anderen bewegten sich an einen Ort zurück, an dem der Weg breit genug war, um dort zu warten, aber auch geschützt genug, um nicht sofort gesehen zu werden. Sie führten die Pferde ein Stück in den tiefer gelegenen Nadelwald hinein den Hang hinab. Es begann in dicken Flocken zu schneien, und ihre Spuren waren schnell nicht mehr zu sehen.
Sie warteten, die Kälte biss, und die Zeit wurde ihnen lang. »Soll ich sie suchen gehen?«, fragte Feral nach einer Weile ungeduldig. »Du bleibst hier!«, knurrte der sonst so freundliche Rural, der jetzt gerader stand als die ganze Reise über und mit höchster Aufmerksamkeit um sich spähte. Er hielt seinen Reiterbogen in den Händen und konzentrierte sich auf ihre Umgebung. »Entweder sie kommt gleich wieder her, oder sie stirbt dort. Wir verraten uns, wenn noch jemand geht. Du weißt genau, dass du hierbleiben musst.« Feral warf ihm einen verunsicherten Blick zu. »Ich kann versuchen, mich beim Fürsten zu melden«, schlug er vor. »Soll ich?«
»Warten wir noch eine Weile«, entgegnete Rural, der der ältere und erfahrenere der Brüder war, »der Fürst kann uns hier nicht helfen.« Vor seiner schweren Verletzung war er ein sehr guter Schwertkämpfer gewesen und einer der Hoffnungsträger des Fürsten, auch weil er besser durchdachte Entscheidungen treffen konnte als die meisten. Sein Bruder Feral hatte mental die stärkere Begabung, mit dem Schwert war er nur bodenständig, und er war viel leichter zu irritieren. Plötzlich schallte ein Ruf zu ihnen herüber – nicht Telka, sondern eine Männerstimme. Andere, leisere Stimmen folgten, als würde man sich abstimmen. »Jetzt haben sie sie bemerkt«, äußerte Rural, und als Feral ihn flehentlich ansah, schüttelte er den Kopf. »Wir warten«, bekräftigte er. Weiter hörten sie nichts, aber sie konnten durch die Verlinkung beide fühlen, dass Telka am Leben war. Sie bewegte sich auf ihre kleine Gruppe zu.
Nach einer knappen halben Stunde tauchte die Garahonerin, die einen Umweg hatte nehmen müssen, bei ihnen auf. Sie war außer Puste und verletzt, ein Pfeil steckte in ihrer Schulter, doch Telka ließ sich den Schmerz nicht anmerken. Sie setzte sich auf einen Findling, und Feral zog ihr das Geschoss vorsichtig aus Körper und Fellen. Das Leder hatte das Schlimmste verhindert. »Das ist einer von unseren Pfeilen«, bemerkte er bestürzt, und Rural, der sich die ganze Zeit auf ihr Umfeld konzentrierte, sagte nichts. Er schien nicht überrascht. »Näh die Wunde, so schnell du kannst«, trieb er seinen jüngeren Bruder stattdessen an, »sie werden gleich hier sein. Wie viele sind es Telka?«
»Ich habe sechs gezählt«, berichtete sie gepresst, weil Feral schon anfing, »aber es sind ein paar mehr.«
»Dann binden wir die Pferde an und platzieren uns so, dass wir sie überraschen können«, entschied Rural.
Er drehte sich zu Resinà. »Versteck dich im Wald«, befahl er, »du kannst uns hier nicht helfen. Lauf bergab und klettere auf einen Baum. Mach schnell, damit der Schneefall deine Spuren noch verwischt.«
Dann war die Reihe an Marí, die sich von ihm richtiggehend taxiert fühlte. »Du bist vermutlich eine gefährliche Gegnerin«, schätzte er, »aber du musst die Felle auf dem Pferd lassen. Sie behindern dich.« Marí, die das längst erwogen hatte, stimmte zu und legte ihren Pelzüberwurf auf den Sattel ihres Pferdes. Unter ihrer Wolljacke trug sie ein ganz leichtes Kettenhemd aus ihrer Heimat und darunter weiches Leder. Anschließend kletterte sie in der Nähe von Rural behände auf eine alte Tanne, um ihn zu beschützen. Diesen Mann hatte Sentry mit letzter Kraft gerettet, und sie wollte ihn nicht sterben sehen. Eshandra Marí hatte sich vier Wurfmesser in ihren Gürtel gesteckt sowie ihren ausziehbaren Stock für den Nahkampf. Er war aus einer harten Legierung und konnte einem Schwert standhalten. Es war ungewohnt für sie zu tun, was ein jüngerer Mann anordnete, aber er war hier auf heimatlichem Terrain, verantwortlich und sie nicht. Im Übrigen hätte sie genauso entschieden. Vor lauter Aufregung spürte sie die winterliche Kälte nicht mehr. Marí hatte schon Mensch gegen Mensch gekämpft, aber es war ihr halbes Leben her.
Rural, der davon ausging, dass die Wegelagerer nicht einfach nur den Hang hinab kommen würden, verbarg sich in der Nähe der Pferde in einem Gehölz. Auf der einen Seite war er durch die Tiere vor Pfeilen geschützt, auf den anderen verdeckte ihn ein dichter Busch. Auf einen Baum klettern und wieder herunterspringen konnte er nicht.
Feral sollte den Hang wieder hoch und den Angreifern entgegengehen. Er nahm seinen Bogen mit und kletterte in eine alte Fichte. In seiner grauen Uniform war er nicht zu sehen.
Telka blieb am Boden. Sie ließ sich unter ihren weißgrauen Fellen in einer Senke nieder, und nach kurzer Zeit war sie eingeschneit. Klettern kam auch für sie nicht in Frage, weil eben noch ein Pfeil in ihrer Schulter gesteckt hatte.
Jetzt hieß es warten.
Die Verräter kamen gemeinsam, und doch erschienen sie einer nach dem anderen, weil sie geplant hatten, ihre Opfer zu umzingeln. Als sie diese nicht vorfanden wie erwartet, bewegten sie sich zusammen in Richtung der Tiere. Zu dieser Jahreszeit reichte das Entwenden von Pferden, Nahrung und Ausrüstung, um andere umzubringen, und es minimierte das Risiko für die Angreifer.
Sobald sie an Feral vorbei waren, schoss dieser zwei der Männer von seiner Eiche aus in den Rücken und in den Hals und gab dadurch sein Versteck preis. Der im Hals Getroffene starb schnell und röchelnd, weil die Schlagader durchtrennt war, der zweite Mann ging zu Boden und erwartete den Tod. Eilig ließ Feral sich vom Baum gleiten. Er huschte ins Unterholz, schnell und leise, da er nicht zum Ziel für feindliche Bogengeschosse werden wollte. Der junge Garahoner duckte sich und zog seine Machete, um sie gleich von der Seite her zu attackieren. Und er wollte Rural beschützen.
Elf Angreifer hatte dieser inzwischen gezählt. Drei von ihnen trugen ihre heimatliche Uniform, andere sahen aus wie verarmte Söldner, abgerissen und ungepflegt. Sie mussten sie angeworben haben. »Verräter«, fluchte Rural leise und schob dann seine aufkeimende Wut beiseite, um einen kühlen Kopf und eine ruhige Hand zu haben. Auf einen Mann legte er an, sorgfältig zielend. Dann ließ er seine Bogensehne singen und erledigte den Garahoner, der er als Anführer identifiziert hatte. Sie kannten sich vom Sehen, er und Grisz. Der Mann war ein loser Bekannter von Tellosz. Rurals Pfeilschaft samt braunen Truthahnfedern ragte aus der Stirn des dominanten Mannes, als er taumelnd zu Boden ging. Blut lief über seine Stirn und eine Wange und färbte den Schnee. Wie in Zeitlupe nahm der Schütze Grisz' Gesichtsausdruck wahr: entgeistert. Rural griff jetzt ebenfalls zu seiner Machete.
Sämtliche Angreifer kamen schnell auf ihn zu. Feral kam angerannt, um ihm beizustehen. Telka sprang aus ihrer Senke auf und überrumpelte sie von der Seite. Zwei schwarz Gekleidete tötete Marí von oben aus ihrer Tanne, indem sie ihre Messer warf. Doch ihre anderen Wurfmesser gingen fehl, und so blieb ihr nur ihr ausziehbarer Stab, um in den Kampf einzugreifen. Sie ließ sich am Stamm herabgleiten und wurde erst wahrgenommen, als sie unten war. Sechs Angreifer standen ihnen gegenüber, und sie waren nur zu viert. Unter anderen Umständen wäre das nicht bedenklich gewesen, fand Marí, aber Rural hatte Schmerzen und Telka Blut verloren. Beide würden nicht lange durchhalten. Nur Feral und sie selbst waren auf der Höhe dessen, was sie leisten konnten, und deshalb müsste alles schnell gehen.
Es folgte, was folgen musste und was Marí in einem Kampf schon immer zu ihrem Vorteil gereicht hatte. Die Angreifer nahmen sie nicht ernst. Eine kleine, zierliche Frau mit langen Haaren und einem Stab hatte nichts Furchterregendes an sich, und sämtliche Verräter stürzten sich auf die Männer und Telka, die kurze, dunkle Haare hatte und ihre Machete schwang. Marí sahen sie als Beute an. Nichts anderes hatte die Eshandrin erwartet, und so beobachtete sie das Geschehen einen winzigen Augenblick, um sich zu orientieren. Rural beherrschte eine Menge elegante und gefährliche Paraden. Er musste ein Schüler von Trankin sein – sein Stil sah danach aus –, aber er offenbarte Schwächen, weil er Schmerzen hatte. Gleich würde er seine enorme Geschwindigkeit nicht mehr aufrechterhalten können. Gesund wäre er mit vielen fertig geworden, vielleicht mit allen, registrierte Marí staunend, und auf einmal sah sie den jungen Garahoner mit anderen Augen. Sie verglich ihn sogar mit ihrer einzigartigen Nichte Kerí. Der Fürst hatte Rural nicht ohne Grund in der Nähe von Murud dabeigehabt, ging ihr auf, und Garahon hatte durch seine beinahe tödliche Verletzung einen vielversprechenden, jungen Anführer verloren, auch wenn er noch am Leben war. Wie tragisch, dachte sie und stellte sich eine Ballade über ein nicht gelebtes Leben vor. Dann musste sie eingreifen.
»Schlagt mich, wenn ihr könnt!«, rief sie provokant in der gemeinsamen Sprache und stellte sich vor Rural, als der kurzfristig zurückwich. Sie rotierte ihren ausgezogenen Stock, der durch seine Geschwindigkeit zu einer schwer zu durchbrechenden Mauer wurde. Marí hatte vor ihrem Aufbruch mit wesentlich größeren und stärkeren Männern trainiert, auch mit Schwertträgern, und fühlte sich ihrer Sache sicher. In atemraubendem Tempo schwang sie die traditionelle Waffe der Eshandrin und wirbelte und drehte den Stab, der so groß wie sie selbst war, um sich. Von Zeit zu Zeit musste sie Schwerthiebe parieren, doch ihr Stab hielt dem stand und war binnen Sekundenbruchteilen wieder in Bewegung. Er war Schild und Waffe zugleich. Immer wieder schlug sie die Angreifer mit den Enden des Stocks abwechselnd gegen ihre Knie, ihre Arme und die Hüften. Manchmal gegen den Kopf. Einer nach dem anderen wurde aufgrund der Schmerzen unachtsamer. Es war eine alte, zermürbende Eshandrin-Technik, und zum Ende hin brach man dem Gegner das Genick, was Marí tat, sobald sich eine Gelegenheit bot. Manche Eshandrin zielten auch auf den Kehlkopf und stießen, aber Marí bevorzugte es, die Rotationsenergie auszunutzen, weil ihre Körperkraft nicht groß war. In Garahon und Montzien hatte ihre Kampfkunst den unschätzbaren Vorteil, dass ihre Feinde sie noch nie gesehen hatten. Drei Männer tötete Mari auf diese Weise, zwei wurden von Telka und Rural niedergestreckt, und der letzte Angreifer, der Feral gegenübergestanden hatte, floh in den Wald. Es war ein Söldner und kein Garahoner.
Marí hockte sich über die Toten und holte sich ihre wertvollen Wurfmesser zurück. Ähnlich wie Ellosz hielt sie sie in Ehren, weil sie vom Gewicht her ideal austariert waren und zuverlässig flogen, wenn sie mit ihnen warf. Das bekam längst nicht jeder Schmied hin. Die Eshandra nahm Schnee, um sie sauber zu reiben, und anschließend trocknete sie sie ab, damit sie nicht rosteten. Auch ihren Stock reinigte Marí sorgfältig, rieb ihn trocken und schob ihn wieder zusammen. Nachdem sie ihn weggesteckt hatte, hüllte sie sich in die warmen Felle, die sie auf dem Sattel ihrer Stute zurückgelassen hatte. Die Bewegung und die Aufregung hatten sie von innen erwärmt, sie fror gar nicht mehr. Auch die anderen sortierten ihre Sachen, zogen sich warm an und verarzteten kleinere Blessuren. Sie durchsuchten die Toten nach Hinweisen auf ihre Identität. Schwerere Verletzungen hatte zum Glück niemand. Marí selbst hatte ein paar Schrammen erhalten, auch eine im Gesicht, und an einer Seite ihres Brustkorbs eine Prellung, die sie sich am Abend näher ansehen wollte. Das Kettenhemd hatte Schlimmeres verhindert. Sie hockte sich hin und rieb sich Schnee ins Gesicht, um Schmutz, Schweiß und etwas Blut loszuwerden. Außerdem hatte sie das Bedürfnis, sich nach dieser unschönen Erfahrung zu reinigen.
Neben ihr fand sich eine erleichterte Resinà wieder ein, die gute Nerven bewies und von ihrem Baum aus zugesehen hatte. »Eshandra Marí«, redete sie sie mit Titel an, um ihre Hochachtung auszudrücken, »das war eine wahnsinnige Leistung. Das war wirklich unglaublich!« Sie machte eine Pause zum Luftholen und sagte begeistert: »Ich möchte es gern lernen, wenn ich darf. Kannst du mir den Stockkampf beibringen?«
Marí, die gerade wieder zu sich kam, weil sie in einen anderen Modus ihrer selbst geraten war, blickte aus der Hocke zu der jüngeren Frau auf. Die Eshandrin war lange nicht mehr intensiv in eine Kampfhandlung verwickelt gewesen, zuletzt als junge Frau auf Patrouille. Eshfaran hatte eine Wehrpflicht für alle. Mit so vielen Toten um sie herum wurde ihr auf einmal klar, was es bedeuten würde, einen Krieg zu führen. Auch sie, ganz persönlich, würde kämpfen. Es lag in ihrem Charakter, sie musste das tun, und Krieg war ein blutiges Geschäft mit schnellen und zähen Phasen. »Gern«, antwortete sie trotz dieser ernsten Gedanken, nachdem die Frage zu ihr durchgedrungen war. »Ich hatte schon lange keine Schülerin mehr, und es ist ohnehin eine Schande, dass dein Vater Darcio dich nicht unterrichtet hat. Lumenari sind für ihre Effizienz im Kampf berühmt.«
Kurz darauf fand sich Rural neben ihr ein, und inzwischen stand sie auch wieder aufrecht. Er überragte sie trotzdem um Längen. »Vielen Dank, Marí«, äußerte er schlicht. Die weißblonde Frau nickte zuerst nur, weil das eine Selbstverständlichkeit gewesen war. Doch dann fasste sie ihn nochmal anders ins Auge. »Wir haben dich nicht den ganzen Weg von Murud aus transportiert, damit du vorzeitig stirbst, Rural«, sagte sie entschieden. »Ganz sicher gehörst du zu den Menschen mit einer Bestimmung, aber es ist nicht die, die du gern hättest.« Sie behandelte ihn, als wäre er ihr widerspenstiger Sohn oder Kerí, die tatsächlich in einem ähnlichen Alter waren. »Du warst und bist ein großartiger Schwertkämpfer, aber in so einem Außeneinsatz bist du inzwischen falsch. Frag Sentry de Bonbaille oder deinen Fürsten, was du in Zukunft tun sollst. Ich würde den Lord der Energien wählen, weil ich denke, dass er dich aus irgendeinem Grund braucht. Er hat dich aus Mitgefühl gerettet, aber für dich war das Reskala.« Damit drehte sie sich um und ging zu ihrer Stute. Marís Hände wurden kalt, und sie wollte sie unter ihrer Mähne anwärmen. Das Leben war mitunter seltsam, dachte sie. Wenn sie genau hingesehen hatte, hatte sie im Nachhinein oft festgestellt, dass Vorgänge einen Sinn ergaben. Sentry hatte Rural gegen alle Meinungen und Widerstände gerettet, und deshalb gehörte er zu ihm.
Feral, der zu seinem Bruder getreten war, blickte ihr hinterher. »Das wollte ich dir auch längst sagen«, äußerte er betroffen, »aber ich habe mich nicht getraut. Marí ist schnell und sehr direkt, selbst wenn sie redet.«
»Eshandra Marí hat lange Jahre in Eshfaran geherrscht«, antwortete Rural unaufgeregt, und die Erschöpfung war ihm jetzt deutlich anzuhören. »Die Eshandrin hatten sie als Oberhaupt gewählt. Sie leben in einer Republik mit vielen alten Traditionen. Nach unserer Flucht mit Sentry ist sie zurückgetreten, hat sie mir erzählt. Die Reise hatte sie verändert, nicht nur mich, Fürst Jarosz und Tellosz. Sentry zieht Leistungsträger an, aber was ich dabei soll, begreife ich nicht. Ich gehöre nicht mehr dazu.« Rural betrachtete Marí von hinten. »Unserem Fürsten gefällt sie, glaube ich. Mit Jarosz passt sie vielleicht ganz gut zusammen – eine ungewöhnlichere Frau hätte er kaum finden können.« Die zwei Brüder gingen zu ihren Pferden, saßen auf, und die kleine Gemeinschaft setzte ihren Weg um den Steilabsturz, der nun ungefährlich war, fort.
Jarosz hatte das Hin-und-her von Marís Signatur bemerkt, und es hatte ihn nervös gemacht. Als sie sich endlich weiterbewegten, fühlte er echte Erleichterung. Er drängte sein zotteliges Pferd zu größerer Eile.