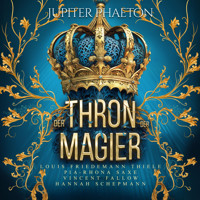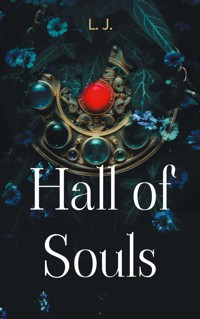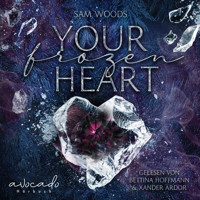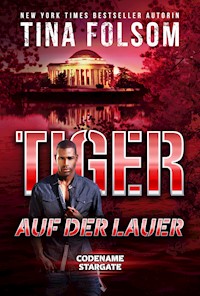Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kampf gegen die Xenlar
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Den Schergen der Xenlar entronnen, findet Sentry de Bonbaille, ein junger Lord der Energien und Rätsel, Zuflucht bei Fürst Jarosz im Hochgebirge von Garahon. Doch der Arm der parasitären Angreifer reicht weit, und überall lauert Verrat. Zusammen mit Gleichgesinnten erforscht der sensible Adept die suggestive Kraft des Feindes und dessen gefährliche, energetische Natur. Vier Enklaven vernetzen sich zum Widerstand, aber noch wagt niemand den ersten Schritt, bis auf Lady Feraia, Sentrys zornige Schwester, der Gebieterin über die Flora …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Kampf gegen die Xenlar
Band 2 – Vier Enklaven
S. P. Dwersteg
Impressum
Deutsche Erstausgabe Copyright Gesamtausgabe © 2023 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2023) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-806-5
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
Inhaltsverzeichnis
Durch den Winter
Während die drei Flüchtenden nach Osten vordrangen, wurde die Landschaft steiler, die Vegetation weniger lieblich. Laubbäume, teilweise windschief und gedrungen, blieben jetzt ganz hinter ihnen zurück, und Nadelbäume sowie Zedern mit knorrigen, dicken Baumwurzeln und abgeknickten Wipfeln übernahmen auf den abschüssigen Hängen das Feld. Fruchtbarer Boden wich schroffen, steinernen Formationen aus Schiefer und Quarzen, über die kalt der Wind strich. Jetzt hatte Sentry seine Heimat Montzien ganz hinter sich gelassen. Hier erinnerte nichts mehr an das grüne, hügelige Land, aus dem er stammte, und die Garahoner kamen ihrem Zuhause mit jedem Huftritt näher. Ohne Pause drängten Fürst Jarosz, sein Erbe Tellosz und der angeschlagene Sentry voran, abwechselnd im Schritt und im Trab, um die Pferde, die mit wenig Nahrung auskommen mussten, nicht zu sehr zu schinden. Der Fürst und sein Hengst gaben den Rhythmus für ihre Tage und Nächte vor, Sentry und Tellosz folgten.
Schon bald hatten sie die Baumgrenze hinter sich gelassen, und immer noch stiegen sie, und der Weg nach ganz oben war weit. Hier gab es nur noch kleine Sträucher, die sich vor dem Wind wegduckten, viele von ihnen voller Dornen und eingetrockneter Beeren, in denen nach frühen Nachtfrösten Eiskristalle glitzerten, wenn die Sonne darauf schien. Es waren Relikte des vergangenen Sommers. Steinbrechgewächse, und zähe, niedrige Storchenschnäbel präsentierten ihnen ihre letzten halbverwelkten Blüten, während ihre Blätter schon vergilbten, und Silberdisteln entließen ihre Samen für das nächste Jahr in den Wind. Das bunte Leben des Sommers verkroch sich, wo immer es konnte – in die Erde, in Felsspalten und in Samen. Murmeltiere mit dichtem, braunem Pelz sahen bei Tagesanbruch vereinzelt aus ihren Löchern, und bei Sonnenaufgang hörten die Männer sie pfeifen. Über ihnen kreisten einzelne mächtige Steinadler und Gänsegeier, und Gämsen standen stolz auf spitzen Felsnadeln. Die Natur hier oben war beeindruckend schön und schrecklich zugleich, und wenn Sentry den Blick zu den Gipfeln schweifen ließ, fragte er sich, wie sie jemals dort hinaufkommen sollten, dorthin, wo es nur noch Schnee und Eis unter einer gleißenden Sonne geben würde.
Kein Mensch wohnte in diesem lebensfeindlichen Umfeld. Nur einmal sahen sie einen Hirten auf der Suche nach einer verirrten Kuh oder einem Schaf, das beim Almabtrieb ausgebrochen war. Nahe einem Grat ließ sich einen Moment lang ein Schneeleopard blicken, und je höher sie kamen, desto winterlicher wurde es. Der Merker musste daran denken, dass er Trankin im ersten Impuls mit einem Raubtier verglichen hatte, und er musterte ihn von hinten. Jarosz bemerkte es sofort und drehte sich auf Lefials Rücken um. »Ist etwas?«, fragte der aufmerksame Mann mit den schräg stehenden Augen, und Sentry hatte keine Antwort. Der Adept lächelte matt, schüttelte den Kopf, und Jarosz wandte sich wieder nach vorn. Den Leoparden hatte der Fürst auch gesehen, und er schien sich ebenfalls darüber zu freuen.
Die Vorräte der Heimkehrer waren knapp bemessen, aber ihr Anführer war strikt dagegen zu jagen oder Feuer zu machen. Also brieten sie kein Wild, das sie von innen hätte wärmen können. Sentry fror wie noch nie in seinem Leben, aber der Fürst blieb unnachgiebig und verbot dem Lord der Energien, Wärme aus Bodenschätzen zu erzeugen, weil das energetische Spuren hinterlassen würde und sie verraten könnte. Wasser gab es jetzt nur noch in Form von Eis und Schnee, und Jarosz fand nichts dabei, ein paar Tage lang von der Hand in den Mund zu leben.
Jeden Tag kamen sie höher hinauf. Die Winde wurden eisiger und die Felsgrate schroffer. Die zwei Garahoner mit ihren dunklen Haaren und grauen Augen wirkten auf Sentry, als wären sie den Felsen selbst entsprungen. Sogar die Kälte schienen sie zu begrüßen und weniger zu frieren als er. Der Adept selbst war noch nie so hoch im Gebirge gewesen, und er hatte ein unsicheres, fast ängstliches Gefühl im Bauch. Nicht nur wegen der Höhe, sondern weil sie in Kürze ankommen würden und er dann Gast in einem fremden Land sein würde. Seine zwei Begleiter freuten sich natürlich auf ihr Zuhause.
Es war am Morgen, als drei Scouts auf kräftigen, gedrungenen Pferden auf sie zuritten. Die Männer hielten in etwa vier Metern Entfernung vor ihnen an und verneigten sich respektvoll, insoweit das auf dem Pferderücken möglich war. Die Tiere hatten auffällig dichten Winterpelz sowie lange Mähnen und einen ebensolchen Fesselbehang. Selbst ihre Wimpern waren ungewöhnlich dicht, und darunter schauten kluge Augen hervor. Die Reiter waren in das übliche Grau gekleidet, und der Adept begriff, dass es die normale Garahoner Uniform war. Über dieser Kleidung trugen sie dicke und lange Umhänge aus verschiedenen grauweißen oder bräunlichen Fellen, um sich warmzuhalten, weshalb sie von weitem kaum zu erkennen gewesen waren. Der braunäugige Sentry, der seine Kapuze hochgeschlagen hatte, um seine aschblonden Haare zu verbergen, wurde mehr oder minder unauffällig gemustert. Fragen über ihn stellten sie aus Respekt vor Fürst Jarosz nicht. »Die Pässe sind schon schwer passierbar, mein Fürst«, berichtete nun einer von ihnen. »Etwas früh in diesem Jahr, wenn ihr mich fragt. Starker Schneefall weiter oben, und die Temperaturen fallen jede Nacht. So …«, er deutete auf ihre Kleidung und die schlechte Ausrüstung, die sie hatten, »werdet ihr schwerlich durchkommen.« Der Sprecher nannte sich Mallosz. Er war groß und benahm sich wie jemand, der viel von seiner eigenen Meinung hielt. Seine Gesichtszüge waren ehrgeizig, sein Ton etwas aufgeblasen, und er linste von Zeit zu Zeit in Sentrys Richtung. »Wir haben in einer Hütte in der Nähe überzählige Fellumhänge, Fürst«, erklärte er dienstbeflissen. »Unsere Wintervorräte, an denen ihr euch bedienen könnt, lagern ebenfalls dort. Außerdem kann ich anbieten, jemanden vorauszuschicken, um euch anzukündigen und damit man euch entgegenkommt.«
»Felle und Nahrung sind gut«, antwortete Jarosz, der das eingeplant hatte, »und ausgeruhte Pferde, wenn welche da sind. Das reicht uns. Ein Bote wäre kaum schneller.« Nach einem weiteren Blick zu Sentry, der keine Zügel hielt und dessen Hände in Verbänden aus in Streifen gerissenen Leinentüchern steckten, äußerte der Grenzer: »Eure persönlichen Pferde sind oben, Fürst Jarosz, und einen Telepathen für euren Gast habe ich nicht hier.« Mallosz war scharfsinnig, und er hatte ins Schwarze getroffen, doch der Fürst reagierte lässig, als läge der Mann grundfalsch. »Gib ihm einfach ein gut ausgebildetes Pferd, Soldat«, befahl er, »mein Gast ist ein exzellenter Reiter und braucht auch sonst keine Zügel.« Der Mann hätte nun gehorchen sollen, doch er wandte sich, von Neugierde getrieben, direkt an den jungen Lord. »Was ist mit euren Händen, Herr?«, erkundigte er sich unter dem Deckmäntelchen der Sorge. »Braucht ihr einen Heiler?«
»Macht euch keine Mühe«, entgegnete der Adept, der damit gerechnet hatte, höflich. »Es sieht schlimmer aus, als es ist. Für den Pelzumhang danke ich dir, für ein frisches Pferd ebenfalls. Meine Stute ist Kälte nicht gewohnt und ein Stall für sie willkommen.« Sentry hatte seiner Aussprache einen leichten Akzent gegeben, den des Steppenkönigreichs, und das Aussehen seines gescheckten Tieres passte annähernd ins Bild. Er beherrschte die Sprache des wilden Pferdelandes, mit dem Montzien Handel trieb, einigermaßen und fühlte sich damit auf der sicheren Seite. Mallosz versuchte zu durchschauen, welchen Status er hatte und wer er war, aber Sentry stellte sich nicht vor, weil er einem Grenzer als Gast von Jarosz keinerlei Rechenschaft schuldig war. Im Übrigen entstammte er dem montzischen Hochadel, und das Verhalten des Mannes war aufdringlich. »Mit uns reitet der Sohn eines Fürsten aus dem Steppenkönigreich, Mallosz. Ich hoffe, das befriedigt deine Wissbegier«, erstickte Tellosz dessen Spekulationen nun ruppig. »Sein voriges Pferd ist gestolpert. Es hat sich ein Bein gebrochen, und er hat sich die Handflächen beim Sturz aufgerissen. Jetzt zeig uns den Weg! Wir sind hungrig und durchgefroren.« Der Mann sah aus, als wäre er von einem Hieb getroffen worden, und seine stolze Mine bekam Risse. Er verneigte sich und wendete sein urtümliches Pferd.
Der Adept betrachtete Mallosz von hinten. War es möglich, dass selbst hier Verrat auf ihn wartete? »Das ist bei uns sehr selten, Sentry, aber es ist schon vorgekommen«, hörte er den Fürsten in seinem Kopf, der auch gerade über den Soldaten nachdachte. »Sag es mir bitte, wenn dir an irgendwem, dem wir begegnen, etwas Ungewöhnliches auffällt. Die Xenlar ziehen ihre Schlinge langsam zu.«
In dicke, graue Pelzüberwürfe gehüllt sowie mit ebensolchen Mützen, Schuhen und Handschuhen versehen, machten sie sich wieder auf den Weg. Sie hatten in der versteckt liegenden Hütte ausreichend gegessen, Tee getrunken und Wegzehrung eingepackt. Die Männer hatten sich durchweg hilfsbereit und dienstbeflissen verhalten, und der Fürst hatte eine Menge Fragen gestellt, um sich auf den aktuellen Stand zu bringen. Dadurch hatte Sentry Gelegenheit erhalten, seine aschblonden, kurzen Haare unauffällig unter einer dicken, topfartigen Pelzmütze zu verstecken. Schließlich brachte Jarosz ein paar große, weiße Talglichter, die angezündet viel Wärme abstrahlen würden, mit hinaus und verstaute sie in seinen Satteltaschen. »Damit du nicht jede Nacht frieren musst«, sagte er mit einem kaum sichtbaren Lächeln zu Sentry. Ihr Zelt hatten sie gegen ein solideres eingetauscht, das einen Boden hatte.
Sentry ritt jetzt auf einer schwarzen, gedrungenen Stute namens Milli, die vor lauter Pelz kaum aus den Augen schauen konnte. Ihre rundlichen Ohren verschwanden fast vollständig in dem Fell, auch wenn sie sie aufmerksam hin und her drehte. Der Fürst hatte ein ähnliches Exemplar in Grau, Tellosz eines in Braun. Eine Pferde-Energiesignatur suchte Sentry vergebens. Er dirigierte das Tier daher nur mit den Beinen, was auf Dauer ziemlich anstrengend war. Seinen Händen ging es nach den gut drei Wochen, die inzwischen vergangen waren, besser, aber er hatte viele nässende, offene Stellen, und die neue Haut, die von den Seiten über die Wunden wuchs, war sehr dünn und leicht zu verletzen. Dass ihm ständig kalt gewesen war, hatte die Heilung auch nicht gerade beschleunigt. Daher hängte er die Zügel – nur für Notfälle – an den Sattelknauf. »Ich kann den Gaul auch hinter mir herziehen«, schlug Tellosz ihm vor, aber Sentry wollte selbst reiten.
Ihre eigenen Pferde sollten ihnen in den nächsten Tagen gebracht werden, wenn diese sich in einem Verschlag, der sie vor Wind und Wetter schützte, erholt haben würden. Sie bekamen dort Heu und Hafer, um wieder zu Kräften zu kommen. Über ihre Rücken waren dicke Pferdedecken aus Wolle gebreitet worden, und als Sentry sich von seiner treuen Scheckenstute verabschiedet hatte, hatte er sich vorgenommen, ihr bei nächster Gelegenheit einen Namen zu geben.
Der junge Felsenadept meinte, noch nie so einen kalten Winter erlebt zu haben, aber seine zwei Mitstreiter lachten nur und erklärten ihm, dass der Winter hier oben noch deutlich härter wäre. Das hier wäre allenfalls Herbst. Im tiefen Winter wären die Pfade kaum noch passierbar, mit Pferden schon gar nicht. Für Notfälle hätten sie ein paar Yaks, aber besser wäre es, es gar nicht erst zu versuchen.
Ihre Umgebung war weiß, die Sonne gleißend. Fürst Jarosz band sich ein halbdurchsichtiges Tuch vor die Augen, wenn es ihm zu hell war. Vor sich sah Sentry nichts als unbezwingbare, scharfe Grate, die sich wie Zähne aneinanderreihten, als wollten sie den Himmel beißen, sowie nicht passierbare Scharten voller Geröll. Auf einigen Höhenzügen lagen bläulich schimmernde, riesenhafte Gletscher, die wie große Zungen aussahen und sich nach unten neigten. Sie waren Überreste der letzten Eiszeit. Fürst Jarosz und Tellosz waren hier zuhause, aber Sentry staunte wie ein Kind darüber. Es gab heimliche Pfade, erklärten sie ihm, aber ein Fremder könnte sie unmöglich finden, und niemand außer ihren eigenen Leuten wüsste, dass hinter den schroffen Gipfeln Landwirtschaft und Zivilisation zu finden wären. Tellosz erklärte dem jungen Adepten, dass die Gegend gut bewacht war, auch wenn sie nicht so aussah. Sie wurden von niemandem angehalten, und sie sahen auch niemanden.
Weitere Tage ritten sie durch Eis und Schnee, und trotz seines dicken Umhangs und seiner Fellschuhe war Sentry die Gegend, über die unablässig kalte Winde fegten, zu lebensfeindlich und grausam. Er begriff, dass es keine bessere Verteidigung für ein Fürstentum geben konnte als den drohenden Kältetod. Die hohen Berge machten es zur stärksten Bastion, die er je kennengelernt hatte. Hier würde niemals ein Heer lagern, und niemand kam unerkannt hinauf. Als Sentry schon fürchtete, dass es noch tagelang so weitergehen würde, führte Fürst Jarosz sie in eine tiefe, natürliche Felsspalte hinein, und schließlich hielten sie auf ein stark befestigtes und bewachtes Tor aus einer Wolframlegierung zu, das Sentry an das Portal zum Hafen von U’Sanforlan erinnerte, welches sie gegen die auflaufende Flut hatten aufdrücken müssen. Es schien einen Tunnel nach außen hin zu verschließen, denn darüber ragte steil das Bergmassiv auf. Über dem Zugang aber prangte ein altes, verwittertes Wappen aus Granit. Einst war es vergoldet gewesen, doch davon waren nur noch Spuren übrig. Es zeigte ein aufrechtes Fünfeck, dessen Strahlen stolz in alle Richtungen wiesen. Sentry betrachtete es eingehend, weshalb Jarosz »das ist das Wappen der Lords, Sentry« mental übermittelte. »Es ist das Gegenstück zu dem Wappen der Xenlar, das der Usurpator nutzt, und ich weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll.«
Während Fürst Jarosz näher ritt, verbeugten sich die Wachhabenden tief und sehr förmlich. Anschließend äußerten einige ihre Freude und Erleichterung darüber, ihn und Tellosz wieder wohlbehalten im Lande zu haben. Der Fürst nickte nach rechts und links und begrüßte ein paar Soldaten mit Namen. Dann ritt er, von Sentry und Tellosz gefolgt, durch das Tor, das sich direkt hinter ihnen wieder schloss.
Sie befanden sich in einem breiten, von Fackeln beleuchteten Gang, der laut Tellosz etwa einen Kilometer lang war. Dieser Zugang nach Garahon konnte leicht verteidigt werden, bemerkte Sentry sofort. Es gab erhöhte Wehrgänge zu beiden Seiten des Tunnels, die Schießscharten hatten, sowie Löcher in der Decker, durch die man heißes Öl gießen könnte. An einigen Stellen waren Fallgitter installiert worden, um Feinde einzusperren und ihnen den Rückweg abzuschneiden. Lords hatten die Anlage noch vor dem ersten Krieg gegen die Xenlar erschaffen, wurde Sentry von Tellosz belehrt, und man hatte sie über Jahrtausende instandgehalten. Sie hätten den Krieg damals frühzeitig kommen sehen und Vorkehrungen getroffen.
Der Adept konnte das nachfühlen – die Energiesignaturen in den Wänden waren uralt und teilweise stark verblasst, älter sogar als in U‘Sanforlan. Doch obwohl das seine Neugier anstachelte, merkte er, dass er den Gang schnellstmöglich passieren müsste, wenn er hier nicht zitternd und bebend zusammenbrechen wollte, was mehr als nur peinlich wäre. Der Stollen erinnerte ihn an die Verliese von Murud, an die Folter, und es half ihm auch nicht, dass dieser hier mehrere Meter hoch, gut fünf Meter breit, einigermaßen gut ausgeleuchtet und belüftet war. Überhaupt müsste Sentry sich mit Schächten, Grotten und Kavernen wieder anfreunden, begriff er, was für einen Felsenadepten wie ihn, der mit Mineralien eng verbunden war, eine wichtige Sache war. Prompt begann er auch schon zu beben und hektischer zu atmen, obwohl er sich um innere Ruhe bemühte wie selten und redlich versuchte, sich zusammenzureißen. All das nützte nichts, und in seiner Not gab er Zotteltier Milli die Sporen und galoppierte freihändig den Gang hinunter. Weg, nichts als weg, raus aus dem Bauch des Berges! Tellosz verwunderte das überhaupt nicht. Er zuckte die Schultern, warf dem Fürsten einen entschuldigenden Blick zu und ritt hinterher, als wäre es ein Wettrennen. Jarosz folgte gemächlicher, aber auch er trödelte nicht.
Vor dem zweiten Tor, das ihn nach draußen entlassen würde und auf das er gerade schnell zu galoppierte, hätte Sentry sein stämmiges Pferd zügeln und abbremsen müssen. Weil er seine Hände nicht nutzen konnte, verlagerte er sein Gewicht abrupt nach hinten. Er konnte nur hoffen, dass das für die Stute ausreichen würde. Milli reagierte zu seiner Erleichterung sofort und legte eine regelrechte Vollbremsung hin, die die meisten anderen Reiter aus dem Sattel katapultiert hätte. Da standen sie nun vor einem geschlossenen Tor, das brave Tier mit Schaum vorm Maul, und der eilige Ritt hatte Sentry rein gar nichts gebracht. Denn die beiden Torflügel öffneten sich nicht, weil der Fürst noch nicht anwesend war, und jede Sekunde wurde für ihn zu einer kleinen, qualvollen Ewigkeit. Kurz nach ihm kam Tellosz vor dem Ausgang zum Stehen. »Du kannst wirklich gut reiten«, äußerte er anerkennend, »das ist gut für deine Reputation hier.« Aber Sentry beachtete ihn nicht, weil er mit sich selbst zu sehr beschäftigt war. Er war kurz davor, ein Loch in den Felsen zu befehlen, nur damit er hinauskriechen und den Himmel sehen könnte. »Diese Anlage und viele weitere Wehrbauten beschützen unser Volk seit Jahrtausenden«, versuchte Tellosz ihn abzulenken, wohl wissend, dass Informationen und Geschichten ihm kaum helfen würden, weil tiefsitzende Angst sich vom Verstand selten beeinflussen ließ. Aber sie mussten auf den Fürsten warten, um keine ungünstigen Gerüchte in die Welt zu setzen, und es galt, die kurze Zeitspanne zu überbrücken. Weil Sentry sich nicht mehr ständig verlinkte, erzählte Tellosz ihm jetzt irgendein Zeug, das ihm gerade so in den Kopf kam und an Sentry vorbeirauschte wie ein Gebirgsbach. »Hilf mir bitte mal«, meldete der Adept, der es nicht mehr aushalten konnte, sich mittendrin mental und verlinkte sich stärker als normalerweise mit dem Heiler, weil er einen Haltepunkt brauchte. Tellosz war selbst hundemüde und nicht gerade erpicht darauf, noch kraftloser zu werden, als er schon war. Endlich waren sie in Garahon angekommen, und er wollte sich erholen. Vor seinem inneren Auge sah er seine gemütliche Wohnstube samt Sofa, auf dem er sich in Kürze auszustrecken gedachte. Dennoch kam er der Bitte nach, so gut es ihm möglich war, aber unter Tonnen von Gestein war es schwieriger als an der frischen Luft, weil Sentrys Panik hier viel Nahrung fand.
Nach einer Weile äußerte der Jüngere gefasster: »Hier sind überall verborgene Türen zu Gängen und Räumen, Tellosz. Darin lagern ungewöhnliche Gegenstände, teilweise mit Signaturen.« Fürst Jarosz, der endlich zu ihnen aufschloss, Sentrys Verfassung bemerkt hatte und seine Feststellung mithörte, erwiderte, dass diese Pforten lange nicht geöffnet worden wären und weiter warten könnten. »Du ruhst dich erstmal aus«, bestimmte er. »Alles andere kommt später. Die Leute in Garahon müssen sich an dich gewöhnen und dich als einen der ihren ansehen. Wir sollten nichts überstürzen und sie vor allen Dingen nicht erschrecken.«
Die drei Männer ritten aus dem Tunnel, der sie bergab geführt hatte, hinaus, und Sentry fand sich im Eingang eines großen Tals wieder, in das sie noch viele hundert Höhenmeter würden absteigen müssen. Die vor ihnen liegende Straße verlief in Serpentinen, und an den Hängen befanden sich Weinstöcke, robuste Obstpflanzungen sowie Gemüsesorten, die mit kühleren Temperaturen zurechtkamen. An der Talsohle erblickte Sentry einen Fluss, eine mittelgroße, sternförmig angelegte Stadt mit Brücken über den Strom sowie mehrere kleinere Ortschaften. Das Tal schien um eine Kurve zu verlaufen, Sentry konnte es nicht vollständig einsehen. Die Farben um ihn herum, erschlugen ihn fast nach all dem Weiß, denn der Herbst war hier noch voller Blüten. Zu Sentrys großem Erstaunen waren die Temperaturen deutlich milder als außerhalb des Tals, und niemand brauchte Felle, um sich warmzuhalten. Schnee blieb nicht liegen, und der Bergeinschnitt war fast windstill. Viele Menschen trugen die Sentry bekannte, graue Kleidung, aber es gab auch eine Menge bunt oder braun angezogene Leute, die zivile Berufe auszuüben schienen. Was allen gemeinsam zu sein schien, das waren die grauen Augen und die dunklen Haare, weshalb er sich wie ein bunter Hund vorkam. »Willkommen in meinem Fürstentum Garahon, Lord Sentry de Bonbaille«, begrüßte ihn Jarosz offiziell, als hätten sie sich vorher nicht die ganze Zeit über gesehen. Tellosz neben ihm lächelte und sah so aus, als würde eine Last von ihm abfallen. Er war zuhause und sah sich um, als würde er etwas oder jemanden suchen. »Von jetzt an«, fuhr der Fürst fort, »werden wir die Geschichte über dich erzählen, die wir uns zurechtgelegt haben.« Er machte eine Pause und sah ihn nachdrücklich an. »Vergrabe deine wahre Identität in dir, Sentry, damit du dich nicht in Widersprüche verstrickst. Tellosz und ich können jederzeit behaupten, etwas nicht zu wissen, aber du selbst musst glaubwürdig sein. Es hängt einiges davon ab.« Sentry nickte langsam. Von nun an wäre er ein Kind der Steppe. Er fragte sich, wie er in einem fremden Land heimisch werden sollte, wenn er nicht er selbst sein durfte.
Als mehrere junge Soldaten auf sie zukamen, um ihnen die Felle und das Gepäck abzunehmen, erklärte der Fürst in einer rauen Mundart, die der Adept noch nie von ihm oder Tellosz gehört hatte, und einem befehlsgewohnten Tonfall: »Dies ist der Sohn des verstorbenen Fürsten Mokar von Erenez aus dem Pferdeland. Er heißt wie sein Vater. Sorgt dafür, dass er im Gästehaus in einer Wohnung unterkommt, die direkt an meinen Palast grenzt. Schickt Dienerschaft, sie zu beheizen und fertig zu machen. Beeilt euch.«
»Wird prompt erledigt, Fürst«, erwiderte einer der Männer, er war groß und schlank. Er salutierte und machte sich sofort auf den Weg. »Schickt jemanden zu meiner Ziehtochter Leraille«, wandte Jarosz sich an einen weiteren Soldaten, »teilt ihr mit, dass Mokar und ich heute nur ganz einfach und unter uns essen möchten. An einem anderen Tag können wir in größerer Runde zusammenkommen, wenn es ihr Wunsch ist. Richtet ihr aus, dass Tellosz nicht anwesend sein wird.« Wieder folgten Bestätigung und Salutieren, und der Nächste eilte davon. Dann ritten sie in Richtung Stadt weiter. »Habe ich was vergessen, Tellosz?«, fragte Jarosz seinen jüngeren Cousin, ohne ihn anzusehen. Auch jetzt bediente er sich seines eigenen Dialekts. »Die Badezuber kommen übrigens von allein«, fügte er an Sentry gewandt hinzu. »Vielen Dank, dass du mir Leraille vom Hals hältst«, lachte Tellosz erleichtert, und der Merker blickte nicht mehr durch, zumal er sehr genau hinhören musste, um sie überhaupt zu verstehen. Zu Sentry, alias Mokar, gewandt erläuterte der Fürst: »Eine uneheliche Tochter meines verstorbenen Bruders möchte ihn heiraten, seit ich ihn zu meinem Erben gemacht habe.«
»Ist das so unangenehm?«, wunderte Sentry sich und sah zu Tellosz rüber. »Grauenhaft«, antwortete der, »ich lebe mit einem Schmied zusammen. Lass mich bloß nie mit Leraille allein, wenn wir zusammen im Raum sind, Mokar. Die Frau versetzt mich in Angst und Schrecken.« Er schüttelte sich und musste dann über sich selbst lachen. »Sie hat leider keinen angenehmen Charakter«, stimmte der Fürst, der sich auch nicht auf die Frau zu freuen schien, zu. »Aber Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen, wie man so sagt, und sie gehört zu meinem Haushalt. Wir arrangieren uns miteinander.«
Nach einem Ritt von vielen Stunden, der sie durch herbstliche Terrassen und Felder sowie am Fluss entlang mitten ins Tal geführt hatte, erreichten sie die Stadt Lashta, in deren Zentrum sich das Palais der Fürsten von Garahon befand. In den kleineren Orten, die sie zuvor passiert hatten, waren die Häuser überwiegend bäuerlich, zweckmäßig, aus Holz und Natursteinen und ein- oder zweigeschossig gewesen, wohingegen sich in Lashta auch höhere, hübsche Bauten fanden, die teilweise schon sehr alt sein mussten. In der Mehrzahl waren es mittelgroße, mehrgeschossige Stadthäuser, die sich wie Perlen aneinanderreihten und liebevoll gepflegt aussahen. Es gab Bauwerke aus Naturstein neben verputzten Häusern, die bemalt oder sogar stuckverziert waren. Nicht ein Haus war verfallen, weil man in Garahon nicht verarmen konnte. Geldwirtschaft gab es nicht. Wenn ein Gebäude nicht mehr gut war, wurde es saniert oder erneuert, erfuhr Sentry von Jarosz, und an jemanden mit Bedarf vergeben.
Tellosz erklärte, mehrere Räume im Palast zu haben, sie aber so gut wie nie zu nutzen. Das Landhaus seines Freundes wäre viel gemütlicher, rechtfertigte er sich vor Sentry, der das verzierte, alte Palais über den anderen Gebäuden thronen sah und neugierig beäugte. Als sie endlich um die letzte Ecke ritten, kam ihnen ein ungeheuer breitschultriger Mann, der sie dort erwartet zu haben schien, in einer dicken, ledernen Schürze voller Brandspuren entgegen. Er hatte seine Arme freudig ausgebreitet und strahlte über das ganze Gesicht. Tellosz unterbrach sich mitten im Satz und sprang von seinem struppigen Untersatz. Er ließ das Tier laufen und warf sich dem kräftigen Mann in die Arme. Der Schmied hob ihn hoch, als wäre der große Tellosz ein Fliegengewicht, und drückte ihn so sehr an sich, dass Sentry sich fragte, ob sein Freund gleich blau anlaufen würde. Nach dieser herzlichen Begrüßung drehte der Mann sich sofort zu ihnen um. Respektvoll und gut gelaunt verneigte er sich vor dem Fürsten, den er offenbar gut kannte. »Darf ich vorstellen«, sagte Jarosz mit amüsiertem Unterton zu dem erstaunten Sentry, der neben ihm im Sattel saß, »einer unserer Schmiede und der Mann von Tellosz. Er heißt Manusz. Ein riesiger Muskelberg, aber der harte Kerl von den beiden ist eindeutig Tellosz.« Manusz lachte und erwiderte: »Es ist schön, dass ihr wieder da seid, Fürst Jarosz. Ich bin überglücklich. Und diesmal scheint er sogar noch heil zu sein.« Manusz deutete auf seinen Lebenspartner. »Aber ich habe ihn noch nie so müde und erschöpft gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Nun, das ist nichts, was gutes Essen und Schlaf nicht richten könnten.« Er lachte fröhlich.
Tellosz stieg nicht wieder aufs Pferd, sondern ließ es von einem Bediensteten einfangen und wegbringen. Er verneigte sich ernst und förmlich vor Jarosz, was Sentry bisher noch niemals gesehen hatte, und der Fürst wünschte den beiden einen angenehmen Abend. Tellosz war vorerst entlassen und sollte sich am Nachmittag des Folgetages bei ihm einfinden. Sentry ging auf, dass Jarosz ihm zuliebe offener und zugänglicher war, als er sich sonst verhielt.
Bevor er mit seinem Partner nach Hause ging, wandte Tellosz sich an den jungen Adepten, den er in der fremden Umgebung nicht sich selbst überlassen mochte. »Richte dich erst mal ein wenig ein, Mokar«, schlug er vor, »und wenn ihr nachher zusammen gegessen habt, komm am Abend auf einen Wein vorbei.« An dieser Stelle blickte er fragend zu Manusz, der gastfreundlich zustimmte. »Wir müssen dich und deine Hände gesund bekommen. Außerdem möchte ich dir mein Zuhause und Manusz vorstellen.«
»Bis dann also«, antwortete Sentry höflich, »vielen Dank für die Einladung.« Er unterbrach seine Verlinkung mit Tellosz, damit der seine Ruhe vor ihm hätte, und fing sich einen besorgten Blick deshalb ein. Aber der Heiler sagte nichts, verneigte sich minimal vor ihm und ging mit Manusz, um den er einen Arm gelegt hatte, davon.
Als sie in das helle, luftig verzierte Palais traten, über dessen Portal das Wappen der Lords glitzerte, kam eine stämmige Frau in einem blauen, hochgeschlossenen Kleid mit schneeweißer Schürze auf sie zu wie ein Wirbelsturm. Es war die ältere Haushälterin des Fürsten, die ihm nach einem tiefen und formellen Knicks den verschlissenen Umhang, der seine Söldnerverkleidung komplettiert hatte, abnahm. Man konnte ihr ansehen, dass sie die löchrige, alte Kleidung des Fürsten überhaupt nicht angemessen fand, sie aber dennoch gut behandeln würde, weil sie zweckdienlich war. Anschließend musterte sie den Fürsten kritisch von oben bis unten: sein Gesicht, seine Kleidung, seine Ausstrahlung, seine Haltung. Dabei strich sie sich eine Haarsträhne, die aus ihrem dunkelgrauen Dutt gerutscht war, hinter ein Ohr. In ihrem Rücken standen drei Hausmädchen, von denen sich zwei kaum zu rühren wagten, sowie seitlich ein älterer Mann, der gut gekleidet war und gelassen abwartete. An sämtlichen Türen wachten mindestens zwei Männer, die ihre Ohren pflichtschuldig verschlossen hatten und vorgaben, nichts zu hören. »Stimmt etwas nicht, Madeleine?«, frage Fürst Jarosz routiniert und als müsste er sich in etwas Unvermeidliches fügen. »Ihr habt schon besser ausgesehen, Fürst, aber auch schon viel schlechter«, kommentierte sie seinen Anblick streng, die Arme vor der Brust verschränkt. »Ich nehme an, ihr wart verletzt, aber es geht euch schon besser?« Sie beäugte ihn argwöhnisch. »Könnt ihr baden oder noch nicht?« Jarosz zog seine Augenbrauen schicksalsergeben nach oben, bemerkte Sentry, und sie schien keine ernsthafte Antwort zu erwarten. Was sich hier vor seinen Augen abspielte, schien eine Art Ritual zu sein. Dementsprechend ging Madeleine nun auch zum Tagesgeschäft über. »In der Gästewohnung sind alle Öfen befeuert, Fürst Jarosz«, erläuterte sie viel respektvoller und auch freundlicher, »aber es dauert noch ein paar Stunden, bis die Räume angenehm warm sein werden. Immerhin sind sie sauber, eingerichtet und das Bett ist bezogen. Die Mädchen und Burschen haben sich beeilt. Ich habe angeordnet, für euch und für euren Gast Badezuber zu füllen, aber wie mir scheint, ist der junge Mann ebenfalls verletzt und das Baden – zumindest der Hände – sicher nicht gut. Nun, das werden wir gleich sehen.« Darauf drehte sie sich zu Sentry, der weit unterwürfigere Bedienstete gewohnt war und sich in einer Gewöhnungsphase befand. »Ich werde euch eines der Mädchen zum An- und Auskleiden schicken, Mokar, und vorher selbst nach euren Händen sehen.« Die resolute Haushälterin war voller Tatendrang, und jeder Versuch einer Widerrede wäre zum Scheitern verurteilt, schätzte Sentry überrumpelt. Also bedankte er sich höflich. »Wünscht ihr noch etwas, mein Fürst?«, wandte sie sich erneut an Jarosz. »Wenn euer Gast andere Möbel oder sonst etwas möchte, werden wir es finden. Einen Spiegel haben wir aufgehängt, Schreibtisch und Schreibutensilien, Kleiderschrank und Sitzgruppe vor dem Kamin sind da.« Die scharfsinnige Frau warf wieder einen Blick auf Sentry und äußerte dann: »Wie mir scheint, reist er ohne Gepäck. Ich werde nach dem Schneider und dem Schuster schicken. Im alten Schrank von Tellosz sind ein paar Sachen, die ihm in den Schultern nicht mehr passen dürften. Das zweite Mädchen kann sie ändern.«
Madeleine musste eine Pause zum Luftholen machen, und Sentry ging auf, dass sie sich ernstliche Sorgen um den Fürsten gemacht hatte. Sie war aufgeregt, und der Stress fiel gleichzeitig von ihr ab. Die beiden mussten in etwa gleich alt sein und waren zusammen aufgewachsen, vermutete er. Madeleine schien erleichtert zu sein, dass er wieder zuhause war, und ihn von Herzen gern zu haben, was offenbar erwidert wurde. Jarosz nutzte die kurze Unterbrechung, um einen Satz einzuwerfen. »Wir möchten in zwei Stunden essen, Madeleine«, erklärte er. »Der Koch soll keinen größeren Aufwand treiben. Wir bleiben zu zweit.«
»Was sage ich eurem Mündel Leraille, Fürst Jarosz?«, fragte Madeleine darauf. »Sie wird gewiss herunterkommen wollen.«
»Ich stelle sie Mokar gern vor, aber dann soll Leraille uns für heute in Ruhe lassen. Wir haben anstrengende Tage hinter uns. Morgen werden wir beide erholter und eher für eine Unterhaltung zu haben sein.« Jarosz hatte unlustig geklungen, woraufhin die Wirtschafterin nickte und davoneilen wollte, um den Haushalt zum Rotieren zu bringen.
»Einen Moment, Madeleine«, hielt Jarosz sie auf. Er schnallte seinen schweren Gürtel mit den Söldnerwaffen ab, um sie ihr zu geben. Die beiden waren ein eingespieltes Team, und die aufmerksame Frau stellte sich ganz nahe an ihn heran und nahm seinen Waffengurt entgegen. »Färbe meinem Gast zuerst die Haare dunkel«, murmelte er, während Dolch- und Schwertscheide mehrfach laut aneinanderschlugen und seine Worte übertönten. Madeleine zuckte mit keiner Wimper, aber sie würde sich darum kümmern und zu niemandem ein Wort sagen, wusste der Fürst – sie hatten schon viele Geheimnisse miteinander geteilt. Unauffällig musterte die Wirtschafterin Sentry jetzt, der immer noch die topfartige Pelzmütze auf seinem Kopf hatte. »Kommt mit mir Mokar von Erenez«, sagte sie resolut, »ich zeige euch eure Unterkunft, und ihr könnt euch nach der langen Reise frischmachen.«
Während die Haushälterin des Fürsten Sentry tiefer ins Gebäude lotste, um ihn zu seiner neuen Wohnung zu führen, verschwand der Fürst mit seinem Verwalter, der die ganze Zeit über respektvoll danebengestanden hatte, in einem zweckmäßig eingerichteten Kontor. Auch das war ein eingespielter Ablauf. Der Fürst ließ sich Bericht erstatten und legte Termine für die Folgetage fest, die dann von Boten, bei weiten Entfernungen von Raben, weiterverbreitet wurden. Jarosz Ernesz Lobrador, 423. Beschützer und Fürst von Garahon, war Oberster Richter und Oberster Verwalter des Landes in einer Person. Vor allem bei Kapitalverbrechen und Verrat urteilte er üblicherweise persönlich, aber auch die Versorgung der Bevölkerung verantwortete er in letzter Instanz. Er war nicht weniger erschöpft und schmutzig als die beiden anderen, aber zuallererst kam er seinen Pflichten nach. Badezuber und frische Kleidung mussten warten.
Eine neue Heimat
»Gute Güte, eure Hände sehen schlimm aus, junger Mokar!« Hausdame Madeleine schlug die Hände vor Schreck zusammen, als die Verbände ab waren. »Solche Brandwunden – wie seid ihr dazu bloß gekommen? Und die Schmerzen – nein, sagt nichts, es geht eine alte Wirtschafterin ja nichts an. Ich werde sie vorsichtig reinigen und, wenn sie trocken sind, eine Salbe mit Ringelblumen und Honig auftragen. Das wird helfen. Überhaupt müsst ihr die neue, dünne Haut gut pflegen und sehr vorsichtig sein, vor allem wenn die Verbände demnächst ab sein werden. Wie lange habt ihr das schon und wer hat euch bisher versorgt? Ach Moment, Tellosz war ja bei euch. Der Junge hat ein Händchen.« So ging es eine ganze Weile weiter, aber der Fürst schien die tüchtige Frau sehr zu mögen, und deshalb verhielt Sentry sich höchst respektvoll und ließ alles über sich ergehen. Im Übrigen war er schon immer ein höflicher Mensch gewesen, und so fiel es ihm leicht. Nachdem seine Hände gekonnt versorgt worden waren, färbte sie ihm ebenso fachkundig die Haare dunkelbraun, allerdings mit dem Hinweis, dass sie sie regelmäßig nachfärben müssten, damit sich kein Blond zeigte. Sentry war froh, keine Mützen mehr tragen zu müssen, und äußerte das auch. Seine Locken waren ein wenig nachgewachsen und fielen ihm wieder etwas in die Stirn. Schließlich wurde er mit dem Hinweis »die Hände immer schön hochhalten, junger Mann« in einen dampfenden Badezuber bugsiert, in dem er sich zurücklehnen und entspannen wollte. Aber als Sentry eben das tat, rief die Hausdame, praktisch denkend, wie sie war, eine der jungen Frauen herein. Sie sollte Sentry beim Waschen, Rasieren, Abtrocknen und Anziehen helfen, und sie bekam ganz genaue Anweisungen, was ihm das Blut ins Gesicht trieb. Die ältere Haushälterin schien nichts dabei zu finden und verschwand gleich darauf in Richtung Küche.
Sentry fühlte sich peinlichst berührt, weil ihm Marthe, so hieß die junge Frau, zur Hand gehen sollte, was diese offenbar als nette Abwechslung empfand. Andererseits war er wirklich nicht dazu in der Lage, sich zu rasieren. Zum Glück schämte er sich für seinen Körper nicht mehr, was früher manchmal der Fall gewesen war, aber ein männlicher Diener wäre ihm dennoch wesentlich lieber gewesen. Die lange Reise, die Entbehrungen, viel Bewegung und das Reiten hatten sein Erscheinungsbild verändert, wie er es nicht für möglich gehalten hätte. Er war froh, in einem Stück entkommen zu sein, und nahm seinen Körper längst, wie er war. Ein Blick in den leicht trüben Metallspiegel, den sie für ihn aufgehängt hatten, hatte ihm offenbart, dass er viel sehniger und dünner aussah als vor seiner Gefangennahme, wo er leicht speckig gewesen war. »Nicht unbedingt hübscher«, urteilte er in Gedanken über sich selbst, »sondern ganz anders. Ich müsste mehr essen.« Denn wenn es eine Wahrheit gab, dann war es die, dass er ein anderer wurde. Er hatte Murud hinter sich, war lange geflohen, hatte Menschen getötet, war dann fast wahnsinnig geworden vor Angst, hatte Ryshuar widerstehen können, seine Hände verbrannt und war unter Entbehrungen erneut geflüchtet. Was jetzt kommen würde, wusste Sentry nicht, und er hatte immer noch Albträume. Aber er fühlte sich wieder lebendiger, bloß eben auch ganz anders als früher. Er hatte das Gefühl, überlebt zu haben, und das war neu. Dinge, die ihm vorher wichtig gewesen waren, verblassten. Während er in der Badewanne saß und sich nun doch entspannte, sah Sentry erneut in den Spiegel, und er erkannte auch seinen Blick kaum wieder. Älter sah er nicht unbedingt aus, aber er schaute ernster und – so merkwürdig das auch war – authentischer.
Am Abend aß er mit dem Fürsten zusammen. Er wurde Leraille, dessen Ziehtochter, vorgestellt, die sich als dunkelhaarige, schlanke Schönheit mit stahlgrauen Augen entpuppte. Wenn Sentry in ihre Augen blickte, die ihn an einen frostigen Abend erinnerten, fing er sofort an zu frieren – Leraille war attraktiv wie eine Eiskönigin, fand er. In einem hautengen, schwarzen Kleid, das mit Diamantsplittern besetzt war, saß sie auf einem der mit dunkelrotem Samt bezogenen Stühle und richtete Fragen an ihn. Sentry trug die zu klein gewordene, edle Kleidung von Tellosz, die man für ihn zurechtgemacht hatte. Seine Haut war von der gleißenden Sonne auf den Bergen gebräunt, und mit seinen dunkel gefärbten Haaren und kastanienbraunen Augen war er nun ein südlicherer Typ als von Natur aus. Sein dunkelgrauer, knielanger Gehrock mit breiten, silberbestickten Aufschlägen, versilberten Knöpfen und einem hohen Kragen ließ ihn deutlich besser aussehen, als er sich in Wirklichkeit fühlte. Der Merker hatte im Wust seiner übernommenen Erinnerungen etwas über die Steppenregion, aus der er angeblich stammte, gefunden und konnte daher einigermaßen gut Auskünfte über das Leben als Nomade im wilden Pferdeland erteilen. Selbst über seine Heimat Montzien wusste er nicht alles, dachte er bei sich und war einigermaßen zufrieden mit seiner Leistung. In der Gesellschaft fremder oder gefährlicher Leute verfiel er in einen Automatismus, der ihn in ihren Augen ausgesprochen höflich, zuvorkommend und harmlos erscheinen ließ. Das war eine Schutzreaktion, die er im Umfeld von Fürst Bagalysh erlernt hatte, und die sich gerade als nützlich erwies.
Als ihm das Interesse der schönen Leraille zu aufdringlich wurde, drehte er den Spieß kaum merklich herum und formulierte selbst einen ganzen Sack voller Fragen, womit er sie kurze Zeit später aus dem Raum vertrieben hatte. Das zauberte dem sonst so ernsten Jarosz ein Lachen ins Gesicht. »Du darfst gern öfter vorbeikommen«, meinte er erleichtert, als er sie auf der Treppe nach oben hörte. Diese Seite von Sentry hatte er bisher noch nicht kennengelernt. Der Adept war niemand, der ständig redete, aber wie man etwas im Gespräch erreichen konnte, hatte er in seinem ersten Leben bei Hofe zur Genüge gelernt. Man konnte Leute mit Höflichkeit lahmlegen und mit Rhetorik vor sich herschieben. Was ihm leider viel Konzentration abverlangte, war der Steppenkönigreich-Akzent, den er niemals vergessen durfte. Seine normale, glasklare Aussprache würde ihn sofort als montzischen Adligen brandmarken. Davon abgesehen verstand er nicht alles, was die anderen zu ihm sagten, und so fragte er öfter nach.
Sobald sie unter sich waren, bestand der Fürst darauf, Sentry zu bewaffnen, obwohl der es eigentlich nicht wollte. Aber in diesem Punkt blieb Jarosz auf eine väterliche Art unerbittlich. »Tellosz kann dich nicht beschützen, solange du nur irgendein Fürstensohn bist, Sentry«, erklärte er ihm in Gedanken, während sie die Waffenkammer ansteuerten. »Sein gesellschaftlicher Status ist auch viel zu hoch für einen Leibwächter, und im Übrigen möchte ich ihn nicht verlieren. Wir werden Alternativen finden, doch du musst vor allem selbst lernen, auf dich aufzupassen. Ich werde dir in Kürze den hiesigen Schwertmeister vorbeischicken. Daosz ist ein ungewöhnlicher, alter Mann, dem du voll vertrauen kannst. Er wird dich längst bemerkt haben, weil er ein starker Telepath ist.« In der Waffenkammer angekommen, wählte Jarosz eine schlichte, schlanke Machete für Sentry, die antik, aber gut geschärft aussah. Der Adept selbst griff nach einem schmalen, silbernen, dezent verzierten Dolch, der ihn irgendwie ansprach. Er drehte die Waffe nachdenklich in seinen nur noch leicht verbundenen Händen, als käme sie ihm vage bekannt vor. Jarosz beobachtete ihn aus dem Augenwinkel, sagte aber nichts dazu. »Man kann nie wissen, wer einen als nächstes umbringen will, Mokar«, äußerte er todernst, »nimm das nicht auf die leichte Schulter.« Sentry hörte ihm nur mit einem halben Ohr zu, denn interessanterweise lagen Drusen in unterschiedlichen Größen in dem gut sortierten Raum sowie lange, dünne Bergkristalle. Dies mussten die Waffen lange toter Lords sein, die man über Jahrtausende hinweg unzählige Male abgestaubt und umgepackt haben musste. Zwei kleinere Gesteinsknollen steckte er in eine Jackentasche, als die Wachsoldaten, die vor dem Eingang standen, nicht in den Raum sahen. Einen der langen Kristalle wollt er in seine Wohnung legen, um später damit zu experimentieren, aber Jarosz verneinte und meldete sich dazu in Sentrys Kopf. »Wir können nicht ausschließen, dass jemand deine Räume durchsuchen wird. Schon die Drusen sind hochriskant, aber wenn du sie am Körper behältst, mag es gehen«, meinte er.
Später am Abend ließ Sentry sich zu dem Gebäude, in dem Tellosz und Manusz wohnten, führen. Das Haus wäre nicht weit entfernt, hatte ihm sein Begleiter erklärt, und nun waren sie zu Fuß unterwegs. Er fühlte sich ziemlich müde, und die Gesteinsknollen kullerten in seiner Tasche hin und her und beulten sie aus. Jarosz hatte ihm einen seiner Palastwächter an die Seite gegeben, einen freundlichen, jungen Mann, der Sentry stark an Rural erinnerte. Aber weil er vorhin so viel hatte reden müssen, schwieg er jetzt, während sie die dunklen Straßen entlanggingen, über denen ein wässriger Halbmond stand. Der Soldat war unaufdringlich, und Sentry fand das angenehm. Sie durchquerten die alte Innenstadt von Lashta, bis die enge, gedrängte Bauweise der Stadthäuser sich auflockerte. Die Gebäude standen hier freier und hatten Gärten. Schließlich deutete sein Führer auf ein gut gepflegtes Landhaus, vor dem mehrere Wachen standen. »Da ist es«, erklärte er schlicht und »ich werde hier warten.« Sentry nickte und wandte sich dem Haus zu.
Standesgemäß war es auf keinen Fall, dachte er im Näherkommen, aber es war kunstvoll gemauert. Das Walmdach aus Schiefer hatte hübsche Gauben, und an einer Seite gab es einen großen, ebenerdigen, hölzernen Erker, was die Bewachung sicherlich schwierig machte. Gebrochene Natursteine, aus denen die Mauern bestanden, glitzerten im Mondlicht oder Fackelschein, offenbar waren sie voller Glimmer, und über der Tür hatten Tellosz und Manusz einen hölzernen Regenschutz, der dem Ganzen eine rustikale Note gab und Sentry an ein Wirtshaus erinnerte. Vor dem Haus blühten späte, niedrige Astern und Ringelblumen in lila und orange neben einem hübsch gewachsenen Hagebuttenstrauch. Er war kein Experte für Pflanzen, aber seine Schwester interessierte sich dafür, und deshalb hatte er sich ein paar Namen gemerkt. Insgesamt war dieses Haus ein liebliches Nest, das dem Felsenadepten zu dem Tellosz, den er kennengelernt hatte, gar nicht zu passen schien. Seinem Empfinden nach gehörte der Freund in eine Offizierswohnung in einer Kaserne. Er musste sich an seinen Liebhaber angepasst haben. Aber es war seine Sache, und Sentry hatte nicht vor, sich in etwas einzumischen, das ihn nichts anging.
All das hätte friedlich gewirkt, wenn das Grundstück nicht rundherum von Soldaten bewacht gewesen wäre. Einerseits war das nur logisch, da sich der Erbe des Fürsten darin befand, andererseits war Garahon befestigt wie kein zweites Land, das Sentry kannte. Sie schützten sich vor Feinden aus dem Inneren, folgerte er, und das hatte einen bitteren Beigeschmack. Ideale, friedliche Orte gab es nirgends, ging dem Adepten durch den Kopf, und es frustrierte ihn. Ihn selbst hatte sein hasserfüllter, zehn Jahre älterer Bruder denunziert. Es war nur die Spitze eines Eisbergs gewesen; Alastair war ein Sadist, er hatte ihn schon als Kind gequält und auch andere. Vor der Tür stehend, kam es dem Felsenadepten plötzlich seltsam vor, seinen ersten Besuch in dieser fremden Stadt in Verkleidung und unter falschem Namen zu machen, doch dann betätigte er entschlossen den Türklopfer. Er hatte sich schon immer verstellen müssen, dachte er, im Grunde war es nichts Neues.
Die Tür ging auf, und vor ihm stand ein strahlender Manusz. »Komm rein, nur rein mit dir!«, rief er mit einer Hand gestikulierend, da die andere noch den Knauf hielt. Sentry trat in einen großen, gemütlichen Raum, in dessen schmiedeeisernem Herd ein Feuer prasselte. Auf einem schlichten Holztisch brannten mehrere Kerzen in einem Messingleuchter, und Tellosz kam gerade mit zwei verschiedenen Weinkrügen aus dem Keller hoch. »Diesen oder den?«, fragte er Manusz, der »stell sie doch beide auf den Tisch« antwortete. Jetzt erst bemerkte er Sentry. »Du siehst verdammt gut in meinen alten Klamotten aus!«, rief er und lachte, dabei war er auch selbst edel gekleidet. Ganz offensichtlich war er froh, wieder zuhause zu sein. »Habe ich auch so blendend darin ausgesehen, Manusz?«, fragte er. »Mindestens«, antwortete der Muskelberg fröhlich und lachte nun auch. »Wir trinken Wein. Willst du auch welchen?«, wollte Tellosz von dem jüngeren Freund wissen, und als der bejahte, sagte er zu seinem Mann: »Ich nehme den südlichen Steilhang, den Roten.«
»Mach das«, pflichtete dieser bei, während er sich neben dem Herd zu schaffen machte. Sie wollten noch ein paar Kleinigkeiten auf den Tisch stellen, Häppchen mit Brot, Wurst, Käse und späte Trauben, soweit Sentry es sehen konnte.
Als sie am Tisch saßen, erzählten sie ihm, wie sie zu ihrem fast bäuerlichen Altbau gekommen waren und wie sie ihn gemeinsam wieder hergerichtet hatten. Tellosz gab offen zu, dass er lieber einfacher wohnte als im Palast, und Manusz strahlte ihn dankbar an. Keiner von ihnen dreien hatte Lust, den schönen Abend durch ernste Gesprächsthemen zu verderben, und so plauderten sie munter weiter. »Wie hat dir die schöne Leraille gefallen?«, erkundigte sich Tellosz neugierig bei ihm – überhaupt erzählte Sentry nur von seinen ersten Eindrücken in Garahon, weil er nicht wusste, wie er mit Manusz umgehen sollte. Anlügen wollte er ihn nicht unbedingt. Als Sentry auf die Frage nur »ich bin fast erfroren« antwortete, war das Gelächter groß. »Nimm dich vor der Frau in Acht«, warnte Tellosz, »und lass mich bitte nicht mit ihr allein.« Der Heiler schaute gespielt hilflos, obwohl er es durchaus ernst gemeint hatte. Nach einer guten Stunde war Sentry so müde, dass ihm die Augen zufallen wollten. »Kann ich mich einen Moment auf euer Sofa legen?«, fragte er. »Es war ein langer Tag, aber es geht bestimmt gleich wieder.«
»Mach’s dir gemütlich«, antwortete Manusz großzügig, und Sentry ging zur Couch rüber. Erst setzte er sich nur hin und ließ den Kopf nach hinten an die Lehne fallen, aber dann legte er die Füße doch hoch und war fast auf der Stelle eingeschlafen.
Tellosz und Manusz hatten sich lange nicht gesehen und viel zu erzählen. Sie vergaßen für mehrere Stunden ganz und gar, dass Sentry überhaupt da war. Irgendwann kannte Tellosz fast alles, was sich im Ort, im Tal und in der Schmiede zugetragen hatte, wohingegen er selbst mit seinen Äußerungen weitaus zurückhaltender gewesen war. Aber er hatte viele Landschaften, Bauwerke und Menschen, die er gesehen bzw. getroffen hatte, beschrieben. Dass Ferrecz zu Tode gekommen war, hatte er natürlich auch berichtet, wenngleich er die genauen Umstände im Nebel gelassen hatte. Ebenso war es bei Rural, den sie nur sehr knapp hatten retten können. Schließlich, es war tief in der Nacht, blickte er zufällig zum Sofa herüber. Dort entdeckte er den fest schlafenden Felsenadepten, den er vollkommen vergessen hatte. Tellosz verstummte abrupt, und er konnte seinen Blick nicht gleich wieder losreißen, weil ihm etwas auffiel. »Was ist los?«, wollte sein Freund, der ihn noch nie so gesehen hatte, wissen. »Er schläft seit etwa vier Stunden, Manusz«, antwortete der Freund bewegt – er konnte es kaum fassen. »Und was ist an dem schlafenden Jüngling so besonders, Tellosz?«, forschte der Schmied vorsichtig weiter. »Ach, du hast ja keine Ahnung«, erwiderte der Heiler, verbarg sein Gesicht in den Händen und bekam feuchte Augen. Manusz, der ein paar Jahre älter war, legte einen Arm um ihn und sagte: »Ich habe dich lange nicht mehr so gesehen, Tellosz. Du bist zäher als jeder von uns, mit Ausnahme des Fürsten. Aber manchmal wäre es ganz hilfreich, wenn du nicht nur über das Wetter reden würdest, wenn du nach Hause kommst.«
Als Tellosz sich wieder gefasst hatte, umrundete er das Haus, um sicherzustellen, dass niemand lauschte. Doch die Wachen standen alle etwas entfernt, und Terosz, der Kommandeur seiner Leibwache und ein guter Freund, achtete darauf, dass es so blieb. Feral, Sentrys Begleiter, schickte Tellosz zum Palast zurück, um mitzuteilen, dass er bei ihnen schlief und erst am Morgen zurückkommen würde. Terosz sollte ihn dann begleiten, weil er in der Nähe wohnte, hatte Tellosz pragmatisch entschieden. Als er danach wieder im Haus war, erzählte er seinem Partner in knappen, wesentlichen Zügen, was es mit Sentry auf sich hatte. Und mit ihm selbst.
»Das kann auf Dauer niemand aushalten, Tellosz. Du bist müde. Geh schlafen. Ich kümmere mich um den Jungen, wenn er aufwacht.« Manusz war sich seiner Sache sicher. »Er wird ganz sicher wach werden«, erwiderte Tellosz mit einem Blick auf Sentry sanft. »Meistens starrt er an die Decke, oft zittert er wie verrückt, hin und wieder schlägt er um sich und schreit.«
»In dem Fall fällt er vom Sofa, und wir werden wach«, überlegte sein Freund, »aber er fällt ja nicht tief.« Der Schmied holte eine Wolldecke aus einer Truhe unter der Treppe und deckte Sentry damit zu. »Es ist niemandem damit geholfen, wenn du diese Nacht auch noch wach bleibst«, fuhr er vernünftig fort. »Im Übrigen bist du oben, falls was ist. Ich schlafe auf dem Teppich hier, ist mir weich genug.«
»Danke, Manusz«, antwortete Tellosz und stieg die knarrende, hölzerne Treppe hoch. Der Schmied holte sich Decke und Kissen herunter und schlief angezogen auf dem Teppich ein. Er gehörte zu den Menschen, die immer und überall schlafen konnten.
Als Sentry noch vor Sonnenaufgang erwachte, fiel er nicht vom Sofa, aber er bebte und zitterte und fror, obwohl der Raum noch gut warm war. Er setzte sich auf, zog die Knie zu sich heran und schlang die Arme darum, aber es half nicht. Seine Decke rutschte ihm auf den Boden und machte ein Geräusch, das den Schlafenden auf dem Teppich aufweckte. Der Schmied hatte eine kleine Ölfunzel brennen lassen, damit Sentry sich im Dunklen orientieren konnte. Jetzt setzte er sich auf und rieb sich den Schlaf aus den Augen. »Ich dachte, ich schau besser mal nach dir«, äußerte der massige Mann schüchtern, als Sentry ihn aus erschrockenen, braunen Augen ansah. »Tellosz ist oben, falls das wichtig ist.«
»Stör ihn bitte nicht meinetwegen«, brachte Sentry mühsam heraus. Er legte seine Stirn auf den angezogenen Knien ab und schwieg. »Ich mache dir eine warme Ziegenmilch mit Honig – hilft immer, wenn man nicht schlafen kann«, entschied Manusz. Und schon machte er sich am Herd zu schaffen. Die freundliche Umgebung tat Sentry gut, aber als er die Milch ausgetrunken hatte, war ihm immer noch bitterkalt. Deshalb suchte der Schmied nach weiteren Decken, und weil sie so etwas eigentlich nicht besaßen, kam er schließlich mit einer enorm schweren und großen Pferdedecke aus Schurwolle an, die vor Jahren für ein kälteempfindliches Vollblut beschafft worden war. Diese nahm er doppelt und legte sie über den bebenden Sentry, der sich wieder hingelegt hatte. Anschließend setzte er sich daneben und beschrieb ihm die Schmiede, in der er arbeitete, jedes kleinste Detail. Irgendwann hörte Sentry auf zu zittern. »Besser?«, fragte Manusz. »Ja, vielen Dank«, antwortete Sentry erschöpft. »Ich helfe gern, Felsenadept«, erwiderte der Schmied in ähnlicher Manier, wie Tellosz es oft tat, und er fügte an: »Du siehst nicht gerade gefährlich aus, Sentry.« Der Adept lächelte müde. »Nein«, meinte er und schüttelte seine dunkelbraunen Locken, »ich bin gelernter Buchhalter, Manusz. Aber das ist nur eine Seite von mehreren, meine menschliche. Wenn ich den Kriegslord dominieren lassen würde, hättest du Angst vor mir, und ich würde weder Schmerzen noch Furcht fühlen. Alles außer Krieg und Rache wäre weit, weit weg.« Er ließ einen Moment verstreichen und sagte dann: »Ich bin froh, dass Tellosz dir erzählt hat, wer oder was ich bin, aber von jetzt an heiße ich Mokar von Erenez. Es ist sonst zu gefährlich für uns alle, auch für dich.«
»Ich weiß«, erwiderte Manusz, und als er ihm erneut in die Augen blickte, kam Sentry ihm schon deutlich weniger harmlos vor.
Auf einem Adelssitz in Montzien
Feraia de Bonbaille, genannt Ferry, war 15 Jahre alt, und sie hatte ihr Leben fest im Griff. Seit einigen Wochen wusste sie, dass sie den dritten Sohn des Großfürsten Bagalysh, dessen Vater die rechte Hand des Usurpators in Thrùne war, heiraten sollte. Und seitdem hatte sie ihre Eltern ebenso konsequent wie unauffällig bearbeitet, um die Hochzeit so weit wie möglich nach hinten zu verschieben. Ferrys Mühen fingen an, Früchte zu tragen, denn tatsächlich hatte sich ihr Vater inzwischen an seinen jüngeren Bruder gewandt, der für Bagalysh arbeitete, um eben dies zu erreichen. Seine Tochter wäre leider noch nicht reif genug, hatte er in einem Brief bedauert, im Kopf ein kleines Mädchen und längst keine Frau. Daran würde der Sohn des Großfürsten sicherlich wenig Freude haben. Wenn sie aber noch ein gutes Jahr abwarten würden, sähe das Ganze bestimmt anders aus, und er könnte dem Bräutigam eine Schönheit übergeben.
So viel zur Lage, sinnierte Feraia desillusioniert, während sie ihre verzierten, äußerst zierlichen Lederstiefeletten zuschnürte. Kritisch überprüfte sie ihr Erscheinungsbild im Spiegel. Weil sie diese oder eine ähnlich furchtbare Verheiratung längst hatte kommen sehen, hatte sie frühzeitig angefangen, sich einen schlechten Ruf zu erarbeiten. Genau genommen kultivierte sie eine plumpe Art der Kindlichkeit, weshalb sie den Leuten mitunter fast stumpfsinnig vorkam. Ihre Eltern betrachteten sie als reines Handelsgut, aber welcher Mann wollte sich eine bescheuerte Frau einkaufen? Um dieses Image zu pflegen, wählte sie Stoffe und Schmuckborten so aus, dass ihre Kleider immer ein wenig zu verspielt aussahen, und sie frisierte sich zwar altersgemäß und sehr aufwendig, doch stets ein bisschen zu unordentlich, was diesen Eindruck wundervoll verstärkte. Auch der Schnitt ihrer Kleider behielt eine kindliche Note, obwohl er der Mode zumindest einigermaßen entsprechen musste. Ausgeschnittene Dekolletees waren unbedingt zu meiden, ebenso taillierte Kleider, weil sie ihre schon frauliche Figur betont hätten. Puffärmel waren in der Tat hilfreich, wenn sie zum Ganzen passten, und ihre Röcke durften nicht ganz so lang ausfallen, wie ihre Mutter sie trug, also immer etwas zu kurz, als wäre sie herausgewachsen. Das Ganze war eine Wissenschaft für sich. Professionell setzte die junge Comtesse de Bonbaille einen unsicheren, schmollenden Gesichtsausdruck auf, den eine junge montzische Frau ihrer Meinung nach unbedingt beherrschen sollte, und lief aufgeregt zu ihrer Mutter in deren Ankleidezimmer, um ihre Pläne weiter voranzubringen.
Als die Fürstin sie bemerkte, verfinsterte sich ihr Blick. »Liebes, du musst deine Haare noch einmal von deiner Zofe richten lassen«, wurde Ferry von ihrer eleganten, ziemlich blassen Mutter belehrt. »Wie du aussiehst! Es sind schon wieder Strähnen herausgerutscht. Benimm dich einmal wie eine junge Dame, Feraia. Und stecke dir die goldene Brosche mit dem rosafarbenen Achat an. Wir sind kein Armenhaus, und das soll der Großfürst sehen. Schließlich bekommst du eine stattliche Mitgift, damit es sich für seinen Sohn auch lohnt.« Leonore de Bonbaille zog ihr eigenes, silbrig schimmerndes Seidenkleid in Form und fuhr dann fort. »Du musst deinem Schwiegervater gefallen wollen, Feraia. Es hängt viel davon ab. Immerhin sollen sie ein ganzes Jahr auf dich warten, damit du heranreifen kannst, wenn es nach dem Willen deines Vaters geht. Eine bessere Partie kannst du nicht machen.« Sie blickte missbilligend auf ihre zerzauste Tochter.
Feraia, die sich wie ein rotbäckiger Pfirsich auf dem Präsentierteller neben einem Aperitif vorkam, warf sich ins Zeug. »Die Brosche! Ich werde sie gleich suchen und anstecken. Wenn ich nur wüsste, wo ich sie habe. Ich werde ganz fröhlich und charmant sein, Mutter! Ist der Großfürst ein hübscher Mann? Hat er einen schönen Sohn? Auf meiner Hochzeit will ich tanzen!« Sie gab der Fürstin, die sich kaum merklich wehrte, einen verspielten Kuss auf die Wange, drehte sich mehrfach wild um sich selbst, raffte ihre fliegenden Röcke zu hoch und sprang aufgedreht davon. Auf eine Antwort hatte sie nicht gewartet. »Ich bin ein Pfirsich mit Wurm«, dachte Ferry bei sich, während ihr ihre vertraute Freundin und Zofe Gesine kurz danach die große Brosche ansteckte. Die beiden Mädchen schmiedeten ihre Pläne grundsätzlich gemeinsam.
Leonore de Bonbaille lächelte nicht, als ihre anstrengende Tochter aus dem Zimmer war. Herrisch wiegte sie ihren Kopf, um den blonde, schwere Haarflechten wie eine Krone gewunden waren, und machte ein miesepetriges Gesicht. Ihr versoffener Gatte Damien, der gleichzeitig ihr älterer Großcousin war, und sie selbst hatten drei strebsame Söhne, die sie stolz machten, insbesondere der Älteste. Alastair und der erste Zwilling würden es beim Usurpator in Thrùne weit bringen, überlegte sie. Das stand außer Zweifel. Der zweite Zwilling war zu schweigsam und in sich gekehrt. Aber er war beflissen, immerhin. »Dem Gott der Ränkespiele sei Dank«, ging ihr sarkastisch durch den Kopf, und sie zog ihre Mundwinkel in einer Art umgedrehtem Lächeln herunter, »wenigstens dieser Plan geht auf.« Sie hatte den Gott der Ideen schon vor Jahrzehnten umgetauft. Ideen … es war lächerlich! Was Leonore brauchte, war Taktik. Denn den Status ihres Adelshauses unterminierte leider ihr missratener, vierter Sohn. Sie hätte Sentry als Säugling erdrosseln sollen, das hatte sie schon oft gedacht, aber sie hatte direkt nach seiner Geburt ein zu weiches Herz gehabt. Er war gezeichnet gewesen, sie und Damien hatten es beide gesehen und entfernen lassen. In den unteren Offiziersrängen hätte er vielleicht noch durchgehen können – schließlich wurde ein vierter Sohn wenig beachtet, weil er nicht erben würde. Doch Sentry war ein Wechselbalg. Weiß Gott, Alastair hatte versucht, ihn zu unterjochen, damit er spurte, und bei jedem anderen hätte das auch geklappt. An ihm war alles abgeglitten, als wäre er nicht von dieser Welt. Seit Jahren war Sentry dem Einflussbereich der Familie schon entkommen. Fürstin Leonore hatte ihn jedes Jahr ein bisschen mehr gehasst, weil er ihr nichts als Unglück gebracht hatte. Seinetwegen hatte sie die Zuneigung ihres Gatten verloren – Damien hatte geglaubt, dass sie fremdgegangen war –, und nun brachte Sentry durch seinen Widerstand gegen die Macht im Staate ihren alten Namen in Verruf. Sie und ihr Gatte würden die zurückgebliebene Feraia um jeden Preis mit einem Sohn von Bagalysh vermählen, um eine Allianz mit dem mächtigen Günstling zu erreichen. Es war nicht so, dass die Fürstin ihre einzige Tochter verabscheute, aber Leonore war von ihr enttäuscht, und sie verzweifelte an dem dummen Ding, das einfach nicht erwachsen wurde. Im Ringen um politischen Einfluss mussten Opfer gebracht werden, insbesondere von Frauen. Sie selbst hatte sich dem Notwendigen gefügt. Es war lange her.
Als ihre ältliche Dienerin der Fürstin nach dem Pudern und Schminken ihres Gesichts ein wertvolles Diadem umlegte, riss sie sich aus ihren trübsinnigen Gedanken. Leonore de Bonbaille grinste hart und gezwungen in den blankgeputzten Silberspiegel, ihre braunen Augen wirkten nach innen gekehrt. Lächeln war ungewohnt, es wollte ihr nicht recht gelingen. Nachher müssten sie alle ein freundliches Bild abgeben. Die Fürstin hoffte nur, dass ihr Gatte sich nicht bis zur Bewusstlosigkeit betrinken würde.
Bonbaille erwartete Großfürst Bagalyshs hohen Besuch, und der ganze Palasthaushalt war in Bewegung geraten. Überall wurde poliert und gewienert, und alle Mitglieder des Haushalts putzten sich heraus. Die Wachsoldaten hatten blitzende Schuhe, Helme und Waffen, ihre Uniformen waren ausgebürstet und Rasierwasserduft hing in der Luft. Männliche Bedienstete trugen frisch gestärkte, blau-weiße Livree, die Frauen ebensolche Kleider mit Schürzen. Selbst Pferdeknechte waren heute in Uniform und legten letzte Hand an. Längst waren sämtliche Boxen ausgemistet und repariert, falls sich der Großfürst für die Warmblutzucht interessieren würde. In jeder Ecke des großen Anwesens klopfte, klapperte, rauschte, trippelte und huschte es unterwürfig. Niemand wollte an einem solchen Tag negativ auffallen, denn das würde sich in Leonores Gedächtnis einbrennen, und die Fürstin war nachtragend.