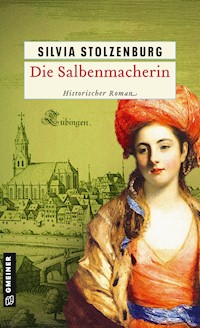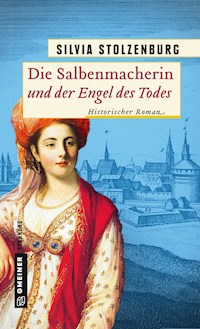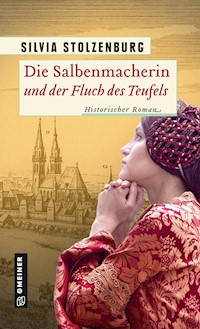Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Begine von Ulm
- Sprache: Deutsch
Anna Ehinger wähnt sich am Ziel ihrer Träume: Sie und ihr Gemahl Lazarus sind zurück in ihrem wiederaufgebauten Haus, Anna hat einen gesunden Sohn geboren und im Spital verläuft alles in geordneten Bahnen. Da taucht ein Sterndeuter in der Stadt auf, der den Ulmern eine Katastrophe voraussagt. Einige fliehen in Angst, und als sie zurückkehren, sind ihre Häuser ausgeraubt. Wenig später treibt der Scharlatan tot in der Blau und Anna will eine Unschuldige vor der Verurteilung bewahren. Sie gerät in einen Strudel aus Täuschung und Gewalt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Stolzenburg
Die Begine und der Sterndeuter
Historischer Kriminalroman
Zum Buch
Großes Unheil Ulm, Anno Domini 1416. Anna Ehinger ist glücklich: Sie und ihr Gemahl Lazarus sind zurück in ihr Haus gezogen und Anna hat einen gesunden Sohn zur Welt gebracht. Im Spital verläuft unter Bruder Martin, dem neuen Magister Hospitalis, alles geordnet, und es scheint, als würde einem ruhigen Leben nichts mehr im Wege stehen. Da taucht ein Sterndeuter in der Stadt auf, der den Ulmern großes Unheil voraussagt. Die Konstellation der Planeten deutet, so behauptet er, auf eine verheerende Katastrophe hin, der nur entkommen kann, wer die Stadt verlässt. Nicht wenige Ulmer fallen auf den Scharlatan herein und werden in ihrer Abwesenheit ausgeraubt. Dazu rücken falsche Münzen Annas Bruder Jakob in ein schlechtes Licht. Als dann noch die Leiche des Astrologen in der Blau treibt und Anna eine unschuldige Hübschlerin vor der Verurteilung bewahren will, gerät sie in einen gefährlichen Strudel aus Täuschung und Gewalt …
Dr. phil. Silvia Stolzenburg studierte Germanistik und Anglistik an der Universität Tübingen. Im Jahr 2006 promovierte sie dort über zeitgenössische Bestseller. Kurz darauf machte sie sich an die Arbeit an ihrem ersten historischen Roman. Sie ist hauptberufliche Autorin und lebt mit ihrem Mann auf der Schwäbischen Alb, fährt leidenschaftlich Mountainbike, gräbt in Museen und Archiven oder kraxelt auf steilen Burgfelsen herum – immer in der Hoffnung, etwas Spannendes zu entdecken.
Impressum
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München)
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Daniel Abt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bildes von: © Elnur / stock.adobe.com; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fr%C3%A8res_Limbourg_-_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_-_mois_de_mai_-_Google_Art_Project.jpg; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_avril.jpg?uselang=de
ISBN 978-3-7349-3230-4
Widmung
Für meinen Liebsten, der mich immer wieder aufrichtet, wenn ich geknickt bin
Kapitel 1
Ulm, Mai 1416
»Höret, ihr Ulmer!«, scholl die Stimme eines wunderlich gekleideten Mannes über den Platz vor der Münsterkirche.
Der Morgen war freundlich und mild, die Luft schwer vom Duft der ersten Blüten. Die dicken Mäntel der Ulmer wichen allmählich leichteren Gewändern, die Pelzkappen bunten Filzhüten und hohen Hauben. Auf dem Dach des Barfüßerklosters, das im Schatten des noch immer nicht fertiggestellten Westturms des Münsters lag, schimpften Spatzen. Das saftige Grün der Bäume verhieß einen warmen Frühling, nach dem sich nicht nur der Stadtpfeifer Gallus sehnte. Der Winter war lang und eisig gewesen.
Gallus, der auf dem Weg zur Beginensammlung war, um Luna zu treffen, verlangsamte beim Anblick des merkwürdigen Kauzes die Schritte.
»Höret meine Worte und merket auf!« Der seltsame Mann hob die Hände, wodurch die weiten Ärmel seines mit silbernen Sternen bestickten Gewandes zu den Ellenbogen rutschten. »Die kosmischen Zeichen verheißen großes Unheil, das jeden treffen wird, der meine Warnung in den Wind schlägt!«
Gallus blieb stehen, ein Dutzend andere taten es ihm gleich.
Die Zimmerleute und Steinmetze, die Ziegelstreicher und Mörtelträger der Münsterbaustelle ließen ebenfalls ihre Werkzeuge sinken und kamen näher.
»Ich komme von einem weit entfernten Ort im Morgenland«, rief der Mann mit einem Blick in die Runde. »Mein Name ist Antiochus, und ich bin in der Lage, das Schicksal der Menschheit in den Sternen zu lesen.«
Gallus spürte, wie ihm ein Schauer über den Rücken kroch. Ein Sterndeuter in Ulm? Was würde Luna wohl dazu sagen? Er musterte den Kerl neugierig.
Das Haar des Sterndeuters war lang und von silbernen Strähnen durchzogen. Ein dünner Ziegenbart zierte sein Kinn. Sein Blick war durchdringend, die Nase scharf geschnitten. Seine Hände, an denen Ringe funkelten, tanzten durch die Luft, als er zum Himmel zeigte. »Schon bald, am übernächsten Sonntag, droht einer der gefährlichsten Dies Aegyptiaci«, warnte er. »Ein Unglückstag von solcher Macht, dass ihm nur entfliehen kann, wer diesen Ort, diese Stadt«, er fuchtelte mit den Armen, »meidet.«
Ein Raunen ging durch die Reihen.
»Was meint er?«, flüsterte eine junge Frau hinter Gallus.
»Woher soll ich das wissen?«, entgegnete ihre Begleiterin.
»Die Sonne wird sich verfinstern, und der Mond wird seinen Schein nicht geben«, posaunte Antiochus. »Und die Sterne werden vom Himmel fallen. So steht es in der Heiligen Schrift!« Er machte eine bedeutungsvolle Pause. »Das Ende der Tage könnte näher sein, als ihr denkt!«
»Was für ein Unsinn!«, rief einer der Zimmerleute. »Wie oft haben wir so einen Mist schon gehört?«
Antiochus wirbelte herum und fasste den Zimmermann scharf ins Auge. »Du zweifelst an meinen Worten?«, fragte er.
»Jeder, der einen Funken Verstand im Kopf hat, wird daran zweifeln. Wer bist du überhaupt?«
Antiochus warf sich in die Brust. »Ich bin derjenige, der weiß, zu welcher Stunde eines jeden Tages welcher Planet regiert. Ich allein weiß, wann du mit der Güte von Jupiter und Venus rechnen kannst und wann du dich vor der Bosheit, dem Unheil und dem Übel hüten musst, das Saturn und Mars mit sich bringen!« Er hob anklagend den Finger. »Es ist eine Tatsache, dass es für jedes Ding in der Natur, für jedes Lebewesen andere Dinge und Lebewesen gibt, die ihm freundlich oder feindlich gesonnen sind. Alles hängt zusammen, alles besitzt eine göttliche Ordnung. Gerät diese Ordnung ins Wanken, droht der Untergang der Welt!«
»Und dieser Untergang soll am übernächsten Sonntag sein? Und nur in Ulm?«, höhnte der Zimmermann unbeeindruckt.
»Gott wird die Zweifler bestrafen«, tönte Antiochus. »Hochmut kommt vor dem Fall!«
Einige lachten, anderen war anzusehen, dass die Worte des Sterndeuters verfingen.
»Wenn du in die Zukunft sehen kannst«, höhnte ein Steinmetz, »dann sag mir, ob ich bald ein Weib finde!«
»Für derlei Dinge solltest du dich an eine Handleserin wenden«, war die verächtliche Antwort. »Ich erkenne nur die großen Ereignisse, die so gewaltig sind, dass sie euer aller Schicksal beeinflussen.« Er zeigte erneut zum Himmel. »Dieser Turm erzürnt Gott«, klagte er an.
»Da bist du nicht der Erste, der das behauptet«, winkte der Steinmetz ab. Er schien das Interesse an Antiochus zu verlieren und machte Anstalten, sich abzuwenden.
»Der Herr wird euren Unglauben mit einer Pestilenz von gewaltigem Ausmaß bestrafen!«, krakeelte Antiochus. »Üble Winde werden die Stadt mit ihrem Gestank erfüllen und jeden vergiften, der sie einatmet!« Er setzte eine finstere Miene auf. »Ich habe euch gewarnt«, sagte er. »Brecht nicht in Wehklagen aus, wenn es zu spät ist, um auf meine Worte zu hören!« Mit einer Bewegung, die sein Gewand aufbauschte, kehrte er den Schaulustigen den Rücken und stolzierte in Richtung Marktplatz davon.
Gallus runzelte die Stirn. War der Kerl ein Betrüger? Oder sprach er die Wahrheit? Er beschloss, Luna von ihm zu erzählen. Während die Menschen um ihn herum anfingen, aufgeregt durcheinanderzureden, eilte er zur Hafengasse und erreichte wenig später die Frauengasse, in der sich der Beginenhof befand.
Da die Torhüterin ihn kannte, ließ sie ihn ungehindert passieren, obwohl ihr das Missfallen über seinen neuerlichen Besuch anzusehen war. Gallus wusste, dass die Beginen es nicht guthießen, wie offen Luna und er miteinander umgingen. Die verkniffenen Gesichter, die tadelnden Blicke und das kaum zu übersehende Kopfschütteln der frommen Betschwestern waren ihm gleichgültig. Vor nicht allzu langer Zeit wäre Luna fast gestorben, doch dieses Mal hatte Gott ein Einsehen mit der Frau gehabt, an die Gallus sein Herz verloren hatte. Er würde alles dafür tun, sie endlich aus diesem Beginenhof zu befreien! Irgendwann würde er den Mut finden und sie bitten, seine Gemahlin zu werden.
Er betrat den rechteckigen Innenhof und verspürte das wohlbekannte Kribbeln im Bauch, das ihn jedes Mal überfiel, wenn er sich Luna näherte. Sie war so anders als alle Frauen, denen er bisher begegnet war. Luna war geheimnisvoll und rätselhaft, leidenschaftlich und sie besaß die geschmeidige Kraft einer Katze. An manchen Tagen konnte er noch immer nicht glauben, dass sie hin und wieder das Bett mit ihm teilte. Als er den Hof überquerte, stieg ihm der Duft von frisch gebackenem Brot in die Nase. Die Sonne glänzte auf den Dächern der Scheunen und Ställe, und das Weiß der Fachwerkgebäude, die um den Innenhof angeordnet waren, erschien ihm an diesem Tag besonders strahlend. Die Blüten der Kletterrosen, die sich überall emporrankten, wurden von Bienen umschwärmt. Die Ehehalten, die Knechte und Mägde der Beginen, waren emsig bei der Arbeit, besserten Gerätschaften aus, schöpften Wasser aus dem Zugbrunnen und misteten die Ställe aus. Aus der Ferne trug der Wind das Schlagen von Zimmermannshämmern heran.
In einem der überdachten Kreuzgänge entdeckte Gallus eine Gruppe von Beginen, die sich mit einer Frau unterhielten. Vermutlich handelte es sich um eine Reisende, die im Hof Unterkunft gefunden hatte. Froh darüber, dass sie ihn nicht bemerkt zu haben schienen, eilte Gallus zur Arzneistube, in der sich Luna die meiste Zeit über aufhielt, wenn sie im Beginenhof war. Ohne anzuklopfen, betrat er den kleinen Raum, der nur zwei winzige Fenster besaß. Da unter der gemauerten Kochstelle ein kräftiges Feuer prasselte, war es warm in der Küche. Der Funkenhut über der Kochstelle war mit einem Schornstein verbunden, dennoch hing genug Rauch in der Luft, um die Umrisse der Frau zu verwischen, die über einen Hacktisch gebeugt stand. Sie trug bunte Gewänder und hatte ihr dunkles Haar zu einem dicken Zopf geflochten, der bis zur Hüfte reichte. Sie war bleich, zierlich und wunderschön. Auch wenn sie nicht zu sehen waren, wusste Gallus, dass an ihrem Hals mehrere silberne Ketten und Amulette hingen. Ihre Armreifen klimperten, als sie nach einem Mörser griff.
»Luna«, sagte er mit plötzlich belegter Stimme.
Sie wandte sich mit hochgezogenen Brauen zu ihm um. »Gallus?«, fragte sie verwundert. »Was tust du denn hier?«
Er blinzelte überrascht. »Ich … Ich dachte …«, stammelte er.
Ein Lächeln erhellte ihr Gesicht. »Ist es schon so spät?«
Erleichterung vertrieb die Sorge, die sich plötzlich in ihm ausbreiten wollte. »Ich sollte dich ins Fischerviertel begleiten«, erinnerte er sie. Seit dem Überfall, bei dem sie fast ihr Leben verloren hatte, wich er nicht mehr von ihrer Seite, wenn sie den Ulmern ihre Zaubersprüche und Wundermittel verkaufte.
Sie schob den Mörser von sich und wischte sich die Hände an einem Tuch ab. Anschließend räumte sie die Zutaten auf und verstaute Flaschen und Tiegel in den schlichten Regalen, die an zwei der vier Wänden standen.
»Du wirst nicht glauben, wem ich auf dem Weg hierher begegnet bin«, sagte Gallus.
Luna warf ihm einen Blick über die Schulter zu. »Einem Waldschrat?«, neckte sie ihn.
Gallus schüttelte den Kopf. »Einem Sterndeuter.«
Einige Augenblicke rührte sie sich nicht, dann wandte sie sich langsam um. »Einem Sterndeuter?«
Gallus nickte. »Antiochus aus dem Morgenland. Er hat behauptet, dass eine gewaltige Katastrophe über die Stadt hereinbrechen wird.«
Kapitel 2
Die Nachmittagssonne malte lange Schatten auf den Boden der Kinderstube. Anna Ehinger hielt ihren Sohn Johannes, Hansi genannt, in den Armen und verfolgte lächelnd, wie er nach der Kette aus bunten Glasperlen an ihrem Hals griff. Er war gerade ein halbes Jahr alt, wirkte jedoch kräftiger als andere Kinder in seinem Alter. Seine zweijährige Schwester Agnes kniete am Boden und warf Kegel um.
»Er ist so neugierig!«, lachte die Amme, die sich in Annas Abwesenheit um die Kinder kümmerte. »Er wird bestimmt ein stattlicher Mann.« Sie trat zu Anna und verwuschelte Hansis Haare.
Anna hielt ihre Kette fest, damit ihr Sohn sie nicht abreißen konnte.
»Soll ich ihn nehmen?«, fragte die Amme. Sie schien vernarrt zu sein in den Kleinen.
Anna hätte ihren Sohn stundenlang anschauen können. Schweren Herzens reichte sie ihn weiter, da sie in der Kräuterküche zu tun hatte. Lazarus war an diesem Tag früh ins Spital gegangen und bis jetzt nicht zurückgekehrt. Seit Anna die Spitalapotheke mit Arzneien bestückte, hatte sie noch mehr zu tun als früher.
Sie war froh, dass sie wieder in ihrem eigenen Haus wohnten. Nach dem Brand im Haus ihres Bruders Jakob hatte es lange gedauert, bis die Handwerker es wieder so weit aufgebaut hatten, dass man darin wohnen konnte. Vor vier Wochen waren ihr Bruder und ihre Schwägerin Ella aus Annas Haus ausgezogen, in dem sie Unterkunft gefunden hatten. Anna und Lazarus hatten derweil in einer Pfründnerwohnung im Spital gelebt. Die gewohnte Umgebung hatte Anna gefehlt.
Während die Amme ein Lied anstimmte und Hansi zu seiner Schwester trug, ging Anna zur Tür und zögerte kurz, ehe sie die Kinderstube verließ. Es half nichts, die Arbeit konnte nicht warten. Zwar wurde Lazarus vom Rat mit einer ansehnlichen Summe für seine Arbeit im Spital entlohnt, allerdings erlaubte erst ihr gemeinsamer Verdienst die Lebensweise, an die sie sich gewöhnt hatten. Außerdem wusste Anna, dass sie sich innerhalb kurzer Zeit langweilen würde, wenn ihr Tag ausschließlich aus häuslichen Pflichten bestünde.
Nachdem sie das Haus verlassen hatte, ging sie zur Rückseite, wo sich die Kräuterküche befand, die eigens für sie eingerichtet worden war. Das kleine Häuschen mit dem großen Kamin war umgeben vom Grün der Sträucher, die entlang der Mauer wuchsen, die das Anwesen ihres Bruders umfing. Das Haus, das Jakob Anna und Lazarus geschenkt hatte, grenzte an seinen eigenen Garten an, und im Winter konnte Anna das Licht in den Fenstern seiner Stube sehen.
Mit den Gedanken bei Agnes und Hansi entzündete sie ein Feuer unter der Kochstelle und schloss die kleine Tür, durch die man Holzscheite nachlegen konnte. Dann kam sie auf die Beine und ging zu den großen Tontöpfen, in denen sich getrocknete Kräuter und andere Dinge befanden, die sie zur Herstellung von Arzneien benötigte. Nicht nur die wohlhabenden Patrizierinnen und die Pfründner im Heilig-Geist-Spital suchten regelmäßig ihre Hilfe, auch die Hübschlerinnen des Frauenhauses verließen sich auf Anna, um sich vor Krankheiten, Wundheit oder ungewollter Empfängnis zu schützen. Lazarus hieß es nicht gut, dass Anna das Frauenhaus besuchte, um den Huren zu helfen, aber ihr taten die jungen Frauen leid. Viele von ihnen waren ohne eigenes Zutun in den Fängen des Frauenwirtes gelandet, meist von den eigenen Familien verpfändet. Da der Frauenwirt eine beträchtliche Summe für die schäbigen Kammern und das schlechte Essen verlangte, gelang es den meisten von ihnen nie, dem Leid und der Ausbeutung zu entfliehen.
Mit einem Seufzen holte sie etwas getrockneten Beifuß hervor, den sie in einen Topf voller Wein gab, um ihn zu kochen. Wenn eine Frau diesen Wein trank, wurde ihre monatliche Reinigung herbeigeführt, wodurch sich entweder eine Empfängnis verhindern ließ oder ein früher Abort einsetzte, sollte sie bereits empfangen haben. Anna wusste, dass sie mit dem Abbruch einer Schwangerschaft eine schwere Sünde beging, doch galt ein Ungeborenes im Schoß einer Frau bis zu achtzig Tage nach der Empfängnis als Fetus inanimatus, als unbeseelter Fötus. Dieser wurde selbst von der Kirche noch nicht als Lebewesen, sondern als Körperteil der Schwangeren angesehen. Nach Ablauf dieser achtzig Tage war das Geschlecht des Kindes festzustellen, weshalb zu diesem Zeitpunkt dem Körper die Seele »eingegossen« wurde.
Beifuß galt als menstrua purgat, als die Menstruation anregendes Kraut, ebenso Wermut, Rote Betonie, Kamille, Fenchel, Lilie und Gurkenkraut. Zudem hatte sich erwiesen, dass eine Empfängnis verhindert werden konnte, wenn der Bauch einer Frau vor dem Koitus mit dem Saft frischer Pfefferminzblätter eingerieben wurde. Die Beeren des Kriechwacholders verursachten ebenfalls den Monatsfluss und schwemmten den conceptus, das empfangene Kind, aus.
Anna war so in ihre Arbeit vertieft, dass sie ihre Schwägerin Ella erst bemerkte, als sie mitten im Raum stand. Schweigend, mit gerunzelter Stirn, beobachtete Ella, wie Anna in dem Wein auf der Kochstelle rührte. »Störe ich?«, fragte sie.
Anna zwang sich zu einem Lächeln. Seit der Fehlgeburt, die Ella im letzten Jahr erlitten hatte, war der Umgang mit ihr schwierig. Anna hatte den Eindruck, dass Ella ihr die Schuld daran gab, das Kind verloren zu haben. »Du störst nie«, sagte sie und hoffte, dass Ella ihr die Lüge nicht ansah.
Ella schien nicht recht zu wissen, was sie sagen wollte, da sie sich auf die Lippe biss und den Blick durch den Raum schweifen ließ. Sie wirkte beklommen.
Hoffentlich erriet ihre Schwägerin nicht, welche Mittel sie gerade herstellte. Nach der Fehlgeburt war Ella lange Zeit niedergeschlagen und traurig gewesen. Sie würde nicht verstehen, dass ein Abbruch der Schwangerschaft für manche Frauen eine Erlösung darstellte.
»Ich glaube, ich habe wieder ein Kind empfangen«, sagte Ella schließlich. Ihre Stimme zitterte leicht.
Anna ließ den Holzlöffel sinken, mit dem sie im Wein gerührt hatte. »Das ist eine wunderbare Nachricht!«, rief sie aus, legte den Löffel zur Seite und trat auf Ella zu. Ohne lange zu überlegen, griff sie nach den Händen ihrer Schwägerin. »Dieses Mal wird alles gutgehen.«
Ellas Blick war unsicher. »Deshalb bin ich gekommen«, sagte sie. »Ich will, dass du mir etwas gibst, das verhindert …« Sie brach den Satz ab und blinzelte heftig, um die Tränen zu vertreiben, die in ihre Augen stiegen. »Jakob wünscht sich so sehr noch einen Sohn«, fuhr sie fort, nachdem sie ihre Fassung wiedererlangt hatte. »Ich konnte ihm den Wunsch nicht abschlagen.«
Anna hatte die harten Worte ihrer Schwägerin nicht vergessen, trotzdem beschloss sie, nicht nachtragend zu sein. »Ich kann wirklich nicht verstehen, warum du dich nicht selbst um deine Tochter kümmerst«, hatte Ella Anna kurz nach dem verheerenden Feuer an den Kopf geworfen. »Eine Amme ist keine Mutter!« Die Worte hatten einen wunden Punkt getroffen, da Anna sich oft wünschte, mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können. Doch Gott hatte ihr eine Aufgabe gegeben, die wichtiger war als ihre eigenen Bedürfnisse. Sie ließ Ellas Hände los und ging zu einem der Regale, in dem Dutzende von Flaschen standen, um eine davon hervorzuholen und Ella zu reichen.
»Was ist das?«, fragte ihre Schwägerin und betrachtete die dunkle Flüssigkeit darin mit einem sorgenvollen Ausdruck.
»Ein Trank aus Hainbuchensprossen«, erklärte Anna. »Gib jeden Tag einen Löffel davon in heiße Milch und trink sie. Das verhindert einen drohenden Abort.«
»Bist du sicher?«
Anna verkniff sich ein Seufzen. »Nur Gott hat die Macht, dich und dein Kind zu beschützen«, sagte sie. »Aber dieses Mittel hat schon manchem Ungeborenen das Leben gerettet.«
Ella schien einige Augenblicke mit sich zu ringen, dann sagte sie: »Ich hätte früher zu dir kommen sollen.«
Diese Worte waren so ungewöhnlich für Annas Schwägerin, dass Anna plötzlich etwas Ähnliches wie Zuneigung empfand. Der Tod eines Kindes war ein harter Schlag für eine Frau, dessen war sie sich bewusst. Der Verlust hatte Ella schwer getroffen. Von der hochmütigen, stets herausgeputzten Gemahlin ihres Bruders war nicht mehr viel übrig. Und das, obwohl Jakob seit einiger Zeit das wichtige Amt des städtischen Kämmerers innehatte. Ella protzte weder mit neuen Kleidern noch mit den albernen Hauben, mit denen sie in der Vergangenheit aufgefallen war. Vielleicht lag ihre Bescheidenheit zum Teil daran, dass ein großer Teil von Jakobs Waren, Tuche und teure Weine, bei dem Feuer in Rauch aufgegangen waren. Allerdings hatte sich auch Ellas Gebaren gewandelt.
Anna nickte. »Dieses Mal werde ich, so oft ich kann, nach dir sehen«, versprach sie. »Und du kommst sofort zu mir, wenn du dich unwohl fühlst oder glaubst, dass etwas nicht stimmt. Versprich mir das.«
»Das werde ich.« Ellas Augen glänzten feucht. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, schloss ihn jedoch wieder und verließ wortlos die Kräuterküche.
Anna blickte eine Weile auf die Stelle, an der ihre Schwägerin gestanden hatte, ehe sie die Gedanken an Vergangenes abschüttelte und sich wieder an die Arbeit machte.
Kapitel 3
Anderthalb Stunden später war das Feuer in der Kochstelle erloschen und alle Mittel waren hergestellt, die gebraucht wurden. Da man im Spital dringend auf Tyriaca magna Galeni, das Allheilmittel Theriak, wartete, beschloss Anna, sich gleich auf den Weg zu machen, um die Bestände der Spitalapotheke aufzufüllen.
Nachdem sie zwei Dutzend Fläschchen verkorkt und die Glut in der Feuerstelle mit dem Schürhaken auseinandergeschoben hatte, warf sie sich einen leichten Mantel über und verließ die Kräuterküche. Auf der breiten Straße vor ihrem Haus drängten sich mit Steinen und Holz beladene Fuhrwerke, die, so vermutete Anna, zur Münsterbaustelle unterwegs waren. Seit dem Ende des Winters wurde wieder emsig an dem gewaltigen Gotteshaus gebaut, dessen Fertigstellung aller Voraussicht nach erst Annas Enkel erleben würden.
Der Geruch zahlloser Herdfeuer stach ihr in die Nase, als sie sich zum Spital aufmachte. Ihr Weg führte sie am Beginenhof vorbei, dem sie an diesem Tag nur einen flüchtigen Blick zuwarf. Seit der Geburt ihres Sohnes war der letzte Rest Wehmut verschwunden, die sie jedes Mal verspürt hatte, wenn sie an ihrem ehemaligen Zuhause vorbeigekommen war. Ihr Leben als Begine schien in so weiter Ferne zu liegen, dass sie sich manchmal schwertat, sich an den strengen Tagesablauf der Schwestern zu erinnern.
Es dauerte nicht lange, bis das Ochsenbergle vor ihr auftauchte. Doch ehe sie in Richtung Spital weitergehen konnte, fiel ihr eine Ansammlung von Menschen auf, die sich unweit des bunt bemalten Rathauses um etwas drängten, das sie nicht sehen konnte. Die Neugier ist eine Tugend des Teufels,schoss ihr durch den Kopf, dennoch gelang es ihr nicht, sie zu unterdrücken. Was ging dort vor sich? Bevor sie sich davon abhalten konnte, setzten sich ihre Füße wie von selbst in Bewegung.
»Wer Ohren hat, der höre!«, scholl ihr eine sich überschlagende Stimme entgegen, als sie sich den Schaulustigen näherte.
Ohne auf die missfälligen Blicke zu achten, bahnte sie sich einen Weg nach vorn, bis sie einen wunderlich gekleideten Mann erblickte, dessen Augen fiebrig leuchteten. Er hatte die Arme ausgebreitet und einen mahnenden Zeigefinger erhoben. »Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war …«, er machte eine bedeutungsvolle Pause, »… der Tod!«
Anna runzelte die Stirn. Was war das denn für ein Kerl? Um einen Wanderprediger schien es sich nicht zu handeln, dafür war sein Gewand zu auffällig.
»Und die Hölle folgte ihm nach!«, setzte der Mann hinzu.
»Was soll das?«, rief jemand. »Ich dachte, du wärst ein Sterndeuter! Aber du erzählst nichts anderes als die Pfaffen in der Kirche!«
Ein Sterndeuter? Anna fasste den Mann genauer ins Auge.
»Eine Geißel Gottes wird diese Stadt treffen, eine Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß!«, rief der Sterndeuter. »Zweifelt nur, ihr ungläubigen Thomasse. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt!«
»Was für eine Katastrophe?«, wollte eine dralle Frau wissen, auf deren Kopf eine schmutzig weiße Haube saß.
»Ich habe gesagt, was zu sagen ist«, war die Antwort. »Wer an dem schlimmsten aller Unglückstage in dieser Stadt verweilt, wird es bereuen! Habt ihr denn nicht den Schweifstern gesehen, der über den Himmel gezogen ist?«
»Was für ein Schweifstern?«
»Nachts sind anständige Leute im Bett.«
»Der erzählt bloß wirres Zeug!«
Die Ulmer redeten aufgebracht durcheinander.
»Der Evangelist Lukas sagt: ›Es wird gewaltige Erdbeben an vielen Orten und Seuchen und Hungersnöte geben; schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen.‹« Der Sterndeuter ließ den erhobenen Zeigefinger sinken. »Ich kann nicht mehr tun, als euch zu warnen. Die Harmonie des Kosmos war noch nie in so großer Gefahr wie jetzt.«
Das Aufblitzen eines bunten Gewandes ließ Anna die Augen zusammenkneifen. Luna, dachte sie mit einem Anflug von Misstrauen. Was hatte die hier zu suchen? Steckte sie mit diesem Scharlatan unter einer Decke? Anna zweifelte keinen Moment daran, dass die Prophezeiung dieses sogenannten Sterndeuters nichts als ein Ammenmärchen war, mit dem er den Ulmern Geld aus der Tasche ziehen wollte. Vermutlich bot er Amulette oder anderen Tand zum Verkauf, mit dem man sich vor der angeblichen Katastrophe schützen konnte. Sah Luna ihre Felle davonschwimmen? Erkannte sie, dass es sich um einen Konkurrenten handelte, der – genau wie sie – die Einfältigkeit der Gutgläubigen ausnutzte?
Ihr Blick wanderte weiter zu Gallus, der seit dem Angriff auf Luna im vergangenen Winter nicht mehr von ihrer Seite zu weichen schien. Er war der schönen Zauberin offenbar mit Haut und Haar verfallen. Anna würde nie begreifen, warum die Beginen Luna nicht nur gestatteten, im Beginenhof zu wohnen, sondern sie obendrein dabei helfen ließen, Tränke und andere Mittel zuzubereiten. Schwester Guta und die Beginenmeisterin schenkten Lunas Beteuerungen Glauben, die Zauber nur mit Gottes Hilfe zu wirken, die sie den Ulmern verkaufte. Anna hingegen hielt Luna für eine Betrügerin.
Sie hatte das Interesse an dem Kerl im wunderlichen Mantel verloren und schob sich erneut durch die Menge, um ihren Weg zum Spital fortzusetzen, das sie kurz darauf erreichte. An diesem Nachmittag warteten nur wenige Fuhrwerke und Bedürftige vor dem Tor. Der Beschließer schenkte Anna kaum Beachtung, als sie hindurchschritt, um den kleineren der beiden Spitalhöfe zu betreten. Obwohl sie seit Jahren ein- und ausging, beeindruckte sie das weitläufige Gelände immer wieder aufs Neue.
Zu ihrer Rechten befanden sich die Ställe, Scheunen und Fruchtkästen, zu ihrer Linken ragte die Spitalkirche in den Himmel. Eine Schmiede, eine Bäckerei und mehrere Wirtschaftsgebäude schlossen an die Kirche an. Gegenüber dem Tor zeichneten sich die Umrisse der Siechenstube ab, hinter der einer der Türme der Stadtbefestigung aufragte. Durch einen Bogengang neben der Kirche gelangte man in einen zweiten, größeren Hof, in dessen Mitte sich ein Ziehbrunnen befand. In der Nähe des Brunnens waren die größeren landwirtschaftlichen Geräte und Fuhrwerke des Ordens abgestellt. Östlich der Kirche verbarg sich das stattliche Haus des Spitalmeisters mit einer Kapelle hinter einer Reihe hoher Linden. Den Abschluss des größeren Hofes bildeten die Häuser für die Pfründner, die älteren Insassen des Spitals, eine Badestube und ein Speisesaal. Am Fuß der Stadtmauer gab es einen kleinen Friedhof und einen Kräutergarten.
Wie immer herrschte reger Betrieb in den Höfen, da zahlreiche Bedürftige und Kranke im Spital wohnten. Dutzende von Ordensbrüdern kümmerten sich um die männlichen Insassen, die Wöchnerinnen und weiblichen Kranken wurden von der Meisterin, einer Milchmutter und zwei im Spital wohnenden Schwestern versorgt. Da Anna vorhatte, vor Einbruch der Dunkelheit ins Frauenhaus zu gehen, eilte sie auf direktem Weg zur spitaleigenen Apotheke, die sich im selben Gebäude befand wie die Siechenstube. Sie öffnete die Tür eines Seiteneinganges und gelangte an einer Wäschekammer vorbei zur Apotheke. In Gedanken vertieft, stellte sie die mitgebrachten Arzneien an ihren Platz und unterdrückte den Drang, in der Siechenstube nach Lazarus zu sehen. Seitdem Bruder Michael, der ehemalige Siechenmeister, für seine Verbrechen hingerichtet worden war, hatte Lazarus diesen Posten wieder inne. Allerdings wusste Anna, dass er mit dem Wundarzt zu kämpfen hatte, der ihm feindselig gesonnen war. Erst kürzlich hatte er laut darüber nachgedacht, Ortwin Besserer, den Spitalpfleger, darum zu bitten, anstelle des Wundarztes den Henker vom Rat bezahlen zu lassen. Allerdings würde es sicher eine Weile dauern, bis sich der Rat mit dieser Frage beschäftigen konnte.
Es fiel ihr schwer, ihn nicht wenigstens kurz zu sehen, dennoch verließ sie das Gebäude auf demselben Weg, auf dem sie gekommen war, und überquerte den Hof. Ein Blick zum Himmel verriet ihr, dass nicht mehr viel Zeit blieb bis zum Sonnenuntergang. Wenn sie zu Hause sein wollte, bevor die Nacht hereinbrach, musste sie sich beeilen.
Kapitel 4
»Was soll das?«, ereiferte sich der Wundarzt in der Siechenstube. Er stand mit verschränkten Armen am Fuß eines Lagers, in dem ein Knecht des Spitals lag. Der Mann hatte sich beim Sturz vom Heuboden mehrere Rippen und einen Arm gebrochen. »Er braucht deine Kuren und deine Schonkost nicht«, schnauzte der Wundarzt Lazarus an.
Lazarus verkniff sich ein Stöhnen. Er hatte gehofft, dass der Wundarzt mit den drei Burschen beschäftigt sein würde, die sich vor dem Spitaltor geprügelt hatten. Einer von ihnen hatte eine gebrochene Nase, die anderen hatten ebenfalls böse Schrammen davongetragen. Bruder Martin, der neue Magister Hospitalis, hatte sie zur Siechenstube bringen lassen, anstatt sie davonzujagen, wie sein Vorgänger es getan hätte.
»Er hat Fieber«, sagte Lazarus gezwungen ruhig. »Es ist möglich, dass er sich innere Verletzungen zugezogen hat.«
Der Wundarzt schnaubte. »An einer gebrochenen Rippe ist noch niemand gestorben! Du willst bloß wieder die Arzneien loswerden, die deine Gemahlin herstellt!«
Lazarus zog die Brauen hoch. So war das also? Deswegen begegnete ihm der Wundarzt so feindselig. »Du fürchtest wohl, dass man deine Salben und Pflaster nicht mehr braucht«, entgegnete er barsch.
»Ich pfusche dir nicht in die Kur, da kann ich wohl erwarten, dass du dich aus meinen Angelegenheiten raushältst!« Der Wundarzt funkelte Lazarus wütend an. »Bruder Michael hat nie …«
»Bruder Michael war ein Verbrecher!«, fiel Lazarus ihm ins Wort. »Das hast du wohl vergessen?«
Der Wundarzt schwieg.
Lazarus war es leid, sich mit ihm zu streiten. Anders als viele gelehrte Ärzte hatte er durchaus gelernt, sich um Wunden und Brüche zu kümmern, aber das schien den Wundarzt nicht zu interessieren. »Ich bin der Siechenmeister«, sagte er schroff. »Es ist meine Entscheidung, wie die Kranken in dieser Stube behandelt werden. Wenn dir das nicht passt, kannst du jederzeit gehen.«
Der Wundarzt öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, schloss ihn jedoch wieder und presste die Lippen aufeinander. Er packte seine Instrumente ein und stürmte wortlos davon, um sich am anderen Ende der Siechenstube um die Streithähne zu kümmern.
Lazarus zog sich einen Schemel heran und setzte sich neben das Lager des verunglückten Knechtes. »Wie fühlst du dich?«, erkundigte er sich.
Der Knecht stöhnte. »Als ob mich ein Ochse zertrampelt hätte.«
Lazarus schlug die Decke zurück und betrachtete den Brustkorb des Mannes. Er war blau und schwarz. Vorsichtig drückte er mit drei Fingern auf den Bereich unterhalb der Rippen.
Der Knecht schrie auf.
»Hast du Schwierigkeiten beim Atmen?«, fragte Lazarus.
Der Knecht nickte.
Lazarus war sich nicht sicher. Er fürchtete, dass ein Teil der gebrochenen Rippe die Lunge des Mannes verletzt haben könnte, allerdings hätte er in diesem Fall längst über Atemnot geklagt. Er legte ihm die Hand auf die Stirn. Das Fieber war nicht hoch, vermutlich eine Folge der Verletzungen. Lazarus nahm sich dennoch vor, den Knecht im Auge zu behalten, um zu verhindern, dass sich Fäulnis entwickelte. Er winkte einen der Helfer zu sich. »Gib ihm jede Stunde Fiebertrank«, sagte er. »Und achte darauf, ob sein Atem anfängt zu rasseln.«
Der junge Mann nickte und eilte davon, um den Trank zu holen.
Lazarus erhob sich. »Gott wird dich beschützen«, versprach er dem Knecht und reichte ihm eines der hölzernen Kruzifixe, die am Kopfende eines jeden Bettes hingen. »Bete für deine Genesung.«
Der Knecht umklammerte das Kruzifix und schloss die Augen. Kurz darauf bewegten sich seine Lippen im stillen Gebet.
Lazarus ging weiter zu einem Spitalpfründner, der an einem Krebs in seinen Gedärmen litt. Er hatte über Schmerzen im Unterleib geklagt, und bei der Kotschau hatte Lazarus Blut gesehen. Zufolge der Lehre von den Körpersäften entstand ein Krebs aus einem Überschuss an schwarzer Galle. Dieser fiel, wie ein Weinstein bei der Weingärung, bei der Blutbildung in der Leber an. Wenn dieser Stoff nicht durch die Milz aus dem Körper ausgeschieden wurde, stockte er und verursachte die Krebsgeschwüre. Bei Frauen bewirkte der monatliche Blutfluss diese Reinigung, weshalb Ältere oft an einem Krebs in der Brust litten.
Der Greis schien unter großen Schmerzen zu leiden. Als er Lazarus kommen sah, hob er flehend den Blick. »Wann erlöst mich der Barmherzige endlich von diesen Qualen?«, jammerte er. »Es fühlt sich an, als wohnte ein Dämon in mir.«
Lazarus holte ein Laßeisen hervor, ein breites Messer, mit dem er einen kleinen Schnitt in der Armbeuge des Kranken machte, um sein Blut zu untersuchen. Auch darin waren Schwebstoffe zu sehen, die auf den Krebs hinwiesen.
»Kannst du es nicht einfach aus mir rausschneiden?«, fragte der Pfründner verzweifelt. »So wie bei der alten Gisela?«
Lazarus schüttelte den Kopf. »Die alte Gisela hat an einem harmlosen Geschwür gelitten, du hingegen …«
»Warum straft mich Gott mit dieser Krankheit?«, fragte der alte Mann. »Mein Leben lang habe ich alle Gebote befolgt, war stets in der Kirche und habe meine Sünden gebeichtet. Warum ich?«
»Diese Frage kann dir allein Gott beantworten«, seufzte Lazarus und holte eine kleine Flasche aus der Tasche hervor, die er immer bei sich trug. Darin befand sich Mohnsaft. Da der Krebs im Bauch des Mannes so weit fortgeschritten war, dass man ihn von außen ertasten konnte, blieb ihm nichts anderes übrig, als die Schmerzen des Kranken zu lindern.
»Wenn ich doch nur schon bei meiner Mechthild wäre!«, seufzte der Pfründner, nachdem Lazarus ihm einen Becher an die Lippen gesetzt hatte, um ihm die Arznei einzuflößen. »Vor zehn Jahren hat sie mich verlassen.« Seine Augenlider wurden schwer.
Lazarus spürte Mitleid in sich aufsteigen. Er konnte sich nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie es sein würde, ohne Anna zu leben. Sie war ein Teil von ihm, sein Herz gehörte ihr. Der Gedanke daran, irgendwann so zu enden wie der Alte vor ihm, machte ihm die Kehle eng. Hastig erhob er sich, griff nach seiner Tasche und machte weiter mit seiner Runde in der Siechenstube.
Kapitel 5
Anna hatte Lazarus versprochen, nicht mehr ohne Begleitung der Magd Ava ins Frauenhaus zu gehen. An diesem Tag beschloss sie, eine Ausnahme zu machen. Bald würde die Dämmerung hereinbrechen, und sie hatte alle Mittel dabei, die sie für die Frauen zubereitet hatte. Es würde nichts passieren. Jedenfalls hoffte sie das, als sie den Weg Richtung Stadtmauer einschlug, wo sich ihr Ziel befand.
Frauenhäuser waren ein fester Bestandteil der städtischen Ordnung, ihr Betrieb wurde durch eine vom Rat erlassene Frauenhausordnung geregelt. Durch die Einrichtung dieser Häuser sollten Bürgerinnen und Jungfrauen vor Nachstellungen geschützt werden, da in einer vielbesuchten Handelsstadt wie Ulm zahlreiche unverheiratete Hausknechte und Handwerksgesellen auf der Suche nach Vergnügen waren. Die Hübschlerinnen, die an den Frauenwirt verpfändet worden waren, konnten ihre Freiheit nur erlangen, wenn sie dem Wirt die Pfandsumme bezahlten.
Bei ihren zahlreichen Besuchen hatte Anna erfahren, unter welchen Umständen die Huren lebten. Für die wöchentliche Verpflegung mussten sie dem Wirt vierzig Pfennige bezahlen, für die Unterkunft in einer der winzigen Kammern waren sieben Pfennige Wochengeld zu entrichten. Darüber hinaus war der Frauenwirt am Umsatz beteiligt – mit einem Pfennig, wenn der Freier nach Erledigung des »leiblichen Werks« wieder ging, mit drei Pfennigen Schlafgeld für einen »Schlafmann«, einen Freier, der über Nacht blieb.
Obwohl es den Hübschlerinnen erlaubt war, das Haus zu verlassen und sich ungehindert in der Stadt zu bewegen, blieben die meisten Frauen im Haus, um nicht die Verachtung der anständigen Bürger auf sich zu ziehen. An ihrer Kleidung mussten sie gut sichtbar ein Band in einer der Schandfarben Rot, Gelb oder Grün tragen, damit man sie von Weitem als schändliche Weiber erkannte. Viele von Annas wohlhabenderen Kundinnen waren der Ansicht, dass Huren Unglück brachten oder gar den bösen Blick besaßen, was natürlich blanker Unsinn war.
In Gedanken versunken näherte sie sich dem Frauenhaus, wo zu ihrer Erleichterung noch keine Männer herumlungerten. Ein buntes Tuch vor einem der Fenster ließ sie wissen, dass der Frauenwirt nicht im Haus war. Die Huren hatten es aufgehängt – für den Fall, dass Anna ihnen einen Besuch abstatten wollte. Der Frauenwirt hatte ihr nach einem unerfreulichen Vorfall verboten, das Haus zu betreten, aber Anna hielt sich schon lange nicht mehr an dieses Verbot. Sollte er doch die Wache holen, falls er sie erwischte! Was wollte er tun? Er würde wohl kaum wagen, sich an ihr zu vergreifen, jetzt, wo ihr Bruder den Posten des Kämmerers innehatte.
Mit einem Blick über die Schulter vergewisserte sie sich, dass niemand sie beobachtete. Jakob und Lazarus waren stets um ihren Ruf besorgt. Ihrem Bruder war ihre Hilfsbereitschaft ein Dorn im Auge, jedoch sah Anna es als ihre Christenpflicht an, den Hübschlerinnen zu helfen.
Nachdem sie das Haus betreten hatte, erklomm sie eine der schmalen Stiegen, über die man die oberen Stockwerke erreichte, wo sich die Kammern der Frauen befanden. Es waren keine eindeutigen Geräusche zu hören. Da sie nicht länger verweilen wollte als absolut notwendig, klopfte sie an eine der Türen und wartete, bis eine Hübschlerin öffnete.
»Dem Himmel sei Dank!«, rief die junge Frau aus. Mit ihrem dicken rotblonden Haar und dem herzförmigen Gesicht mit rosigen Wangen wirkte sie mehr wie eine Gänsemagd als wie eine Hure, aber der Schein trog wie so oft.
»Ich habe die Salben und Tränke für euch mitgebracht«, sagte Anna und schob sich an ihr vorbei in den Raum, in dem es außer einem Bett nicht viel gab. Seit dem Tod einer Frau, der sie einen Trank zum Herbeiführen eines Aborts verweigert hatte, verlangte Anna kein Geld mehr von den Huren. Die Schuldgefühle hatten sie lange Zeit verfolgt.
»Gott segne dich!«, murmelte die Hübschlerin, als Anna die Sachen auf die schmale Fensterbank stellte.
»Seid vorsichtig damit«, warnte Anna und zeigte auf eine kleine Flasche mit einem roten Band am Hals. »Nicht mehr als ein Tropfen, sonst könntet ihr sterben.«
Die Hübschlerin nickte.
»Ist eine von euch krank?«, erkundigte sich Anna.
Die junge Frau zuckte mit den Schultern. »Nur das Übliche. Ausfluss, Schmerzen beim …« Sie brach den Satz ab und errötete.
»Nehmt mehr von der Salbe gegen Wundsein«, riet Anna. »Falls der Ausfluss übelriechend ist, kann ich euch Zäpfchen machen.«
Die Hure nickte. Sie war neu im Frauenhaus, und Anna fragte sich, welches Schicksal sie wohl nach Ulm geführt hatte. War sie die Tochter eines Bauern aus den umliegenden Dörfern? Hatte ihre Familie sie verstoßen, weil sie mit dem Falschen angebandelt hatte? Oftmals endeten ledige Schwangere im Frauenhaus, weil es keinen anderen Ort für gefallene Töchter gab.
Als die junge Frau eine Tür im Erdgeschoss schlagen hörte, zuckte sie zusammen. »Es ist Zeit zu gehen«, sagte sie und verließ eilig die Kammer. Allerdings stieß sie am Treppenabsatz fast mit dem Frauenwirt zusammen, der offenbar nach dem Rechten sehen wollte.