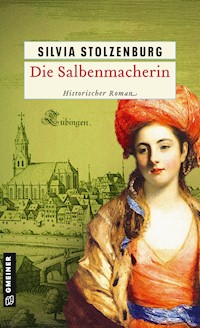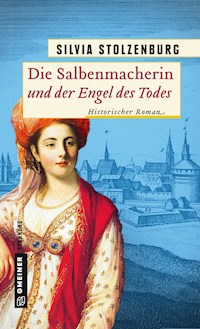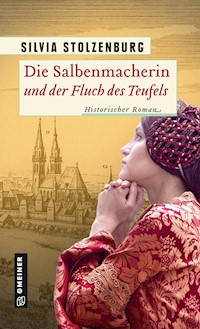Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Meisterbanditin
- Sprache: Deutsch
Nach der gefährlichen Zeit als Spionin im Dienst der Mätresse des württembergischen Herzogs ist endlich etwas Ruhe in Maries Leben eingekehrt. Das ändert sich jedoch schlagartig, als ihr Geliebter Jost von der Leibgarde des Herzogs festgenommen wird. Man bezichtigt ihn des Mordes an einem Soldaten des Markgrafen von Baden-Durlach. Maries Flehen stößt bei der Mätresse auf taube Ohren. Daher bleibt ihr nichts anderes übrig, als Jost selbst aus dem Kerker zu befreien. Allerdings sind ihnen die Männer des Herzogs dicht auf den Fersen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Stolzenburg
Die Flucht der Meisterbanditin
Historischer Kriminalroman
Impressum
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München)
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Die Heilerin des Sultans (2019), Falschspiel (2019), Die Salbenmacherin und der Engel des Todes (2019), Die Meisterbanditin (2018), Das Erbe der Gräfin (2018), Die Launen des Teufels (2018), Das dunkle Netz (2018), Die Salbenmacherin und die Hure (2017), Blutfährte (2017), Die Salbenmacherin und der Bettelknabe (2016), Die Salbenmacherin (2015)
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerrit_van_Honthorst_-_Het_Concert.jpg
und https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gerrit_van_Honthorst_(Dutch_-_Musical_Group_on_a_Balcony_-_Google_Art_Project.jpg
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6186-6
Widmung
Für Eumel. Und mich.
Prolog
In der Nähe eines Dorfes, Juli 1716
Der Schrei war so markerschütternd, dass die beiden Knaben mitten im Lauf innehielten.
»Was war das?«
»Ich weiß nicht. Ein Tier?«
Der ältere Junge schüttelte den Kopf und lauschte in die Dämmerung. Eigentlich hätten sie schon längst zu Hause sein müssen, doch eines der Ferkel war weggelaufen und hatte sich irgendwo am Ufer des Flusses versteckt.
»Lass uns weitersuchen«, drängte der Jüngere. Sein blondes Haar war zerzaust, das Gesicht starrte vor Schmutz.
Beide waren barfuß.
»Wenn wir das Ferkel nicht finden, gerbt uns Vater das Fell.«
Ein weiterer Schrei durchschnitt die Stille.
»Das ist kein Tier«, stellte der ältere Bruder fest. »Es kommt von dort.« Er zeigte auf eine Stelle am Ufer, an der der Fluss eine Biegung machte. Mächtige Weiden und Pappeln überschatteten das Wasser und schirmten die Böschung vor neugierigen Blicken ab.
Das Geräusch eines Schlages ließ die beiden Jungen einen erschrockenen Blick tauschen.
Ohne nachzudenken, schüttelte der Ältere die Furcht ab und rannte über die Wiese aufs Ufer zu.
Erneut gellte ein Schrei, verwandelte sich in ein Wimmern und erstarb, als der Knabe die Böschung erreichte.
Was er erblickte, ließ ihm das Herz in der Brust erkalten. Eine junge Frau lag mit blutüberströmtem Gesicht im Uferschlamm. Ihr Kleid war zerfetzt, die Röcke hochgeschoben. Über ihr kniete ein Mann, dessen nacktes Gesäß vor- und zurückzuckte. Mit einer Hand stützte er sich auf dem Boden ab, mit der anderen würgte er sein Opfer, das keuchend nach Luft rang.
Wie gelähmt starrte der Knabe auf das furchtbare Schauspiel, wollte nicht begreifen, dass es sich bei der jungen Frau um eine seiner Schwestern handelte. Erst als sein Bruder neben ihm auftauchte und »Barbara« hauchte, fiel die Lähmung von ihm ab. Mit einem Wutschrei stürzte er sich auf den Kerl und schlug blindlings auf ihn ein. »Lass sie los!«, brüllte er. »Lass meine Schwester los!«
Als wäre er nicht mehr als eine lästige Fliege, beendete der Mann, was er angefangen hatte, ehe er die Hose hochzog und sich zu seiner vollen Größe aufrichtete.
Er überragte die Knaben um mehr als zwei Köpfe.
Erst jetzt bemerkte der Ältere die Uniform, die ihn als Soldaten des Markgrafen von Baden-Durlach auswies, der zurzeit mit einer Jagdgesellschaft im Dorf weilte. Erschrocken wich er zurück, als der Mann ein Messer zückte und auf ihn zukam. »Verschwindet!«, knurrte er.
Aus dem Augenwinkel sah der Junge, wie seine Schwester versuchte davonzukriechen. Sie blutete nicht nur im Gesicht, auch ihre Beine waren besudelt. Die Wut kehrte zurück. Ohne nachzudenken, bückte er sich nach einem abgebrochenen Ast und ging auf den Soldaten los.
Der wich seinem ersten Hieb mit einem verächtlichen Lachen aus und versetzte ihm einen Faustschlag ans Kinn, der ihn nach hinten schleuderte.
Der Ast landete im Matsch.
»Was erlaubst du dir, du dreckiger Bauernlümmel?« Mit einem langen Schritt war der Mann bei dem Knaben, kniete sich auf seine Brust und setzte die Klinge an seine Kehle. »Wofür haltet ihr Gesindel euch?«, zischte er.
Der Junge schnappte nach Luft. Das Gewicht des Soldaten brach ihm fast die Rippen.
»Bitte«, keuchte er, als der Mann den Druck der Klinge verstärkte. »Herr …«
»Halt dein Maul!« In den Augen des Mannes glomm Wut. Seine Muskeln spannten sich, als er dazu ansetzte, dem Jungen die Kehle durchzuschneiden.
Allerdings kam er nicht dazu.
Der Ast traf ihn so unvermittelt am Hinterkopf, dass sich seine Augen erstaunt weiteten, ehe er nach vorn kippte und erschlaffte.
»Jost, ist dir was passiert?« Die Stimme des Jüngeren überschlug sich vor Furcht. »Jost?«
Mit einem Keuchen befreite sich Jost von dem auf ihm liegenden Soldaten und betastete seinen Hals. Die Klinge hatte einen oberflächlichen Schnitt hinterlassen, der zwar heftig blutete, ihn aber nicht umbringen würde.
»Oh Gott! Was sollen wir jetzt nur tun? Die Männer des Grafen werden uns furchtbar bestrafen«, hauchte sein Bruder.
Jost rappelte sich auf. Sein Blick fiel auf ihre Schwester, die sich weinend unter einem Baum zusammengekauert hatte. Hass wallte in ihm auf. Als der Soldat ein Stöhnen von sich gab, die Augen öffnete und nach seinem Messer tastete, hob er den Ast auf. Bevor der Mann ganz zu sich kommen konnte, holte er aus und versetzte ihm einen gewaltigen Schlag auf den Hinterkopf.
Der Kerl erschlaffte.
Immer und immer wieder schlug Jost zu, bis sein Bruder ihn von dem Mann wegzog. »Ist er …?«
Jost blickte auf den Soldaten hinab, von dessen Kopf nicht mehr viel übrig war. Der Ast rutschte ihm aus den zitternden Händen. »Nichts wie weg von hier!«
Kapitel 1
Ludwigsburg, 3. November 1721
Mit einem Stöhnen warf Jost sich im Bett hin und her.
Wäre Marie nicht schon längst auf gewesen, hätte er sie geweckt. Allerdings saß sie seit geraumer Zeit auf der Ofenbank des Hauses, das Wilhelmine von Grävenitz ihnen geschenkt hatte, und wog ein goldbeschlagenes kleines Kästchen mit einem silbernen Schloss in den Händen. Da es kalt war in ihrer Schlafkammer, hatte sie sich in eine Decke gewickelt und sich mit dem Rücken an die noch handwarmen Kacheln des Ofens gelehnt.
Durch eines der kleinen Fenster fiel Mondlicht auf den Holzboden, malte Schatten und beleuchtete einen der Bettpfosten. Auch der Nachttopf war deutlich zu erkennen, ebenso wie die große Truhe, in der sich ihre Habseligkeiten befanden. Noch vor einem halben Jahr hätte Marie sich nie träumen lassen, dass sie einmal so herrschaftlich wohnen würde. Zu Hause, auf dem Bauernhof ihres Vaters, hatte sie sich den Schlafplatz mit ihren Schwestern teilen müssen. Und als Küchenmagd auf Schloss Brenz war ihr das Gesindequartier im Keller zugewiesen worden. Allein die Vorstellung, ein eigenes Haus zu besitzen, war für sie vollkommen abwegig gewesen. Manchmal erschien ihre derzeitige Lage ihr wie ein Traum. Sie lauschte in die Dunkelheit und stellte das Kästchen auf die Ofenbank.
Jost gab ein weiteres Stöhnen von sich.
Marie wartete, bis sein Atem ruhiger und tiefer wurde, ehe sie das Kästchen wieder in die Hand nahm und geistesabwesend mit den Fingern über die glatte Oberfläche strich. Als Jost ihr kurz nach dem vereitelten Anschlag auf Wilhelmine von Grävenitz gestanden hatte, dass er ein Mörder war, hatte sie zuerst gedacht, er würde im Fieberwahn reden. Doch nachdem der herzogliche Leibarzt seine Wunde versorgt und das Fieber gesenkt hatte, war Jost bei seiner abenteuerlichen Behauptung geblieben.
»Ich habe ihn getötet«, hatte er immer und immer wieder beteuert. Und dann hatte er Marie erzählt, was vor fünf Jahren passiert war.
»Deine Schwester ist an ihren Verletzungen gestorben?«, hatte Marie ungläubig gefragt. »Und niemand hat sich dafür interessiert, wer ihr das angetan hat?«
Jost hatte den Kopf geschüttelt. »Es gab eine Untersuchung. Aber nur wegen des toten Soldaten, nicht wegen meiner Schwester.«
»Wer hat dich verraten?«
Jost zuckte die Achseln. »Ich habe keine Ahnung.«
Marie sah ihm an, dass er log. »Dein Bruder?«, fragte sie.
Jost bearbeitete seine Unterlippe mit den Zähnen und schwieg.
»Du warst noch ein halbes Kind«, sagte Marie. »Ich hätte nicht anders gehandelt.«
Jost seufzte. »Du hättest gewiss nicht so lange auf ihn eingeschlagen, bis …« Er brach den Satz ab.
»Glaube mir, das hätte ich«, erwiderte Marie. Sie konnte nur zu gut nachvollziehen, wie ohnmächtig Jost sich gefühlt haben musste.
Er warf sich erneut auf die andere Seite und murmelte etwas im Schlaf.
Marie hoffte, dass die Albträume nachlassen würden, sobald die Männer des Markgrafen Ludwigsburg wieder verließen. Vor zwei Tagen war eine Abordnung des Herrschers von Baden-Durlach in der Residenz eingetroffen, vermutlich, um beim bevorstehenden Ordensfest das Verhältnis zwischen den beiden Fürstenhäusern zu verbessern. Die Gemahlin des württembergischen Herzogs, Johanna Elisabeth von Baden-Durlach, harrte immer noch allein im Alten Schloss in Stuttgart aus, während der Herzog in Ludwigsburg mit seiner Mätresse Wilhelmine von Grävenitz residierte. Marie ahnte, wie demütigend dieser Zustand für die Herzogin sein musste. Sie nahm an, dass deshalb der gedungene Mörder auf Wilhelmine angesetzt worden war, dessen Anschlag sie und Jost in letzter Sekunde vereitelt hatten.
Ihr kroch ein Schauer über den Rücken, als sie an die Ereignisse zurückdachte. An den Mann, der sie gezwungen hatte, das Kästchen zu stehlen; an das zufällig belauschte Gespräch der Verschwörer und die wilde Flucht; an den Jäger, dessen Kugel Wilhelmine töten sollte; und an die furchtbare Schusswunde, die Jost davongetragen hatte, weil er nicht von ihrer Seite weichen wollte.
Sie drehte das silberne Kästchen erneut zwischen den Fingern hin und her. Bisher hatte sie immer noch nicht herausgefunden, warum sie es hatte stehlen sollen. Zwar war es zweifelsohne wertvoll, allerdings hatte sich nichts darin befunden außer einigen wertlosen Ringen. Warum war es dem Mann so wichtig gewesen? Sie versuchte, sich die Uniform in Erinnerung zu rufen, die er getragen hatte. Er war hochgewachsen gewesen, mittleren Alters und hatte ein strenges Gesicht gehabt. Marie schloss die Augen und bemühte sich, die zahllosen Orden an seiner Brust in Gedanken nachzuzeichnen. Ohne Erfolg. Hätte sie nicht versucht, ihm seine Taschenuhr zu stehlen, wäre Wilhelmine von Grävenitz vielleicht nicht mehr am Leben. Doch warum war dem Mann das Kästchen so wichtig gewesen? Ihre Finger fanden eine kleine Vertiefung an der Unterseite, die ihr bisher verborgen geblieben war. Neugierig betastete sie etwas, was sich anfühlte wie eine Öse.
Sie runzelte die Stirn, als ein leises Knacken ertönte.
Das Mondlicht fing sich in der glänzenden Oberfläche, als Marie das Kästchen öffnete. Erstaunt sah sie, dass sich ein Teil des Bodens bewegt hatte und ein kleines Fach zum Vorschein gekommen war. Sie griff hinein und zog ein paar Briefe und etwas hervor, das aussah wie ein silbernes Siegel. Ihre Neugier wurde frisch entfacht. Leise, um Jost nicht zu wecken, erhob sie sich von der Ofenbank und trug ihren Fund in die angrenzende Küche. Dort entzündete sie einen Fidibus, einen harzreichen Holzspan, an der noch leise glimmenden Glut im Herd und hielt ihn an eine Talgkerze. Diese stellte sie auf den Tisch und setzte sich, um ihre Entdeckung genauer in Augenschein zu nehmen.
Obwohl Jost ihr inzwischen Lesen und Schreiben beigebracht hatte, hatte sie Schwierigkeiten, die Briefe zu entziffern. Es schien sich um einen Austausch zu handeln, dessen Inhalt sich unter anderem um das seltsame Siegel drehte. Die Namen der Unterzeichner entzifferte Marie nur mühsam. »Fredegonde?«, murmelte sie. Was für ein Name sollte das sein? Der andere Unterzeichner nannte sich »Cupido«. Sie überflog das Geschriebene, in dem immer wieder eine Person namens »Argande« auftauchte. Irgendwann fingen ihre Augen an zu brennen und sie legte die Papiere zur Seite.
»Was tust du hier mitten in der Nacht?«
Sie zuckte erschrocken zusammen.
Jost stand auf der Schwelle und sah sie fragend an. Er wirkte bleich im Kerzenschein. Sein rotblondes Haar stand in wilden Locken von seinem Kopf ab. »Warum bist du schon auf?« Er kam näher, gähnte und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Dann schlang er fröstelnd die Arme um sich. »Es ist kalt.«
Marie schob die Briefe über den Tisch. »Das war in dem Kästchen versteckt, von dem ich dir erzählt habe«, sagte sie.
Jost schob die Brauen zusammen. »Briefe?«
Marie nickte. Während Jost den Austausch überflog, fachte sie ein Feuer im Herd an und ging in die Speisekammer, um Milch und Hirse zu holen. Es würde gewiss nicht mehr lange dauern bis zum ersten Hahnenschrei, und da sie schon mal auf waren, konnten sie ebenso gut frühstücken. In wenigen Stunden begann die letzte Probe für das neue Stück, das zum Anlass des Ordensfestes aufgeführt werden sollte. Auch wenn sie La Boneille, den Prinzipal der Theatertruppe, zutiefst verabscheute, hatte sie notgedrungen eingewilligt, weiter ein Teil des Ensembles zu bleiben. Wilhelmine von Grävenitz hatte darauf bestanden, da sie immer noch wünschte, dass Marie für sie spionierte.
»Das erscheint mir ziemlich verworren«, sagte Jost schließlich und ließ die Briefe sinken. »Wer ist Argande?«
»Ich weiß es nicht«, erwiderte Marie. Sie goss die Milch in einen Topf und stellte ihn auf die Kochstelle. »Aber sie scheint den anderen ein Dorn im Auge zu sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieses Siegel eine Art Zeichen, um zu verhindern, dass die Briefe in falsche Hände gelangen.«
Jost schürzte die Lippen. »Es könnte auch eine Verehrung sein.«
»Eine was?« Marie sah ihn fragend an.
»Ein silberner Glücksbringer, den sich die hohen Herrschaften zu Neujahr schenken«, erklärte er.
»Das glaube ich nicht. Für mich sieht es aus wie ein Siegel.«
»Ich werde nicht schlau daraus«, sagte Jost mit einem Kopfschütteln. »Was ist an dem Kästchen so wichtig, dass du es stehlen musstest?«
»Ich vermute, das Siegel«, beharrte Marie. »Wenn es eine Art Geheimzeichen ist …«
»Wofür?«
Marie nahm Jost die Briefe ab und legte sie zurück in die Schatulle. Dann verschloss sie das kleine Fach wieder und brachte das Kästchen zurück in das Versteck, in dem sie es verborgen hatte. »Ich weiß nicht, was hinter der ganzen Angelegenheit steckt«, sagte sie, als sie zurück in die Küche kam. »Aber vielleicht erfahren wir es irgendwann.«
»Und dann?«
Marie schürzte die Lippen. »Dann ist es jemandem vielleicht viel Geld wert.«
Jost rieb sich mit den Handflächen übers Kinn. »Warum willst du dich damit in Gefahr bringen?«, fragte er. »Wir haben alles, was wir brauchen. Ein Haus, genug Geld, die Gunst der Gräfin. Vielleicht sollten wir es vergessen und …« Er brach den Satz ab und machte eine vage Handbewegung.
»Was? Heiraten? Ein normales Leben führen?«, fragte Marie.
Jost nickte. »Es ist ohnehin ein Wunder, dass die Gräfin sich nicht daran stört, dass wir nicht Mann und Frau sind.«
Marie kehrte ihm den Rücken und goss die warme Milch über die Hirse. Dann rührte sie mit einem Löffel darin herum. Sie liebte Jost von ganzem Herzen. Die Angst um ihn hatte sie fast den Verstand gekostet. Dennoch fürchtete sie, dass diese Art von Leben für sie in unerreichbarer Ferne lag. Sie war eine Spionin, eine Diebin, und Jost ein gesuchter Mörder. Sie füllte zwei Schalen mit dem warmen Brei und stellte sie auf den Tisch. »Die Gräfin und der Herzog sind auch nicht verheiratet«, sagte sie. »Und willst du wirklich das Risiko eingehen, in einer voll besetzten Kirche vor den Altar zu treten?«
»Ich dachte eher an eine kleine Dorfkirche«, murmelte Jost. Er stocherte in seinem Brei herum. »Aber du hast vermutlich recht.«
Marie atmete erleichtert auf. »Es ist zu gefährlich«, sagte sie.
»Das ist ein Auftritt in der Residenz auch«, gab Jost zurück. »Vor allem jetzt, wo …« Er brauchte den Satz nicht zu beenden.
Marie griff nach seiner Hand und drückte sie beruhigend. »Keine Angst, in deinem Kostüm bist du Kasper, der Hanswurst. Niemand wird dich in der Verkleidung erkennen. Und jetzt iss. Die Probe wird sicher anstrengend.«
Kapitel 2
Ludwigsburg, 3. November 1721
Während Jost sein Hanswurstkostüm anzog, bestehend aus roter Jacke mit bauschigen Ärmeln, einer weiten gelben Hose, einem Hemd mit breitem Kragen und einem hohen grünen Spitzhut, verwandelte Marie sich in eine Jungfrau namens Palmire. Obwohl die Aufführung deutscher Stücke am Hof eine Seltenheit war, hatte der Herzog darauf bestanden, ausgerechnet diese Hanswurstiade vor seinen Gästen spielen zu lassen. Marie vermutete, dass er damit der Gesandtschaft aus Baden-Durlach ein Schnippchen schlagen wollte, das nicht allzu offensichtlich war. Die hohen Herren und Damen erwarteten vermutlich eine französische Komödie und würden gewiss staunen, wenn Jost in seinem Kostüm auf die Bühne stürmte.
Die Geschichte des Singspiels, das sie zur Feier des Ordensfestes aufführen würden, erschien selbst Marie mehr als abenteuerlich. In »Kaspar, der Fagottist, oder: Die Zauberzither« ging es um einen Prinzen und seinen Diener Kaspar Bita, die sich auf der Jagd im Zauberwald der Fee Perfirime verirrten. Trotz der Tatsache, dass sie das Lieblingsreh der Fee erlegten, vergab diese ihnen und forderte dafür, dass sie ihr einen vergoldeten Feuerstrahl wiederbeschafften. Dieser war ihr von einem bösen Zauberer geraubt worden, der überdies ihre Tochter Sidi, deren Vertraute Palmire und einige weitere Jungfrauen entführt hatte. Der Prinz, der von La Boneille gespielt wurde, bekam von der Fee eine Zauberzither überreicht, mit der er Leidenschaften erregen oder besänftigen konnte.
Marie verzog das Gesicht. Wie passend die Rolle für La Boneille war. Allerdings benötigte er im wirklichen Leben keine Zauberzither, um unerfahrenen jungen Frauen wie ihr Liebe und Leidenschaft vorzugaukeln. Sie schluckte die Bitterkeit, die in ihr aufsteigen wollte, flocht ihr dunkles Haar und befestigte eine kleine Haube auf ihrem Kopf. Dann färbte sie sich die Wangen rot und umrandete ihre blauen Augen mit einem Kohlestift.
In dem Theaterstück gab es auch einen guten Geist, den Jost in der Rolle des Kaspers rufen konnte, sowie er Hilfe benötigte. Wenn es doch nur so einfach wäre, dachte Marie. Dann würde sie den Geist bitten, die Gesandtschaft des Markgrafen aus Ludwigsburg verschwinden zu lassen, und Josts Vergangenheit auszulöschen. Mit einem Seufzen betrachtete sie sich in einem kleinen Spiegel und klebte einen Schönheitsfleck über ihre Oberlippe.
Nachdem Jost ihr geholfen hatte, sich zu schnüren, verließen sie das Haus und machten sich auf den Weg zur Residenz. Draußen schlug ihnen ein eisiger Wind entgegen, der Marie frösteln ließ. Sie zog den Mantel enger um die Schultern und hoffte, dass der erste Schnee noch eine Weile auf sich warten ließ. Der Himmel war zwar seit einigen Tagen bleigrau und schwer, doch der Winter schien ein Einsehen mit dem Herzog und seinem Ordensfest zu zeigen. Froh darüber, festes Schuhwerk an den Füßen zu haben, stapfte Marie an den zahlreichen Misthaufen vorbei, die das Fortkommen auf den Straßen an manchen Stellen schwierig machten. Obwohl ihnen ein paar Kinder hinterhersahen, fielen sie nicht besonders auf in einer Stadt, in der zahlreiche Hofbedienstete in exotischen Trachten herumliefen. Am Hof und rings um den Marktplatz war der Anblick von Heiducken, Türken, Ungarn, Kroaten und den Hofmohren des Herzogs keine Seltenheit.
Je näher sie der Residenz kamen, desto dichter wurde der Verkehr. Marie zählte über zwei Dutzend Kutschen, die vor dem Tor darauf warteten, eingelassen zu werden. Jost und sie begaben sich zu einem Seiteneingang, der ebenfalls von Soldaten des Herzogs bewacht wurde. Wie immer hämmerte Maries Herz, als sie sich der prunkvollen Residenz näherten. Im Hof des Schlosses stand etwa ein Dutzend Männer der Leibwache des Herzogs Spalier. Überall trotzten Zitronen- und Orangenbäumchen in Kübeln der Kälte und verstärkten den Eindruck, in eine andere Welt einzutauchen. Die zahlreichen Pfauen, die sonst stolz ihre Räder schlugen, hatten sich in einer Nische zusammengedrängt, um Schutz vor dem Wind zu suchen. Hufgetrappel und das Poltern von Rädern übertönte die Befehle, die von den Offizieren gerufen wurden. An diesem Tag war das Schlagen der Hämmer und Meißel verstummt, der Schmutz der Bauarbeiten so gut wie möglich verborgen. Noch immer raubten die prachtvollen Bauten, die zahllosen Statuen und Säulen, die Lakaien und vornehm gekleideten Hofangestellten Marie den Atem.
Als eine Abordnung Reiter in den Farben des Markgrafen von Baden-Durlach an der Leibgarde vorbeipreschte, zog Jost den Kopf ein.
»Sie können dich unmöglich erkennen«, beruhigte Marie ihn erneut. »Wir sind für sie nichts weiter als Gesinde. Du könntest genauso gut unsichtbar sein.«
»Dein Wort in Gottes Ohr«, murmelte Jost und eilte am Küchenbau und der Ordenskapelle vorbei auf eine Tür zu, die in einen der Flügel der Residenz führte. Dort befand sich der Ordenssaal, in dem die Bühne für das Schauspiel errichtet worden war.
Marie folgte ihm. Über einen auf Hochglanz polierten Boden ging es einen Gang entlang zu dem Saal, dessen flache Decke so bemalt war, dass sie wirkte wie eine gewaltige Himmelskuppel. Die Gestalten, die sich dort tummelten, waren kaum bekleidet, und Marie fragte sich nicht zum ersten Mal, ob man derlei am Hof nicht anstößig fand. Auch die zahlreichen Statuen zeigten mehr, als sie gewohnt war zu sehen, doch offensichtlich galten am herzoglichen Hof andere Regeln als in ihrem Dorf. Zahlreiche Kronleuchter hingen über den Stühlen im Zuschauerbereich. Ein roter Brokatvorhang am Kopfende des Saales war zur Seite geschoben worden, um Platz zu machen für die Hinterbühne, auf der sich ein Teil der Handlung abspielte. Die Bühne selbst stand auf einem kleinen Podest.
»Da seid ihr ja endlich!«, begrüßte La Boneille sie. Er bedachte Marie mit einem Blick, der dafür sorgte, dass sich ein Stachel in ihr aufrichtete. Wie immer war er makellos frisiert mit einem langen blonden Zopf, auf dem ein Jägerhut saß. Er steckte in eng anliegenden Hosen und einem kostbar bestickten Wams, das die Breite seiner Schultern betonte. Die weißen Rüschen seines Hemdes verdeckten seine Hände fast vollständig.
Marie versuchte, nicht daran zu denken, wo diese Hände sie überall berührt hatten.
»Wir müssen den zweiten Aufzug noch einmal proben«, dröhnte ein Bass. Ein Mann mit einem Bauch wie ein Weinfass klatschte ungeduldig in die Hände. »Der Gesang ist grauenvoll!«
La Boneille runzelte unwillig die Stirn. »Ich dachte, ich sei der Prinzipal dieser Truppe«, bemerkte er barsch.
Der Mann mit der Bassstimme, ein Italiener, der am Hof Sängerinnen ausbildete, machte eine wegwerfende Geste. »Ihr seid für die Schauspieler zuständig, der Gesang ist mein Ressort.«
Froh darüber, dass sich ihre Rolle zum Großteil aufs Sprechen beschränkte, kehrte Marie den beiden Streithähnen den Rücken und erklomm die Bühne. Diese war mit einem einfachen Vorhang vom Zuschauerraum abgetrennt, den sie beiseitezog. Ein zweiter Vorhang teilte die Bühne in Vorder- und Hinterbühne. Im Hintergrund befanden sich zwei Bilder, die einen prunkvollen Palast und einen Wald darstellten. Die Kulisse war drehbar, sodass die Darsteller abwechselnd im Palast oder im Wald spielen konnten. Am Rand der Vorderbühne befand sich eine Versenkungsklappe, durch die die Schauspieler verschwinden konnten. Von der Balustrade über ihren Köpfen ließen die Hoftechniker es donnern, regnen oder blitzen. Marie setzte sich an eine der Spindeln, die auf der Hinterbühne aufgestellt worden waren.
»Wir beginnen an der Stelle, an der Kaspar den Geist ruft. Der überreicht ihm das Zauberfagott, mit dem er den Frauenwächter und den Zauberer verzückt«, sagte La Boneille. Offensichtlich hatte er sich gegen den Italiener durchgesetzt. »Jost, blas, so schräg du nur kannst!«
Jost nickte. Er kletterte auf die Bühne, warf sich in die Brust und trompetete aus vollem Halse.
»Die Mädchen, die Lieb und der Wein
Begeistern den Menschen allein.
O Liebe! Mein Labsal bist du!
Und du, liebes Fläschchen, gluglu!
O Pizichi! Pizichi! Hilf mir aus der Not!
O Pizichi, blase statt meiner Fagott.«
Marie verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich in ihrem Stuhl auf der Hinterbühne zurück, um auf ihren Auftritt zu warten.
Nachdem Jost als Kaspar das Fagott in Empfang genommen hatte, folgten allerlei Durcheinander, derbe Streitigkeiten und Zankereien, bis er endlich ebenfalls in den Palast des Zauberers eingelassen wurde. In der folgenden Szene betrat La Boneille als alter Mann verkleidet die Hinterbühne, um für die Mädchen und deren Wächter die Zauberzither zu spielen.
Marie gab vor, von seinem Spiel in den Bann geschlagen zu sein.
»Es hielt in seinem Felsennest«, sang La Boneille,
»Vor langer, grauer Zeit
Der Mädchen schönstes hart und fest,
Der alte Ritter Veit.
Er raubte sie,
Man weiß nicht wie?
Noch wo? – bei einem Streit.
Das Mädchen weinte bitterlich
Am Turme an der See,
Und härmte wohl drei Jahre sich,
O weh! O weh! O weh!«
Marie konzentrierte sich mit aller Macht auf ihre Rolle, während La Boneille der Frau, die seine Angebetete spielte, den Hof machte. Nur mit viel Mühe schluckte sie die Wut, die in ihr aufstieg, als sie daran zurückdachte, wie er sie in ähnlicher Art und Weise umgarnt hatte. »Er wird dir das Herz brechen«, hatte Jost ihr damals prophezeit. Und er hatte recht gehabt. Die Demütigung saß immer noch tief und sorgte dafür, dass es in Marie kochte und brodelte wie in einem Kessel. Sie drehte ihre Spindel, sagte ihren Text auf und bemühte sich um das dümmliche Gesicht, das von ihr erwartet wurde.
La Boneille ist unwichtig, redete sie sich ein. Was zählte, war, dass sie und Jost das Hubertusfest unentdeckt überstanden und herausfanden, was für ein Geheimnis das silberne Kästchen wirklich barg. Ein Gedanke keimte in ihr auf. Je länger sie sich in La Boneilles Gegenwart befand, desto stärker wurde der Wunsch, nicht für den Rest ihrer Tage in seiner Truppe durch die Lande ziehen zu müssen, um für Wilhelmine von Grävenitz zu spionieren. Gewiss, die Gräfin war gut zu ihnen gewesen und ihr Leibarzt hatte Jost das Leben gerettet. Allerdings war das nur nötig geworden, weil Jost und Marie sie vor einem Mordanschlag bewahrt hatten.
»Komm, schöne Maid!«, trällerte Jost.
Sie ließ sich von ihm vom Stuhl ziehen und wild im Tanz durch die Gegend wirbeln, während es in ihrem Kopf arbeitete. Vielleicht gelang es ihnen doch irgendwann, ein normales Leben zu führen, auch ohne einen guten Geist, der die ganze Welt verzauberte. Sie ignorierte die Stimme der Vernunft, die ihr einflüsterte, dass sie eine Träumerin war, und schmetterte lauthals: »Adieu parthie!«
Kapitel 3
Ludwigsburg, 3. November 1721
Wilhelmine von Grävenitz strich mit einem Seufzen den Stoff des ausladenden Reifrockes glatt und legte den Brief beiseite, den sie überflogen hatte. »Das kann warten«, sagte sie zu dem Mann, der ihr an dem großen runden Tisch gegenübersaß.
Heinrich von Schütz, das einzige Mitglied des Konferenzministeriums, das an diesem Tag anwesend war, hob fragend die Brauen. »Was beschäftigt Ihro Exzellenz? Der Markgraf von Baden-Durlach?«
Wilhelmine machte ein säuerliches Gesicht. »Es passt mir nicht, dass er und Eberhard in diesem verdammten Orden Ritter spielen! Das ganze Hubertusfest bereitet mir Kopfschmerzen.«
»Der Markgraf ist ein Gründungsmitglied«, versuchte Schütz, sie zu beruhigen. »Und sein Schwager. Der Herzog hätte ihn wohl kaum ausladen können wegen …« Er brach den Satz ab.
»Ich glaube nicht, dass der Markgraf nur wegen der Jagden in Ludwigsburg ist«, sagte Wilhelmine. Ihr Misstrauen war geweckt worden, als Eberhard Ludwig ihren Fragen über seinen Schwager ausgewichen war. »Da steckt vermutlich wieder diese alte Hexe dahinter!«
»Die Herzogin?«, fragte Schütz.
Wilhelmine schnaubte. »Wer denn sonst?« Seit dem vereitelten Anschlag auf sie hasste sie die Gemahlin ihres Geliebten noch mehr als vorher. Außerdem hatte die Tatsache, dass man ihr bei einer Prunkjagd nach dem Leben getrachtet hatte, ihre Abneigung gegen Eberhards Lieblingsbeschäftigung noch verstärkt.
»Es ist nicht sicher, dass die Herzogin …«
»Eine meiner Spioninnen hat die Männer beschrieben, die den Mörder gedungen haben«, unterbrach Wilhelmine ihn. »Ich verpfände meine Seele an den Leibhaftigen, wenn nicht dieser verdammte Staffhorst hinter allem steckt!« Der ehemalige Geheime Rat war seit Wilhelmines annullierter Doppelehe mit Eberhard Ludwig einer ihrer erbittertsten Feinde. Für Wilhelmine bestand kein Zweifel daran, dass er mit Einwilligung der Herzogin gehandelt hatte.
»Aber Sie können nicht sicher sein, dass sie den Auftrag gegeben hat«, wandte Schütz ein.
»Vermutlich würde sie einen heiligen Eid schwören, dass sie nichts von dem Anschlag wusste«, gab Wilhelmine zurück. »Das entspräche vermutlich sogar der Wahrheit, da sie gewiss nicht mit den Einzelheiten belästigt werden wollte.«
»Ihre Anschuldigung wiegt schwer«, mahnte Schütz.
»Keine Angst, ich weiß, wem ich mich anvertrauen kann und wem nicht.« Wilhelmine musterte ihn forschend. »Mir scheint, Ihnen liegt auch etwas auf dem Herzen.«
Schütz wich ihrem Blick aus. »Nur eine Kleinigkeit«, sagte er. »Damit muss ich Sie nicht belästigen. Es wird sich alles aufklären.«
Wilhelmine runzelte die Stirn. »Etwas, worüber ich mir Sorgen machen muss?«
Schütz schüttelte den Kopf. »Eine Kleinigkeit«, beteuerte er. »Nur eine Kleinigkeit.« Er erhob sich. »Wenn Sie mich nicht mehr brauchen, setze ich ein paar dringende Depeschen auf.«
Wilhelmine hielt ihm die Hand hin, damit er einen Kuss darauf hauchen konnte. »Wir sehen uns zur Mittagstafel.« Obwohl die Damen der Jagdgesellschaft von dieser Tafel ausgeschlossen waren, würde Wilhelmine wie immer daran teilnehmen. Eberhard und seine Begleiter waren bereits um sieben Uhr zur Treibjagd auf die Schlotwiese bei Zuffenhausen aufgebrochen. Wilhelmine hoffte, dass dem Herzog das Glück hold war, da er sonst wieder den ganzen Tag über bei schlechter Laune sein würde. Stach ihn sein Schwager, der Markgraf, aus, würde er sich vermutlich wieder bitterlich bei ihr beklagen.
Sie wartete, bis Heinrich von Schütz ihr Gemach verlassen hatte, ehe sie ans Fenster trat und auf den Hof hinaussah. Dort tummelten sich zahllose Hofchargen, Kutscher, Lakaien und anderes Gesinde. Zwei junge Burschen waren damit beschäftigt, den Pferdemist einzusammeln und in Schubkarren fortzuschaffen. Ein Blick auf eine kleine Uhr auf dem Tisch verriet Wilhelmine, dass es fast elf war. Zeit, sich um die Fragen zu kümmern, die seit der Ankunft des Markgrafen an ihr nagten. Sie winkte einen der Pagen zu sich, die stocksteif neben der Tür standen, um auf ihre Befehle zu warten. Sie schrieb etwas auf einen Zettel.
»Lauf in den Ordenssaal und gib das der jungen Frau, die die Palmire spielt«, trug sie ihm auf.
Der Knabe nahm den Zettel mit einer kleinen Verbeugung entgegen. Dann eilte er davon, um Wilhelmines Befehl auszuführen.
Wilhelmine wartete ein paar Minuten, bevor sie sich von ihrem Kammerfräulein aus dem ausladenden Reifrock helfen ließ, um ein einfacheres Kleid anzuziehen. Dann warf sie sich einen Kapuzenmantel über und verließ das Corps de Logis ohne Begleitung. Mit gesenktem Kopf machte sie sich auf den Weg zum Schloss Favorite, wo sie sich zur Rückseite des Gebäudes begab, um vor neugierigen Blicken geschützt zu sein. Bei dieser Witterung lief sie wenig Gefahr, einem Gärtner zu begegnen, da die Bäume beschnitten waren und das Gras gestutzt. Fröstelnd zog sie den Mantel enger um die Schultern und sah sich immer wieder um. Auch wenn sie nicht leicht zu ängstigen war, hatte sie der Anschlag erschreckt. Ausgerechnet ein Mann, mit dem sie das Bett geteilt hatte, war von ihren Feinden als Mörder gedungen worden. Die Tatsache, dass sie das Komplott nicht durchschaut hatte, wurmte sie gewaltig. Es war an der Zeit, die Zügel wieder fester in die Hand zu nehmen. Wenn sie auch nur einen Hauch von Schwäche zeigte, würden ihre Feinde sie einkreisen wie ein Rudel hungriger Wölfe.
Kapitel 4
Ludwigsburg, 3. November 1721
»Palmire?«
Marie drehte sich erstaunt um und musterte den Pagen, der vor ihr stand. Die Probe war vor ein paar Minuten beendet worden und sie wartete auf Jost, der sich mit einem der anderen Schauspieler stritt. »Ja?«
Der Junge hielt ihr einen Zettel unter die Nase. »Von der Gräfin.«
Maries Magen zog sich zusammen. Mit einem unguten Gefühl nahm sie das Stück Papier entgegen und steckte es in ihren Ausschnitt, wo ganz sicher niemand danach suchen würde.
Der Page errötete. Dann machte er hastig kehrt und stob davon.
Aus dem Augenwinkel sah Marie, dass La Boneille sie musterte. Es kostete sie alle Selbstbeherrschung, so zu tun, als ob sie ihn nicht bemerkte. Demonstrativ wandte sie ihm den Rücken zu und steuerte auf die Tür des Ordenssaals zu.
Jost war immer noch in ein hitziges Gespräch mit dem Mann vertieft, der den Frauenwächter spielte. Dieser durfte im Verlauf des Stückes mit einer Rute nach seinen Gefangenen schlagen, was Jost offenbar missfiel.
»Wenn du noch mal so hart zuschlägst, nehme ich dir dein Stöckchen weg und lasse dich selbst etwas von deiner Arznei kosten«, schimpfte er.
»Aber La Boneille hat gesagt …«
»Und ich sage dir …«
Marie verließ den Saal und schloss die Tür hinter sich. Dann holte sie den Zettel aus ihrem Ausschnitt hervor und faltete ihn auseinander.
›Komm in den Garten von Schloss Favorite, sobald du diese Nachricht erhältst.‹
Die Botschaft trug keine Unterschrift und das dumpfe Gefühl in Maries Magen verstärkte sich. Einen Moment lang überlegte sie, ob sie warten sollte, bis Jost seinen Zank beigelegt hatte. Doch der Befehl war eindeutig. Sie steckte den Zettel wieder in ihr Kleid, setzte eine ausdruckslose Miene auf und ging zurück in den Ordenssaal.
Jost und der andere Schauspieler redeten immer noch hitzig aufeinander ein.
La Boneille zog fragend die Brauen hoch, aber Marie ignorierte seinen Blick. Sie spuckte auf ein Tuch, wischte sich die Schminke aus dem Gesicht und holte ihren Mantel.
»Wo willst du hin?«, fragte La Boneille, als sie erneut nach der Türklinke griff. Er war plötzlich so dicht hinter ihr, dass Marie die Wärme spürte, die von ihm ausging.
Ihr Herzschlag beschleunigte sich. »Ich muss gehen«, sagte sie kühl, brachte Abstand zwischen sich und ihn und stieß die Tür auf.
»Von wem war die Nachricht?«, wollte La Boneille wissen.
Marie ließ ihn wortlos stehen.
»Marie!«, rief er ihr hinterher.
Sie beschleunigte ihre Schritte und atmete erleichtert auf, als sie den Ausgang aus dem Flügelbau erreichte und ins Freie trat. Erst jetzt erlaubte sie sich einen Blick über die Schulter, um sich zu versichern, dass er ihr nicht folgte. Mit gerafften Röcken eilte sie über den Hof zum Tor und befand sich wenig später auf dem Weg zum Schloss Favorite, das nicht weit entfernt von der Residenz lag. Zu ihrer Erleichterung schenkte ihr niemand besondere Aufmerksamkeit, als sie über die Straße hastete und sich dem kleinen Schlösschen näherte. Was konnte die Gräfin von ihr wollen? Hatte sie herausgefunden, dass Marie eine Diebin war? Obwohl sie den Sack mit dem Diebesgut verloren hatte, fürchtete sie immer noch, dass ihr Verbrechen früher oder später ans Tageslicht kommen und Wilhelmine von Grävenitz sie verhaften lassen würde. Sie schluckte die Angst, die in ihr aufstieg. Wenn es ihr gelungen wäre, mit der Beute zu fliehen, hätte Jost ihr nie seine Liebe gestanden. Allerdings wäre sie dann längst über alle Berge und müsste nicht jeden Tag die Gegenwart dieses verfluchten La Boneille ertragen. Sie presste die Lippen aufeinander und eilte weiter. Vermutlich hatte die Gräfin sie nur zu sich gerufen, weil sie einen Auftrag für sie hatte. Das würde zwar auch Gefahr bedeuten, aber nicht den sicheren Tod durch den Henker.
»Hierher!«
Der gezischte Befehl ließ Marie herumwirbeln.
Zuerst erkannte sie Wilhelmine von Grävenitz nicht, da diese einen einfachen Kapuzenmantel trug.
»Mach schon! Ich stehe mir hier die Füße in den Bauch!« Die Gräfin winkte Marie ungeduldig zu sich. Sie hatte sich zwischen zwei immergrünen Büschen verborgen, die so zurechtgestutzt waren, dass sie aussahen wie Tannenzapfen.
»Ihro Ex…«
»Ich brauche deine Dienste«, fiel Wilhelmine ihr ins Wort. Sie hielt Marie mit einer herrischen Geste davon ab, sich zu verbeugen.
Erleichterung machte Marie das Herz leichter. Offensichtlich wusste die Gräfin tatsächlich nicht, dass sie ihre Rolle als Meisterdiebin in der Theatertruppe allzu wörtlich genommen hatte.
»Du musst herausfinden, warum der Markgraf in Ludwigsburg ist«, sagte Wilhelmine. »Ich glaube nicht, dass er nur wegen dieses lächerlichen Ordensfestes hier ist.«
»Ich soll was?«
»Du sollst dich unter das Gesinde mischen und in Erfahrung bringen, ob der Markgraf wirklich nur wegen der Jagd in die Residenz gekommen ist«, erklärte Wilhelmine.
»Aber man wird mich erkennen«, protestierte Marie. Immerhin hatte sie der Gräfin das Leben gerettet. Außerdem würde sie an diesem Abend vor dem Markgrafen und all den anderen hochgeborenen Gästen auf der Bühne stehen.
Die Gräfin lachte. »Niemand wird dich erkennen, Kind, sei nicht töricht!«
Marie schrak zusammen, als es in einiger Entfernung im Gebüsch raschelte.
Auch Wilhelmine kniff die Augen zusammen und lauschte. »Sicher nur ein Vogel«, sagte sie schließlich. Dann kehrte ihr Blick zu Marie zurück. »Ich will, dass du dich als Magd ausgibst und die Bediensteten des Markgrafen aushorchst«, befahl sie. »Derlei Volk ist klatschsüchtig, gewiss wird dir etwas zu Ohren kommen.« Sie musterte Marie von oben bis unten. »Verkleide dich meinetwegen, aber eine Magd ist eine Magd, kein Mensch wird Fragen stellen.«
»Wie soll ich das anfangen?«
»Ich schicke jemanden, der dich zu den Dienerzimmern bringt«, sagte Wilhelmine. »Noch heute Abend nach dem Theaterstück.« Sie griff in die Tasche und drückte Marie eine Münze in die Hand. Dann zog sie sich die Kapuze tiefer ins Gesicht und ließ die junge Frau stehen.
Marie sah ihr nach, bis sie an der Vorderseite des Jagdschlösschens verschwunden war, ehe sie die Münze einsteckte und grübelnd vor sich hinstarrte. Einerseits bedeutete der Auftrag, dass sie sich vielleicht in Gefahr begab. Andererseits bot sich so die Möglichkeit herauszufinden, ob man in Baden-Durlach immer noch nach Jost suchte. Zwar hatte Marie keine Ahnung, wie sie es anstellen sollte, das Gesinde auszuhorchen. Doch bis jetzt war ihr immer etwas eingefallen. Wenn sie sich an diesem Abend stärker schminkte als sonst, würde man sie ohne all die Farbe im Gesicht gewiss nicht erkennen. Bei der Vereitelung des Anschlages hatte sie zum Glück Männerkleider getragen. Sie straffte die Schultern und machte Anstalten, Wilhelmine zu folgen. Allerdings vertrat ihr bereits nach wenigen Schritten jemand den Weg.
»Was hast du hier zu suchen?« La Boneille durchbohrte sie fast mit seinem Blick.
Marie wich erschrocken zurück.
Als sie nicht antwortete, packte er sie hart am Arm.
»Lass mich los!«
»Wer war das?« Er machte eine Kopfbewegung in die Richtung, in die Wilhelmine von Grävenitz verschwunden war.
»Das geht dich nichts an«, fauchte Marie und befreite sich von ihm. »Geh mir aus dem Weg!«
»War es die Gräfin?«, fragte La Boneille.
Marie spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg.
»Was wollte sie von dir?« La Boneille tat einen drohenden Schritt auf sie zu.
»Frag sie doch selbst«, zischte Marie. Sie funkelte ihn zornig an. »Glaub nicht, dass ich Angst vor dir hätte.«
»Das ist ziemlich töricht von dir«, knurrte er.
»Was willst du tun?«, gab Marie eisig zurück. »Mir wieder vorgaukeln, dass du mich liebst?«
La Boneille verzog das Gesicht. »Darum geht es? Du grollst mir immer noch, weil ich nicht die große Liebe bin, nach der du dich verzehrt hast?« Er lachte abfällig. »Wofür hältst du dich? Dachtest du im Ernst, du wärst etwas anderes als ein kleiner Zeitvertreib?«
Die Worte trafen Marie wie Schläge. Zwar waren ihre Gefühle für La Boneille längst in Hass umgeschlagen, dennoch verletzte sie sein Hohn mehr, als sie gedacht hatte. »Lass mich in Ruhe!«, presste sie hervor.
»Was sonst? Hetzt du dann Jost auf mich?«, spottete La Boneille. »Weiß er, wie du dich mir an den Hals geworfen hast?«
Marie holte aus, um ihm eine Ohrfeige zu versetzen, aber er fing ihren Hieb mühelos ab. »Das solltest du nicht noch mal versuchen«, drohte er.
Marie zitterte vor Wut. »Lass mich in Ruhe!«, zischte sie erneut, riss sich von ihm los und rannte über den Rasen davon, als ob der Leibhaftige hinter ihr her wäre.
Kapitel 5
Ludwigsburg, 3. November 1721
Erst als sie die Residenz erreicht hatte, wagte Marie, ihre Schritte zu verlangsamen. Dieser verdammte La Boneille! Die Wut war wie Säure, die sich in ihr Herz fraß. Er musste ihr hinterhergeschlichen sein, obwohl sie sich vor Verfolgern sicher gewähnt hatte. In Zukunft musste sie aufmerksamer sein. Mit einer Verwünschung auf den Lippen eilte sie zurück zum Ordenssaal, um sich Jost anzuvertrauen. Dabei war sie darauf bedacht, den Kopf gesenkt zu halten und niemandem in die Augen zu blicken.