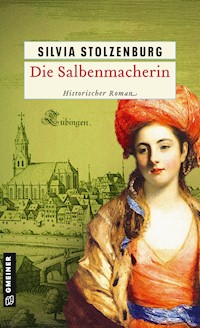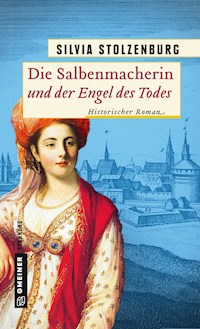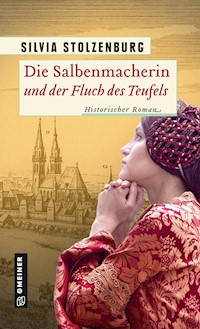Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Begine von Ulm
- Sprache: Deutsch
Das Leben der ehemaligen Begine Anna Ehinger verläuft in ruhigen Bahnen, wie erhofft erwartet sie endlich ein Kind von ihrem Gemahl Lazarus. Doch dann taucht eine Zauberin im Heilig-Geist-Spital auf. Plötzlich häufen sich die Todesfälle in der Stube der Wöchnerinnen, und eine furchtbare Seuche beginnt unter den Insassen zu wüten. Steckt die geheimnisvolle Frau dahinter, an deren Kräfte selbst Annas Bruder Jakob zu glauben scheint? Als immer mehr Menschen sterben, beginnt Anna Fragen zu stellen und gerät in höchste Gefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Stolzenburg
Die Begine und die Zauberin
Historischer Kriminalroman
Zum Buch
Dunkle Mächte Anno Domini 1414: Das Leben der ehemaligen Begine Anna Ehinger verläuft in ruhigen Bahnen. Da sie inzwischen ein Kind von ihrem Gemahl Lazarus erwartet, kümmert sie sich vermehrt um das Herstellen von Tränken und Arzneien, die sie nicht nur an reiche Patrizierinnen verkauft. Auch die Hübschlerinnen aus dem städtischen Frauenhaus zählen zu ihren Kundinnen – eine Tatsache, die Lazarus ein Dorn im Auge ist. Als eines Tages eine Zauberin auftaucht, ist es jedoch mit der Ruhe vorbei. Plötzlich häufen sich die Todesfälle im Heilig-Geist-Spital und im Frauenhaus. Zudem beginnt eine furchtbare Seuche in der Siechenstube zu wüten. Steckt die geheimnisvolle Frau dahinter, an deren Kräfte selbst Annas Bruder Jakob zu glauben scheint? Als immer mehr Menschen sterben, beginnt Anna Fragen zu stellen und gerät in höchste Gefahr.
Dr. phil. Silvia Stolzenburg studierte Germanistik und Anglistik an der Universität Tübingen. Im Jahr 2006 promovierte sie dort über zeitgenössische Bestseller. Kurz darauf machte sie sich an die Arbeit an ihrem ersten historischen Roman. Sie ist hauptberufliche Autorin und lebt mit ihrem Mann auf der Schwäbischen Alb, fährt leidenschaftlich Mountainbike, gräbt in Museen und Archiven oder kraxelt auf steilen Burgfelsen herum – immer in der Hoffnung, etwas Spannendes zu entdecken.
Impressum
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München)“
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © Elnur / stock.adobe.com und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rogier_van_der_Weyden_-_Triptych-_The_Crucifixion_-_Google_Art_Project.jpg
ISBN 978-3-8392-7610-5
Widmung
Für meinen Süßen
Kapitel 1
Ulm, Juni 1414
Obwohl die Dämmerung nicht mehr fern war, lag die Sommerhitze wie ein erstickendes Tuch über der Stadt. Von der Donau her blies ein laues Lüftchen, das den Geruch von Algen und vollen Fischernetzen herantrug. Der elfjährige Micha hockte auf einem Ast in einem großen Apfelbaum, dessen Laub ihm Schatten und Blickschutz bot. Das arme Viertel bei der Stadtmauer, in dem er seit Monaten in einem alten Schuppen hauste, war wie ausgestorben, da die Ackerbürger ihr Tagwerk beendet hatten.
Seitdem er im vergangenen Winter dabei geholfen hatte, einen Mörder dingfest zu machen, war er auf sich allein gestellt und schlug sich teils bettelnd, teils stehlend mehr schlecht als recht durch. Nachdem er sich beim Bettelmeister eine Bettelmarke gekauft hatte, versuchte er, den anderen Gassenjungen der Stadt aus dem Weg zu gehen, da ihr Anführer, der Schwarze Utz, eine Rechnung mit ihm offen hatte. Durch Michas Handeln war den Jungen ein dicker Fisch durchs Netz geschlüpft, und er fürchtete, dass sie immer noch auf Rache aus waren.
Als von irgendwoher ein Schrei gellte, zuckte er zusammen. Furchtsam blickte er sich um, froh darüber, vom Boden aus so gut wie unsichtbar zu sein. Dem ersten Schrei folgten weitere, plötzlich herrschte eine unheimliche Stille. Er spürte, wie sich seine Nackenhaare aufrichteten. Derlei Geräusche waren keine Seltenheit in der Gegend, doch diese Schreie klangen anders als die, die üblicherweise ertönten, wenn die Männer am Abend zu viel Bier getrunken hatten. Entgegen aller Vernunft kletterte er behände aus dem Baum und legte einige Augenblicke lauschend den Kopf schief.
Ein weiterer Schrei ging in ein ersticktes Wimmern über, dann brüllte ein Kind.
Micha begriff. Irgendwo in der Nähe musste eine Frau entbunden haben. Erleichterung machte sich in ihm breit, und er beschloss, ein wenig durch die winzigen Gärten zu streifen, um Beeren zu stehlen. Seit dem frühen Morgen hatte er nichts mehr gegessen, weil er an diesem Tag kaum etwas erbettelt hatte. In seiner Tasche ruhte seine gesamte Barschaft, die nicht mehr als ein paar Pfennige umfasste. Es wurde Zeit für einen neuen Diebeszug auf dem Marktplatz, allerdings fürchtete er, dass Utz und die anderen ihm dort auflauern oder ihn an die Marktaufsicht verraten könnten. Die Vorstellung, was ihm bevorstünde, sollte man ihn auf frischer Tat ertappen, ließ Übelkeit in ihm aufsteigen. Wenn er Glück hatte, würde man ihn nur aus der Stadt prügeln, im schlimmsten Fall drohte ihm das Abhacken einer Hand.
Geduckt schlich er zum nächstgelegenen Garten, schwang sich über den morschen Zaun und kniete sich vor ein Beet voller Erdbeerpflanzen. Zwar waren noch nicht alle Früchte reif, doch er fand genug, um den schlimmsten Hunger zu stillen. Auf dem Weg zum nächsten Garten pflückte er Süßkirschen und Johannisbeeren und hoffte, auf freilaufende Hühner zu treffen. Wo es Hühner gab, waren frische Eier nicht weit, doch als er ein Hühnerhaus entdeckte, lief ein Hahn mit geschwollenem Kamm drohend auf ihn zu.
»Spiel dich nicht so auf!«, brummte er und machte einen Satz nach hinten, als der Hahn nach seinem Schienbein pickte. Eilig ging er weiter zum nächsten Garten, der hinter einer Kate lag, deren winzige Fenster offen standen. Als er näherkam, wurde das Weinen des Neugeborenen lauter, und er hörte die Stimme einer Frau.
»Wir müssen warten, bis es dunkel ist, sonst entfaltet der Zauber seine Wirkung nicht richtig.«
Micha horchte auf. Zauber? Er duckte sich und schlich näher an eines der Fenster.
»Es ist zu spät, um die Stadt zu verlassen, sonst hätte ich sie in den Fluss werfen können«, ertönte die Stimme erneut. »Wenn sie nicht verbrannt oder vergraben wird, können sich Hexen ihrer bemächtigen und ein Wechselbalg aus ihr machen.«
»Heilige Muttergottes!«, keuchte eine andere Frau.
Als Micha vorsichtig durch das Fenster lugte, sah er eine Wöchnerin mit rotem Gesicht und eine junge Frau in bunten Gewändern, deren dunkles Haar zu einem dicken Zopf gebunden war und bis zur Hüfte reichte. Sie war bleich und zierlich und wunderschön. An ihrem Hals hingen mehrere silberne Ketten, die aussahen wie Amulette. Armreifen klimperten, als sie etwas aufhob, das in ein blutiges Tuch gewickelt war.
»Ich bringe sie nach draußen«, sagte sie.
Micha schauderte, zog sich hastig zurück und versteckte sich hinter einem Misthaufen. Was hatte die Frau vor? Wollte sie das Neugeborene umbringen? Obwohl ihm sein Verstand riet, so schnell wie möglich das Weite zu suchen, verharrte er wie angewurzelt und beobachtete, wie die Frau ein Feuer entzündete.
Während die Scheite anfingen zu brennen, wiegte sie das blutige Bündel in den Armen, hob es zum Himmel und murmelte Worte, die Micha nicht verstand. Dann holte sie etwas aus der Tasche und warf es in die Flammen, die zischend in die Höhe schlugen.
»Ebra debra!«, hörte er sie in einem sanften Singsang sagen. »Cinium, cinium, gossium, strassus!« Sie malte ein Zeichen in die Luft über dem Bündel und ließ es, ohne zu zögern, ins Feuer fallen.
Micha hielt sich den Mund zu, um den Schrei zu ersticken, der in ihm aufstieg. Eine kalte Hand griff nach seinem Herzen, als er begriff, was die Frau getan hatte: Ohne mit der Wimper zu zucken, hatte sie ein Neugeborenes getötet!
Kapitel 2
Mit einem erschöpften Prusten wischte sich der Stadtpfeifer Gallus den Schweiß von der Stirn und schlüpfte in seine Kleider. Obwohl er sich geschworen hatte, vor Einbruch des Winters in eine bessere Unterkunft zu ziehen, war sein Wille zur Sparsamkeit nicht besonders groß. Seit er die junge Frau, die ihm gelangweilt beim Anziehen zusah, das erste Mal beim Marktplatz getroffen hatte, war er ihren Reizen verfallen, und daran würde sich vermutlich so schnell nichts ändern. Ihr Haar hatte die Farbe von Kupfer, ihre Augen die eines Sommerhimmels. Winzige Sommersprossen tanzten nicht nur auf ihrer Nase, sondern auch auf dem üppigen Busen, an dem Gallus sich nicht sattsehen konnte. Ihm war von Anfang an klar gewesen, dass sie eine Hure war, dennoch erlaubte er sich, sich einzubilden, dass ihr seine Besuche ebenso viel Vergnügen bereiteten wie ihm.
»Warum willst du denn schon gehen?«, gurrte sie und strich neckend mit dem Zeigefinger über die Brust. »Wir könnten uns noch mal vergnügen.« Ihr Blick fiel auf seinen Hosenlatz. »Oder bist du erschöpft?«
»Besorgst du es mir dann umsonst?«, fragte er.
Sie lachte. »Natürlich nicht! Sei nicht einfältig!«
Er holte eine Münze aus der Tasche und warf sie ihr zu. Anschließend zog er seine Schuhe an, rückte seine Männlichkeit zurecht und ging zur Tür.
»Kommst du morgen wieder?«
Er zuckte mit den Schultern. »Vielleicht.« Ohne sich noch einmal umzudrehen, verließ er die Kammer, die sich in einer billigen Herberge befand. Obwohl es sicherer für sie gewesen wäre, in einem Frauenhaus zu arbeiten, hatte sie sich dazu entschlossen, auf eigene Faust nach Männern wie Gallus zu suchen. Er hatte sie nie gefragt, warum sie keinem anderen Gewerbe nachging, und wenn er ehrlich war, interessierte es ihn auch nicht. Sie befriedigte seine Bedürfnisse, mehr nicht. Er kannte nicht mal ihren Namen.
Als er ins Freie trat, schlug ihm der Geruch von den vollen Sickergruben und dem Abfall entgegen, den die Bewohner des schäbigen Viertels trotz des städtischen Verbots einfach auf die Straße warfen. Nicht weit von dem Haus entfernt, in dem seine Gespielin wohnte, lag der aufgedunsene Kadaver eines Hundes, um den grün schillernde Fliegen schwirrten. Am Ende der Gasse ragte ein Turm der Stadtbefestigung auf, auf dem das Banner der Stadt aufgezogen war. Da kein Lüftchen wehte, hing es schlaff an seinem Mast.
Gallus rümpfte die Nase. Die drückende Hitze setzte ihm zu, und er hoffte, dass die Wolken am Horizont endlich die ersehnte Abkühlung bringen würden. Seit Tagen fühlte es sich an, als würde die ganze Stadt in einem Ofen backen. Als er den Arm hob, um eine Fliege zu verscheuchen, stieg ihm der Geruch seines eigenen Schweißes in die Nase. Er beschloss, dem Badehaus einen Besuch abzustatten, auch wenn ihn die Ausgabe jetzt schon reute.
Während sich das wohlbekannte schale Gefühl einstellte, das er stets empfand, wenn er die Hure verließ, wich er streunenden Katzen und Ansammlungen von Unrat aus, die weniger wurden, je näher er der Stadtmitte kam. Kurz darauf tauchte das Münster vor ihm auf, an dem zu dieser Zeit nicht mehr gebaut wurde. Bevor ihm bewusst wurde, was er tat, schweifte sein Blick zum Gottesacker hinter der Kirche, auf dem die einzige Frau begraben war, für die er bis jetzt aufrichtige Gefühle gehegt hatte. Der Verlust schmerzte ihn immer noch, doch die Trauer über Idas Tod war inzwischen so schwach geworden, dass er sich an manchen Tagen dafür schämte. Sie ist tot, dachte er, ärgerlich über sich selbst. Was sollte er denn tun? Aufhören zu leben? Er schlug den Weg zu einem der zahlreichen Badehäuser der Stadt ein, an dessen Tür die Badeordnung aufgehängt war. Nachdem er ein paar Pfennige aus der Tasche gefischt hatte, erklomm er die Treppe zum Eingang und wischte sich erneut den Schweiß von der Stirn, bevor er den dämmrigen Raum betrat.
Trotz der späten Stunde herrschte reger Betrieb. Der Geruch von Schwefel, Salz und Seife hing in der Luft und vermischte sich mit dem Duft von frisch zubereiteten Speisen. Am Ende des langen Raumes stand ein riesiger befeuerter Kessel, der dafür sorgte, dass stets heißes Wasser für die Badenden zur Verfügung stand. Von einer Stellwand aus dünnem Tuch abgetrennt, zechten Männer und Frauen in mehreren aneinandergestellten Bottichen, über die ein langes Brett gelegt worden war, das als Tisch für die von einer Bademagd aufgetragenen Köstlichkeiten diente. Ein Fiedler gab ein heiteres Lied zum Besten, während die Badenden aßen, tranken und sich freizügiger Beschäftigung miteinander hingaben. An die Badeordnung schien sich unter diesem Dach seit Langem niemand mehr zu halten.
Eine der blutjungen Bademägde schwebte mit einem honigsüßen Lächeln auf ihn zu. »Womit kann ich dir dienen?«, fragte sie. Ihr geschmeidiger Körper wurde nur ansatzweise von einem durchsichtigen Gewand bedeckt, ihr Haar hing offen herab. In der Hand hielt sie einen Badewedel aus bunten Federn, den sie einladend hin- und herdrehte.
»Ich brauche ein Bad«, entgegnete Gallus und starrte auf die verführerisch durch den dünnen Stoff blitzenden Brüste. Seine Männlichkeit fing schon wieder an, sich zu regen.
Sie lächelte ihn erneut an. »Komm mit!«, forderte sie ihn auf und führte ihn mit wiegenden Hüften an den Zechenden vorbei in einen Korridor, von dem mehrere, mit Vorhängen abgetrennte Kammern abgingen, in denen man Dienste in Anspruch nehmen konnte, die nichts mit Reinlichkeit zu tun hatten.
Es dauerte nicht lange, bis sie den Durchgang zu einem Raum erreichten, in dem sich zahlreiche Zuber, Bänke und Stapel von frischen Tüchern befanden.
»Zieh dich aus, ich hole warmes Wasser«, forderte ihn die Magd auf.
Dieser Aufforderung leistete Gallus nur allzu gern Folge, und wenig später saß er im Bottich und schloss genüsslich die Augen, während die Bademagd ihn mithilfe eines Schwamms einseifte.
Der Genuss war viel zu schnell vorbei, doch Gallus wollte nicht mehr Geld ausgeben als unbedingt nötig, weshalb er sich eine halbe Stunde später auf den Heimweg machte. Dieser führte ihn über den Marktplatz, der übersät gewesen war mit welkem Gemüse, das von den Karren der Bauern gefallen war. Das meiste war längst von den Ärmsten der Stadt eingesammelt worden, doch in der Nähe des Brunnens kniete noch eine alte Frau, die etwas in einen Korb steckte. Froh darüber, nicht so bettelarm zu sein wie die Alte, steuerte Gallus auf die Herberge zu, in der er eine Kammer gemietet hatte. Obwohl sein Magen knurrte, ging er an der Schankstube vorbei, um in ein frisches Hemd zu schlüpfen, bevor er etwas zu essen bestellte.
Die alten Stufen knarrten so laut unter seinen Füßen, dass er fürchtete, sie würden irgendwann zusammenbrechen. Im Sommer, wenn die winzigen Fenster der Herberge offen standen, war die Luft im Haus erträglich, doch im Winter hing stets der Geruch von Schimmel in den Räumen. Als er den Treppenabsatz erreichte, hielt er mitten im Schritt inne. Vor der Tür seiner Kammer kniete jemand auf dem Boden und schien sich an deren Schloss zu schaffen zu machen.
»He!« Er sprang nach vorn, um den Burschen am Kragen zu packen, doch der reagierte sofort.
Wieselflink kam er auf die Beine, duckte sich unter Gallus’ Arm hindurch und rannte zur Treppe.
Allerdings war er nicht schnell genug, dass Gallus sein Gesicht nicht erkannt hätte.
»Verfluchte kleine Diebe!«, knurrte der Stadtpfeifer und konnte sich nur mit Mühe beherrschen, dem Bengel nicht nachzusetzen. Er gehörte zu den Gassenjungen, mit denen er sich seit langer Zeit herumschlug. Obwohl er sich mehrfach bei der Wache beschwert hatte, schienen die Stadtknechte nicht besonders erpicht darauf zu sein, diesem verdammten Utz und seiner Bande das Handwerk zu legen.
Er ballte die Fäuste und nahm das Türschloss genauer in Augenschein. Wäre er später gekommen, hätte sich der Bengel zweifellos Zutritt zu seiner Kammer verschafft und alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest war. Während sich seine Wut verstärkte, wanderten seine Gedanken zu Micha, den er seit der Nacht, in der er Idas Mörder zur Rechenschaft gezogen hatte, nicht mehr gesehen hatte. Ob der Junge zu der Bande zurückgekehrt war? Oder hatte er die Stadt längst verlassen, um an einem anderen Ort sein Glück zu suchen? Leise vor sich hin fluchend entschied er, ein weiteres Schloss an der Tür anzubringen und von jetzt an wieder ein schärferes Auge auf die Gassenjungen zu haben. Wenn sich die Wache nicht um diese Bande kümmerte, musste er es eben selbst in die Hand nehmen.
Kapitel 3
An diesem Tag fühlte sich Anna Ehingers Kräuterküche an wie der Vorhof der Hölle. Es war so heiß in dem kleinen Raum, dass ihr Kleid am Rücken durchgeschwitzt war und ihr Haar, das sich aus der Haube gelöst hatte, an der Stirn klebte. Unter der Kochstelle loderte ein starkes Feuer, da sie an diesem Tag neue Arzneien für die Hübschlerinnen im Frauenhaus hergestellt hatte. Seit einigen Monaten besuchte sie die Frauen regelmäßig und versorgte sie mit Mitteln, die ihre monatliche Blutung anregten. Keine von ihnen wollte ein Kind empfangen, da dies bedeuten würde, dass der Frauenwirt sie des Hauses verweisen musste.
Frauenhäuser waren ein fester Bestandteil der städtischen Ordnung, ihr Betrieb durch eine vom Rat erlassene Frauenhausordnung geregelt. Durch die Einrichtung dieser Häuser sollten Bürgerinnen und Jungfrauen vor Nachstellungen geschützt werden, da in einer vielbesuchten Handelsstadt wie Ulm zahlreiche unverheiratete Hausknechte und Handwerksgesellen auf der Suche nach Vergnügen waren. Die meisten Hübschlerinnen waren freiwillig in den Dienst des Frauenwirts getreten, allerdings gab es auch mehrere junge Frauen, die gegen ihren Willen von einem Familienangehörigen verpfändet worden waren. Ihre Freiheit konnten diese Mädchen nur erlangen, wenn sie dem Wirt die Pfandsumme bezahlten.
Bei ihren häufigen Besuchen im nahegelegenen Frauenhaus hatte Anna erfahren, unter welchen Umständen die Huren lebten. Für die wöchentliche Verpflegung mussten sie dem Wirt vierzig Pfennige bezahlen, für die Unterkunft in einer der winzigen Kammern waren sieben Pfennige Wochengeld zu entrichten. Darüber hinaus war der Frauenwirt am Umsatz beteiligt – mit einem Pfennig, wenn der Freier nach Erledigung des »leiblichen Werks« wieder ging, mit drei Pfennigen Schlafgeld für einen »Schlafmann«, einen Freier, der über Nacht blieb.
Obwohl es den Hübschlerinnen erlaubt war, sich ungehindert in der Stadt zu bewegen, blieben die meisten Frauen im Haus, um nicht der Verachtung der anständigen Bürger ausgesetzt zu sein. An ihrer Kleidung mussten sie gut sichtbar ein Band in einer der Schandfarben Rot, Gelb oder Grün tragen, damit man sie schon von Weitem als schändliche Weiber erkannte. Viele von Annas wohlhabenderen Kundinnen waren der Ansicht, dass Huren Unglück brachten oder gar den bösen Blick besaßen, weshalb sie ihre Besuche des Frauenhauses stets spät am Abend machte, um nicht dabei gesehen zu werden.
Die jungen Frauen taten ihr leid, viele von ihnen schienen sich in ihr Los gefügt zu haben. Es kam nicht selten vor, dass Anna gerufen wurde, weil eine von ihnen von einem Freier brutal vergewaltigt worden war und sich eine Blutung nicht stillen ließ. Lazarus hatte mehrfach versucht, sie davon abzubringen, den Hübschlerinnen zu helfen, und auch an diesem Tag öffnete sich die Tür der Kräuterküche kurz bevor sie zum Frauenhaus aufbrechen wollte.
»Wie hältst du es hier drin nur aus?«, fragte er mit einem Nicken in Richtung des prasselnden Feuers. »Warum lässt du mich nicht draußen eine Feuerstelle bauen?«
»Weil es im Sommer zu gefährlich ist«, entgegnete Anna. »Die Funken, das trockene Gras …« Sie schüttelte den Kopf. »Ich komme gut zurecht.«
Sein Blick wanderte weiter zu ihrem Bauch, der inzwischen sichtbar gerundet war. Im Winter war ihr Wunsch endlich in Erfüllung gegangen, und sie hatte ein Kind empfangen. Lange Zeit hatten sie und Lazarus es vergeblich versucht, so lange, dass Anna bereits in Sorge gewesen war, Gott wollte sie bestrafen.
»Gehst du noch mal weg?«, fragte er.
Sie bejahte.
»Ins Frauenhaus?«
»Das weißt du doch ganz genau«, erwiderte sie mit einem Lächeln. »Mir passiert nichts.«
»Mir ist nicht wohl dabei«, seufzte Lazarus. »Diese Männer, die dort ein und aus gehen …«
»… wollen zu den Hübschlerinnen«, unterbrach Anna ihn. »Der Frauenwirt sorgt dafür, dass alles mit rechten Dingen zugeht.«
»Aber das stimmt nicht!«, protestierte Lazarus. »Du hast selber gesagt, dass es dort oft zu Notzucht kommt!«
Anna wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. Die Freier, die sich an den Frauen vergriffen, mussten mit keiner Strafe rechnen, da ein solches Vergehen niemanden interessierte. »Niemand wird mich für eine Hure halten«, sagte sie schließlich und zeigte auf die Haube auf ihrem Kopf und auf ihren Bauch.
»Und wenn doch?«
Sie ging auf ihn zu, fasste ihn an den Händen und sah zu ihm auf. »Mach dir keine Sorgen. Ich kann gut auf mich aufpassen.«
Lazarus verzog das Gesicht. »Du weißt, dass das nicht der Wahrheit entspricht«, brummte er.
Anna senkte den Blick. Er hatte recht. Zu oft war sie seit ihrer ersten Begegnung mit ihm im Heilig-Geist-Spital in scheinbar ausweglose Lagen geraten, die sie fast das Leben gekostet hätten. Konnte sie ihm seine Sorge verübeln? »Ich bin ja nicht allein«, sagte sie. »Wer ist schon so dumm, sich an zwei Frauen auf einmal zu vergreifen?«
Er blies die Backen auf. »Ich wünschte, du würdest Vernunft annehmen«, seufzte er.
»Es ist meine Christenpflicht«, sagte sie. »Auch wenn ich keine Begine mehr bin, wäre ich eine schlechte Christin, wenn ich mich nicht um die Bedürftigen kümmern würde.«
Darauf wusste Lazarus keine Antwort. Nach kurzem Schweigen stieß er einen Seufzer aus und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich begleite dich«, sagte er.
Anna schüttelte den Kopf. »Warum? Bis jetzt bin ich gut alleine zurechtgekommen.«
»Ich weiß nicht«, gestand er. »Ich habe heute ein ungutes Gefühl.«
»Der Frauenwirt wird dich nicht einlassen. Ausschließlich Freier haben Zutritt. Willst du, dass man sieht, wie du dich vor dem Frauenhaus herumdrückst?« Sie packte die Mittel für die Hübschlerinnen in einen flachen Weidenkorb. »Was würden wohl deine reichen Patienten sagen? Oder die Pfründner? Jetzt, wo wir wieder Zugang zum Spital haben.« Nachdem der aus Rom zurückgekehrte Magister Hospitalis den neuen Pfleger Ortwin Besserer dazu gebracht hatte, Anna und Lazarus des Spitals zu verweisen, hatte dieser vor einigen Wochen seine Meinung geändert. Der junge Arzt, den der Magister Hospitalis aus Rom mitgebracht hatte, schien nicht besonders fähig zu sein, weshalb Lazarus und sie wieder häufiger im Spital anzutreffen waren.
Lazarus brummte etwas Unverständliches.
»Ich bin zurück, bevor die Sonne untergeht«, versprach Anna, stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn auf die Wange. »Versprochen.«
»Das hast du schon mal gesagt«, hörte sie Lazarus murmeln, als sie die Kräuterküche verließ und in den Garten hinter ihrem Haus trat. Obwohl bei seinen Worten schlimme Erinnerungen in ihr aufstiegen, schob sie die Gedanken an das Feuer im Haus ihres entfernten Schwagers, auf das er anspielte, beiseite und machte sich auf den Weg zur Straße. Der Duft von verblühtem Flieder, Rosen und warmer Erde begleitete sie, doch als sie die Straße erreichte, blies der Wind ihr Staub ins Gesicht und vertrieb die Wohlgerüche. Sie zögerte nur kurz, ehe sie in Richtung Stadtmauer ging, wo sich das Frauenhaus befand.
Obwohl die Stadttore bald geschlossen wurden, waren noch zahlreiche Bauern aus den umliegenden Dörfern in der Stadt, die ihre Waren auf dem Markt verkauft hatten. Eine gewisse Reizbarkeit lag in der Luft, die sich darin äußerte, dass an fast jeder Ecke gestritten wurde.
»Himmelherrgott, stell dich doch nicht immer so töricht an!«, hörte Anna einen Fuhrmann schimpfen, dem ein Fass von der Ladefläche gerollt war.
Ein Junge, kaum älter als ihr jüngster Neffe, mühte sich damit ab, die restliche Ladung festzuzurren.
»Elendiger Nichtsnutz!«, knurrte der Fuhrmann und versetzte dem Jungen eine Ohrfeige.
Etwas weiter die Straße entlang balgten sich vier Burschen um etwas, was Anna nicht erkennen konnte. Der Streit schien allerdings nicht ernst zu sein, da sie lachten. Immer noch lag die Hitze flimmernd über der Stadt, verwischte die Formen am Horizont und sorgte dafür, dass die Misthaufen schlimmer stanken als sonst. Schon nach wenigen Schritten lief Anna der Schweiß in die Augen, und sie warf einen Blick zum Himmel. Wenn es doch nur endlich regnen würde! Die Pflanzen in ihrem Kräutergarten drohten zu verdorren, obwohl sie sie jeden Tag mit Wasser aus dem Brunnen goss. Die Blätter der Bäume waren schlaff und braun, und falls nicht bald Regen fiel, würde die Ernte dieses Jahr schlecht ausfallen. Dann drohten Hunger und Not, und die Dürftigenstube im Spital würde sich vorzeitig füllen.
In Gedanken versunken legte sie den Rest des Weges zurück, bis das Frauenhaus vor ihr auftauchte. Zu ihrer Erleichterung lungerten keine Männer davor herum, dennoch beeilte sie sich, das kühle Innere zu betreten und eine der schmalen Stiegen zu erklimmen, über die man die oberen Stockwerke erreichte. Sie hatte gerade den ersten Absatz erreicht, als ein gellender Schrei an ihr Ohr drang.
Kapitel 4
Entsetzt starrte Micha auf das brennende Bündel, das in einem Funkenregen tiefer ins Feuer rutschte, als ein Holzscheit zerbarst. Erst nach einigen Augenblicken kam Leben in ihn, und er fing an zu rennen, bevor sein Verstand ihn davon abhalten konnte. Obwohl die Flammen drohten, ihn zu versengen, hob er einen Stecken vom Boden auf und lief zum Feuer, das vom Wind immer mehr angefacht wurde. Wenn er das Bündel mit dem Stock zwischen den Scheiten hervorholte …
Eine Wand aus Hitze schlug ihm entgegen und ließ ihn zurückschrecken. Die Flammen schienen nach ihm zu lecken, und er spürte, wie Funken auf seinem Haar landeten. Das Tosen war so laut, dass er die Rufe kaum hörte.
»Gib acht!« Hände griffen nach ihm und zogen ihn vom Feuer weg. »Willst du dich umbringen?«
Hustend rang Micha nach Luft, während das Bündel stetig tiefer ins Feuer rutschte und mit einem Zischen vollends in Flammen aufging.
»Was soll das?« Die Frau, die das Kind ins Feuer geworfen hatte, sah ihn kopfschüttelnd an. »Bist du nicht bei Trost?«
Micha hob abwehrend die Hände. »Weiche, Satan!«, keuchte er und schlug ein Kreuz.
»Satan?« Zu seiner Verwunderung lachte die Frau. »Glaubst du, ich bin eine böse Zauberin?«
Sein Blick zuckte zum Feuer. »Was denn sonst? Du hast ein Neugeborenes verbrannt!« Seine Worte gingen in ein Husten über, da der Wind den Rauch in seine Richtung blies.
»Ein Neugeborenes?« Sie lachte erneut. »Du bist ein dummer Junge!«
Micha starrte auf das Bündel, von dem nicht mehr viel übrig war. Für das Kind darin kam jede Hilfe zu spät.
»Geh nach Hause«, hörte er die Frau sagen. »Du hast hier nichts zu suchen.«
Er wirbelte herum und funkelte sie empört an. Zauberin hin, Zauberin her, sie war eine Mörderin! Wut verdrängte die Angst, die ihm die Kehle zuschnürte. »Ich hole die Wache«, keuchte er und machte Anstalten, sich abzuwenden.
»Die wird dich auslachen.« Die Frau packte ihn beim Arm und zog ihn weiter vom Feuer weg. »Das da ist kein Kind.« Sie zeigte auf das verbrennende Bündel.
»Aber ich habe gesehen, wie du …«
Aus dem Haus hinter ihnen erklang das Weinen eines Säuglings.
Micha blinzelte verwirrt.
»Du hast gar nichts gesehen!«, fuhr sie ihn an. »Du denkst nur, dass du was gesehen hast.« Ihre Augen funkelten zornig im Schein des Feuers. »Das da«, sie deutete erneut auf das Bündel, »ist die Nachgeburt!«
Micha öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, aber die Worte blieben ihm im Hals stecken.
»Warum schnüffelst du überhaupt hier rum?«, fragte sie argwöhnisch. »Was hast du um diese Zeit hier zu suchen?« Sie musterte ihn genau. »Du bist ein Bettler«, stellte sie fest, als ihr seine Bettelmarke auffiel.
»Ich …« Micha verstummte, als der Säugling erneut lauthals weinte. Er spürte, wie ihm das Blut in die Wangen stieg.
»Verschwinde!«, zischte sie. »Oder ich schreie: ›Haltet den Dieb!‹ Deswegen bist du doch da, oder? Um zu stehlen?«
Micha wich von ihr zurück. »Das stimmt nicht!«, beeilte er sich zu sagen.
»Sieh zu, dass du fortkommst!« Sie machte eine Handbewegung, als wollte sie eine Schmeißfliege verscheuchen. Als er sich nicht rührte, tat sie einen drohenden Schritt auf ihn zu.
Obwohl sie kaum größer war als er, flößte ihm der Blick ihrer dunklen Augen Angst ein. Was, wenn sie nicht die Wahrheit sagte und doch mit dem Teufel im Bunde stand? Würde sie ihm dann die Seele stehlen und ihn zwingen, ein Diener des Bösen zu werden? Trotz der Hitze des Feuers kroch ihm ein Schauer über den Rücken.
»Hau ab!« Sie griff nach einem der Amulette an ihrem Hals.
Micha wich vor ihr zurück. Während die Flammen nach wie vor im Wind tanzten, kehrte er ihr den Rücken und lief in die Richtung davon, aus der er gekommen war. Er verlangsamte die Schritte erst, als er einen der kleinen Gärten erreichte. Ein Blick über die Schulter verriet ihm, dass die Zauberin auf dem Weg zurück ins Haus war, weshalb er zögerte, ehe er über den Zaun kletterte. Würde sie der Mutter etwas antun, um ihrem bösen Herrn zu dienen? Obwohl eine kleine Stimme in seinem Ohr ihm sagte, dass es klüger war zu verschwinden, war seine Neugier auch dieses Mal stärker. Sobald die Zauberin im Haus verschwunden war, kam er aus seinem Versteck hervor und schlich zurück zu dem Fenster, durch das er die Frauen beobachtet hatte.
»Dem Kind wird nichts geschehen«, hörte er die Hexe sagen. »Seine Seele ist vor dem Bösen sicher.«
»Der Herr segne dich«, entgegnete die Mutter.
Vorsichtig hob Micha den Kopf, um einen Blick auf das Neugeborene zu erhaschen.
Es lag an der Brust seiner Mutter, die erschöpft auf einem Lager aus Strohsäcken ruhte. Dank einer Talglampe auf einem Tischchen konnte Micha sehen, wie das Kind gierig nuckelte. Es schien wohlauf zu sein, dennoch hatte er ein ungutes Gefühl. Mit heftig klopfendem Herzen verfolgte er, wie die Zauberin in einen Beutel griff, etwas hervorholte und es der Mutter aufs Knie legte.
»Nimm es in den Mund und zerkaue es!«, forderte sie die Wöchnerin auf. »Dann spuck es auf dein linkes Knie und huste dreimal drauf! Das wird dich und das Kind vor Schaden bewahren.«
Die Mutter befolgte die Anweisung, während Micha überlegte, was er tun sollte. Noch bevor er einen Entschluss gefasst hatte, hörte er Münzen klimpern und die Zauberin verabschiedete sich.
Kurz darauf knarrte die Tür.
Hastig duckte er sich und beobachtete, wie die Hexe das Haus verließ und nach Westen davonging. Das Feuer, in das sie die Nachgeburt geworfen hatte, war inzwischen fast niedergebrannt, der Qualm verzogen. Ohne lange nachzudenken, richtete Micha sich auf, holte tief Luft und folgte der Zauberin.
Der Weg führte ihn am Heilig-Geist-Spital vorbei in Richtung Stadtmitte, wo die Zauberin zu seiner Verwunderung im Beginenhof verschwand. Micha runzelte die Stirn. Was konnte sie bei den Beginen wollen? Er beschloss, im Schutz des gegenüberliegenden Pfleghofes der Zisterzienser abzuwarten, bis sie wiederauftauchte. Grübelnd betrachtete er die stattliche Ansammlung von Gebäuden, die von einer Mauer und einem großen Tor geschützt wurden. Obwohl er erst seit einem Jahr in Ulm lebte, wusste er, dass die Beginen nicht bei allen Bürgern gut gelitten waren. Viele schienen zu fürchten, dass sie den Zorn Gottes über die Stadt bringen könnten, weil sie einem Großteil der Geistlichen als Ketzerinnen galten. War das der Grund, warum die Zauberin im Hof verschwunden war? Stimmte es, was man über die Beginen sagte? Froh über die breite Gasse, die sich zwischen ihm und dem Beginenhof befand, lehnte er sich mit dem Rücken gegen die dicke Mauer des Pfleghofes.
»He! Bursche!«
Micha zuckte zusammen, als einer der Zisterzienserbrüder auf ihn zukam.
»Warum drückst du dich hier herum?«, fragte der Mönch scharf. Er musterte Micha mit einer Mischung aus Argwohn und Herablassung.
»Ich …« Micha suchte nach einer Ausrede.
»Stellst du den Beginen nach?« Die Augen des Ordensbruders verengten sich.
»Nein!« Micha hob abwehrend die Hände. »Ein Almosen!« Er zeigte auf seine Bettelmarke.
Das Misstrauen verschwand aus dem Gesicht des Mönches. »Du bist ein Bettler«, stellte er fest.
Micha nickte.
»Geh zur Pforte!«, sagte der Zisterzienser. »Dort erhältst du ein Almosen.« Mit diesen Worten wandte er sich von Micha ab und verschwand durch eine Tür in der Mauer.
Nach einem letzten Blick zum Beginenhof beschloss Micha, das Angebot anzunehmen und sich danach zu seinem Unterschlupf aufzumachen. Vielleicht war es besser, wenn er die Zauberin vergaß und sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte. Wenn er nicht für alle Ewigkeit als Bettler leben wollte, musste er versuchen, eine Anstellung als Tagelöhner zu bekommen. Er setzte eine demütige Miene auf, ging zur Pforte und streckte bittend die Hand aus.
Kapitel 5
Die Kerzenlampe auf Jakob Ehingers Schreibtisch erlosch mit einem leisen Zischen. Er saß seit Stunden über den Steuerbüchern der Stadt, um die Steuereintreibung vorzubereiten, die am folgenden Tag beginnen würde. Seit man ihm das Amt eines Steuerherrn übertragen hatte, gehörte auch das zu seinen Aufgaben, die er von Tag zu Tag mehr verabscheute. Bestünde nicht die berechtigte Hoffnung, dass man ihn in naher Zukunft zum Kämmerer wählen würde, hätte er das Amt längst aufgegeben und sich um einen anderen Posten bemüht. Was auch immer er für seine Zukunft plante, er war auf Unterstützer angewiesen, die ihm ihre Stimme gaben, weshalb ihm die Steuereintreibung ungelegen kam. Zwar hatte sich die Feindseligkeit der Zunftmeister etwas gelegt, dennoch war er sicher, dass er sich mit der Eintreibung neue Feinde machen würde.
Sämtliche Bürger von Ulm waren durch Eid verpflichtet, die »Losunge« – die Vermögensabgabe an die Stadt – ehrlich und fristgerecht zu entrichten, was nicht immer reibungslos verlief, da sie sich selbst einschätzten. Oftmals kam es zu Unstimmigkeiten, die entweder vor Ort oder vor dem Rat geklärt werden mussten. Die Aufgabe der Eintreiber war es, die veranschlagten Beträge zur Stadtkasse zu bringen, wo alles ein weiteres Mal überprüft wurde. Die Eintreiber, die Jakobs Aufsicht unterstanden, folgten einem bestimmten Weg, der seit Jahrzehnten vorgeschrieben war. Dieser sah vor, dass sie sich zunächst innerhalb der Grenzen der ehemaligen Stauferstadt bewegten, von der Blau über den Lautenberg entlang des westlichen und nördlichen Münsterplatzes durch die Hafengasse und die Grünhofgasse bis zur Donau. Erst dann betraten sie den neueren Teil der Stadt und arbeiteten ihn von Westen nach Osten ab.
Die Strafen bei Säumnis waren der dritte Pfennig oder gar das »Duplum«, die Verdoppelung des Steuerbetrages; außerdem waren Ehrenstrafen möglich wie das öffentliche Verlesen des Namens des Steuerschuldners. Wer wiederholt nicht zahlte, dem wurde die Tür ausgehängt, bis die Forderung beglichen war. Vielfach wurden den Steuereintreibern Pfänder anstelle der Barzahlung übergeben, die – bei Nichteinlösung oder Unterdeckung der Schuld – dazu führten, dass die Schuldner vor Gericht landeten. Bei Steuerrückständen waren Abschläge oder mehrjährige Ratenzahlung möglich, doch meist verbesserte sich dadurch die Lage der Schuldner nicht. Wurden die Raten nicht rechtzeitig bezahlt, erhöhte sich der Steuersatz um bis zu fünfundzwanzig Prozent; wer den Endtermin nicht einhielt, dessen Gebrauchs- und Wertgegenstände wurden gepfändet. Mehrere Stadtknechte begleiteten die Steuereintreiber, um sie vor Angriffen zu schützen.
Jakob, für den es der erste Rundgang dieser Art war, hatte gehofft, als Steuerherr von der Pflicht befreit zu sein, doch der Rat hatte ihn eines Besseren belehrt. Seine Aufgabe war nicht nur das Einteilen der Eintreiber auf die entsprechenden Gassen und Straßen, er musste zudem dafür sorgen, dass der Rundgang vorschriftsgemäß durchgeführt wurde.
Mit einem Stöhnen rieb er sich die Augen, entzündete eine neue Kerze und lehnte sich erschöpft zurück. Im Haus war es seltsam still, nicht einmal von seiner anderthalbjährigen Tochter Maria war etwas zu hören. Vermutlich hatte seine Frau Ella sie längst ins Bett gebracht, um in Ruhe in der Stube ihre Näharbeiten zu erledigen. Sein Sohn Martin, der demnächst zwölf Jahre alt werden würde, kümmerte sich um die Waren, die an diesem Tag angeliefert worden waren. Dessen jüngerer Bruder Heinrich half ihm dabei, weil er Jakob beweisen wollte, dass auch er das Zeug zum Kaufmann hatte. Ursprünglich hatte Jakob vorgehabt, Heinrich bei einem anderen Handelsherrn in die Lehre zu geben, doch der Junge lag ihm jeden Tag in den Ohren, dass er nicht fortwollte.
»Bitte, Vater!«, hatte er erst an diesem Morgen wieder gedrängt. »Ich will lieber hierbleiben.«
»Du weißt, dass es Usus ist, den jüngeren Sohn außer Haus ausbilden zu lassen«, hatte Jakob entgegnet.
»Aber du sagst immer, es würde zu viel Arbeit geben!« Heinrich, dessen kindliche Unbeschwertheit sich in eine fast komische Ernsthaftigkeit verwandelt hatte, hatte ihn flehend angesehen.
Und Jakobs Herz war weich geworden. Warum sollte er einen fremden Lehrling zu sich holen, wenn er zwei Söhne hatte? Vielleicht konnte er Martin nach Venedig schicken und Heinrich in Ulm behalten, wenn beide ihre Lehre abgeschlossen hatten. Für ihn wurden die langen Reisen allmählich zu beschwerlich, seine Söhne hingegen brannten darauf, endlich die weite Welt kennenzulernen. Folglich hatte er nachgegeben und Heinrich versprochen, ihn ab dem Spätsommer zusammen mit Martin auszubilden.
»Ich helfe jetzt schon«, hatte Heinrich freudestrahlend versprochen und war in den Hof gelaufen, wo er überall im Weg herumstand.
Da die Einträge in den Steuerbüchern trotz der neuen Kerze vor Jakobs Augen verschwammen, erhob er sich von seinem Schreibtisch und reckte sich. Sein Rücken schmerzte vom langen Sitzen, sein Nacken und seine Schultern waren verspannt. Mit steifen Gliedern ging er zu einem der Bleiglasfenster, öffnete einen Flügel und atmete die laue Sommerluft ein. Draußen war es noch heller, als er gedacht hatte, die Sonne war noch ein gutes Stück vom Horizont entfernt.
Auf der Straße unter ihm balgten sich ein paar Kinder um etwas, was er nicht erkennen konnte, während eine Frau erfolglos versuchte, sie zur Ordnung zu rufen. In Augenblicken wie diesem schlich sich Wehmut in Jakobs Herz, da ihm sein Alter schmerzlich bewusst wurde. Manchmal kam es ihm vor, als wäre er erst gestern ein hoffnungsvoller junger Mann gewesen, der sich auf seine erste Handelsreise freute. Wo war nur die Zeit geblieben?