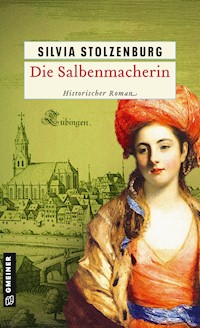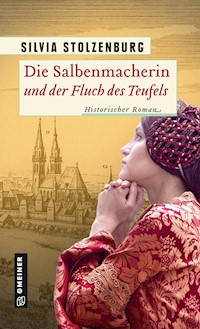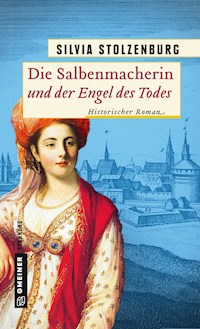
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Salbenmacherin
- Sprache: Deutsch
Nachdem die Salbenmacherin Olivera die Nachricht vom Tod ihrer Großmutter erhalten hat, versinkt sie in tiefer Trauer. Um Ablenkung zu finden, arbeitet sie noch mehr als sonst im Heilig-Geist-Spital. Als jedoch kurz hintereinander ein Greis und eine Wöchnerin versterben, erhebt der Spitalmeister schwere Anschuldigungen gegen sie. Auf Befehl des Rates wird sie verhaftet, doch auf dem Weg zum Gefängnis verhilft ihr der Henker zur Flucht. Allein, hochschwanger und schwer verletzt flieht Olivera aus der Stadt und schwebt in tödlicher Gefahr …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Stolzenburg
Die Salbenmacherin und der Engel des Todes
Historischer Roman
Zum Buch
Mord im Spital Als die Salbenmacherin Olivera erfährt, dass ihre Großmutter in Konstantinopel im Sterben liegt, wünscht sie sich nichts sehnlicher, als sie ein letztes Mal zu sehen. Wäre Olivera nicht im sechsten Monat schwanger, würde sie die gefährliche Reise nach Konstantinopel antreten. Um sich von ihrer tiefen Trauer abzulenken, arbeitet sie noch mehr als sonst im Heilig-Geist-Spital, wo vor allem die reichen Pfründner auf ihre Arzneien vertrauen. Als jedoch kurz hintereinander ein Greis und eine Wöchnerin versterben, die Olivera behandelt hat, erheben der Spitalmeister und der Medicus schwere Anschuldigungen gegen sie. Auf Befehl des Rates wird sie verhaftet und soll zum Verhör ins Loch gebracht werden. Auf dem Weg zum Gefängnis verhilft ihr jedoch der Henker Jacob zur Flucht. Allein, hochschwanger und durch einen Armbrustbolzen schwer verletzt, flieht Olivera aus der Stadt und schwebt in tödlicher Gefahr …
Dr. phil. Silvia Stolzenburg studierte Germanistik und Anglistik an der Universität Tübingen. Im Jahr 2006 promovierte sie dort über zeitgenössische Bestseller. Kurz darauf machte sie sich an die Arbeit an ihrem ersten historischen Roman. Sie ist hauptberufliche Autorin und lebt mit ihrem Mann auf der Schwäbischen Alb, fährt leidenschaftlich Mountainbike, gräbt in Museen und Archiven oder kraxelt auf steilen Burgfelsen herum – immer in der Hoffnung, etwas Spannendes zu entdecken.
Impressum
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München)
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mrs._Richard_Paul_Jodrell_by_Sir_Joshua_Reynolds.jpeg
und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuernberg-1650-Merian.jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppina_Grassini_by_Louise_Élisabeth_Vigée_Le_Brun_2.jpg
ISBN 978-3-8392-6004-3
Widmung
Für Effan – mein Juwel
Prolog
Nürnberg, September 1409
Die Nacht war so dunkel, dass man kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Nach der Hitze der letzten Wochen hatte es sich in den vergangenen Tagen etwas abgekühlt, weshalb die Gestalt fröstelnd die Arme um sich schlang. Ihr Umhang war alt und fadenscheinig, die Kapuze von Motten zerfressen. Eine schmale Mondsichel blitzte immer wieder zwischen den Wolken hervor, die vom Wind über den Himmel getrieben wurden. Der Geruch von feuchter Erde und den ersten toten Blättern lag in der Luft. In der Ferne, über den Zinnen der Burg, rief ein Nachtvogel.
Immer wieder sah sich die Gestalt um. Obwohl sie sich im Schatten der Häuser verborgen hielt, fürchtete sie, dass ein Nachtwächter sie entdecken könnte. Ihre Hand umklammerte ein langes Messer, mit dem sie sich gegen jeden Angreifer zur Wehr setzen konnte. Normalerweise war die Dunkelheit ihr Feind, doch in dieser Nacht bot sie Schutz.
Während ihr das Herz bis zum Hals schlug, schärften sich all ihre Sinne. Irgendwo jaulte ein streunender Hund, in einem der Häuser zu ihrer Linken fiel etwas mit einem lauten Scheppern zu Boden. Ein Schlag und ein Schrei folgten, dann herrschte Ruhe. Die Gestalt wartete einige Augenblicke, dann huschte sie weiter, bis sie eine hohe Mauer erreichte. Dort sah sie sich ein weiteres Mal um, ehe sie das Messer in den Gürtel steckte. Geschickt setzte sie einen Fuß auf einen kleinen Vorsprung und krallte die Finger in eine Lücke zwischen den Steinen. Es war nicht leicht, doch nach einigen Augenblicken der Anstrengung saß sie auf der Mauer und rang keuchend nach Atem. Ein Baum bot Schutz vor neugierigen Blicken. Das Seil, das um einen der Äste geschlungen war, wickelte die Gestalt ab, um sich daran in die Tiefe zu hangeln. Ein Sprung wäre zu waghalsig.
Der Hof, der vor ihr lag, war weitläufig und von einem gewaltigen Tor geschützt. Außer dem mehrstöckigen Wohnhaus gab es mehrere Wirtschaftsgebäude, Schuppen und ein langgezogenes Stallgebäude. Am Ende des Hofes lag ein riesiger Wachhund an einer Kette, schien jedoch zu schlafen. So leise wie möglich kletterte der Eindringling nach unten, horchte in die Finsternis und huschte an der Mauer entlang zum Wohnhaus.
Der Wachhund rührte sich nicht.
Während die Furcht sich immer tiefer in seiner Brust einnistete, schlich der nächtliche Besucher zur Eingangstür. Wie erwartet, war diese von innen verriegelt. Da die Fenster mit schweren Läden gesichert waren, machte er sich auf zur Rückseite des Hauses. Nach einigem Suchen fand er, wonach er Ausschau gehalten hatte. Mit zitternden Händen zog er an einem Eisenring, um eine Luke zu öffnen, durch die Feuerholz in den Keller geworfen werden konnte. Unten war es so dunkel, dass nicht einmal der Boden zu sehen war. Obwohl ihm das Herz bis zum Hals schlug, überlegte er nicht lange. Ohne darüber nachzudenken, was passieren würde, wenn man ihn erwischte, hangelte er sich am Rand der Luke in die Tiefe und ließ sich fallen.
Der Aufprall auf dem Boden entlockte ihm ein Keuchen. Ein Stechen fuhr ihm in den Knöchel, doch er ignorierte den Schmerz und versuchte, etwas in dem Kellerloch zu erkennen. Nur ein schwacher Streifen Mondlicht fiel durch die Luke herein. Vorsichtig tastete der Einbrecher sich zur Kellertür vor und zog sie behutsam auf. Außer seinem eigenen Atmen war nichts zu hören. Auf Zehenspitzen schlich er die schmale Treppe hinauf, bis er eine weitere Tür erreichte. Als er den großen Raum im Erdgeschoss betrat, schlug ihm augenblicklich ein Gemisch aus unterschiedlichen Gerüchen entgegen. Etwas Stechendes ließ ihn die Hand vor den Mund pressen, um nicht zu husten.
Als es plötzlich neben ihm krächzte, hätte er vor Schreck beinahe einen Schrei ausgestoßen. Dem Krächzen folgten ein Flattern und das Geräusch eines Schnabels, der an Holz knabberte.
Ein Vogel.
Vor Erleichterung schlug der Eindringling ein Kreuz vor der Brust und schalt sich einen Narren. Die Bewohner schliefen. Er hatte nichts zu befürchten. Er wollte sich gerade auf den Weg zu dem angrenzenden Raum machen, als im Stockwerk über ihm die Dielen knarrten. Sein Herzschlag raste. Während sich all seine Muskeln spannten, zog er erneut den Dolch und kauerte sich hinter einen langen Verkaufstisch.
Kapitel 1
Nürnberg, September 1409
So leise wie möglich schloss Olivera die Tür der Schlafkammer hinter sich. Auf keinen Fall wollte sie Götz wecken, da sie ihn schon die letzten Nächte mit ihrem Weinen vom Schlafen abgehalten hatte. Noch immer fühlten sich ihr Herz und ihre Seele so wund an, als ob sie nie wieder glücklich sein könnte. Daran konnten weder Götz’ tröstende Worte noch das Kind in ihrem Leib etwas ändern. Seit sie der Brief ihrerGroßmutter aus Konstantinopel erreicht hatte, schien die Trauer sie jeden Tag ein wenig mehr in einen Abgrund zu ziehen.
Mit ausgestreckten Armen tastete sie sich durch den dunklen Korridor zur Stube, wo sie an der noch nicht erloschenen Glut des Kaminofens einen Kienspan entzündete. Diesen hielt sie an den Docht einer dicken Kerze, deren Flamme kurz darauf den Raum erhellte.
Der Brief ihrer Yiayia lag in einem silberbeschlagenen Kästchen auf einem Tisch beim Fenster. Der Kerzenschein malte gespenstische Schatten auf den bunt gefliesten Boden, als Olivera den Deckel aufschlug, das Papier glattstrich und sich auf einen Schemel setzte. Drei Wochen war es her, dass sie den Brief erhalten hatte, und noch immer wollte sie nicht glauben, was darin stand. Obwohl Tränen in ihren Augen schwammen, las sie die Worte ihrer Großmutter zum wohl hundertsten Mal.
Mein liebes Kind,
lange habe ich die Antwort auf Deinen Brief hinausgezögert, in der Hoffnung, Dir bessere Nachrichten zukommen zu lassen. Doch jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit. Es hat mir beinahe das Herz gebrochen, Deine Zeilen zu lesen, zu erfahren, dass Dein Gatte verstorben ist. Wie sehr ich gehofft hatte, Dich bei einer seiner nächsten Reisen zu uns wiederzusehen und in die Arme zu schließen.
Deinen Vater hat die Nachricht von seinem Tod ebenfalls sehr betrübt, er hat sich tagelang gegrämt.
Olivera ließ den Brief sinken, um einige Augenblicke ins Leere zu starren. Offensichtlich hatte ihre Großmutter nicht die geringste Ahnung davon gehabt, dass ihr Vater und Laurenz, Oliveras erster Gemahl, einen furchtbaren Handel betrieben hatten. Lange hatte Olivera sich gefragt, ob ihre Yiayia gewusst haben konnte, dass die beiden nicht nur gefälschte Reliquien verkauft, sondern Menschen getötet hatten, um diese angeblichen Reliquien herzustellen. Doch die Worte ihrer Großmutter bestätigten, dass sie genauso unwissend gewesen war wie Olivera. Sie schlang schaudernd die Arme um sich, als die Erinnerungen an Laurenz zurückkehrten. Wäre es ihr nicht gelungen, ihm zu entkommen, hätte er auch sie umgebracht. Ihre Hand wanderte zu ihrem Bauch, als sie an die entsetzlichen Stunden dachte, in denen sie um ihr eigenes Leben und das ihres Kindes gebangt hatte. Wäre Götz nicht gewesen … Sie schob die schreckliche Erinnerung beiseite und nahm den Brief wieder auf, dessen Schrift mit jedem Satz unleserlicher wurde. Es war deutlich zu sehen, dass das Schreiben ihre Großmutter viel Kraft gekostet hatte.
Ich hoffe so sehr, dass Du in der Fremde dennoch Dein Glück findest. Seit Du nicht mehr in Konstantinopel bist, scheinen die Tage mühsamer und die Nächte länger zu werden. Jeden Tag bete ich zu Gott, damit er Dich behütet und Sein Angesicht leuchten lässt über Dir.
Du schreibst, dass Du ein Kind erwartest und dass Dein neuer Gemahl ein guter Mann ist. Vergiss nicht, was ich Dich gelehrt habe, damit weder Dir noch Deinem Kind bei der Niederkunft etwas zustößt.
Wenn Dich dieser Brief erreicht, werde ich vermutlich nicht mehr auf Gottes Erdboden sein. Ein Krebs hat sich in mir eingenistet, der mir mehr und mehr Kraft raubt. Trotz all des Wissens und all der Arzneien bin ich dagegen machtlos. Es ist Gottes Wille, den ich nicht infrage stellen darf.
Die Zeit, die mir noch bleibt, verbringe ich in Gedanken bei Dir in der Fremde. Ich sitze oft am Fenster und sehe aufs Meer hinab, stelle mir vor, dass die Wellen meine guten Wünsche zu Dir tragen.
Ich liebe Dich, mein Kind, Du warst wie eine Tochter für mich und ich denke oft an den Tag zurück, an dem Du uns verlassen hast.
Gottes Wege sind unergründlich, was auch immer geschehen mag, Du darfst niemals aufhören, an Seine Gnade zu glauben.
Leb wohl, nimm meinen Segen und werde glücklich.
Yiayia.
Die Trauer machte Olivera die Kehle eng. Weinend ließ sie den Brief in ihren Schoß fallen und vergrub das Gesicht in den Händen. Ihre Großmutter war das Wichtigste für sie gewesen, bis Laurenz in ihr Leben getreten war und ihr das Herz gestohlen hatte. Wäre sie ihm nicht in die Fremde gefolgt, hätte sie ihrer Yiayia in der letzten Stunde beistehen können. Tränen tropften auf den Brief und verwischten die Worte. Mit einem Schluchzen legte Olivera ihn auf den Tisch und ließ sich von Schuld und Trauer davontragen.
Sie wusste nicht, wie lange sie so dagesessen hatte, bis die Tränen schließlich versiegten. Das Kind in ihrem Leib schien den Aufruhr ihrer Gefühle zu spüren, da es sich mit einem Tritt bemerkbar machte. Instinktiv legte sie erneut die Hand auf ihren Bauch. Ihr Herz zog sich zusammen, als ihr klar wurde, dass sie Götz niemals kennengelernt hätte, wenn sie seinem Bruder Laurenz nicht gefolgt wäre. Ihre Yiayia hatte ihr vergeben, wollte, dass sie glücklich wurde. Anstatt sie mit bodenloser Trauer zu erfüllen, sollten ihre Worte Olivera Trost spenden. Sie wischte sich die Augen und faltete den Brief mit zitternden Fingern zusammen. Warum hatte sie ihre Yiayia nicht mitgenommen?
Weil sie ihre Heimat niemals verlassen hätte, beantwortete sie sich die Frage selbst. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus. Ihre Großmutter war eine starke und gebildete Frau gewesen. Von ihr hatte Olivera all ihr Wissen über Arzneien und Heilkräuter erworben. Allerdings war ihre Yiayia stets der Ansicht gewesen, dass Oliveras Platz nicht an der Seite eines Fremden sein sollte.
Sie stand auf, um den Brief zurück in das Kästchen zu legen. Als sie ihn vor drei Wochen erhalten hatte, war ihre Welt zusammengebrochen. Blind vor Trauer hatte sie ein Reisebündel packen wollen, um sich auf den Weg nach Konstantinopel zu machen. Allerdings hatte Götz sie davon abgehalten.
»Du bist schwanger!«, hatte er versucht, sie zur Vernunft zu bringen. »Du weißt, wie mühsam und gefährlich eine solche Reise ist.«
»Das ist mir gleichgültig!«, war Olivera aufgebraust. »Meine Yiayia liegt im Sterben!«
»Olivera.« Götz hatte sie sanft bei den Schultern gefasst und ihr in die Augen gesehen. »Deine Großmutter würde sicher nicht wollen, dass du dein Leben aufs Spiel setzt.«
»Woher willst du wissen, was meine Yiayia will?« Olivera hatte versucht, sich von ihm loszumachen, aber er hatte sie festgehalten. »Ich … Sie …« Die Trauer hatte ihr die Kehle zugeschnürt.
»Du hast sie nicht im Stich gelassen«, hatte Götz ausgesprochen, was an Olivera nagte.
An diese Auseinandersetzung erinnerte sich Olivera, als sie den Deckel des Kästchens wieder schloss. Sie wusste, dass Götz recht hatte. Es wäre Wahnsinn gewesen, sich in ihrem Zustand auf den Weg nach Konstantinopel zu machen. Sie war hochschwanger, in wenigen Wochen würde ihr Kind zur Welt kommen. Dennoch fühlte sich ihr Herz so schwer an, als ob ein Gebirge auf ihm lastete. Obwohl es warm war in der Stube, fröstelte sie. Wenn sie nicht ihre und die Gesundheit des Kindes gefährden wollte, musste sie aufhören, sich zu martern. Jeden Tag fiel es ihr schwerer, ihre Arbeit zu verrichten, da sie nur wenig Schlaf fand. Ihre Yiayia würde gewiss nicht wollen, dass sie vor lauter Gram ihr Kind verlor. Sie hatte ihren Segen geschickt. Dieser Gedanke gab ihr ein wenig Kraft, drängte die Ängste zurück, die sie beinahe genauso plagten wie die Trauer. Sie war in guten Händen. Eine Hebamme würde ihr bei der Geburt helfen, Tränke aus weißem Helleborus und Wermut zur Beschleunigung der Wehen standen in der Salbenküche bereit. IhrKind würde keine Totgeburt, ihrUnterleib nicht zerfetzt werden. Siewürde nicht an den Folgen des Kindbetts sterben.
Sie beschloss, zurück in die Schlafkammer zu gehen, um wenigstens noch ein bisschen Ruhe zu finden. Am nächsten Tag wartete reichlich Arbeit auf sie, da im Heilig-Geist-Spital ein heftiger Durchfall grassierte. Wenn sie nicht schlief, würde die Erschöpfung sie spätestens am Nachmittag einholen. Und da der Medicus sich auffällig oft in ihrer Nähe herumdrückte, wollte sie keine Anzeichen von Schwäche zeigen.
Sie nahm die Kerze in die Hand, öffnete die Stubentür und erstarrte, als sie ein Geräusch aus dem Erdgeschoss vernahm. War jemand in der Offizin, der Salbenküche? Sie legte den Kopf schief, um besser hören zu können. Deutlich drang das Klappern von Tongefäßen an ihr Ohr. Ihr Puls machte einen Satz. Ein Blick über die Schulter verriet ihr, dass die Tür der Schlafkammer geschlossen war, es sich nicht um Götz handeln konnte. Sie umklammerte die Kerze fester. Hatte sich ein Einbrecher ins Haus geschlichen? Plötzlich flammte Wut in ihr auf. Sie ging zurück in die Stube, griff nach einem schweren Schürhaken und wog ihn in der Hand. Das Wertvollste im Haus waren ihre Arzneien und die Bücher, die ihre Yiayia ihr als Mitgift mit auf den Weg gegeben hatte. Sollte sich wirklich ein Herumtreiber ins Haus geschlichen haben … Die Wut verstärkte sich. Sie hatte schon ihre Großmutter verloren. Das Wenige, was ihr als Andenken an sie blieb, würde sie nicht auch noch verlieren!
Kapitel 2
Nürnberg, September 1409
Der Eindringling schnürte seinen Sack zu, löschte das Talglicht, das er mit Funkeneisen, Feuerstein und Zunder entzündet hatte, und machte sich auf den Weg zum Ausgang. Er hatte alles, was er finden konnte, in den Beutel gestopft, auch das, wofür man ihn bezahlte. Die anderen Dinge würde er verkaufen, um sich einen warmen Mantel für den kommenden Winter leisten zu können. Die Versuchung, noch mehr einzupacken, war groß gewesen. Allerdings musste er das Diebesgut ein ganzes Stück weit tragen. Er hatte die verriegelte Haustür fast erreicht, als über ihm erneut Dielen knarrten. Obwohl beim ersten Mal niemand die Treppe hinabgekommen war, zückte er auch jetzt seinen Dolch. Aus dem Augenwinkel sah er einen Lichtschein auf den Stufen tanzen.
Einen Augenblick lang verharrte er wie festgenagelt auf der Stelle. Doch als sich der Lichtschein auf ihn zubewegte, huschte er zum Verkaufstresen, verbarg sich hinter einem Fass und hielt die Luft an. Die Hand mit dem Dolch zitterte. Obwohl er schon viele schlimme Dinge getan hatte, hatte er noch nie einen Menschen getötet. Allerdings war ihm klar, dass ihm kein anderer Ausweg bleiben würde, sollte man ihn entdecken. Er rang die Übelkeit nieder, die in ihm aufsteigen wollte. Still, schärfte er sich ein. Dann kam er vielleicht ungesehen davon. Er machte sich noch kleiner und lauschte auf die zögerlichen Schritte.
»Ist hier jemand?«, zischte es.
Der Eindringling wagte nicht zu atmen. Nur einLaut und seine Seele gehörte für immer dem Teufel.
Die Schritte näherten sich seinem Versteck, dann hielten sie inne. »Jonata, bist du das?«, fragte eine Frauenstimme. Der Lichtschein flackerte, dann entfernte er sich in Richtung Salbenküche.
Der Einbrecher ließ leise den angehaltenen Atem aus der Lunge entweichen. Da er fürchtete, dass die Frau bald zurückkommen würde, schielte er vorsichtig hinter dem Tresen hervor. Der Schein ihrer Kerze warf zuckende Schatten. Sie stand vor einem der Regale, das er geplündert hatte, und griff nach einem großen Tontopf. Wenn er ganz leise war … Er kroch hinter dem Tresen hervor, schulterte den Sack und huschte zur Tür. Nachdem er ein Stoßgebet zum Himmel gesandt hatte, dass die Scharniere geölt waren, hob er den Riegel aus seiner Halterung und drückte die Tür einen Spaltbreit auf. Mit einem letzten Blick versicherte er sich, dass die Frau noch in der Salbenküche war, ehe er sich durch den Spalt ins Freie zwängte.
*
Der elfjährige Jona warf mit einer stillen Verwünschung die Decke zurück und kam schlaftrunken auf die Beine. Seit beinahe einer Stunde drehte er sich von einer Seite auf die andere und versuchte, wieder einzuschlafen. Allerdings wurde der Druck auf seine Blase immer größer, weshalb ihm nichts anderes übrigblieb, als dem Drang nachzugeben. Um den Knecht Mathes, der ebenfalls in dem Schuppen schlief, nicht zu wecken, schlich er auf Zehenspitzen zur Leiter und kletterte vom Heuboden. Dann eilte er zur Tür und trat hinaus ins Freie. Das kleine »Scheißhäuslein« stand zwischen Hühnerstall und Kräutergarten, am anderen Ende des Hofes. So schnell er konnte, erledigte Jona seine Notdurft, umrundete den Wachhund in einem weiten Bogen und machte sich auf den Weg zurück zum Schuppen. Er hatte gerade einen der vor den Ställen abgestellten Karren erreicht, als er aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm.
Was war das?
Er kniff die Augen zusammen, um in der Dunkelheit besser sehen zu können. Obwohl sich eine Wolke vor die schmale Mondsichel geschoben hatte, erkannte er eine Gestalt, die vom Haus aus in Richtung Mauer eilte. Sie trug einen Sack und einen Umhang mit Kapuze. Immer wieder sah sie sich um, als fürchte sie, verfolgt zu werden.
Augenblicklich regte sich Misstrauen in Jona. Wer schlich nachts heimlich über den Hof? Olivera, Götz und seine beiden Kinder Uli und Cristin schliefen im Haus. Die Magd Jonata und Irmla, die Köchin, ebenfalls. Mathes hatte lauthals geschnarcht, als Jona den Schuppen verlassen hatte. Wer also war der Kerl, der soeben vom Schatten der Mauer verschluckt wurde? Ein Einbrecher? Jona verspürte einen Stich der Aufregung. Ohne darüber nachzudenken, in welche Gefahr er sich vielleicht begab, duckte er sich und heftete sich an die Fersen der Gestalt. Verwundert stellte er schon nach wenigen Schritten fest, dass der Eindringling auf seinen Baum zurannte; den Baum, an dem Jona ein Seil befestigt hatte, um besser über die Mauer klettern zu können. Obwohl er es schon längst entfernen wollte, hatte er es immer wieder vor sich hergeschoben – vermutlich aus Angst, dass Götz oder Mathes ihn dabei erwischen könnten. Wenn die beiden dachten, dass er sich wieder heimlich vom Hof stehlen wollte, würde er nicht nur mit einer Tracht Prügel davonkommen. In dieser Hinsicht war Götz deutlich gewesen. Wenn er Jona noch einmal dabei ertappte, wie er etwas Unerlaubtes tat, würde er ihn aus dem Haus jagen.
Jona versuchte, nicht an die letzte Standpauke zu denken. Stattdessen beschleunigte er die Schritte und griff nach dem Umhang des Eindringlings, als dieser sich an dem Seil in die Höhe ziehen wollte. »He! Was soll das? Wer bist du?«, zischte er.
Der Kerl mit dem Umhang verlor das Gleichgewicht und fiel hintenüber auf seinen Allerwertesten. Dabei rutschte ihm die Kapuze vom Kopf.
Jona stieß ein Keuchen aus. »Casper?«
»Scheiße!«, schimpfte der andere. »Hau ab! Lass mich in Ruhe!«
»Spinnst du? Was tust du hier? Warum hast du dich in den Hof geschlichen?« Jonas Blick fiel auf den Sack. »Hast du etwas gestohlen?«
Casper rappelte sich auf und griff nach dem Sack, der ihm entglitten war. »Halt bloß die Klappe!«, fauchte er. Er machte Anstalten, erneut nach dem Seil zu greifen.
»Was ist in dem Sack?«, wollte Jona wissen.
»Nichts«, war die trotzige Antwort.
»Das glaube ich dir nicht.« Jona streckte die Hand nach dem Sack aus. Doch ehe er ihn zu fassen bekam, versetzte Casper ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Getroffen taumelte Jona nach hinten. Einige Augenblicke lang tanzten bunte Sterne vor seinen Augen. Als sich die Benommenheit wieder legte, hatte Casper schon fast die Mauerkrone erreicht. Während Wut in Jona aufflammte, griff er nach dem Seilende und hangelte sich ebenfalls nach oben.
»Verdammt!«, fluchte Casper, als Jona sein Bein fasste. »Lass mich los!«
Jona dachte nicht daran. Was auch immer Casper im Hof zu suchen gehabt hatte, er würde es herausfinden. Nach dem Verschwinden des Freundes hatten Schuldgefühle an ihm genagt, weil er Caspers Versteck an die Stadtwachen verraten hatte. Allerdings war er inzwischen zu der Erkenntnis gelangt, dass Casper selbst die Schuld an seiner Lage trug. Wäre er wie Jona zurück zu dem Mann gegangen, der ihm ein Dach über dem Kopf gegeben hatte, müsste er nicht wieder als Bettler auf der Straße leben. Jona hatte die Prügel für das nächtliche Umherstreunen eingesteckt. Wäre Casper nicht so ein Feigling, hätte er sich ebenfalls der Strafe für seinen Ungehorsam gestellt.
»Komm runter!«, keuchte er, packte Caspers Bein am Knöchel und zog heftig daran.
Der Freund verlor mit einer gotteslästerlichen Verwünschung den Halt.
Jona ließ das Seil los und sprang zu Boden.
»Du Verräter!«, fauchte Casper. Er rappelte sich auf, ballte die Fäuste und schlug erneut nach Jonas Gesicht.
Der wich jedoch aus und parierte den Hieb. »Hör auf damit!«
»Pffffff.« Casper bückte sich, griff in den Dreck am Boden und schleuderte ihn Jona ins Gesicht. Dann versetzte er ihm einen heftigen Schlag in die Magengrube.
Jona sackte mit einem Stöhnen zusammen. Während er gegen die aufsteigende Übelkeit ankämpfte, hörte er, wie Casper sich aus dem Staub machte.
Kapitel 3
Nürnberg, September 1409
Fassungslos starrte Olivera auf das Durcheinander in der Offizin. Sie hatte die Kerze auf einem der Tische abgestellt und ging in die Knie, um einen Tontopf aufzuheben. Der Inhalt – teurer Kyphi, ein Mittel gegen Fieber, das sie aus Konstantinopel mitgebracht hatte – schien unangetastet zu sein. Mehrere andere Gefäße waren ebenfalls geöffnet worden, doch auf den ersten Blick konnte Olivera nicht erkennen, ob etwas gestohlen worden war. Der Eindringling hatte es offensichtlich eilig gehabt. Nahe der Feuerstelle lagen einige Kupfertöpfe auf dem Boden, außerdem war der Block mit Oliveras Messern bewegt worden. Eines davon fehlte. Olivera schüttelte ärgerlich den Kopf, umfasste den Schürhaken fester und nahm die Kerze wieder vom Tisch.
Der Eindringling konnte noch nicht weit gekommen sein. Obwohl ihr Verstand ihr sagte, dass es klüger wäre, Götz oder Mathes zu wecken, ging sie zur Haustür und trat in den Hof hinaus. In der Stille der Nacht vernahm sie die Geräusche eines Kampfes.
»Du Verräter!«, zischte jemand.
»Hör auf damit!«
Ein Hieb und ein Stöhnen folgten, dann hörte Olivera Schritte. Ohne zu zögern, hob sie den Schürhaken und lief in die Richtung, aus der die Geräusche gekommen waren. Im schwachen Licht des Mondes sah sie eine Gestalt am Boden kauern. Eine andere erklomm die Mauer, schwang sich darüber und verschwand im Dunkeln. Ehe sich die zusammengesackte Gestalt aufrappeln und ebenfalls fliehen konnte, war Olivera bei ihr. »Keine Bewegung«, warnte sie und schwang drohend den Schürhaken.
»Was geht hier vor sich?«, dröhnte eine tiefe Stimme.
Aus dem Augenwinkel sah Olivera, wie sich die Tür des Schuppens bewegte.
Mathes trat in den Hof, bewaffnet mit einem Knüppel und einer Mistgabel.
»Dieser Kerl ist in die Salbenküche eingebrochen«, sagte Olivera. Sie bohrte der Gestalt am Boden den Schürhaken in den Rücken. »Steh auf!«
»Nein.« Der Protest war schwach, gefolgt von einem Keuchen. »Ich bin es. Jona.«
Olivera ließ den Schürhaken sinken. »Jona?«
Mathes, der sie inzwischen erreicht hatte, packte den Knaben beim Kragen und zog ihn grob auf die Beine. »Was hast du mitten in der Nacht hier draußen zu suchen?« Als Jona nicht sofort antwortete, hob er die Hand und versetzte ihm eine schallende Ohrfeige. »Die letzte Tracht Prügel hat dich wohl nichts gelehrt?«
»Ich …«, stammelte Jona.
»Wer war das?« Olivera zeigte mit dem Kinn auf die Mauer, von der ein Seil herabhing.
»Ich weiß es nicht«, gab Jona gepresst zurück. Er hielt sich mit einer Hand die Wange, mit der anderen den Bauch. »Ich musste austreten. Da habe ich ihn gesehen.«
»Lüg uns nicht an!«, herrschte Mathes ihn an.
»Ich lüge nicht!«
Olivera ließ den Schürhaken sinken. Im Licht der Kerze sah sie, dass Jonas Lippe aufgeplatzt war. Offenbar hatte er mit dem Eindringling gekämpft. »Ich glaube, er sagt die Wahrheit.«
Mathes schnaubte. »Soll ich sichergehen, dass er nicht lügt?«
Jona zog den Kopf ein.
»Nein.« Olivera fasste dem Jungen unters Kinn und zwang ihn, sie anzusehen. Seine Nase blutete ebenfalls. »Komm mit ins Haus«, sagte sie. »Die Blutung muss gestillt werden.«
»Wie sah der Kerl aus?«, wollte Mathes wissen.
»Er hatte eine Kapuze auf. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen.« Jona zuckte zusammen, als Olivera nach seiner Nase griff, um sie vorsichtig zu bewegen.
»Sie ist nicht gebrochen. Du hast Glück gehabt«, stellte sie fest. An Mathes gewandt, sagte sie: »Lauf zum Tor und sieh nach, ob du noch eine Spur von dem Einbrecher entdeckst.«
Einen Augenblick lang sah es so aus, als ob Mathes widersprechen wollte. Doch dann lehnte er die Mistgabel an die Mauer und machte sich, nur mit dem Knüppel bewaffnet, auf zum Tor.
»Komm«, forderte Olivera Jona auf. Sie glaubte dem Jungen, auch wenn er sich seltsam verhielt. Vermutlich hatte er Angst, dass Götz ihn doch noch vom Hof jagte. Sie fasste ihn beim Arm und zog ihn aufs Haus zu. Drinnen wurden sie von Kerzenschein und Götz’ besorgtem Gesicht empfangen.
»Warum steht mitten in der Nacht die Tür auf?«, wollte er wissen. Sein Blick wanderte von Olivera zu Jona. »Wieso seid ihr alle auf den Beinen?«
Olivera erklärte ihm, was vorgefallen war.
Eine steile Falte grub sich zwischen Götz’ Brauen. Er musterte Jona mit einer Mischung aus Strenge und Misstrauen. »Und du hast sein Gesicht nicht erkennen können?«
»Es war zu dunkel«, verteidigte sich Jona. Er zog die Luft durch die Zähne, als Olivera ihn auf einen Schemel drückte und erneut seine Nase betastete.
»Ohne Licht sieht man wirklich kaum die Hand vor Augen«, sprang Olivera ihm bei.
»Und rein zufällig musstest du austreten?« Götz klang immer noch argwöhnisch.
Jona nickte.
»Halt still!« Olivera untersuchte die Platzwunde an Jonas Lippe. Dann bat sie Götz, Feuer zu machen, kochte Wasser und übergoss frische Schafgarbenblätter und ein Pulver aus getrockneter Schafgarbe damit. Sie tränkte ein Stück Stoff und drückte es auf Jonas Gesicht. »Halt es fest, bis das Tuch ausgekühlt ist«, sagte sie. Anschließend machte sie einen Tee aus der Heilpflanze, den Jona trank, sobald Olivera ihm den Verband wieder abnahm. »Jetzt geh ins Bett.« Sie scheuchte Jona aus der Salbenküche und ließ sich mit einem Seufzer auf einen Schemel sinken.
Götz, der in der Zwischenzeit aufgeräumt hatte, setzte sich neben sie. »Wie ist der Einbrecher überhaupt ins Haus gekommen?«, wollte er wissen.
Daran hatte Olivera noch gar nicht gedacht. Anstatt zu antworten, stellte sie die Frage, die ihr durch den Kopf ging. »Denkst du, der Medicus hat etwas damit zu tun?«
Götz runzelte die Stirn. »Ich kann mir nicht vorstellen, was er sich davon versprechen sollte. Was hätte er davon?«
»Er könnte unsere Arzneien stehlen«, gab Olivera zurück. »Dann wäre es ein Leichtes zu behaupten, wir wären nicht zuverlässig. So könnte er vielleicht den Rat doch noch davon überzeugen, dass das Spital eine eigene Apotheke benötigt.«
Götz schüttelte den Kopf. »Das macht keinen Sinn. Er selbst würde wohl kaum das Risiko auf sich nehmen, hier einzubrechen. Und woher sollte ein Handlanger wissen, was er stehlen soll?«
Das leuchtete Olivera ein. Das Durcheinander in der Offizin deutete darauf hin, dass es sich nicht um einen gezielten Einbruch gehandelt hatte. Tontöpfe und Gläser waren scheinbar willkürlich geöffnet, Säcke durchwühlt worden. Vermutlich hatte der Eindringling nach Geld gesucht.
»Warum hat der Wachhund nicht angeschlagen?«, fragte Götz ärgerlich. »Wozu haben wir den Köter?«
»Sollen wir die Wache rufen?« Olivera kam mühsam auf die Beine. Ihr Bauch schien mit jedem Tag schwerer zu werden.
Götz überlegte einen Moment. »Nein. Wenn Jona den Kerl nicht gesehen hat …« Er schob die Brauen zusammen. »Glaubst du ihm? Der Bengel hat uns schon so oft angelogen …«
»Ich denke, er sagt die Wahrheit«, gab Olivera zurück. »Der Einbrecher hat ihn ziemlich übel zugerichtet.«
Götz holte tief Luft und ließ den Atem hörbar durch die Nase entweichen. »Geh ins Bett«, sagte er schließlich. »Ich versuche herauszufinden, wie der Dieb ins Haus gelangt ist.«
»Kann das nicht bis morgen früh warten?«, fragte Olivera. »Mathes sucht nach ihm.« Plötzlich sehnte sie sich nach etwas Ruhe. Die Nacht hatte sie beinahe mehr erschöpft als die Arbeit im Heilig-Geist-Spital. Die Angst vor der Niederkunft, die Trauer um ihre Yiayia, die nagenden Schuldgefühle … Und jetzt das. Sie griff nach Götz’ Hand und sah ihm bittend in die Augen. »Lass uns versuchen, noch etwas zu schlafen«, schlug sie vor.
Zuerst sah es so aus, als ob Götz widersprechen wollte. Doch dann stieß er einen Seufzer aus, nickte und fasste sie bei der Hand. »Du hast recht«, sagte er mit einem Blick auf ihren Bauch. »Du brauchst Ruhe. Ich bin gleich bei dir. Ich rede nur kurz mit Mathes.« Damit schob er sie auf die Treppe zu und verschwand ins Freie.
Kapitel 4
Nürnberg, September 1409
Am nächsten Morgen vermied Jona es, Mathes in die Augen zu blicken. In der Nacht hatte er sich schlafend gestellt, als der Knecht schließlich in den Schuppen zurückgekommen war. Und jetzt, im hellen Licht des Tages, fürchtete er, dass man ihm die Lügen ansehen würde. Obwohl er vorgegeben hatte, nicht zu hören, wie Mathes die Leiter erklomm, hatte er den Rest der Nacht wachgelegen, um über das Zusammentreffen mit Casper nachzudenken. All die Zeit seit Caspers Verschwinden hatte Jona sich gefragt, was aus dem Freund geworden war, ob er Nürnberg verlassen hatte. Mehrmals war er zu dem von den Stadtwachen vernagelten Unterschlupf geschlichen, um nachzusehen, ob Casper sich vielleicht wieder dort verbarg. Allerdings hatten die Wächter ganze Arbeit geleistet. Das halb verfallene Haus war unzugänglich, von Casper weit und breit keine Spur zu entdecken.
Mit einem Stöhnen schlüpfte Jona in Hose und Kittel, zog seine Schuhe an und zupfte sich das Stroh aus den Haaren. Sein Gesicht schmerzte. Er tastete vorsichtig mit der Zunge nach einem Zahn, der ein wenig wackelte. Casper hatte fester zugeschlagen, als Jona es ihm zugetraut hätte. Er schauderte, als er sich an das wutverzerrte Gesicht des Freundes erinnerte. Was war nur mit Casper geschehen? Wie konnte er so dumm sein, sich wieder auf ein Leben als Dieb einzulassen? Früher oder später würden die Stadtwachen ihn verhaften und er würde entweder im Loch oder auf dem Richtplatz enden.
»Trödel nicht so herum!«, herrschte Mathes ihn an.
Jona zog den Kopf ein, als Mathes sich vor ihm aufbaute. Seit einigen Wochen schien alle Freundlichkeit von dem hünenhaften Knecht abgefallen zu sein. Er beobachtete Jona stets mit Argusaugen und war schnell mit einer Maulschelle oder einem Hieb mit dem Gürtel zur Hand. Sein Misstrauen stand ihm auch an diesem Morgen deutlich ins Gesicht geschrieben.
»Ich trödle nicht«, murmelte Jona.
Mathes schnaubte. Er schob den Jungen beiseite und fing an, dessen Schlaflager zu durchsuchen.
»Was tust du?«, fragte Jona, obwohl er ahnte, was Mathes antrieb.
Der Knecht ignorierte die Frage, stocherte im Stroh und schüttelte die Decken aus. Als er nichts fand, richtete er sich wieder auf und musterte Jona mit zusammengekniffenen Augen. »Dem Herrn kannst du vielleicht einen Bären aufbinden«, knurrte er. »Aber mir nicht. Wo sind die Sachen?«
Jona wich einen Schritt zurück, als Mathes drohend auf ihn zutrat. »Du denkst, ich war der Einbrecher?«
Mathes’ Mundwinkel zuckten verächtlich. »Wer sonst? Ich habe niemanden auf der Straße gesehen. Und das«, er zeigte auf Jonas Gesicht, »kannst du dir selbst zugefügt haben.«
Jona sah ihn fassungslos an. »Aber warum sollte ich so etwas tun?«
»Weil du ein nichtsnutziger Bengel bist«, brummte Mathes. Einen Augenblick sah es so aus, als ob er Jona am Kragen packen wollte, doch dann ließ er die Hände sinken. »Ich habe ein Auge auf dich«, drohte er. »Glaub nicht, dass du damit durchkommst.« Mit diesen Worten ließ er Jona stehen und kletterte die Leiter vom Heuboden hinab.
Jona folgte ihm mit einem flauen Gefühl im Magen. Wenn Mathes ihn verdächtigte, hegte Götz vielleicht dieselbe Vermutung. Wie konnte er die beiden davon überzeugen, dass er unschuldig war, ohne Casper zu verraten? Warum schützte er den Freund überhaupt? War Casper noch ein Freund? Jona verzog das Gesicht und folgte Mathes, da sein Magen vor Hunger knurrte.
In der Stube warteten bereits die sechsjährige Cristin, der dreijährige Uli und die Kindermagd Jonata auf sie. Auf dem Tisch standen Schüsseln mit dampfendem Haferbrei, mehrere Teller mit Äpfeln und ein Topf Honig. Olivera und Götz betraten kurz nach Jona und Mathes die Stube, dann trug die Köchin einen Krug warme Milch und verdünntes Bier auf.
»Was ist mit deinem Gesicht passiert?«, wollte Cristin wissen. Ihre dunklen Locken standen wie immer wild von ihrem Kopf ab. Ihr kurzärmeliges Hemdkleid wies an einigen Stellen Flecken auf, die vom Herumtollen stammten.
»Er ist hingefallen«, mischte sich Götz ein, ehe Jona antworten konnte.
»Oh.« Cristin riss den Mund auf. »Hat es wehgetan?«
»Ein bisschen«, murmelte Jona und steckte hastig einen Löffel voller Brei in den Mund. Es war ihm unangenehm, dass sich plötzlich aller Augen auf ihn hefteten, da er nicht wusste, was er sagen sollte. Zu seiner Erleichterung mieden die anderen das Thema, vermutlich, um den Kindern keine Angst zu machen.
Sobald Jonata die beiden aus der Stube gebracht hatte, sagte Götz jedoch: »Ich finde, wir sollten doch die Wache informieren.«
Jona verschluckte sich fast an dem Brei.
Olivera zog die Brauen hoch. »Ich dachte, du wolltest nicht zur Wache gehen.«
»Ich habe es mir anders überlegt.« Götz bedachte Jona mit einem harten Blick. »Auch wenn du den Einbrecher nicht deutlich gesehen hast, wirst du ihn den Wächtern beschreiben. Vielleicht helfen dir ihre Fragen, dich besser zu erinnern«, setzte er hinzu.
Jona rutschte das Herz in die Hose. Wollte Götz ihn verhören lassen? Vielleicht sogar foltern? Er spürte, wie ihm erst heiß und dann kalt wurde. »Aber es war dunkel«, protestierte er schwach.
»Das ist egal«, gab Götz zurück. »Irgendetwas musst du gesehen haben.«
Mathes gab einen undefinierbaren Laut von sich.
Plötzlich hatte Jona keinen Hunger mehr. Er ließ den Löffel sinken und sah bittend zu Olivera.
»Muss das wirklich sein?«, kam sie ihm zu Hilfe. »Wir wissen nicht mal genau, was fehlt.«
Götz runzelte die Stirn.
»Wenn du das Seil abschneidest, mit dem er über die Mauer geklettert ist, und wir in Zukunft nachts den Hund loslassen …«
»Wie ist er überhaupt ins Haus gekommen?«, meldete Mathes sich zu Wort.
»Das weiß ich noch nicht«, gab Götz zurück.
»Sollten wir das nicht zuerst herausfinden?«, fragte Olivera.
Götz überlegte einen Augenblick, dann nickte er. »Also gut. Die kommenden Nächte muss aber jemand Wache halten«, sagte er schließlich. Sein Blick fiel auf Jona.
»Er?«, fragte Mathes.
»Willst dudir die Nacht um die Ohren schlagen?«, war die Gegenfrage.
Mathes schüttelte den Kopf.
»Dann wird Jona die Wache übernehmen. Wenn allerdings noch mal jemand hier eindringt, ist es eine Angelegenheit für den Hauptmann.«
Obwohl Jona die Aussicht, stundenlang allein im Dunkeln zu sitzen, nicht besonders erbaute, war er froh, dass der Gang zur Wachstube vorerst vom Tisch zu sein schien. Seit man ihn und Casper vor einem halben Jahr unschuldig ins Loch gesperrt hatte, fürchtete er sich noch mehr vor den Stadtwachen, als er es ohnehin getan hatte. Manchmal träumte er immer noch von der »Kapelle«, der Folterkammer im Lochgefängnis der Stadt. »Wer frevle Taten begangen hat, den grause Spiele empfangen«, stand dort an der Wand. Zwar waren Jona und Casper mit der Peitsche davongekommen, doch die Erinnerung an all die Foltergeräte ließ ihm immer noch das Blut in den Adern gefrieren.
»Iss auf!«, befahl Götz. »Auf dich wartet Arbeit.«
Kapitel 5
Nürnberg, September 1409
Während Götz und Mathes sich aufmachten, um herauszufinden, wie der Einbrecher ins Haus gekommen war, trottete Jona zum Holzhacken davon. Obwohl auch Olivera viel zu tun hatte, blieb sie noch eine Weile am Tisch sitzen und versuchte, die Müdigkeit abzuschütteln. Trotz der beruhigenden Worte von Götz hatte sie auch den Rest der Nacht kein Auge zugetan, weshalb sie sich wie gerädert fühlte. Ihr Bauch erschien ihr mit jedem Tag schwerer. So sehr sie sich vor der Niederkunft fürchtete, so sehr hoffte sie, dass das Kind bald kommen würde. Jeden Tag schmerzte ihr Rücken etwas mehr und der Harndrang war oft unerträglich.
Nachdem die Köchin den Tisch abgeräumt hatte, erhob Olivera sich schließlich mit einem Seufzen. Ihr Blick wanderte zu dem silberbeschlagenen Kästchen, in dem der Brief ihrer Yiayia lag. Die Trauer war auch an diesem Morgen wie ein Band, das sich um ihr Herz gelegt hatte. Als Tränen in ihren Augen aufstiegen, floh sie hastig aus der Stube und machte sich auf den Weg in die Salbenküche.
Dort suchte sie Walnusswurzelerde zur Behandlung von Gelenkschmerzen, Galgantwurzelwein gegen Hexenschuss, Zedernfrüchte zur Linderung von Durchblutungsstörungen und schwarzen Helleborus, Wolfsmilch und Majoran gegen Blähungen und Durchfall zusammen. Die reichen Pfründner im Heilig-Geist-Spital, um die sie sich kümmerte, konnten ihre teuren Arzneien bezahlen, anders als die ärmeren Insassen. Die mussten sich mit dem zufriedengeben, was der Bader zur Hand hatte. Sie packte alles in einen großen Korb, legte ihren Umhang um die Schultern und verließ das Haus. Das ungute Gefühl, das sie in der Offizin beschlichen hatte, schrieb sie dem nächtlichen Einbruch zu.
Die Einwohner der Stadt waren bereits auf den Beinen und strömten zu dem an diesem Tag stattfindenden Kälber- und Fischmarkt. Zahllose Karren holperten über das Kopfsteinpflaster und das Brüllen des Viehs hallte durch die Gassen. Der Morgen war kühl, aber sonnig. Die hoch über der Stadt aufragende Burg wirkte festlich herausgeputzt, da auf den Zinnen Fahnen aufgezogen waren. Vermutlich hielt sich der Burggraf immer noch in der Stadt auf, um dem Anschlag auf sein Leben auf den Grund zu gehen. Genau wie Olivera schien er nicht davon überzeugt zu sein, dass der wahre Schuldige gefasst worden war, und stellte immer wieder unangenehme Fragen. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken konnte, hatte er dem Rat mehrfach mit einem Nachspiel gedroht. Offenbar ging er davon aus, dass die Nürnberger Ratsherren den Anschlag auf ihn befohlen hatten.
Olivera verdrängte den Gedanken an den Burggrafen und die Intrige gegen ihn, da Götz sie gebeten hatte, die Angelegenheit ruhen zu lassen. Wegen des Kindes, hatte er gesagt. Aber Olivera war sicher, dass er auch Angst um ihr Leben hatte. Für ihn war der Anschlag aufgeklärt. Schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Mit einem Seufzen umfasste sie den Korb fester und reihte sich in den Strom der Kauflustigen ein. Den Marktplatz beim Rathaus ließ sie links liegen, um bei der Fleischbrücke an der Pegnitz entlang zum Heilig-Geist-Spital zu gehen. Wenig später tauchten die Gebäude des Spitals vor ihr auf. Vor dem großen Tor, das in den sogenannten Hanselhof führte, war der Andrang trotz der frühen Stunde groß. Mehr oder weniger geduldig warteten Fuhrknechte, Mägde, Bedürftige, Werkleute und Metzger vor dem Wachhaus des Beschließers – des Torwächters – darauf, von ihm eingelassen zu werden. Auch einige Bettler trieben sich vor dem Tor herum, in der Hoffnung auf eine warme Mahlzeit und ein Bett für die Nacht. Obwohl sie mitleiderregend und abgerissen aussahen, wusste Olivera, dass der Beschließer sie abweisen würde. Der Spitalmeister und die Spitalmeisterin achteten streng darauf, dass nur echte Kranke und Bedürftige aufgenommen wurden. Wer eine Krankheit vortäuschte, wurde ohne viel Federlesens vom Hof gewiesen.
»Der Winter wird dieses Jahr strenger als sonst«, hörte sie eine Bäckerin mit einem Korb voller Brote sagen.
»Woher willst du das wissen?«, fragte eine Magd.
»Der Wald ist voller Eicheln.«
»Das war er im letzten Jahr auch«, wandte die Magd ein.
»Die alte Agnes spürt es in den Knochen, sagt sie«, fügte die Bäckerin hinzu.
Die Magd lachte. »Warum ist es dann noch so warm?«
»Du wirst schon sehen. Bald fällt der erste Schnee«, beharrte die Frau mit dem Brotkorb.
»Das glaube ich nicht.«
Die Bäckerin zuckte die Achseln. »Glaub, was du willst, aber du wirst dich noch an meine Worte erinnern.«
Olivera warf einen Blick auf die Bäume, die das Ufer der Pegnitz säumten. Die Blätter waren noch grün und sie hoffte inständig, dass die Magd recht hatte. Mit Grauen erinnerte sie sich an den letzten Winter, dessen eisige Kälte sie fast umgebracht hätte. Zwar hatte Götz inzwischen einen kleinen Ofen in ihre Schlafkammer gemauert, doch der genügte kaum, um sie nachts warm zu halten. Ihre Gedanken schweiften zu ihrer Heimat ab, verweilten bei der Hitze Konstantinopels, der frischen Meeresbrise und dem Duft von Zitronen und Zypressen. Da diese Erinnerungen jedoch unweigerlich zu ihrer Yiayia führten, schob sie sie hastig beiseite.
»Du bist an der Reihe«, brummte der Torwächter, als Olivera vor seinem Häuschen stand.
»Ich bringe Arzneien für die Pfründner«, sagte sie. Obwohl der Mann sie kannte, fragte er sie jeden Tag aufs Neue, was sie im Spital wollte. Olivera hatte schon lange aufgehört, sich darüber zu ärgern.
Wie jedes Mal brummte der Beschließer etwas Unverständliches und gab ihr mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass sie passieren konnte.
Als Olivera den Hanselhof betrat, fröstelte sie. Im Schatten des riesigen Gebäudekomplexes war es wesentlich kühler als in der Sonne. Wie gewöhnlich war das Rauschen der Pegnitz hinter den langgestreckten Bauten deutlich zu hören. Zu ihrer Linken ragte der Turm der Spitalkirche in den blauen Himmel. Da bis zum Stundengebet der Terz noch etwas Zeit blieb, strömten die Insassen und Pfründner noch nicht auf die Kirchenpforte zu. Einer der sechs Priester des Spitals stand unter dem Torbogen und beobachtete das bunte Treiben. Als Oliveras Blick den seinen traf, wandte er sich hastig ab und verschwand im Inneren der Kirche. Sie trat zur Seite, als ein schwer beladenes Fuhrwerk an ihr vorbeipolterte. Der Lenker, ein hagerer Mann mit einem zerschlissenen Kapuzenumhang, zügelte vor einem der Wirtschaftsgebäude sein Pferd und sprang vom Bock. Dann begann er, schwere Säcke von der Ladefläche zu heben.
Im Hof herrschte das übliche Gewimmel. Die Insassen des Spitals, die kräftig genug waren zum Arbeiten, waren vom Spitalmeister zum Kehren, Holzhacken oder Wasserholen eingeteilt worden. Einige der stärkeren Männer halfen beim Verstauen der angelieferten Waren. Diejenigen, die zu schwach waren, um zu helfen oder die Stundengebete zu besuchen, hielten sich in der Siechenstube auf. Dort wachten Tag und Nacht Mägde und eine Kusterin über sie, damit rechtzeitig nach einem Kaplan gerufen werden konnte, falls einer der Leidenden nach den Sakramenten verlangte. In den beiden größten, parallel angeordneten Gebäuden des Spitals befanden sich die Stuben. Daran grenzten je eine Küche für die Patienten der oberen und unteren Stuben an, eine Badestube für die Männer und eine für die Frauen, ein Waschraum und das heimliche Gemach für die Insassen. Außerdem waren hier das Narrenhäuslein, die Einrichtungen für die armen Pfründner und die Unterkunft für Waisen und Findlinge untergebracht. Olivera war gerade auf dem Weg zu den Wohnungen der reichen Pfründner, als eine junge Frau über den Hof auf sie zugeeilt kam.
»Olivera!« Das schmale Gesicht des Mädchens war leicht gerötet, einige Strähnen ihres dunkelblonden Haares hatten sich aus der Haube auf ihrem Kopf gelöst.
»Gerlin«, begrüßte Olivera sie.
»Ich brauche deine Hilfe!«, stieß die junge Frau atemlos hervor.
Olivera runzelte die Stirn. Gerlin, eine ehemalige Hübschlerin, arbeitete seit einigen Wochen als Magd im Spital und schien ihre neue Aufgabe sehr ernst zu nehmen. »Was ist?«, fragte sie.
Gerlin machte eine Handbewegung zu Oliveras Bauch. »Eine der Schwangeren blutet heftig. Sie schreit so laut, dass die anderen Wöchnerinnen sich die Ohren zuhalten. Du musst ihr helfen!«
Olivera schüttelte den Kopf. »Das ist Aufgabe der Hebmägde«, sagte sie. »Geh zur Meisterin.«
»Die Meisterin ist nicht da, sie kauft Vorräte für die Siechenkammer ein«, erwiderte Gerlin.
»Dann sag der Kusterin Bescheid.«
»Die ist mit den Kranken beschäftigt.«
Olivera runzelte die Stirn. Sie wusste, dass die unverheirateten Wöchnerinnen kein hohes Ansehen im Spital genossen. Oft wurden sie nach der Entbindung für ein paar Tage ins Loch geworfen, um sie für ihren unmoralischen Lebenswandel zu bestrafen. Dass die Leiden einer Niederkommenden ignoriert wurden, hatte sie allerdings noch nicht erlebt.
»Bitte, Olivera«, beharrte Gerlin. »Sie stirbt, wenn du ihr nicht hilfst!«
Kapitel 6
Nürnberg, September 1409
Der Anblick, der sich Olivera bot, als sie die Stube der Wöchnerinnen betrat, ließ sie erschauern. Eine junge Frau, kaum älter als fünfzehn Jahre, lag zusammengekrümmt in einem der Bettkästen und brüllte vor Schmerz. Das Laken unter ihr war blutverschmiert, ihr Gesicht kalkweiß. Ihre Hand umklammerte ein hölzernes Kruzifix, ihre Lippen formten lautlose Worte.
»Sie betet«, wisperte Gerlin.
Olivera trat ans Bett der Frau und fasste ihr an die Stirn. Sie war eiskalt. »Bitte den Bader, ein heißes Bad einzulassen«, sagte sie. »Wir müssen die Krämpfe lösen.« So vorsichtig, wie sie konnte, betastete sie den Bauch der Frau.
Die schrie auf.
»Ich bin keine Hebamme«, seufzte Olivera. »Aber ich denke, dass das Kind entweder falsch liegt oder nicht mehr lebt.«
Die Frau wimmerte.