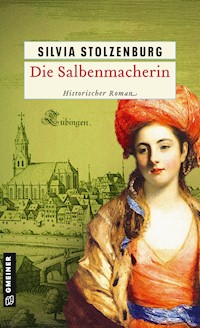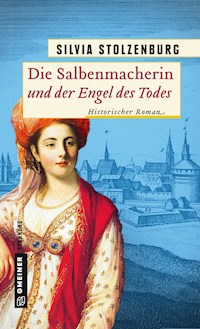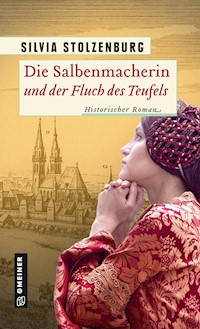Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Salbenmacherin
- Sprache: Deutsch
April 1410. Über ein halbes Jahr ist vergangen, seit die Salbenmacherin Olivera und ihr Gemahl beinahe einer tödlichen Intrige zum Opfer gefallen wären, doch die Lage scheint sich ein wenig beruhigt zu haben. Es herrscht eine Art Waffenstillstand mit ihren mächtigen Gegnern, der allerdings durch die Ankunft eines Wanderheilers in Gefahr gerät. Dieser behauptet, im Besitz des „Steins der Weisen“ zu sein, der kurze Zeit später auf rätselhafte Weise verschwindet. Als der Heiler dann auch noch erschlagen aufgefunden wird, spitzt sich die Situation dramatisch zu …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Stolzenburg
Die Salbenmacherin und der Stein der Weisen
Historischer Roman
Zum Buch
Aufruhr in Nürnberg Über ein halbes Jahr ist vergangen, seit die Salbenmacherin Olivera und ihr Gemahl Götz beinahe der Intrige mehrerer aufstrebender Kaufmannsgeschlechter zum Opfer gefallen wären. Doch die Lage scheint sich ein wenig beruhigt zu haben. Es herrscht eine Art Waffenstillstand mit ihren mächtigen Gegnern, der allerdings durch die Ankunft eines Wanderheilers in Gefahr gerät. Der Heiler behauptet, im Besitz des „Steins der Weisen“ zu sein, mit dem man nicht nur unedle Metalle in Gold verwandeln, sondern auch sämtliche Krankheiten heilen kann. Plötzlich scheint die ganze Stadt vor Euphorie den Verstand zu verlieren, während Olivera zur Besonnenheit mahnt. Man unterstellt ihr, neidisch auf den Wanderheiler zu sein, der kurze Zeit später erschlagen aufgefunden wird. Olivera ahnt Schlimmes. Als dann auch noch ihr wenige Monate alter Sohn entführt wird, spitzt sich die Situation für sie und ihre Familie auf hochdramatische Art und Weise zu …
Dr. phil. Silvia Stolzenburg studierte Germanistik und Anglistik an der Universität Tübingen. Im Jahr 2006 promovierte sie dort über zeitgenössische Bestseller. Kurz darauf machte sie sich an die Arbeit an ihrem ersten historischen Roman. Die Vollzeitautorin lebt mit ihrem Mann auf der Schwäbischen Alb, fährt leidenschaftlich Rennrad, gräbt in Museen und Archiven oder kraxelt auf steilen Burgfelsen herum - immer in der Hoffnung, etwas Spannendes zu entdecken.
Impressum
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München)
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sina Deter
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: Alex Shadrin / stock.adobe.com und
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuernberg-1650-Merian.jpg
ISBN 978-3-8392-6632-8
Widmung
Für Effan, Goldstück und Edelstein
Prolog
In der Nähe von Nürnberg, Ende April 1410
Der Wind, der die Wolken über den Nachthimmel trieb, war kalt und schneidend. Ein beinahe voller Mond malte gespenstische Schatten in die Landschaft und verstärkte zusammen mit den hin- und herschaukelnden »Atzmännern« vor dem großen Zelt den Eindruck des Unheimlichen und Dämonischen. Diese kleinen wächsernen Puppen waren mit Espenblättern umwickelt, mit wundersamen Worten beschrieben und mit Weihwasser bespritzt. Die durch die Dunkelheit herbeieilenden Besucher warfen ihnen ängstliche Blicke zu, da jeder von ihnen fürchtete, seine Seele könne darin gefangen sein.
Der junge Mann, der vor dem Zelt stand, um die Dorfbewohner zu beobachten, schlang seinen Mantel enger um sich und schlug den Kragen hoch. Die kalte Luft fühlte sich an wie eine Hand, die nach seinem Nacken griff, und eine körperlose Stimme schien ihm warnende Worte ins Ohr zu raunen.
»Kommt herbei! Kommt herbei!«, lud ein grauhaariger Mann die Menschen ein. Er steckte in einem dunklen, mit silbernen Sternen und Monden bestickten Umhang, auf seinem Kopf saß eine prächtig verzierte Kappe. »Die Stunde der Wahrheit hat schon fast geschlagen«, posaunte er. »Beeilt euch, sonst ist es zu spät für eure Wünsche.«
Ein verächtlicher Ausdruck huschte über das Gesicht des jungen Mannes und er war froh, dass er im Schatten einer alten Eiche stand. Während die wohlbekannte Wut in ihm aufwallte, ballte er die Fäuste und mahnte sich wieder einmal zur Geduld. Seine Zeit würde kommen. Bald würde der Teufel ein Einsehen mit ihm haben und ihm dabei helfen, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Sein Blick zuckte zu den vier kräftig gebauten Kerlen, die das Zelt und die in einiger Entfernung stehenden Karren bewachten.
»Kommt herbei! Schnell, schnell! Die Stunde naht.«
Immer mehr Menschen strömten aus dem Dorf, das eine halbe Meile entfernt war, zu dem Zelt auf der kleinen Wiese, um das ein Ring aus Pflöcken gezogen worden war. An diesen Pflöcken befanden sich allerlei eingeritzte Zeichen, von einem hing der vertrocknete Kadaver einer Katze.
Als sich nach einiger Zeit auch der letzte Unentschlossene aus seiner warmen Stube gewagt hatte, warf der Grauhaarige dem jungen Mann einen fragenden Blick zu.
Der nickte. Dann folgte er dem Alten ins Innere des Zelts, wo ein großes Feuer prasselte.
Die Besucher hatten sich ehrfürchtig im Kreis darum aufgestellt und wagten offenbar kaum zu atmen. Ein schwerer, würziger und zugleich stechender Geruch hing in der Luft, der das Atmen schwer und die Sinne leicht machte.
»Tretet näher!«, lud der Grauhaarige die Leute ein. Er griff nach einem Metallstab und einem Gefäß, schüttete die Asche darin auf den Boden und zog mit dem Stab Linien, die sich zu einem sechszackigen Stern verbanden. »Schemhamphoras«, murmelte er.
Einige der Anwesenden bekreuzigten sich.
»Schemhamphoras!«, rief er etwas lauter.
So schnell, dass es nur für das geübte Auge des jungen Mannes sichtbar war, fuhr die Hand des Alten in die Rocktasche und er warf etwas ins Feuer.
Ein Zischen ließ die Dorfbewohner zusammenzucken, dann stieg Qualm aus den Flammen auf.
»Barmherziger, steh uns bei!«, hörte der junge Mann jemanden wispern.
»Was, wenn er mit dem Teufel im Bunde ist?«
»Sei still! Sein Ruf eilt ihm voraus. Ich habe von der zahnlosen Marthe gehört, dass er die Toten zum Leben erwecken kann.«
»Heilige Muttergottes!«
Die Mundwinkel des jungen Mannes zogen sich nach unten. Wie einfältig die Leute doch waren! Bitterkeit stieg in ihm auf. Fast so einfältig wie sein Vater. Er presste die Lippen aufeinander und verfolgte den Hokuspokus verächtlich.
Nachdem der Rauch sich etwas verzogen hatte, entzündete er auf einen Wink des Alten hin ein halbes Dutzend Kerzen und platzierte sie auf den Zacken des Sterns. Während ein Raunen durch die Reihen ging, holte er eine Flasche hervor, in der sich eine tiefrote Flüssigkeit befand.
»Salathiel, mächtiger Dämon, komm herbei, fahre in mich!«, beschwor der Grauhaarige eine dunkle Macht, die der junge Mann schon längst nicht mehr fürchtete. »Nimm hin das Opfer der Fledermaus!« Er entkorkte die Flasche, spritzte etwas von dem darin enthaltenen Blut in die Flammen und schloss die Augen. Dann wiegte er den Oberkörper leicht hin und her und verfiel in unverständliches Murmeln.
Der junge Mann zog sich in die Menge zurück.
»Was tut er da?«, flüsterte eine Frau. Sie sah sich furchtsam im Zelt um.
»Schsch!«
»Salathiel!«, donnerte der Alte unvermittelt mit so lauter Stimme, dass einige der Bauern zusammenzuckten.
Ein tiefer Ton erklang, wie von einem Horn, das unter der Erde erschallte.
Der junge Mann wusste, dass es einer der vier Kerle blies, die im Freien geblieben waren.
Die einfältigen Dorfbewohner bekreuzigten sich immer ängstlicher. Als der Grauhaarige plötzlich die Augen aufriss und einen Totenkopf unter seinem Mantel hervorzog, erklangen einzelne Schreie. »Stellt eure Fragen!«, befahl er, nachdem er den Schädel in die Mitte des Sterns gestellt und wohlriechendes Räucherwerk entzündet hatte. »Salathiel wird euch durch mich antworten.«
Der junge Mann wandte sich von dem Schauspiel ab und drückte sich durch einen Spalt in der Zeltleinwand ins Freie. Die Vorführungen langweilten ihn nicht nur, jede einzelne weckte den Wunsch in ihm, nicht länger zu warten. Am liebsten hätte er seinen Dolch gezogen, ihn dem Scharlatan mitten ins Herz gerammt und sich genommen, was ihm gehörte. Doch sein Rachedurst würde nicht an diesem Abend gestillt werden. Wenn er zu früh sein wahres Gesicht zeigte, war die ganze weite Reise umsonst gewesen. In diesem ärmlichen Dorf würde der Alte den Stein ganz gewiss nicht aus der schweren Truhe holen, da er den Bauern kein Gold aus der Tasche ziehen konnte. Erst wenn sie weiterzogen nach Nürnberg, kam vielleicht endlich die Gelegenheit, auf die er seit Monaten wartete.
Kapitel 1
Nürnberg, Mai 1410
Das Weinen ihres Sohnes schreckte Olivera aus dem leichten Schlaf auf. Obwohl sie von der Arbeit in der Offizin, der Salbenküche im Erdgeschoss ihres Hauses, müde war, vertrieb das lauter werdende Schreien des Kindes die Schläfrigkeit mit einem Schlag. Behutsam, um ihren Gemahl Götz nicht zu wecken, schlüpfte sie unter der dünnen Decke hervor, warf sich ein Untergewand über und tappte im Dunklen zur Tür der gegenüberliegenden Kammer. Dort lag ihr Sohn – von einem schmalen Streifen Mondlicht beleuchtet – in dem kleinen Bettchen, das Götz ihm gezimmert hatte, und strampelte wütend. Sein Brüllen wurde heftiger, als Olivera sich zu ihm hinabbeugte, um ihn auf den Arm zu nehmen.
»Ich bin ja hier«, beruhigte sie ihn und drückte ihm einen sanften Kuss auf das dunkle Haar. »Hast du schon wieder Hunger?«
Als Antwort krallten sich die winzigen Hände in ihr Untergewand.
Wie immer, wenn Olivera ihren Sohn auf dem Arm hatte, überfiel sie ein Gefühl unendlicher Dankbarkeit. Die Ereignisse unmittelbar vor seiner Geburt vor etwas mehr als einem halben Jahr hatten sie beinahe das Leben gekostet. Hätte der Henker Jacob ihr nicht auf dem Weg zum Lochgefängnis zur Flucht verholfen, wäre Götz vermutlich inzwischen Witwer. Die Erinnerung an die entsetzliche Angst, die gefährliche Verletzung und die Kälte in ihrem Versteck im Wald ließ sie frösteln. Mit einem Finger der freien Hand strich sie gedankenverloren über die Narbe an ihrem Arm, die der Armbrustbolzen hinterlassen hatte. Gott hatte ihr Jona, den Apothekergehilfen ihres Gemahls geschickt, um sie vor einem schändlichen Tod zu bewahren. Nur dem Einfallsreichtum des zwölfjährigen Knaben war es zu verdanken, dass sie weder verblutet war noch ihr Kind verloren hatte.
Ein weiterer zorniger Schrei brachte sie in die Gegenwart zurück. »Geduld, Lukas«, murmelte sie, als sie ihre Brust entblößte, um ihren Sohn zu stillen. Während seine Lippen gierig nach Milch suchten, wiegte sie ihn auf dem Arm und summte eine leise Melodie.
»Hier bist du.« Götz erschien auf der Schwelle der kleinen Kammer und betrachtete sie und das Kind mit einem Gähnen.
»Geh wieder ins Bett«, sagte Olivera. »Ich komme, sobald er gestillt ist.«
Götz gähnte erneut. »Jetzt bin ich schon wach«, erwiderte er. »Es dauert nicht mehr lange, bis es dämmert, da kann ich gleich aufbleiben.« Er kam näher und legte von hinten den Arm um sie. Sein Kinn schmiegte er an ihre Schulter und küsste ihren Hals. »Ihr beiden seid umwerfend«, murmelte er.
Olivera lächelte. Die Liebe, die sie für Götz und Lukas empfand, war beinahe zu groß für ihr Herz. In diesem Augenblick hatte sie das Gefühl, dass es vor Glückseligkeit zerbersten wollte. Sie lehnte sich an Götz und genoss die Wärme, die von ihm ausging. Er war ihr Fels, ihr Halt, der Mann, der alles aufs Spiel gesetzt hatte, um sie vor dem Tod am Galgen zu bewahren. Hätte Götz nicht alles riskiert, sogar sein eigenes Leben, wäre nichts von dem, was sie im Augenblick empfand, je möglich gewesen. »Ich liebe dich«, sagte sie. »Aber das weißt du sicher.«
Sie spürte sein Grinsen. »Ich liebe dich auch«, erwiderte er. »Und den kleinen Burschen da.« Er kraulte Lukas’ Haar, woraufhin sein Sohn einen Augenblick mit dem Nuckeln innehielt. Dann trank er gierig weiter.
»Oh, Ihr seid schon auf!« Ohne dass Olivera oder Götz es bemerkt hatten, war die Amme im Gang vor der Kammer aufgetaucht. Sie war bereits vollständig bekleidet, in der Hand hielt sie eine kleine Kerzenlampe. »Ich wollte gerade nach ihm sehen.« Sie kam auf Olivera zu, stellte die Lampe ab und streckte die Arme aus, um ihr das Kind abzunehmen.
Lukas gab einen unwilligen Laut von sich.
Während Olivera ihre Blöße bedeckte, drückte die Amme ihn an ihre Brust und tätschelte ihm den Rücken.
»Bade ihn und wickle ihn fest«, trug Olivera ihr auf. »Ich schicke nachher Jona mit Butter, Gänseschmalz und Gerstenwasser in die Kinderstube, damit du Lukas das Zahnfleisch damit einreiben kannst.«
Die Amme nickte.
»Er hat immer noch einen harten Bauch«, stellte Olivera fest.
»Ist das gefährlich?«, fragte Götz besorgt.
Sie schüttelte lachend den Kopf. »Nein, aber schmerzhaft. Ich bereite ihm Zäpfchen aus Baumwolle, Honig und Mäusekot, die sollten ihm Linderung verschaffen.« Olivera strich ihrem Sohn zum Abschied ein letztes Mal über den Kopf, ehe sie und Götz die Kammer verließen. »Ich gehe heute ins Spital«, sagte sie, als sie zurück in ihrer Schlafstube waren.
Bei diesen Worten versteifte sich Götz merklich.
»Ich kann mich nicht ewig im Haus verstecken«, seufzte sie. »Der Spitalmeister und der Medicus sind tot, die Meisterin führt jetzt das Regiment über die Insassen.«
»Aber …«
»Ich werde auch Gerlin mitnehmen«, unterbrach sie ihn. »Sie ist zwar tüchtig und lernt schnell, aber es gibt nicht genug Arbeit für sie. Jona reicht mir als Gehilfe vollkommen aus.« Sie trat auf Götz zu und legte ihm die Hände auf die Schultern. »Wir wissen jetzt, wer unsere Feinde sind. Du hast sie im Auge.«
Götz presste die Lippen aufeinander und schnaubte. »Ich bin mir sicher, dass sie nicht einfach aufgeben werden.«
»Aber niemand wird ihnen mehr Glauben schenken. Der Medicus hat unter Folter alles gestanden. Die Mitglieder des Inneren Rates und die Sieben Älteren Herren wissen, wer hinter der Intrige gegen uns gesteckt hat.«
»Das werden sie aber niemals in der Öffentlichkeit zugeben«, hielt Götz entgegen. »Ich hätte diese vermaledeite Urkunde nicht unterzeichnen sollen!«
Olivera reckte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. »Was hättest du denn sonst machen sollen? Wenn du nicht getan hättest, was der Rat von dir verlangt hat, wären die Anklagen gegen dich und mich niemals fallengelassen worden. Dann säßen wir jetzt entweder beide im Loch oder lägen einen Klafter tief unter der Erde.«
»Was ist mit Jacob?«, brummte Götz. »Du wirst im Spital wieder mit ihm zusammenarbeiten müssen.«
Olivera zuckte die Achseln. Auch wenn der Henker und Wundarzt Götz an die Stadtwachen ausgeliefert hatte, hatte er ihr das Leben gerettet. Sie mochte ihn, daran konnte auch die Tatsache nichts ändern, dass er eine Verbrecherin durch Losbitten vor dem Tod bewahrt und sie zur Frau genommen hatte. Er war ein guter Mann, ein aufrichtiger Kerl, auf dessen Hilfe sie immer zählen konnte. Daran wollte sie einfach nicht zweifeln nach allem, was geschehen war.
»Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken«, murmelte Götz. »Was, wenn Gott uns strafen will?«
»Das Leben muss weitergehen«, versuchte Olivera, ihn und sich selbst zu beruhigen. »Wenn Gott uns hätte strafen wollen, wäre das alles«, sie machte eine vage Handbewegung, »nicht so glimpflich ausgegangen.«
»Woher willst du wissen, dass er uns nicht immer noch zürnt?«
»Das weiß ich nicht«, gestand Olivera. »Aber ich vertraue darauf, dass er ein barmherziger Gott ist.« Sie sah Götz in die Augen. »Wir leben nicht mehr in Sünde.«
Er blies die Wangen auf und rieb sich das Kinn. »Warum kannst du die Arzneien nicht einfach hier zubereiten? Dann kann Jona sie zu den Pfründnern ins Spital bringen.«
Olivera schüttelte den Kopf. »Es sind nicht nur die Pfründner …«
»Du weißt, dass du ohne Zustimmung eines Arztes keinem Kranken helfen darfst«, mahnte Götz. »Ich habe einen Eid geleistet, der verbietet, dass wir einem gelehrten Medicus in die Kur pfuschen.«
»Ich weiß«, beschwichtigte Olivera ihn. »Aber vielleicht ist der neue Medicus etwas einsichtiger als der alte. Immerhin kauft er, ohne zu murren, seine Salben bei dir.«
»Immerhin«, gestand Götz widerwillig ein.
»Er ist jung und unerfahren«, stellte Olivera fest. »Vermutlich wird er froh sein über jede Hilfe, die er bekommen kann.«
»Oder er ist einer dieser eingebildeten studierten Gecken, die denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen.«
Olivera schlüpfte in ein einfaches graues Kleid und flocht ihr Haar. Dann verstaute sie es unter einer Haube. »Ich werde nichts unternehmen, das meine, deine oder Lukas’ Sicherheit gefährden könnte«, versprach sie. »Aber ich muss endlich das Haus verlassen. Sonst verliere ich den Verstand.«
Götz holte schwer Atem. »Meinetwegen«, murrte er schließlich. »Aber ich bin nicht glücklich darüber.«
Olivera gab ihm einen weiteren Kuss, ehe sie sich ihrem Waschgestell zuwandte, um sich die Zähne mit geriebenen Walnussschalen, Wein und Salz zu reinigen. Als auch Götz fertig angezogen war, gingen sie in die Stube, in der Jona bereits den Tisch gedeckt hatte.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Olivera, nachdem sie das Fenster geöffnet hatte, um die klare Frühlingsluft in den Raum zu lassen. »Ab jetzt kehrt Ruhe ein in unser Leben.«
Kapitel 2
Nürnberg, Mai 1410
Götz verkniff sich einen skeptischen Kommentar, da er Olivera nicht unnötig aufregen wollte. Obwohl sie selbst offenbar der Ansicht war, wieder voll bei Kräften zu sein, fand er, dass sie bleich und abgekämpft aussah. Ihr Gesicht wirkte kantiger, die dunklen Augen weniger feurig als im vergangenen Sommer. Die Qualen, die sie während ihrer Flucht vor den Stadtwachen hatte erdulden müssen, waren ihr immer noch anzusehen. Die schlimme Narbe an ihrem Arm würde sie für den Rest ihres Lebens daran erinnern, wie knapp sie dem Tod entronnen war. Götz’ Magen zog sich bei dem Gedanken an die Furcht, die er ausgestanden hatte, schmerzhaft zusammen. Was hätte er nur getan, wenn sie nicht wieder gesund geworden wäre? Was, wenn man sie als Mörderin hingerichtet hätte? Ihn lähmte jedes Mal die Angst, wenn er sich zu einer Sitzung des Größeren Rates aufmachte, in dem ihm fast ein Dutzend Männer feindlich gesonnen war. Er verstand, dass es wichtig für Olivera war, ins Spital zurückzukehren, dennoch hätte er sie am liebsten nicht aus dem Haus gelassen. Dann wäre sie allerdings nicht anders als die gefangene Elster, die in einem Käfig beim Fenster auf einer Stange hin- und herwippte. Er verzog das Gesicht.
»Mach dir keine Sorgen«, wiederholte Olivera, die seinen nachdenklichen Gesichtsausdruck bemerkt haben musste. »Nach dem Frühstück sieht die Welt anders aus, glaub mir.«
Götz wünschte, es wäre so einfach. Während die Köchin Milch, Honig, verdünntes Bier und mehrere Schüsseln mit dampfendem Haferbrei auftrug, nahm er am Kopfende des langen Tisches Platz und wartete, bis die anderen sich ebenfalls gesetzt hatten. Götz’ Kinder aus erster Ehe, Cristin und Uli, saßen auf der Bank bei der Wand neben der Kindermagd Jonata und der Amme Barba, die Oliveras Sohn auf dem Arm hatte. Der Knecht Mathes, die Magd Gerlin, Jona und die Köchin hatten auf der gegenüberliegenden Bank Platz genommen, Olivera am anderen Kopfende des Tisches.
»Darf ich Barba heute helfen?«, fragte die siebenjährige Cristin, sobald das Tischgebet gesprochen und der Brei verteilt waren. Ihre dunklen Locken standen wie immer wild von ihrem Kopf ab und auf ihrer Nase war ein Kratzer zu sehen, den ihr die Hofkatze zugefügt hatte.
Olivera warf der Amme einen fragenden Blick zu.
»Warum nicht?«, sagte die junge Frau. »Früh übt sich …«
»Und ich?«, meldete sich ihr vierjähriger Bruder zu Wort.
»Jonata kümmert sich um dich«, antwortete Götz lachend und strich seinem Sohn über den zerzausten Schopf.
»Ich will mit Jona spielen!«, forderte der Kleine.
Götz warf Jona einen Blick zu, woraufhin der Knabe sofort die Augen niederschlug. Götz war noch immer wütend auf ihn, weil er Olivera und ihn belogen hatte. Allerdings war Oliveras Leben durch den Einsatz des Bengels gerettet worden, weshalb Götz ihn nicht aus dem Haus geprügelt hatte, wie er es ursprünglich vorgehabt hatte. »Jona muss arbeiten«, erwiderte er.
»Dann will ich auch Barba helfen«, quengelte Uli.
»Wir könnten den Esel füttern«, mischte sich die Kindermagd ein. »Was hältst du davon?«
Uli schob die Unterlippe vor und stocherte in seinem Haferbrei herum. Dann nickte er.
Das restliche Essen verlief schweigend, außer dem Klappern des Holzgeschirrs war kaum mehr ein Laut zu hören in der Stube, die von der aufgehenden Sonne durchschienen wurde. Der bunt geflieste Boden leuchtete in fröhlichen Farben, doch auch dieser schöne Anblick vermochte es nicht, Götz’ dunkle Ängste zu vertreiben. Zweimal hatte er Olivera fast verloren, ein drittes Mal würde ihnen das Glück gewiss nicht hold sein. Was, wenn sie sich in dem neuen Medicus irrte? Vielleicht gab er nur vor, bescheiden und freundlich zu sein. Sollte es ihm auch in den Sinn kommen, beim Rat um eine eigene Spitalapotheke zu bitten, fingen ihre Probleme von vorne an.
»Mir wird nichts geschehen«, versuchte Olivera erneut, ihn zu beruhigen, als sie sich nach dem Essen auf den Weg zum Verkaufsraum und der Offizin machten.
»Woher willst du das wissen?«, fragte Götz.
Olivera schwieg, holte einige Tiegel und Körbe aus den Regalen, welche die Wände der Salbenküche säumten, und rollte ein paar Stücke Baumwolle zu Zäpfchen. Diese bestrich sie mit Honig und rieb etwas Mäusekot hinein.
»Glaubst du im Ernst, die Meisterin wird einfach darüber hinwegsehen, dass wir für den Tod des Spitalmeisters verantwortlich sind?«, beharrte Götz.
»Wenn jemand für den Tod des Spitalmeisters verantwortlich ist, dann der Medicus«, entgegnete Olivera. »Wir haben ihn nicht im Loch ermorden lassen!«
»Aber er wäre nicht dort gewesen, wenn ich nicht …«
Olivera unterbrach ihn mit einer energischen Handbewegung. »Der Spitalmeister ist selbst schuld an seinem Schicksal. Hätte er sich nicht vom Medicus dafür bezahlen lassen, mich des Mordes zu bezichtigen, würde er noch leben.« Ihre Wangen röteten sich. »Die Einzigen, denen Unrecht widerfahren ist, sind wir und die Insassen, die vergiftet worden sind.«
Götz stöhnte. »Ich fürchte nur, dass der Hass der Meisterin sich gegen dich richten könnte.«
Olivera rief Gerlin zu sich und gab ihr die Zäpfchen. »Bring sie zu Barba«, trug sie ihr auf. »Sie soll Lukas alle zwei Stunden eines verabreichen.« Nachdem die junge Frau die Offizin verlassen hatte, fing sie an, Arzneien und Kräuter in einen Korb zu packen. »Ich kann mich einfach nicht länger im Haus verstecken! Verstehst du das denn nicht?« Ihre Stimme zitterte, genau wie ihre Hände.
Götz begriff und hätte sich am liebsten geohrfeigt. Ihre Angst war genauso groß wie seine, die Stärke und Zuversicht nichts als eine Maske. Anstatt ihr eine Stütze zu sein, machte er ihr das Leben nur schwerer. Er trat auf sie zu, nahm ihr eine verkorkte Glasflasche ab und umfasste ihre Hände.
»Du gehst jede Woche zu den Ratssitzungen, obwohl du weißt, dass man dir dort alles andere als wohlgesonnen ist«, sagte Olivera leise. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Wenn ich mich noch länger im Haus verstecke, haben diese Mistkerle gewonnen!«
Götz führte ihre Fingerspitzen an die Lippen, um sie zu küssen. »Ich will dich doch nur beschützen«, murmelte er.
»Dann lass mich gehen!« Olivera befreite eine ihrer Hände, um sich wütend die Tränen aus den Augen zu wischen. »Wir hatten vor, uns nicht einschüchtern zu lassen«, setzte sie hinzu. »Die Spitalmeisterin ist eine einsichtige Frau. Der Druck auf sie hat längst nachgelassen, weil die Schuldigen gefasst und bestraft worden sind.«
»Nicht alle«, gab Götz zu bedenken.
»Dieses entsetzliche Weib wird das Spital ganz gewiss nicht mehr betreten«, erwiderte Olivera. »Auch wenn sie sich durch List und Tücke in Jacobs Herz geschlichen hat, wird er nicht zulassen, dass sie jemals wieder in die Versuchung kommen kann, Kranke von ihrem Schicksal zu erlösen.«
Götz hoffte, dass sie sich nicht irrte. Er hatte die Frau gesehen, die als Todesengel zahlreiche Morde begangen hatte. Sie war nicht nur wunderschön, ihre Zierlichkeit und Zerbrechlichkeit verleiteten zu der Annahme, dass sie keiner Fliege etwas zuleide tun konnte. Der Henker Jacob schien gänzlich in sie vernarrt zu sein, weshalb Götz noch mehr um Oliveras Sicherheit besorgt war. »Versprich mir, dass du dich niemals allein bei einem der Pfründner oder der Insassen aufhältst«, forderte er. »So kann dir niemand etwas unterstellen.«
Olivera lächelte schwach. »Das hatte ich ohnehin vor«, erwiderte sie, dann befreite sie auch ihre andere Hand. »Außerdem wird Gerlin mich begleiten.« Sie packte die restlichen Sachen in den Korb, ging zur Tür und rief nach Gerlin. Wenig später machten die beiden Frauen sich auf den Weg zum Hoftor.
Götz widerstand nur mühsam dem Drang, ihnen hinterherzueilen, um sicherzugehen, dass ihnen auf dem Weg durch die Stadt nichts zustieß. Er musste aufhören, sich wie ein Narr zu benehmen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis die ersten reichen Nürnberger ebenfalls wach waren und sich auf den Weg zu ihm machten, um Arzneien, Konfekt und süße Tränke zu kaufen. Olivera würde – nein, durfte – nichts geschehen! Er umfasste das Kruzifix an seinem Hals und hoffte, dass er es nicht bereuen würde, sie nicht aufgehalten zu haben.
Kapitel 3
Nürnberg, Mai 1410
Als Olivera und Gerlin das Hoftor erreichten, verlangsamte Olivera ihre Schritte und holte einige Male tief Luft. Ihr Herzschlag beschleunigte sich, kaum trat sie auf die Straße hinaus, und einen Augenblick fragte sie sich, ob sie einen furchtbaren Fehler beging. Nach dem, was im Spital vorgefallen war, hatte sich lange Zeit alles in ihr gesträubt, jemals wieder einen Fuß in die Siechenstube zu setzen. Allerdings schien ihre Sturheit stärker zu sein als die Vernunft. Sie durfte sich einfach nicht geschlagen geben. Die Männer, die ihr und Götz nach dem Leben getrachtet hatten, würden es nicht noch einmal wagen, gegen sie vorzugehen, redete sie sich ein. Auch sie konnten nicht ewig darauf hoffen, straflos davonzukommen. Wenn der Burggraf seine Drohung wahrmachte und nach Nürnberg zurückkehrte, würde ihre Aufmerksamkeit abgelenkt sein. Sie warf einen Blick auf die Zinnen der Burg, die zu ihrer Rechten in den Himmel ragte. Dort flatterte bereits das Banner des Grafen und verkündete dessen baldige Ankunft in der Stadt.
Sie riss den Blick von den trutzigen Türmen los und straffte die Schultern, dann wandte sie sich nach links und machte sich auf den Weg den Burgberg hinab. Die Straße, in der ihr Haus stand, wimmelte schon von Reitern, Karren und Fußvolk, die allesamt zum Markt strömten, wo an diesem Tag Buden mit Backwaren, Käse, Wildbret, gesalzenen Fischen, Butterfässern und Flachs aufgestellt worden waren. In der Nähe des Schönen Brunnens erspähte Olivera mehrere mit silbernen Sternen bemalte Wagen, vor denen ein Schreier lauthals versuchte, die Leute anzulocken.
»Erfahrt eure Zukunft beim großen Adepten Alphonsius!«, brüllte ein Mann in einem langen Gewand. »Verwandelt Unedles in Gold! Kommt herbei, um eure Leiden heilen zu lassen!«
Eine Gruppe Bettelmönche und der Priester der Sankt-Sebaldus-Kirche beäugten den Mann mit unverhohlenem Missfallen und auch einige Marktaufseher schienen Interesse für den Wagen zu entwickeln.
»Was ist ein Adept?«, fragte Gerlin, die schweigend neben Olivera hergetrottet war. Sie war ziemlich bleich um die Nase, was Olivera nicht verwunderte. Immerhin hatte sie sich einen der Spitalprediger zum Feind gemacht, der seinen Posten immer noch bekleidete.
»Ein Scharlatan«, gab Olivera zurück. »Jemand, der einfältigen Leuten das Geld aus der Tasche zieht und sie um ihr sauer Erspartes betrügt.«
»Glaubst du, er kann wirklich Gold machen?«
Olivera schüttelte den Kopf. »So etwas ist nicht möglich.«
»Warum behauptet er es dann?«
»Vergiss ihn«, riet Olivera. »Ich nehme an, die Marktaufseher werden ihn nicht lange gewähren lassen mit seinem Hokuspokus.« Sie wich den neugierigen Blicken der Nürnberger aus, die sie erkannten, und bahnte sich weiter einen Weg durch Frauen und Männer mit Traggestellen, Kinder mit Wasserkrügen und Handkarren voller Mehlsäcke.
»Denkst du, die Spitalmeisterin lässt mich wieder als Magd arbeiten?«, fragte Gerlin. Sie klang besorgt.
»Ich denke, sie sollte dankbar sein, dass du ihr die Augen über Pater Clemens geöffnet hast«, erwiderte Olivera.
»Aber er ist immer noch dort«, gab Gerlin zu bedenken. »Hätte er Greth nicht dazu gezwungen, ihm zu Willen zu sein …«
»Was passiert ist, lässt sich nicht mehr ändern«, fiel Olivera ihr ins Wort. »Alles Weitere wird sich ergeben.« Sie war sich selbst nicht sicher, ob die Spitalmeisterin tatsächlich einsichtig genug sein würde, um sie und Gerlin wieder ihre Arbeit verrichten zu lassen, aber diesen Gedanken behielt sie für sich.
»Falls ich meine Anstellung als Magd zurückbekomme, muss ich dann wieder im Spital schlafen?«, fragte Gerlin unsicher.
Olivera schüttelte den Kopf. »Keine Angst, du kannst dir weiter die Kammer mit Irmla und Jonata teilen«, entgegnete sie. Sie wusste, wovor Gerlin sich fürchtete. Der Priester hatte auch sie belästigt und versucht, sie zu erpressen, damit sie ihm stillschweigend Liebesdienste erwies. Allerdings war Gerlin klug genug gewesen, nicht auf seinen Erpressungsversuch einzugehen.
»Warum hat Gott ihn nicht längst für seine Sünden bestraft?«, wandte sich Gerlin nach einigen Augenblicken des Schweigens wieder an sie. Inzwischen hatten sie das Ufer der Pegnitz erreicht.
»Gottes Wege sind unergründlich«, murmelte Olivera. Auch sie hatte sich schon häufig gefragt, weshalb der Barmherzige oft so blind und grausam war, hatte jedoch gelernt, die Zweifel zu verbergen.
Sie verstummten, da in diesem Moment das Heilig-Geist-Spital vor ihnen auftauchte. Die spitzen Dächer warfen das Licht der Morgensonne gleißend zurück und vor dem großen Tor, das in den dahinterliegenden Hanselhof führte, herrschte der übliche Andrang. Fuhrknechte, Werkleute, Metzger, Mägde und Bedürftige warteten mehr oder weniger geduldig vor dem Wachhaus des Beschließers – des Torwächters – darauf, eingelassen zu werden. Wie immer lauerten zahlreiche zerlumpte Bettler in der Nähe des Tors, in der Hoffnung auf eine warme Mahlzeit und ein Bett für die Nacht. Obwohl viele von ihnen versehrt und abgemagert waren, wusste Olivera, dass der Großteil vom Beschließer abgewiesen werden würde. Der Platz im Spital war begrenzt, nur wer wirklich krank oder bedürftig war, wurde aufgenommen. Viele arme Teufel versuchten, dem Torwächter eine Krankheit vorzugaukeln, doch sie wurden ohne viel Federlesens vom Hof gewiesen.
Neben ihr trat Gerlin aufgeregt von einem Fuß auf den anderen.
»Keine Angst«, sagte Olivera leise. »Pater Clemens kann dir nichts mehr anhaben. Sieh einfach zu, dass du einen großen Bogen um ihn machst.«
»Wie soll ich das denn machen?«, zischte Gerlin. »Er hält die Predigten und ist bei jedem Stundengebet in der Spitalkirche.«
Olivera griff nach ihrer Hand. Sie war eiskalt.
»Ich bin immer in der Nähe«, versuchte sie, der jungen Frau Mut zu machen. Sie verdankte Gerlin fast genauso viel wie Jona. Ohne ihre Hilfe wäre sie vermutlich im Wald verblutet.
»Ich habe Angst«, gestand Gerlin.
Ich auch, hätte Olivera am liebsten geantwortet, doch sie biss sich auf die Zunge. Sie musste Stärke zeigen, dufte sich nicht anmerken lassen, wie tief das Misstrauen und die Furcht vor ihren mächtigen Feinden saßen. Während sie beruhigend Gerlins Hand drückte, fragte sie sich wie schon so oft seit Lukas’ Geburt, ob es nicht besser wäre, in eine andere Stadt zu ziehen und dort von vorn anzufangen.
»Gott, das dauert heute noch länger als sonst!«, unterbrach ein ungeduldiger Fuhrknecht ihre Gedanken. Sein Ochse drängte sich von hinten so dicht an Gerlin und Olivera heran, dass die beiden Frauen einen Schritt zur Seite machten. »Meine Milch wird sauer!«, schimpfte er lautstark.
Einige der Wartenden drehten sich kopfschüttelnd um.
»Verdammte Pfaffen!«, hörte Olivera den Mann brummen.
Sie warteten geduldig, bis die Reihe endlich an ihnen war. Mit gemischten Gefühlen trat Olivera vor den Torwächter.
»Sieh da«, sagte er, als er sie erkannte. »Die Salbenmacherin.« Er bedachte Gerlin mit einem kühlen Blick, dann runzelte er die Stirn. »Was wollt ihr hier?«
»Die Spitalmeisterin sprechen«, erwiderte Olivera.
»Erwartet sie euch?«
Olivera schüttelte den Kopf.
Der Beschließer zögerte.
»Was ist? Warum dauert das so lange?«, rief jemand hinter ihnen.
Einen Augenblick lang sah es so aus, als ob der Beschließer sie abweisen wollte, doch dann steckte er die Finger in den Mund und stieß einen Pfiff aus. Als ein Knabe herbeigelaufen kam, sagte er: »Bring sie zur Meisterin.« Mit einem Kopfnicken gab er ihnen zu verstehen, dass sie passieren konnten.
Als sie durch das große Tor in den Hanselhof traten, spürte Olivera, wie ihr Mund trocken und ihre Handflächen feucht wurden. Plötzlich stürmten Erinnerungen auf sie ein von dem Tag, an dem man sie verhaftet hatte. Mit einem Schlag stieg Übelkeit in ihr auf, aber sie zwang sich, sich nichts anmerken zu lassen. Denn ein Blick auf Gerlin verriet ihr, dass es ihrer Begleiterin keinen Deut anders erging.
Kapitel 4
Nürnberg, Mai 1410
Gerlin spürte, wie ihr die Kehle eng wurde und ihr Puls davonraste, als sie in die Schatten des riesigen Gebäudekomplexes eintauchten. Wie gewöhnlich war das Rauschen der Pegnitz hinter den langgestreckten Bauten deutlich zu hören, doch an diesem Tag hatte es keine beruhigende Wirkung auf sie. Zu ihrer Linken ragte der Turm der Spitalkirche in den blauen Himmel, fast wie ein mahnender Finger. Zu ihrer Erleichterung war auf den ersten Blick kein Priester in der Nähe auszumachen, allerdings herrschte im Hof das übliche geschäftige Treiben. Die Insassen des Spitals, die kräftig genug waren zu arbeiten, waren von der Meisterin zum Holzhacken, Kehren oder Wasserholen eingeteilt worden. Einige der stärkeren Männer halfen beim Entladen der Wagen und beim Verstauen der angelieferten Waren. Die Kranken und Schwachen hielten sich in der Siechenstube auf. Dort wachten Tag und Nacht die Kusterin und mehrere Mägde über sie, damit rechtzeitig nach einem Kaplan gerufen werden konnte, falls einer der Leidenden nach den Sakramenten verlangte. In den beiden größten, parallel angeordneten Gebäuden des Spitals befanden sich die Stuben. Daran grenzten je eine Küche für die Patienten der unteren und oberen Stuben an, ein Waschraum, eine Badestube für die Männer und eine für die Frauen und das heimliche Gemach für die Insassen. Außerdem waren hier die Unterkunft für Findlinge und Waisen, die Einrichtungen für die armen Pfründner und das Narrenhäuslein untergebracht.
Mit wild klopfendem Herzen folgte Gerlin Olivera über den Hof zu einem der Gebäude, in dem sich die Schreibstube der Spitalmeisterin befand. Was würde geschehen, wenn die Meisterin sie vom Hof jagte? Sie wusste, dass sie nicht ewig bei Götz und Olivera bleiben konnte, dazu gab es zu wenig Arbeit im Haus. Würde sie wieder auf der Straße landen? Oder noch schlimmer in einem Frauenhaus? Die Erinnerung an den Frauenwirt und die Liebesdienste, die sie zahllosen Freiern hatte leisten müssen, trieben ihr immer noch die Schamesröte ins Gesicht.
»Du bist eine Schande!«, hallte die Stimme ihres Vaters in ihren Gedanken nach. Er hatte einfach nicht verstehen können, dass es nicht ihre Schuld gewesen war, dass der Knecht sie gezwungen hatte … Sie blinzelte die schlimmen Erinnerungen beiseite und sandte ein Stoßgebet zum Himmel, ehe sie Olivera in das Gebäude folgte.
Wenig später standen sie vor einer schweren Eichentür.
Olivera hob die Hand, um anzuklopfen.
»Herein!«, erklang eine gedämpfte Stimme aus dem Inneren.
Gerlin wurden die Knie weich, als Olivera die Tür öffnete und ihr Blick auf die strenge Spitalmeisterin fiel. Das letzte Mal, als sie der Frau allein gegenübergestanden hatte, war diese so erbost gewesen, dass sie Gerlin vom Beschließer aus dem Spital werfen lassen wollte.
»Warum hast du Pater Clemens beschuldigt?«, hatte sie Gerlin empört gefragt. »Hast du einen Sündenbock gebraucht, weil du nicht wahrhaben wolltest, dass Greth ein loses Mädchen war? Dass sie sich selbst entleibt hat? Oder ist es, weil du selbst die Hurerei nicht aufgeben kannst?«
Die Worte hatten Gerlin mehr geschmerzt als Schläge, und als sie hinter Olivera den Raum betrat, wagte sie nicht, der Meisterin in die Augen zu blicken.
»Olivera!« Die Spitalmeisterin kam hinter ihrem Schreibtisch hervor. »Wie schön, dich zu sehen!«
Gerlin vergaß vor lauter Erstaunen ihre Furcht. Ungläubig hob sie den Kopf und verfolgte, wie die Meisterin auf Olivera zutrat, um sie in die Arme zu schließen. »Ich habe gebetet, dass Gott mir Gelegenheit gibt, mich bei dir für meine Torheit zu entschuldigen«, sagte sie. »Ich bin so froh, dich zu sehen! Wie geht es dir?«
Olivera schien ebenfalls mit ihrer Überraschung zu ringen, da sie einige Augenblicke brauchte, bevor sie antwortete. »Mir geht es gut, Meisterin, danke.«
»Und deinem Kind?«
»Gut«, erwiderte Olivera. »Ich bin gekommen, um Euch um Erlaubnis zu bitten, mich wieder um die Pfründner zu kümmern.«
Die Spitalmeisterin seufzte erleichtert. »Dem Himmel sei Dank«, murmelte sie. Dann fasste sie Olivera bei den Händen und schob sie auf einen Stuhl zu. »Setz dich.« Ihr Blick fiel auf Gerlin.
Die junge Frau spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Plötzlich fühlte sie sich wie eine Maus in der Falle. Als die Meisterin einen Schritt auf sie zumachte, wich sie furchtsam zurück.
»Bitte vergib auch du mir meine harten und ungerechten Worte, Gerlin«, sagte die Spitalmeisterin. »Ich habe mich in dir getäuscht und dir bitter Unrecht getan. Es hat einen weiteren Vorfall mit Pater Clemens gegeben, allerdings ist es mir bisher nicht gelungen, ihn aus dem Spital entfernen zu lassen.«
Gerlin schluckte trocken, brachte jedoch kein Wort hervor.
»Ich war verblendet von Hochmut und Stolz«, sagte die Spitalmeisterin. »Aber Gott scheint mir vergeben zu haben, da er euch zu mir geschickt hat.« Sie fasste auch Gerlin bei der Hand und führte sie zu einem zweiten Stuhl. Dann setzte sie sich an ihren Schreibtisch und faltete die Hände im Schoß. »Es ist einzig und allein meiner Torheit zuzuschreiben, dass so viele Insassen das Leben verloren haben«, sagte sie leise. »Wäre ich aufmerksamer gewesen, hätte ich früher die Anzeichen bemerkt …« Sie seufzte.
»Ihr tragt keine Schuld«, erwiderte Olivera. »Die einzig Schuldigen sind diejenigen, die die Taten begangen haben.«
»Du wärest beinahe gestorben«, entgegnete die Meisterin.
»Gott hat mich beschützt.« Sie warf Gerlin einen Blick zu. »Er hat mir einen Schutzengel geschickt.«
Gerlin errötete.
»Ich bitte Euch darum, Gerlin ihre Anstellung als Magd zurückzugeben«, fuhr Olivera fort.
Die Spitalmeisterin nickte. »Das ist das Mindeste, das ich tun kann.« Sie schloss einen Moment lang die Augen als würde sie ein stilles Gebet sprechen, dann öffnete sie eine Schublade, um etwas daraus hervorzuziehen.
Es war ein silbernes Kruzifix.
»Das hat Greth gehört«, sagte sie und hielt es Gerlin hin. »Sie hätte sicher gewollt, dass es jemand trägt, dem sie am Herzen lag.«
Gerlin starrte verunsichert auf das kleine Kreuz.
»Nimm es!«, drängte die Spitalmeisterin. »Für Greth kann ich nichts mehr tun.«
Gerlin zögerte einen Augenblick, bevor sie nach dem Anhänger griff und ihn sich mit unsicheren Händen umhängte. Sie war sich nicht sicher, ob das Kreuz sie beschützen würde, da sein Besitz Greth nicht davor bewahrt hatte, dem Teufel in Priestergestalt zum Opfer zu fallen.
»Die Kusterin und die Obermagd werden euch wissen lassen, wo ihr am dringendsten gebraucht werdet«, sagte die Meisterin, erhob sich und hielt den beiden Frauen zum Abschied erneut die Hände hin. »Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass ihr zurückgekommen seid«, seufzte sie. »Es scheint, als ob jeden Tag mehr Kranke und Bedürftige zu uns kommen. Und bitte zögert nicht, euch an mich zu wenden, falls es irgendwelche Probleme gibt. Dieses Mal werde ich mich gewiss nicht schuldig machen, indem ich zu hochmütig bin, um auf warnende Stimmen zu hören.«
Als Gerlin und Olivera die Stube verließen, schickte die Meisterin den Knaben zurück zum Torwächter, um ihn darüber zu informieren, dass die beiden Frauen ab jetzt wieder freien Zugang zum Spital hatten.
»Das hätte ich nicht erwartet«, gestand Olivera, sobald sie zurück im Hof waren.
»Ich auch nicht«, pflichtete Gerlin ihr bei. Es hatte sie überrascht, dass die Spitalmeisterin ihren Fehler und ihre Schuld so unumwunden eingestanden hatte. Als plötzlich die Glocke der Spitalkirche die halbe Stunde schlug, zuckte sie zusammen.
»Keine Angst«, ermutigte Olivera sie. »Früher oder später wird der Pfleger nicht umhin kommen, dafür zu sorgen, dass Pater Clemens versetzt wird. Dann brauchst du dich nicht mehr vor ihm zu fürchten.«
Gerlin hoffte, dass Olivera recht hatte. Denn auch wenn sie die Nächte nicht mehr im Spital verbringen musste, verstärkte sich die Angst vor einer Begegnung mit dem gewissenlosen Gottesmann mit jeder Minute, die sie innerhalb der Mauern des Heilig-Geist-Spitales zubrachte.
Kapitel 5
Nürnberg, Mai 1410
Als Olivera und Gerlin die Siechenstube betraten, schlug ihnen der Gestank von Schweiß, Kot und Urin bereits im Vorraum der großen Halle entgegen. Diese wurde von Säulenreihen in zwei gleich große Bereiche geteilt, in denen die Männer und die Frauen untergebracht waren. Bettkasten reihte sich an Bettkasten, und viele der Kranken schrien vor Schmerz oder stöhnten leise vor sich hin. Die weiß getünchten Wände der Stube wurden nur hie und da von schmalen Fensterschlitzen unterbrochen, durch die etwas Sonnenlicht auf den sauber gefegten Boden fiel. Von einer Kanzel am Kopfende des langen Raumes konnte ein Kaplan die Messe für die Bettlägerigen lesen. An diesem Tag herrschte in der Stube regeres Treiben als sonst zu dieser Uhrzeit, da ein Mann, den Olivera für den neuen Medicus hielt, mit der Musterung der Kranken beschäftigt war.
Er war schlank und hochgewachsen, steckte in einem knielangen schwarzen Gewand und hatte eine schlichte Kappe auf dem Kopf. Mit gerunzelter Stirn schnupperte er an einem Gefäß, in dem sich vermutlich der Harn der Frau befand, an deren Bett er stand. Sie war vollkommen entkleidet. »Ihre Haut ist warm und trocken«, hörte Olivera den Medicus sagen. »Das Abdomen schlaff, ohne Verhärtungen.«
Die Frau, die neben ihm stand und auf die Kranke hinabsah, erkannte Olivera als die Kusterin.
Der Medicus griff nach dem Arm der Frau und beugte ihn, danach folgten die Beine. »Mach den Mund auf!«, befahl er.
Die Patientin gehorchte.
Nachdem er ihren Rachen und ihre Zunge untersucht hatte, fasste er nach ihrem Handgelenk. »Regelmäßiger Aderschlag«, stellte er fest. »Spuck in dieses Tuch!« Er hielt der Frau ein weißes Stück Stoff vor den Mund. Nachdem er es sich an die Nase gehalten hatte, nickte er versonnen. »Sie ist genesen«, ließ er die Kusterin wissen. »Sie kann entlassen werden.« Ohne auf eine Antwort zu warten, ging er weiter zum nächsten Bett, in dem sich eine ältere Frau vor Schmerzen wand. Er rümpfte die Nase, griff nach dem Nachttopf neben ihrem Bett und roch daran, ehe er mit einem kleinen Stäbchen darin herumstocherte. »Dreht sie um«, bat er zwei der Mägde, welche die Kusterin und ihn begleiteten.
Olivera verbarg sich im Schatten einer Säule und beobachtete, wie er das Rektum der Kranken untersuchte und danach ihren Bauch abtastete. »Ihr Krebs ist gewachsen«, stellte er schließlich fest. »Gebt ihr etwas gegen die Schmerzen.«
Olivera zog die Brauen hoch. Der Vorgänger des Mannes hätte nie und nimmer den Einfall gehabt, teure Arzneien an die armen Kranken zu verschwenden. Sie hatte sich oft heimlich in die Siechenstube geschlichen, um das Leid der Sterbenden zu lindern, zum maßlosen Ärger ihres Widersachers.
Als der Arzt sich aufmachte, um den nächsten Insassen zu untersuchen, fiel der Blick der Kusterin auf Gerlin und Olivera. Ein strahlendes Lächeln erhellte ihr müdes Gesicht. »Olivera! Dem Herrn und allen Heiligen sei Dank!« Sie ließ den Medicus stehen und eilte auf die Frauen zu. »Ich habe für dich gebetet«, sagte sie und drückte Oliveras Hand. Gerlin schenkte sie ebenfalls ein Lächeln. »Und deine geschickten Hände brauchen wir mehr als dringend. Melde dich bei der Obermagd, sie ist in der Badestube der armen Pfründner.«
Gerlin nickte und machte sich auf den Weg zu einem gewölbten Durchgang, durch den man in den hinteren Teil des Hofes gelangte. Von dort war es nicht weit bis zu den Badestuben.
»Die Meisterin schickt mich zu dir«, erwiderte Olivera.
Die Miene der Kusterin verdunkelte sich. »Hat sie …?«
»Es ist schon gut«, fiel Olivera ihr ins Wort, da sie ahnte, was die Kusterin sagen wollte. »Was geschehen ist, war Gottes Wille.«
Die Kusterin brummte etwas Unverständliches, dann sah sie zum Medicus, der sich inzwischen in den Bereich der männlichen Insassen begeben hatte. »Ich denke, du solltest unseren neuen Arzt kennenlernen«, sagte sie.
Olivera spürte einen Stich der Unsicherheit im Magen. Was, wenn er ihr ebenso feindlich gesinnt war wie der Mann, der beinahe dafür gesorgt hatte, dass sie als Todesengel hingerichtet worden wäre?
Die Kusterin schien ihre Gedanken zu lesen. »Er ist sorgfältig und bescheiden«, ließ sie Olivera wissen. »Gewiss wird er dankbar sein für deine Erfahrung als Salbenmacherin. Soviel ich weiß, kauft er seine Arzneien ohnehin bei euch ein.«
Olivera nickte. Bisher hatte sie ihn noch nicht persönlich zu Gesicht bekommen.
»Komm!«, forderte die Kusterin sie auf.
Mit einer Mischung aus Neugier und Widerwillen folgte Olivera ihr zum Bett eines Greises, dessen Mund sich in einem zahnlosen Gähnen öffnete.
»Das ist Olivera, die Salbenmacherin«, stellte die Kusterin sie vor, sobald sie das Bett erreicht hatten.
Aus der Nähe wirkte der Arzt noch hagerer als aus der Entfernung. Sein Gesicht war lang und schmal, die braunen Augen blickten sanft auf Olivera hinab. Er war jung, doch etwas in seinem Gesicht verriet, dass er schon zu viel Leid gesehen hatte. Er hielt ihr eine seiner großen, knochigen Hände hin. »Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Matthäus.«
Olivera zögerte erstaunt, ehe sie seinen Handschlag erwiderte. Sie hatte erwartet, dass er ebenso abweisend und hochmütig sein würde wie sein Vorgänger, doch Matthäus schien das vollkommene Gegenteil des alten Medicus zu sein.