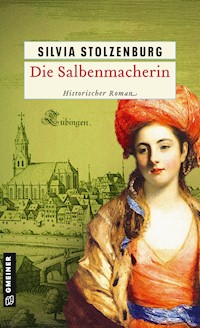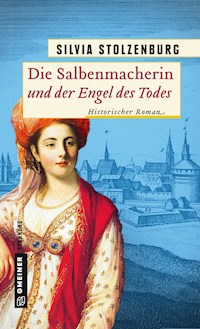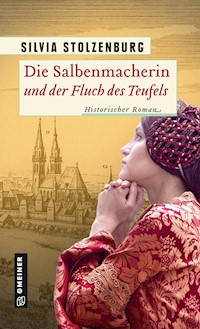Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Meisterbanditin
- Sprache: Deutsch
Die Welt der siebzehnjährigen Marie bricht jäh zusammen, als der Sohn eines wohlhabenden Bauern ihr eröffnet, dass er eine andere heiraten wird. Durch die Demütigung vom väterlichen Hof getrieben, tritt Marie in die Dienste der Mätresse des Herzogs von Württemberg ein. Als Dienstmagd auf Schloss Brenz muss sie sich der Nachstellungen des herzoglichen Jägers erwehren, der sie des Diebstahls bezichtigt. Anstatt sie zu bestrafen, schlägt Wilhelmine ihr vor, sich einer Truppe von fahrenden Schauspielern anzuschließen und für sie zu spionieren. Marie willigt ein und gerät dadurch schon bald in einen Strudel aus tödlichen Intrigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Stolzenburg
Die Meisterbanditin
Historischer Kriminalroman
Impressum
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München)
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Das Erbe der Gräfin (2018), Die Launen des Teufels (2018), Das dunkle Netz (2018),
Die Salbenmacherin und die Hure (2017), Blutfährte (2017), Die Salbenmacherin und der Bettelknabe (2016), Die Salbenmacherin (2015)
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © wikipedia.org/wiki/File:Gerrit_van_Honthorst_(Dutch_-_Musical_Group_on_a_Balcony_-_Google_Art_Project.jpg
ISBN 978-3-8392-5776-0
Widmung
Für Eumel. Und mich.
Prolog
Ein Herrensitz im Herzogtum Württemberg, Ende Juli 1721
Das Herz der jungen Zofe hämmerte so heftig, dass sie das Gefühl hatte, es wolle zerspringen. Mit angehaltenem Atem kauerte sie in einem der engen Gänge hinter dem offenen Kamin im Salon des Jagdschlosses, in dem sie angestellt war. Direkt vor ihr tanzten Flammen, schienen nach ihr zu züngeln und zu lecken. Die Luft in dem beengten Raum war heiß und voller Ruß, und sie fürchtete, sich mit einem Husten zu verraten. Die Hand auf den Mund gepresst, lugte sie durch das Gitter am Feuer vorbei in den prunkvoll ausgestatteten Raum auf der anderen Seite des Kamins. Das Licht der Sonne fiel durch die Fenster herein und malte Schatten auf den gewachsten Holzboden. Das Gold der Türbeschläge und ein fetter Stuckengel spiegelten sich in einem Teil des Bodens, der auf Hochglanz poliert war. Ein dunkelroter Brokatvorhang bewegte sich leicht im Wind, der durch ein geöffnetes Fenster hereinwehte. In weiter Ferne war wütendes Gebell zu hören.
Zwei Männer waren im Blickfeld des Mädchens. Allerdings ließen die Stimmen vermuten, dass sich noch zwei weitere Personen im Salon aufhielten.
Sie sprachen leise, zu leise, um genau zu verstehen, was sie sagten. Lediglich einige Wortfetzen drangen an das Ohr des Mädchens, aus denen es sich jedoch keinen Reim machen konnte. Worum ging es bei dem Treffen? War es überhaupt wichtig? Oder unterhielten die Männer sich über die nächste Jagd, die Hunde, mit denen sie das Wild zu Tode hetzen wollten?
Obwohl der Rauch dafür sorgte, dass ihr die Augen tränten, rückte die Zofe noch näher an das Gitter.
»Woher weißt du das?«, hörte sie einen der Anwesenden fragen.
»Das ist nicht wichtig.«
»Wer sagt, dass es keine Lüge ist?«
»Der Überbringer der Nachricht ist absolut vertrauenswürdig. Es gibt keinen Zweifel.«
Einen Augenblick sagte niemand etwas. Dann ertönte ein wüster Fluch. »Diese Kanaille!«
Der Ausruf war so laut, die Stimme so nah, dass die junge Frau erschrocken von dem Gitter zurückwich und unbedacht die Luft einzog. Augenblicklich stach ihr der Rauch in die Lunge und ließ sie nach Atem ringen.
»Was war das?«
Die Zofe vergrub den Kopf in der Armbeuge, um den Hustenreiz zu unterdrücken. Aber der Schaden war bereits angerichtet.
»Das kam von hinter dem Kamin!«, rief ein Bass aus.
»Da belauscht uns jemand! Worauf wartet ihr? Schnappt ihn euch!« Die Stimme, die den Befehl gab, war so kalt, dass der jungen Frau die Furcht in die Glieder fuhr.
In blinder Hast kehrte sie der Luke den Rücken, kroch durch den engen Gang und drückte die Tür an dessen Ende auf. Immer noch nach Luft ringend, stolperte sie auf den Korridor hinaus. Die Angst war wie eine Klaue, die nach ihrem Herzen griff. Voller Panik wandte sie sich zur Flucht und versuchte, nicht daran zu denken, was sie erwartete, falls die Männer sie einholten.
Hinter ihr schlug eine Tür.
»Da vorn!«
Während die Angst drohte, ihr die Kehle zuzuschnüren, rannte sie auf eine der Dienerschaftstreppen zu, die in den Schlosshof führte. Ohne auf die verwunderten Blicke der Lakaien zu achten, raffte sie ihre Röcke und hastete die Stufen hinab. Im Schlosshof jagte sie an einem Fuhrwerk und drei Reitern vorbei und floh über die Zugbrücke den Hügel hinab in Richtung des Waldrandes, der eine halbe Meile weiter östlich Schutz versprach.
Sie wagte nicht, sich umzusehen. Während ihre Seiten anfingen zu stechen, kletterte sie über ein Gatter und rannte so schnell sie konnte über eine Futterwiese. Heilige Muttergottes, steh mir bei, flehte sie in Gedanken. Wenn es ihr gelang, den Wald zu erreichen, konnte sie sich vielleicht vor ihren Verfolgern verstecken. Das Wiehern eines Pferdes ließ sie herumwirbeln und um ein Haar den Halt verlieren.
Vier Reiter galoppierten hinter ihr den Schlosshügel hinab und setzten wenig später über das Gatter. Einer der Männer im Sattel zog einen Säbel, dessen Klinge im Sonnenlicht aufblitzte. Mit einem erstickten Laut setzte die Zofe ihre Flucht fort. Allerdings schnitten ihr die Verfolger schon bald den Weg zum Wald ab und hetzten sie weiter nach Süden auf den Seitenarm eines Flusses zu.
»Hör auf wegzurennen!«, brüllte einer von ihnen. »Wir holen dich ohnehin ein.«
Aber sie dachte nicht im Traum daran stehen zu bleiben. Wenn sie sich den Männern ergab, würden sie sie zurück zum Jagdschloss bringen und befragen. Sobald sie ihnen gesagt hatte, was sie wissen wollten, würden sie sie entweder in einem tiefen Loch verrotten lassen oder umbringen.
»Sie versucht, die Brücke zu erreichen!«, warnte ein zweiter Reiter, als die junge Frau auf einen der schmalen Stege zulief, über die die Ziegenhirten ihre Tiere trieben.
Nur noch ein Steinwurf trennte sie von dem rettenden Übergang, als der Mann mit dem Säbel an ihre Seite galoppierte und ihr mit dem Knauf der Waffe einen brutalen Hieb versetzte. Der Schmerz war wie eine Explosion in ihrem Kopf. Mit einem Schrei sackte sie in die Knie und blieb einen Augenblick benommen liegen.
Lange genug für ihren Verfolger, um aus dem Sattel zu springen und ihr die Waffe auf die Brust zu setzen.
»Warte!«, hörte das Mädchen einen der anderen Männer rufen. »Warum willst du dir die Hände schmutzig machen?«
»Sie hat uns belauscht!«
»Gewiss. Aber wenn du sie damit tötest …« Er brach den Satz ab.
Die Benommenheit war wie ein zäher Nebel. Mit einem Stöhnen versuchte die junge Frau, sich zu bewegen, doch der Stiefel eines der Reiter nagelte sie am Boden fest.
»Bring sie zum Fluss.«
Als sich Hände unter ihre Achseln schoben und sie grob in die Höhe zerrten, kehrte die Panik mit voller Gewalt zurück. »Lasst mich los!«, flehte sie. Vergeblich versuchte sie, sich aus dem eisernen Griff zu befreien.
Ein freudloses Lachen war die einzige Antwort. Dann wurde sie zum Flussufer geschleppt und auf die Knie gezwungen. Eine Hand packte sie im Nacken.
»Das passiert mit Spionen«, knurrte der Mann hinter ihr, ehe er sie nach vorn drückte und ihren Kopf unter Wasser tauchte.
Kapitel 1
Das Dorf Brenz im Herzogtum Württemberg, August 1721
»Komm schon, tanz mit mir!« Die 17-jährige Marie wischte sich atemlos über die Stirn. Die Hitze des Sommertages lag noch in der Luft, obwohl die Sonne bereits hinter den Baumwipfeln am Horizont verschwand. Vermutlich würde auch diese Nacht nur wenig Abkühlung bringen. Doch heute war es ihr und allen anderen Dorfbewohnern egal, ob die Wolken Regen brachten oder nicht. Sie sah zu dem jungen Mann auf, der sie um Haupteslänge überragte. Seine dunklen Augen lagen im Schatten eines Strohhutes, den er tief in die Stirn gezogen hatte. Seine breiten Schultern spannten den Stoff des dünnen Sommerhemdes, über dem er eine Weste trug. Er stand unter einer Kastanie am Rand der Festwiese und kaute auf einem Grashalm herum. In Maries Augen wirkte er mürrisch. »Warum versteckst du dich vor mir? Ich suche schon den halben Abend nach dir.« Es war als Scherz gedacht, doch die Röte, die dem jungen Mann in die Wangen schoss, ließ Maries Ausgelassenheit verpuffen. »Was ist los?«, fragte sie. Sie sah sich auf der Wiese um, die zum Anlass des Erntefestes mit bunten Fähnchen und Lichtern geschmückt war. Überall wirbelten zum wilden Spiel der Pfeifer, Fiedler und Trommler die Tänzer durcheinander. Die Frauen hatten sich ebenso herausgeputzt wie die Männer, und die Anstrengung der vergangenen Tage und Wochen schienen mit jedem Reigen weiter von ihnen abzufallen. So wie Marie hatten auch die anderen Bauerstöchter, Mägde und Ehefrauen ihre besten Kleider angelegt. Die Männer wirkten ebenfalls frisch und sauber. Nichts erinnerte mehr an den Staub und den Schmutz der Ernte und des Dreschens. Es war ein gutes Erntejahr, weshalb das Fest in diesem Sommer üppiger ausfiel als in den vergangenen drei Jahren.
Ihr Gegenüber trat von einem Fuß auf den anderen und spuckte den Grashalm aus.
»Sag schon, was ist los?«, hakte Marie nach. »Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen?« Sie schielte auf den Tonkrug, der nicht weit entfernt von ihm im Gras lag. »Oder hast du zu viel Bier getrunken?« Sie schnüffelte wie ein Hund. Allerdings überdeckte der Duft der abgeernteten Felder alles andere – selbst den Gestank der Schweinekoben des Bauern, dessen Gehöft an die Festwiese angrenzte. Als er immer noch nicht antwortete, zupfte sie ihn ungeduldig am Ärmel. »Bartholomäus, kannst du mich hören?«
»Ja doch«, brummte er. »Ich bin nicht taub.«
»Dann komm schon. Ich will mit dir tanzen!« Marie versuchte, ihn aus dem Schatten der Kastanie zu ziehen, um sich mit ihm unter die Tanzenden zu mischen.
Aber er sträubte sich. »Ich kann nicht«, murmelte er.
»Wie bitte? Wieso kannst du nicht? Hast du dich beim Dreschen verrenkt?«
Er schüttelte den Kopf und schob den Strohhut nach hinten, um sich an der Schläfe zu kratzen.
Marie kannte diese Geste, schließlich hatten sie und Bartholomäus schon als Kinder zusammen gespielt. Immer wenn er unsicher war oder etwas ausgefressen hatte, kratzte er sich auf diese Art. »Was ist passiert?« Ein ungutes Gefühl nistete sich in ihrer Magengrube ein, als Bartholomäus die Lippen aufeinanderpresste.
»Ich …«, hob er an, schüttelte dann aber den Kopf und fuhr sich mit den Handflächen übers Gesicht. »Ich kann nicht mit dir tanzen«, presste er schließlich hervor. »Nicht heute und auch in Zukunft nicht.«
Marie glaubte ihren Ohren nicht zu trauen. »Was? Willst du mich zum Narren halten? Wieso nicht?«
Bartholomäus senkte den Blick und scharrte mit den Schuhspitzen auf dem Boden herum. »Weil es nicht geht«, sagte er leise.
Marie war wie vom Donner gerührt. Diese plötzliche Schüchternheit konnte nur eines bedeuten. Allerdings war allein der Gedanke daran, was hinter Bartholomäus’ Weigerung stecken musste, genug, um Übelkeit in ihr aufsteigen zu lassen. Sie schüttelte ungläubig den Kopf. »Willst du mir sagen, dass du …?«
»Ich werde Gisela heiraten«, fiel er ihr ins Wort.
Marie sah ihn fassungslos an. »Die Tochter vom Pferdebauern?«
»Wir haben auch Pferde«, gab Bartholomäus trotzig zurück.
»Als ob das wichtig wäre!« Marie spürte, wie sich die Übelkeit in Wut verwandelte. »Seit wann weißt du das?«, fragte sie eisig. Erst vor einer Woche hatte er ihr am Fluss noch ein Armband aus Gras geschenkt und ihr einen Kuss gestohlen. Niemals hätte sie daran gezweifelt, dass sie es war, die er heiraten würde.
»Seit Sonntag«, brummte er.
Marie wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Zwar hatte Bartholomäus noch nicht bei ihrem Vater um ihre Hand angehalten, aber für sie war es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie mit ihm vor den Traualtar treten würde. Ihre Mutter erwartete dasselbe, dessen war sie sich sicher. Mehr als einmal war beim Waschen oder Garnspinnen die Rede auf Bartholomäus gekommen, und Maries Schwestern hatten albern gekichert. Was würden sie jetzt sagen, wenn er sie fallen ließ wie eine faulige Frucht? Sie spürte, wie ihr die Schamesröte ins Gesicht schoss. »Seit Sonntag?«, flüsterte sie. »Und du hast es nicht für nötig gehalten, es mir vorher zu sagen?«
Er hob den Kopf und funkelte sie trotzig an. »Du bist nicht meine Frau!«
»Nein. Deine Versprechungen waren offenbar nichts als Lügen.«
»Ich habe dir nichts versprochen.«
Als er die Arme vor der Brust verschränkte und über ihren Kopf hinweg zu den Tanzenden sah, zerbarst etwas in Marie. Mit einem Keuchen holte sie aus, versetzte ihm eine gewaltige Ohrfeige und stürmte in die Dämmerung davon, ehe ihre Tränen sie vor ihm demütigen konnten.
»Marie!«, rief er ihr hinterher.
Aber sie hörte weder ihn noch die immer wilder aufspielenden Musikanten. Blind vor Zorn und Ohnmacht, rannte sie über die abgeernteten Felder, bis sie den Festplatz weit hinter sich gelassen hatte. Dann steuerte sie auf das Flussufer zu und ließ sich mit einem Schluchzen unter einer Pappel auf den Boden fallen. Dass ihr gutes Kleid dabei schmutzig wurde, nahm sie nicht wahr. Während sich ihre Hände zu Fäusten ballten, liefen die Tränen ihre Wangen hinab, tropften auf ihre Schürze und versiegten im Stoff. Wie hatte sie nur so dumm sein können, Bartholomäus zu glauben, dass er sie liebte? Ihr Zwerchfell verkrampfte sich, und sie zog die Beine an, schlang die Arme um die Knie und vergrub das Gesicht in ihren Röcken. Wie ein Kind wiegte sie sich hin und her, während die Tränen unaufhaltsam weiterflossen. Sie wusste nicht, wie lange sie so dagesessen hatte. Doch irgendwann versiegten ihre Tränen, und die Trauer wich einer unbeschreiblichen Leere. Sie hob den Kopf und wischte sich trotzig mit dem Ärmel über die Augen. Sie würde nicht weiterheulen wie ein kleines Mädchen, weil Bartholomäus mit ihren Gefühlen gespielt hatte. Er war ihre Tränen nicht wert! Es gab andere Männer im Dorf. Sie hob einen Stein vom Boden auf und schleuderte ihn in die Brenz. Eine Forelle suchte das Weite. Wehmütig sah sie dem Fisch hinterher und wünschte sich, sie wäre ebenso frei, könnte hingehen, wohin immer sie wollte. Doch das war ein Traum, der niemals in Erfüllung gehen würde. So wie der Traum von einer besseren Zukunft mit Bartholomäus, dachte sie bitter. Wie hatte sie nur so töricht sein können zu denken, dass Bartholomäus die Tochter eines Kleinbauern heiraten würde? Vermutlich hätte ihr Vater ohnehin nicht die nötigen Mittel für eine Mitgift aufgebracht. Wenn sein Vater starb, würde Bartholomäus das Hofgut erben, die 15 Morgen Land, die Rinder, Pferde, Schweine und Schafe. Die Wut kehrte zurück und ließ sie die Zähne aufeinanderbeißen. Ausgerechnet Gisela! Diese hässliche Kuh. Wenn er sie wenigstens wegen einer Schönheit betrogen hätte, wäre die Demütigung nicht so ungeheuer. Aber Gisela … Sie schnaubte und kam mit einer Verwünschung auf die Beine, die den Dorfpfarrer entsetzt hätte. Allerdings war der Dorfpfarrer auf dem Erntefest, so wie alle anderen Bewohner von Brenz – die Bauern, Tagelöhner, Fuhrleute, Holzfäller, Dorfhandwerker, Knechte und Mägde. Sogar einige Bedienstete aus dem Schloss hatten den Weg zur Festwiese gefunden, obwohl die Gräfin zurzeit in Brenz weilte. Während sie versuchte, nicht weiter an Bartholomäus und Gisela zu denken, trat Marie so dicht ans Ufer, dass das Wasser ihre Schuhspitzen benetzte. Obwohl sie wusste, dass sie sich damit nur quälen würde, beugte sie sich vor und betrachtete ihr Spiegelbild. Ein verheultes Gesicht blickte ihr entgegen. Ihre blauen Augen waren gerötet, das dunkle Haar zerzaust. Der sorgfältig geflochtene Zopf hatte sich gelöst, sodass mehrere Strähnen unter der kleinen Haube auf ihrem Kopf hervorlugten. Ihr Mund wirkte unnatürlich rot in dem bleichen Gesicht. Auf ihrer Nase und den Wangenknochen zeichneten sich die Sommersprossen ab, die ihr jedes Jahr aufs Neue Verdruss bereiteten. Trotzdem sahen ihr die Männer im Dorf hinterher. Wäre sie nicht so einfältig gewesen, Bartholomäus’ Versprechungen zu glauben, wäre sie gewiss längst unter der Haube. Sie spuckte ins Wasser und trat vom Ufer zurück. »Hätte, wäre, könnte«, murmelte sie. Damit konnte sie nichts anfangen. Sie war 17 Jahre alt! Wenn sie nicht als alte Jungfer enden wollte, musste sie schleunigst zusehen, dass ein anderer sich in sie verliebte. Sie straffte die Schultern und biss die Zähne aufeinander. Dann ging sie zurück zur Festwiese, um sich auf die Suche nach einem geeigneten Kandidaten zu machen.
Kapitel 2
Das Dorf Brenz im Herzogtum Württemberg, August 1721
Als Marie am nächsten Morgen aufwachte, tat ihr der Kopf weh. Obwohl sie so gut wie nichts getrunken hatte, brummte ihr Schädel, als ob sie es den Männern gleichgetan hätte. Die hatten bis spät in die Nacht hinein gezecht und gelärmt, während die Frauen sich frühzeitig zurückgezogen hatten. Mit einem Stöhnen setzte Marie sich auf und fasste sich an die Schläfen.
»Du hast wohl den Katzenjammer?«, fragte ihre Schwester Anna, mit der sie das Bett teilte. Sie war drei Jahre jünger als Marie, genauso schlank, aber mit hellerem Haar. Auch aus ihrem Gesicht blitzten blaue Augen. Allerdings tummelten sich auf ihrer Nase keine Sommersprossen.
»Wovon denn?«, fragte Marie übellaunig. »Ich habe nur zwei Becher Bier getrunken.« Sie schnitt eine Grimasse und schwang die Beine aus dem Bett. Vermutlich hatte ihr der Schlaf den Kopfschmerz beschert, da Bartholomäus und Gisela sie bis in ihre Träume verfolgt hatten. Ihre trotzige Entschlossenheit, sich einen anderen jungen Mann zu suchen, hatte nicht lange angehalten, und sie hatte sich früh vom Fest zurückgezogen. Jeder Blick, jedes Tuscheln der anderen Frauen schien sich auf sie zu beziehen. Am Ende hatte Marie es nicht mehr ausgehalten und war nach Hause geflohen.
Sie stand auf und ging zu dem Schemel, auf dem sie ihre Alltagskleider abgelegt hatte. Das Hemd, das sie auch als Nachthemd getragen hatte, behielt sie an und schlüpfte in ihren Rock. Über dem Hemd schnürte sie ein einfaches Mieder. Nachdem sie sich in ihre Strümpfe gekämpft hatte, griff sie nach ihren Schuhen und der Schürze, die das Kleid vor dem Schmutz der Hausarbeit schützen sollte. Auch wenn gestern Erntefest gefeiert worden war, bedeutete das nicht, dass die Arbeit ruhen konnte. Wie jeden Tag würden Marie und ihre Schwestern ihrer Mutter beim Kochen, Waschen und Putzen helfen. Außerdem musste Brot gebacken, die Milch verarbeitet, Fleisch gepökelt und Flachs gesponnen werden, damit daraus Leinen gewebt werden konnte.
An diesem Tag war es Maries Aufgabe, mit der schmutzigen Wäsche zum Waschhaus zu gehen. Obwohl es sich um harte Arbeit handelte, war Marie froh, dem Haus wenigstens für eine Weile entkommen zu können. Sie war sicher, dass ihre Mutter ihr sonst an der Nasenspitze ansehen würde, dass etwas nicht stimmte.
So wie Anna.
»Was ist mit dir?«, fragte ihre Schwester, während sie es Marie gleichtat und in ihre Kleider schlüpfte.
»Nichts«, log Marie. »Es ist nur das Kopfweh.«
Anna beäugte sie misstrauisch. »Hat es etwas mit Bartholomäus zu tun?«, fragte sie listig.
Marie runzelte die Stirn. »Wie kommst du denn darauf?« Sie spürte, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte.
Anna lachte. »Denkst du, ich bin blind?«
»Du bist 14«, gab Marie mürrisch zurück.
»Das bedeutet nicht, dass ich nicht gesehen habe, wie du ihm eine runtergehauen hast.«
»Was?«
Ihre Schwester stemmte die Hände in die Hüften und nickte. »Und dann bist du weggerannt«, sagte sie.
»Hast du mir nachspioniert?«, wollte Marie empört wissen.
Anna schüttelte den Kopf. »Ich …« Sie errötete.
Marie begriff. Ihre Schwester hatte mit einem der Bauernsöhne ein stilles Plätzchen gesucht, um sich ebensolche Torheiten anzuhören, wie sie selbst sie von Bartholomäus zu hören bekommen hatte. »Lass die Finger von den Burschen«, sagte sie, um von sich abzulenken. »Das gibt nur Ärger.«
Anna lachte. »Das sagst ausgerechnet du.«
»Wer weiß noch davon, dass Bartholomäus und ich Streit hatten?«, fragte Marie. Die Blicke und das Tuscheln auf der Festwiese konnten kein Zufall gewesen sein.
Anna zuckte die Achseln. »Das halbe Dorf«, sagte sie ungerührt.
Marie wäre am liebsten im Erdboden versunken. »Mutter auch?«
»Woher soll ich das wissen?«, wich ihre Schwester aus. »Die Älteren sitzen beim Fest an einem anderen Tisch.«
Marie war klar, dass es sich um eine Ausrede handelte. Sie spürte, wie sich die Scham, die sie bereits am Vortag empfunden hatte, verstärkte. Wie sollte sie jetzt noch einen anderen Mann finden? Wenn das ganze Dorf über sie tratschte? Kein Bauernsohn, nicht einmal ein Knecht oder Tagelöhner, würde so töricht sein, eine Frau zu nehmen, die ein anderer abgelegt hatte wie ein altes Kleidungsstück. Auch wenn zwischen ihr und Bartholomäus nicht viel passiert war außer ein paar leidenschaftlichen Küssen, würde man sie spätestens ab seiner Hochzeit mit Gisela im Dorf verachten. Sie stöhnte, ließ sich auf die Matratze fallen und vergrub das Gesicht in den Händen. Wenn sie keinen Bräutigam fand, blieb ihr nichts anderes übrig, als sich möglichst schnell bei einem anderen Bauern als Magd zu verdingen. Ewig würde ihr Vater sie nicht durchfüttern. Allein die Vorstellung, Gisela dauernd beim Kirchgang sehen zu müssen, wie sie an Bartholomäus’ Seite dahinstolzierte, ließ sie wünschen, sie sei tot. Der Klatsch im Dorf würde die Demütigung noch verschlimmern. Wenn sich doch nur der Boden unter ihr auftun und sie verschlingen würde! Dann wäre sie von ihrem Elend erlöst.
»Wo bleibt ihr denn?«, riss die ungeduldige Stimme ihrer Mutter sie aus den Gedanken. »Muss ich euch Beine machen?« Der fadenscheinige Vorhang, mit dem der Schlafbereich des Hauses von der Küche und dem Verschlag für die Hühner abgetrennt war, wurde zur Seite geschoben. »Trödelt nicht so herum.« Als der Blick der Bäuerin auf Marie fiel, vermeinte das Mädchen, eine Mischung aus Mitleid und Ärger darin zu lesen. Allerdings verlor ihre Mutter kein weiteres Wort.
Mit schweren Gliedern erhob Marie sich, setzte ihre Haube auf und folgte ihrer Schwester zur Feuerstelle, die sich direkt auf dem Boden befand. Dort köchelte ein Getreidebrei vor sich hin, den ihre Mutter in zwei Holzschalen füllte und auf den Tisch stellte. Die Funken wurden von einem uralten Funkenhut gesammelt, der Rauch zog frei nach oben ab, räucherte das Fleisch und die Fische auf dem Dachboden und vertrieb das Ungeziefer. Trotz des Funkenhuts und der offenen Tür hing der Qualm dick in der Stube.
»Die anderen sind schon längst fertig«, schalt Maries Mutter.
Marie stocherte lustlos in ihrem Essen herum, während Anna ihren Brei hungrig verschlang. Da sie beim Erntefest kaum etwas gegessen hatte, zwang sie sich schließlich, die Schale auszulöffeln. All die Zeit über hielt sie den Blick gesenkt, um ihrer Mutter nicht in die Augen sehen zu müssen. Als sie fertig war, wischte sie die Schale aus, hängte sie zurück an den Haken über der Kochstelle und suchte die Schmutzwäsche zusammen. Nachdem sie sie in einen Weidenkorb geworfen hatte, verließ sie das Haus.
Die Männer waren bereits bei der Arbeit, um Heu für das Vieh einzubringen. Auch wenn mit dem Erntefest der härteste Teil der Feldarbeit endete, bedeutete dies nicht, dass die Bauern sich auf die faule Haut legen konnten. Bald würde wieder gepflügt, geeggt und gedüngt werden, damit das Wintergetreide rechtzeitig ausgesät werden konnte.
Mit gesenktem Kopf huschte Marie über den Hof, den Weidenkorb fest an ihre Hüfte gedrückt, und atmete auf, als sie die Dorfstraße erreichte. Dort wirbelte eine Kutsche, die in Richtung Schlosshügel holperte, Staub auf. Obwohl der Hügel, auf dem sich das Schloss und die Galluskirche erhoben, fast eine Meile von ihrem Heim entfernt war, konnte Marie die Gebäude bereits sehen: das weiß getünchte Schloss mit seinen spitzen roten Dächern und den beiden Türmen und die streng wirkende, aus grauem Stein erbaute Kirche, um deren Zwiebelturm zwei Störche kreisten. Weit und breit war der Hügel die einzige Anhöhe, und angeblich konnte man von den Türmen des Schlosses das Kloster in Obermedlingen erkennen.
Marie richtete den Blick zurück auf den Boden und setzte ihren Weg zur Dorfmitte fort. Bereits nach wenigen Schritten begann der Schweiß auf ihrer Haut zu prickeln. Die Sonne stach schon wieder aus einem strahlend blauen Himmel, und es würde vermutlich noch heißer werden als am Vortag. In den Wipfeln der Bäume schimpften die Spatzen, als ob sie sich über die andauernde Hitze beschweren wollten. Schwalben trieben ein wildes Spiel rings um die Dächer der Scheunen und Häuser, fingen Insekten aus der Luft und vollführten Kunststücke. In den Gärten und auf den Wiesen tanzten Schmetterlinge und Bienen um die Blüten. Der Duft des Korns lag immer noch schwer in der Luft. Er vermischte sich mit dem Geruch des Staubes, der Marie in die Nase stach, als sie der Kutsche folgte. Vorbei an größeren und kleineren Gehöften, den Häusern der Tagelöhner und den Katen der Hirten, gelangte sie schließlich zum Marktplatz. Dort wandte sie sich nach Süden, bis die Mühle am Fuß des Schlossfelsens vor ihr auftauchte. Etwas weiter flussabwärts befand sich das dorfeigene Waschhaus, vor dem bereits reger Betrieb herrschte. Auch auf der Bleichwiese tummelten sich Mägde und Bauerntöchter, die die dort ausgebreiteten Wäschestücke immer wieder mit Wasser begossen, damit das Sonnenlicht sie bleichen konnte. Als Marie sich dem Waschhaus näherte, sah sie eine Gestalt, deren Anblick sie mitten in der Bewegung innehalten ließ. Gisela! Ausgerechnet diese dumme Gans betätigte die Pumpe vor dem Waschhaus.
Kapitel 3
Das Dorf Brenz im Herzogtum Württemberg, August 1721
Marie biss sich auf die Zunge, um eine Verwünschung zu unterdrücken. Was hatte sie getan, um diese Strafe zu verdienen? War es wirklich so, wie der Dorfpfarrer immer behauptete? Sah Gott alles? War er wütend auf sie, weil sie zugelassen hatte, dass Bartholomäus sie küsste? Die Erinnerung an das letzte Mal, als sie ihn am Flussufer getroffen hatte, ließ sie wünschen, er würde augenblicklich vom Blitz erschlagen. Wie konnte man nur so falsch sein? Sie verzog den Mund zu einem freudlosen Lächeln. Oder so dumm wie sie? Denn einer Sache war sie sich inzwischen klar geworden: Bartholomäus hatte lediglich ihre Einfalt ausgenutzt, um das zu bekommen, was er wollte. Sie umklammerte den Korb wie einen Schutzschild und setzte ihren Weg fort. Wenn sie Glück hatte, sah Gisela sie nicht. Während Gisela ihr den Rücken zukehrte und mit aller Kraft den Pumpenschwengel betätigte, stahl Marie sich ins Innere des Waschhauses. Dort schlug ihr eine feuchte Hitze entgegen, die sie augenblicklich nach Luft ringen ließ.
»Du kannst den Bottich dort hinten benutzen«, sagte der Aufseher und zeigte in den Bereich des Waschhauses, in dem sich auch die Feuerstelle zum Erhitzen des Wassers befand. Dort rührten zwei junge Mädchen in einem Zuber. Als sie Marie sahen, steckten sie die Köpfe zusammen und kicherten.
Marie ignorierte sie und war froh, dass sie die Wäsche heute nur zum Einweichen herbrachte. Erst morgen würde sie wiederkommen und sie kochen müssen, um sie dann mit Bleuel und Waschbrett zu bearbeiten. Ohne die beiden Mädchen eines Blickes zu würdigen, überprüfte sie, ob alle Kleidungsstücke mit einem Zeichen versehen waren, ehe sie sie in den großen Bottich warf. Darin weichten schon die Hemden einiger anderer Familien, und das Wasser hatte bereits eine schmutzig-bräunliche Farbe angenommen. Als Marie fertig war, hob sie ihren Korb wieder auf und teilte dem Aufseher die Anzahl der Kleidungsstücke mit. Falls es zu Streit zwischen den Frauen im Waschhaus kam, war es seine Aufgabe, zu entscheiden, wer recht hatte.
Froh darüber, das stickige Waschhaus wieder verlassen zu können, trat sie zurück ins Freie und wäre um ein Haar mit Gisela zusammengeprallt.
Die schleppte einen Eimer Wasser, um die Kleider, die sie inzwischen auf der Bleiche ausgebreitet hatte, zu benetzen. »Pass doch auf!«, schimpfte sie. Als sie Marie erkannte, weiteten sich ihre Augen und ein gehässiger Zug legte sich um ihren Mund. »Du!«, spuckte sie verächtlich aus. »Ich hatte gehofft, du hättest mehr Anstand. Aber was will man von einer wie dir schon erwarten?«
Marie spürte, wie die Wut in ihr anfing zu brodeln. »Was soll das heißen? Einer wie mir? Wofür hältst du dich eigentlich?«
»Für diejenige, die Bartholomäus zur Frau nimmt«, schoss Gisela zurück. Sie stellte den Eimer ab und stach mit dem Zeigefinger nach Marie. »Halt dich bloß fern von ihm, du loses Weib.«
»Wie nennst du mich?«
»Ein loses Weib. Was anderes bist du nicht!«
Marie hob die Hand, um ihr eine Ohrfeige zu versetzen, aber die Blicke der Umstehenden hielten sie davon ab. Wie Aasgeier kamen sie immer näher, in der Hoffnung auf einen Happen neuen Klatsch. »Du solltest gut auf ihn aufpassen«, zischte Marie. »Er läuft jedem Rock hinterher. Glaub bloß nicht, dass er dich heiratet, weil du die Schönste im Dorf bist.«
Gisela schoss Röte in die Wangen. Vermutlich wusste sie, dass sie keine Augenweide war mit ihrer pockennarbigen Haut und dem dünnen Haar.
Dennoch würde sie den Mann bekommen, mit dem Marie die eigene Zukunft geplant hatte. Die Gewissheit war wie ein Stachel, der sich in Maries Seele bohrte.
Gisela rang einen Augenblick um Fassung. Dann verengten sich ihre Augen und sie beugte sich nach vorn. »Du solltest das Dorf verlassen, wenn du einen Funken Anstand besitzt. Geh nach Stotzingen oder Bächingen und verding dich dort als Magd. Hier wird dich bestimmt keine gottgläubige Frau in ihr Haus lassen.«
Marie schnaubte. »Tu doch nicht so, als ob du eine Heilige wärst.«
»Ich kenne meinen Platz. Du offensichtlich nicht. Dachtest du wirklich, Bartholomäus’ Vater würde ihm erlauben, die Tochter eines Kleinbauern zu heiraten?«
Die Worte schmerzten wie Schläge.
Als eine Gruppe von Reitern auf der Straße in Richtung Schloss ritt, sah Gisela ihnen nach und verzog das Gesicht. »Warum verdingst du dich nicht bei der Hexe als Magd? Man sagt, sie würde gut bezahlen. Gleich und Gleich gesellt sich gern.« Sie schüttelte angewidert den Kopf.
Marie wusste nicht, was sie sagen sollte. Die Blicke der anderen Frauen schienen Löcher in ihr Kleid zu brennen. Als Gisela sich ohne ein weiteres Wort von ihr abwandte, um den Eimer zur Bleiche zu schleppen, hätte sie ihr am liebsten etwas hinterhergeworfen. Da das Getuschel wieder anfing, klemmte sie sich ihren Korb unter den Arm und machte sich zurück auf den Weg zur Straße. »Warum verdingst du dich nicht bei der Hexe als Magd?«, hallten Giselas Hohnworte in ihrem Kopf nach. Sie hob den Blick zum Schlossfelsen und unterdrückte ein Schaudern. Seit der Ankunft der Gräfin erzählte man sich, dass sie tagein, tagaus in ihren Gemächern Tränke köchelte, mit denen sie sich den Herzog von Württemberg gefügig machte. Sonntags predigte der Pfarrer von der Kanzel, dass die Gräfin eine verlorene Seele sei, weil sie mit dem Herzog in Sünde lebte. Angeblich hatte sie ihn sogar dazu gezwungen, sich mit ihr zu vermählen, obwohl er noch mit der Herzogin verheiratet war. Daraufhin war sie vom Kaiser ins Exil geschickt worden, aus dem der Herzog sie allerdings wieder zurückgeholt hatte. »Landverderberin« nannte man sie angeblich im ganzen Herzogtum. Wer sich mit ihr einließ, wurde von der Dorfgemeinschaft geächtet. Im Frühjahr dieses Jahres hatte der Herzog ihr Schloss Brenz geschenkt, woraufhin viele der ärmsten Mädchen des Dorfes dort Arbeit gesucht hatten. Giselas Vorschlag war mehr als eine Beleidigung. Er war ein Hinweis darauf, in welchem Ansehen Marie in Zukunft im Dorf stehen würde. Wenn eine Anstellung bei der Gräfin ihr letzter Ausweg war … Sie schluckte die Bitterkeit, die in ihrer Kehle aufsteigen wollte, hinunter und schlug den Heimweg ein. Gewiss würde sich ein anderer finden. Irgendein Witwer oder Kleinbauer wie ihr Vater. Giselas Gerede war nichts als Boshaftigkeit. Seit wann lässt du dich so leicht ins Bockshorn jagen, fragte sie sich. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie, dass Gisela recht hatte. Bartholomäus’ Entscheidung bedeutete nicht nur das Ende all ihrer Pläne und Hoffnungen. Sie bedeutete auch, dass Marie ihr Leben in die eigenen Hände nehmen musste.
Während sich die Gedanken in ihrem Kopf überschlugen, ging sie die staubige Dorfstraße entlang zurück zum Hof ihres Vaters, wo ihre beiden jüngeren Schwestern mit Flachshäckseln beschäftigt waren.
Ihre Mutter backte in dem gemauerten Ofen neben dem Haus Brot. »Hilf mir mit dem Teig!«, rief sie, als sie Marie sah. »Hol einen neuen Sack Mehl vom Boden.«
Marie tat, wie geheißen, und die nächsten Stunden verbrachten sie und ihre Mutter damit, Brote zu backen. Zu Maries grenzenloser Erleichterung fiel kein Wort über Bartholomäus, allerdings war ihre Mutter ungewöhnlich wortkarg. Obwohl ihr die Sorge um ihre Zukunft auf der Seele lastete, lenkte die harte Arbeit Marie eine Zeit lang von den düsteren Gedanken ab.
Kapitel 4
Das Dorf Brenz im Herzogtum Württemberg, August 1721
Wilhelmine von Grävenitz tupfte sich mit einem Seidentuch die Stirn. Sie stand am Fenster eines ihrer Zimmer im zweiten Stock des Brenzer Schlosses und sah auf das geschäftige Treiben am Fuß des Schlossfelsens hinab. Am Ufer der Brenz befanden sich die Stallungen, vor denen ein Schmied und sein Gehilfe damit beschäftigt waren, die Pferde neu zu beschlagen. An den Kuhstall schloss ein Gebäude für die herzoglichen Kutschen an, daneben sandte der Kamin eines Backhauses schwarzen Rauch in den Himmel. In der Kalkgrube wurde eine neue Ladung Kalkbruch gebrannt und gelöscht, damit die Wände des Haupthauses neu verputzt werden konnten. Außerdem mahlte die herzogliche Mühle das Korn, das die Bauern in einer langen Schlange ablieferten. Neben der Mühle befanden sich ein Waschhaus und die Gärten, in denen das Gesinde Blumen schnitt und Beeren pflückte. Vor wenigen Augenblicken war ein Einspänner vorgefahren. Der Mann auf dem Bock wirkte selbst aus der Entfernung stattlich, und Wilhelmine verfolgte neugierig, wie er den Wachsoldaten gestenreich den Grund für sein Kommen erklärte. Da sie nicht erkennen konnte, um wen es sich handelte, stieg Neugier in ihr auf.
Sie war allein in dem geräumigen Zimmer bis auf ein Kammerfräulein und einen Pagen, der stocksteif neben der Tür auf ihre Befehle wartete. Ihren persönlichen Sekretär hatte sie in Ludwigsburg zurückgelassen genau wie die meisten anderen Bediensteten und Lakaien. Das Schloss war ohnehin viel zu klein für all ihre Kammerdiener, Zofen, Hofdamen, Leibschneider und die sonstigen Fräulein, Räte, Verwalter und Amtsleute, die üblicherweise um sie herumschwirrten wie Bienen um eine volle Blüte.
Mit einem Seufzen wandte sie sich vom Fenster ab und kämpfte mit ihrem Reifrock, bevor sie sich auf einen der gepolsterten Stühle sinken ließ. Trotz des offenen Fensters war es stickig in dem Raum, dessen Holzboden die Hitze genauso zu speichern schien wie die mit Blumenranken bemalten Deckenbalken. Auf einen Wink von ihr trat das Kammerfräulein an ihre Seite, um ihr mit einem Fächer Luft zuzufächeln.
»Es ist noch heißer hier als in Ludwigsburg«, stellte die junge Frau fest.
Wilhelmine nickte. Sie war immer noch müde von der langen Reise, obwohl sie schon vor Tagen im Dorf angekommen war. Das Holpern der Kutsche auf den mit Schlaglöchern übersäten Straßen hatte ihr Rückenschmerzen beschert, die sie immer noch plagten. Dennoch bereute sie es keinen Augenblick lang, dem Lärm und dem Staub, den ewigen Jagden und Bällen in Ludwigsburg wenigstens für eine Weile entkommen zu sein. Zudem waren die wichtigsten Regierungsgeschäfte erledigt, sodass sie sich eine Weile um sich selbst kümmern konnte, anstatt von morgens bis abends Depeschen zu lesen, mit den Geheimen Räten und Sekretären zu konferieren und Befehle zu geben. Noch immer interessierte sich Eberhard Ludwig nicht im Geringsten für die Politik, weshalb er sie zur Landhofmeisterin gemacht hatte. Während Wilhelmine und die Mitglieder des Konferenzministeriums sich um die Belange des Herzogtums kümmerten, ritt ihr Geliebter zur Jagd, erfreute sich an seiner Leibgarde oder ergötzte sich mit Singspielen, Theatervorführungen, Bällen und Konzerten. Und mit dieser verdammten Wölfin! Wilhelmine verzog das Gesicht. Seit einiger Zeit schlief das zottelige Untier sogar auf einem Tigerfell neben Eberhards Bett und starrte sie mit unheimlichen gelben Augen an, wenn sie ihn in seinem Schlafgemach aufsuchte.
»Melac ist zahm wie ein Lamm«, pflegte der Herzog zu behaupten. Allerdings straften ihn die Biss- und Kratzspuren an den Möbeln der Beletage in Ludwigsburg Lügen.
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, als sie sich eingestand, dass sie nicht nur wegen der Ruhe nach Brenz gekommen war. Zwar war der Herzog immer noch ein stattlicher Mann, aber bei Weitem nicht mehr der schmucke Generalfeldmarschall, der ihr bei ihrer ersten Begegnung vor 15 Jahren weiche Knie beschert hatte. Sein ehemals starker Körper war über die Jahre hinweg immer schwabbeliger geworden, sein Bauch fetter und seine Ausdauer geringer. Oft konnte er Wilhelmines Bedürfnisse nicht mehr so erfüllen, wie sie es sich wünschte.
Anders als der Brenzer Jäger, dessen Wohnung sich im Erdgeschoss des Schlosses befand. Wilhelmine spürte, wie sich Hitze zwischen ihren Beinen ausbreitete, als sie an die letzte Nacht zurückdachte. An das Turmzimmer und die Dinge, die sie mit dem Jäger getrieben hatte. Da sie sich vor dem jungen Ding mit dem Fächer nichts anmerken lassen wollte, bemühte sie sich um eine ausdruckslose Miene. Der Jäger, dessen Name lächerlicherweise Hubertus war, gab ihr das Gefühl der Jugend zurück. Auch sie war nicht mehr der elegante Schwan, in den Eberhard sich verliebt hatte. Ihre Haut zeigte ebenso die Spuren des Alterns wie die ihres Geliebten. Obwohl sie sich ihre Salben und Kosmetika selbst herstellte, konnten diese Mittelchen den Lauf der Zeit nicht aufhalten. Mit ihren 35 Jahren war sie zwar noch keine alte Frau, aber die fehlende Straffheit ihres Busens machte ihr täglich mehr zu schaffen. Während es Eberhard zusehends schwerer fiel, sie zu befriedigen, war Hubertus über sie hergefallen, als habe er noch nie eine begehrenswertere Frau gesehen.
Gedankenverloren fasste sie sich an die Wange, die immer noch von seinen Bartstoppeln zu brennen schien. Ein Schauer der Lust kroch über ihren Rücken, als sie sich vorstellte, dass sie sich in dieser Nacht wieder ins Turmzimmer schleichen würde. Barfuß, nur mit ihrem Nachtgewand bekleidet wie eine gemeine Frau. Die Unangemessenheit war beinahe so reizvoll wie die Tat selbst.
Wenn die Angelegenheiten des Herzogtums sie nicht früher nach Ludwigsburg riefen, würde sie erst am 18. September, zur Gala an Eberhards Geburtstag, wieder in die neue Residenz zurückkehren. Den Ludovici am 25. August, einen der beiden Namenstage ihres Geliebten, würde sie auslassen. Eberhard hatte zwar geschmollt, es aber schließlich akzeptieren müssen. Vielleicht war bis zu ihrer Rückkehr im September das Dach des Ludwigsburger Schlosses nicht mehr undicht, und die Handwerker hatten endlich die Kamine wieder zugemauert. Daran, wie oft diese Kamine inzwischen aufgerissen worden waren, wollte Wilhelmine gar nicht denken. Mehr als einmal waren durch den Schmutz, den Staub und den Ruß, der dabei entstand, Eberhards Appartements im Corps de Logis unbewohnbar geworden, sodass er in die Wohnräume des Erbprinzen hatte umziehen müssen.
Ein Klopfen an der Tür ließ sie Ludwigsburg und den Jäger vergessen. Sie gab dem Pagen mit einem Wink zu verstehen, die Tür zu öffnen. Als ein Lakai den Mann hereinführte, den sie durchs Fenster beobachtet hatte, hob sie erstaunt die Brauen. Was wollte einer der Männer ihres engsten Verbündeten, Heinrich von Schütz, hier in Brenz? Gab es eine Krise? Rief die Pflicht sie etwa jetzt schon wieder zurück nach Ludwigsburg?
»Ihro Exzellenz«, begrüßte der Besucher sie. Er verneigte sich tief.
»Was gibt es, das nicht warten konnte, bis ich wieder in Ludwigsburg bin?«, fragte sie unwirsch. Sie musterte den Mann von Kopf bis Fuß. Seine Kleidung war staubig von der Reise. Dennoch wirkte er nicht übermäßig erschöpft. »Braucht Schütz mich?«
Der Besucher schüttelte den Kopf. »Es geht um etwas anderes«, hob er an, verstummte jedoch mit einem Blick auf das Kammerfräulein und den Pagen.
Wilhelmine verstand. »Lasst uns allein«, befahl sie. Als die Zofe und der Knabe den Raum verlassen hatten, erhob sie sich und kam auf den Besucher zu. »Was ist passiert?«
»Eine Eurer Spioninnen ist tot aus dem Neckar gefischt worden«, kam der Mann ohne Umschweife zur Sache.
Wilhelmine sah ihn ungläubig an. »Tot?«
Er nickte. »Ertrunken.«
»War es ein Unfall?«
Der Mann zuckte die Achseln. »Das konnte man offensichtlich nicht mehr feststellen. Sie muss einige Tage lang im Wasser getrieben sein, bis man sie gefunden hat.«
Wilhelmine schloss einen Augenblick die Augen. »Wo?«, fragte sie schließlich.
»In der Nähe von Tübingen.«
»Wer ist sie?«, wollte Wilhelmine wissen.
»Eine der Zofen von Frau von Münsing.«
Wilhelmine widerstand nur mühsam der Versuchung, zu fluchen. Sie wusste, um welches Mädchen es sich handelte. Mit großer Mühe hatte sie die junge Frau bei der Gemahlin eines ihrer Erzfeinde untergebracht, damit diese sie mit Neuigkeiten versorgte. Offenbar hatte das Mädchen seine Nase in Angelegenheiten gesteckt, die zu ihrem Tod geführt hatten. Keinen Moment lang glaubte Wilhelmine daran, dass es sich bei ihrem Ertrinken um einen Unfall handelte. »Wenn sie in Tübingen aus dem Wasser gefischt worden ist, kann sie überall flussaufwärts ertrunken sein«, sagte sie mehr zu sich selbst als zu ihrem Besucher.
»Der Geheime Rat Schütz möchte wissen, ob er Männer zu Madame von Münsing schicken soll, um sie zu befragen«, berichtete der Bote weiter.
Wilhelmine überlegte einen Augenblick, dann schüttelte sie den Kopf. »Nein. Wenn sie oder ihr Mann hinter dem Tod des Mädchens stecken, werden sie alles abstreiten. Sie werden höchstens gewarnt, dass wir etwas vermuten.« Von Münsing gehörte zum Kreis ihrer erbitterten Feinde, der täglich weiter zu wachsen schien. Vermutlich steckte die Herzogin hinter der Tat, weil Eberhard sie in Stuttgart versauern ließ. Diese bigotte Ziege! Wilhelmine ballte die Hände zu Fäusten. »Sag Schütz, er soll versuchen herauszufinden, wo das Mädchen sich vor seinem Tod aufgehalten hat«, trug sie dem Boten auf. Dann entließ sie ihn und trat zurück ans Fenster. Es war bereits die dritte Spionin, die sie verloren hatte. Die Dinge schienen sich zuzuspitzen. Und es wurmte sie gewaltig, dass sie keine Ahnung hatte, was ihre Feinde im Schilde führten.
Kapitel 5
Das Dorf Brenz im Herzogtum Württemberg, August 1721
»Du wirst dir bald eine Anstellung als Magd suchen müssen.«
Die Worte ihres Vaters veranlassten Marie, den Blick zu senken und die Lippen aufeinanderzupressen. Zusammen mit ihrer ganzen Familie saß sie am Tisch neben der Feuerstelle und löffelte einen dicken Brei, in dem zur Feier der reichen Ernte Fleischstückchen schwammen. Vier Tage war es her, seit Bartholomäus ihr das Herz gebrochen hatte, und seitdem hatte sie darauf gewartet, dass die Axt auf sie hinabsauste. Da man im Dorf inzwischen einen Bogen um sie machte und alle hinter vorgehaltener Hand über sie tuschelten, wäre sie am liebsten davongelaufen. In den Augen der Dorfgemeinschaft war sie ein fauler Apfel, mit dem man sich sein Mus nicht verderben wollte. Auch wenn sie es nicht sah, wusste sie, dass ihre vier Brüder grinsten.
»Der Schweinebauer sucht noch Gesinde«, fügte ihr Vater hinzu, als Marie nichts sagte.
Marie hob den Kopf und versuchte tapfer, sich nicht anmerken zu lassen, wie dick der Kloß in ihrem Hals war.
»Es gibt schlechtere Anstellungen«, sagte ihre Mutter. Es klang lahm.
Marie rührte mit ihrem Löffel in dem Brei herum, um Zeit zu gewinnen. Beinahe jede Nacht war sie seit dem Erntefest wach gelegen und hatte über ihre Zukunft nachgedacht. Die Begegnung mit Gisela hatte einen Gedanken in ihren Kopf gesetzt, den sie nicht mehr los wurde. Auch wenn alle Dorfbewohner die Gräfin hassten oder fürchteten, war die Bezahlung im Schloss ganz gewiss besser als die beim Schweinebauern. Man erzählte sich außerdem, dass Wilhelmine von Grävenitz manchmal Bedienstete aus dem Dorf mit nach Ludwigsburg nahm. Wenn es Marie gelang, die Gunst der Gräfin zu erlangen, konnte sie vielleicht den Demütigungen in Brenz entkommen.
»Sag schon etwas«, brummte ihr Vater. »Unter meinem Dach kannst du nicht mehr länger bleiben.«
Marie fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen. »Ich gehe nach dem Essen ins Dorf und suche mir eine Anstellung«, erwiderte sie.
»Beim Schweinebauern?«
»Dort werde ich auch fragen«, wich Marie aus.
»Gut.« Ihr Vater wischte seine Schale mit einem Stück Brot aus und stellte sie zurück auf den Tisch. Dann erhob er sich und gab Maries Brüdern einen Wink. »Kommt. Die Arbeit wartet.« Damit war die Angelegenheit für ihn erledigt.
Marie wusste, dass er erwartete, sie spätestens am nächsten Morgen nicht mehr an seinem Tisch sitzend vorzufinden.
»Willst du dich nicht lieber bei einem der Großbauern verdingen?«, fragte ihre Schwester Anna. »Der Schweinebauer ist …« Sie rümpfte die Nase.
»Ein guter Mann«, fiel ihr Maries Mutter ins Wort.
»Warum versuchst du nicht, bei Bartholomäus’ Vater eine Anstellung zu bekommen?«, wollte eine ihrer jüngeren Schwestern wissen. Offenbar hatte sie nicht begriffen, warum das ganze Dorf über Marie klatschte.
»Rede nicht solchen Unsinn, Kind«, schalt die Mutter. Sie bedachte Marie mit einem strengen Blick. »Deine Schwester muss zusehen, dass sie irgendwo unterkommt, wo man sie haben will. Wählerisch kann sie nicht sein.« Unverhohlener Vorwurf schwang in den Worten mit.
Marie war klar, dass die Mutter ihr die Schuld an allem gab. Vermutlich hatte sie damit sogar recht. Mit einem Seufzen schob sie die Schale von sich und erhob sich von der harten Bank. »Kann ich gehen?«, fragte sie.
Ihre Mutter nickte. »Bald werden wir sowieso ohne dich auskommen müssen.«
»Darf ich dann bei Anna schlafen?«, meldete sich Maries dritte Schwester zu Wort.
Der Kloß in Maries Hals drohte, ihr die Luft abzuschnüren. Offensichtlich würde sie niemand vermissen. Sie strich ihren Rock glatt und versicherte sich, dass die Haube auf ihrem Kopf ordentlich saß. Dann ging sie zu dem Bett, das sie sich mit Anna teilte, und suchte ihre mageren Habseligkeiten zusammen.
»Warum nimmst du dein Bündel mit?«, fragte Anna, als Marie zurück in den Wohnbereich trat.
»Lass sie nur«, sagte ihre Mutter. »Sollte der Schweinebauer sie einstellen, kann sie gleich dort bleiben.«
»Oh.« Anna sah Marie mit großen Augen an. »Aber …«
»Kein Aber«, unterbrach die Mutter sie. »Wenn du keinen Bräutigam findest, wirst du dich in einem oder zwei Jahren auch als Magd verdingen müssen. So war es schon immer, so wird es bleiben. Gott hat für jeden von uns einen Weg vorherbestimmt.«
Anna senkte demütig den Blick.
»Wenn Gott sagt, dass Marie gehen muss, dann muss sie gehorchen«, mischte sich Maries jüngste Schwester ein. »Nicht wahr?«
»Gott muss man immer gehorchen«, war die Antwort ihrer Mutter. Sie schlug ein Kreuz vor der Brust und murmelte etwas, zweifelsohne ein Gebet.
Vermutlich betet sie, dass meine Schande nicht auf ihre anderen Töchter abfärbt, dachte Marie bitter. Mit schwerem Herzen schulterte sie ihr Bündel und verabschiedete sich. Dann trat sie hinaus in den brütend heißen Sommertag. Die Luft flimmerte über den abgeernteten Feldern und ließ die Konturen der Bäume am Horizont verschwimmen. Es wirkte, als würde alles miteinander verschmelzen. Insektenschwärme tanzten in der Luft, während am Himmel Raubvögel ihre Kreise zogen. Überall wurde emsig gearbeitet. Marie kam sich vor wie eine Fremde, als sie mit ihrem Bündel die Straße entlang in Richtung Marktplatz ging. Die Bauersfrauen und Mägde, die in den Gärten hackten, schnitten und zupften, verfolgten sie mit ihren Blicken. Marie ignorierte sie und wich an den Rand der staubigen Straße aus, als ihr eine Gruppe von Reitern entgegenkam. Da sie die Aufmerksamkeit der Männer nicht auf sich ziehen wollte, zog sie den Kopf ein und presste das Bündel vor ihre Brust.
Dennoch stieß einer der Reiter einen Pfiff aus und zügelte sein Pferd.
Marie wagte nicht, zu ihm aufzusehen.
»Wohin des Wegs so allein?«, fragte der Mann.
Seine Begleiter lachten.
Marie spürte, wie ihr die Knie weich wurden. Sie hatte von den Reitern gehört, Geschichten von Männern, die plötzlich auf den Feldern auftauchten, wenn die Bäuerinnen und Mägde alleine waren. Während die Furcht ihr den Mund trocken und die Handflächen feucht werden ließ, starrte sie auf ihre Schuhspitzen.
»Lass sie in Ruhe, Hubertus. Wir haben anderes zu tun.«
»Die Enten flattern schon nicht davon«, war die Antwort. »Dieses Täubchen hier …«
»Was wird wohl die Gräfin dazu sagen?«
Der andere schnaubte. »Geht’s dich was an?«
»Nein. Aber ich glaube nicht, dass sie besonders erbaut wäre, wenn du dich auf offener Straße an ein Dorfmädchen heranmachst.«
Marie sandte ein Stoßgebet zum Himmel. Sie hatte keine Ahnung, wer die Kerle waren. Aber sie hoffte, dass sie so schnell wie möglich weiterritten.
»Komm schon, wir haben zu tun.«
»Also gut«, brummte der, der Hubertus genannt wurde. »Ein Jammer.«