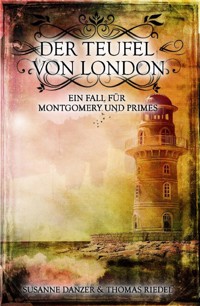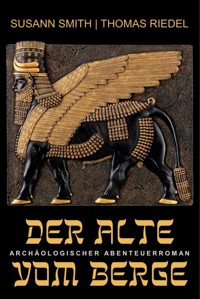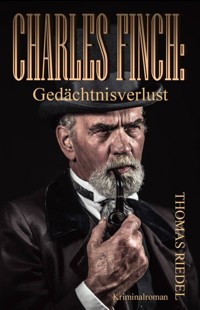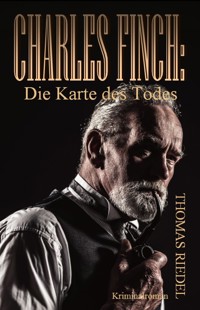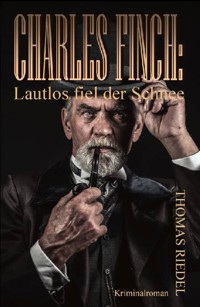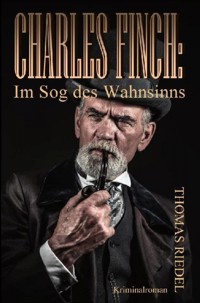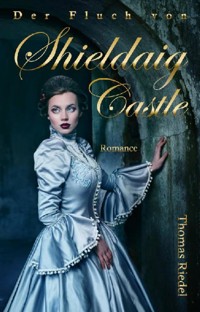Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein anonymer Anruf, eine direkte Weisung von ganz oben und ein Mord ohne Leiche, bereiten Detective Chief Inspector Isaac Blake und seinem Kollegen Cyril McGinnis Kopfschmerzen. Wer war der unbekannte Anrufer? Warum erhalten sie ihre Anweisungen direkt vom Chief Constable? Wo ist die Leiche und was steckt hinter den zahlreichen Vermisstenmeldungen, die der Fall auf einmal mit sich bringt? Ein Verwirrspiel entsteht. Mit der Zeit kommt den beiden Kriminalisten ein schlimmer Verdacht ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die blaue Blume
Die blaue Blume
Mystery-Thriller
von
Anna-Lena & Thomas Riedel
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar
2. Auflage (überarbeitet)
Covergestaltung:
© 2019 Susann Smith & Thomas Riedel
Coverfoto:
© 2019 depositphoto.com
ImpressumCopyright: © 2019 Anna-Lena & Thomas RiedelDruck und Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.deISBN siehe letzte Seite des Buchblocks
»Er sah nichts als die blaue Blume,
und betrachtete sie lange
mit unnennbarer Zärtlichkeit.«
Novalis (1772 - 1801)
Kapitel 1
D
ie Dunkelheit der eingebrochenen Nacht hatte sich über dem parkähnlichen Garten wie ein alles bedeckendes Betttuch ausgebreitet. Die offensichtlich schon seit ewigen Zeiten ungeschnittenen Rasenkanten und die Abgrenzungen der zahlreichen Beete waren nur noch schwer zu erkennen. Der zarte Duft einiger Chrysanthemen, Dahlien, Hortensien und Rosen hing in der Luft. Trotz der inzwischen weit fortgeschrittenen Jahreszeit, standen sie noch in voller Blüte. Hinter weichen Schattenlinien vereinzelter Sträucher, wippten ganz leicht und in leiser Bewegung die langen rutenförmigen Äste einiger Trauerweiden, die sich weit über den schwarz glänzenden Wasserspiegel des großen flachen Beckens neigten. Inmitten dieser Anlage stiegen im Halbdunkel die unsichtbaren Fontänen eines Springbrunnens in die Höhe, den man nur an seinem leisen Plätschern, das die Eintönigkeit dieser beschaulichen Stille unterbrach, dort vermutete.
Doch da war etwas!
Etwas, das diese nahezu märchenhafte nächtliche Beschaulichkeit störte!
Denn das, was im Wasser des Beckens schwamm, wollte so gar nicht in den Park einer alten Villa, im Londoner Stadtteil Westend, passen!
Es war die menschliche Gestalt eines Erwachsenen, bei der auf den ersten Blick nicht eindeutig zu erkennen war, ob es sich bei ihr um eine weibliche oder männliche Person handelte.
Und noch etwas störte die idyllische Ruhe!
Denn plötzlich waren schlurfende Schritte vom Kiesweg her zu hören. Keine Minute später tauchte ein Mann von kleiner Statur zwischen den tiefhängenden Weidenästen auf. Trotz der Dunkelheit musste er die reglose Gestalt auf der Wasseroberfläche ausgemacht haben. Er hielt inne. Mit starrem Blick sah er zu dem Körper hinüber. Dabei verzog sich sein Gesicht zu einer ungläubigen Grimasse. Kaum hatte er den ersten Schrecken verdaut, fasste er sich mit seiner Rechten in den Nacken und begann sich nachdenklich am Hinterkopf zu kratzen.
Der kleine Mann war selbst für Londoner Verhältnisse äußerst seltsam gekleidet. Er trug einen mit reichlich goldenem Brokat verzierten Schlafrock. Seine Füße zierten arabische Schnabelschuhe und auf seinem Kopf trug er eine orientalische Kopfbedeckung – einen orangefarbenen Dastar, den Turban der indischen Religionsgruppe der Sikhs. In seinem Aufzug sah der Mann wie ein orientalischer Adeliger aus, eben so, wie man sich eine Figur aus den morgenländischen Erzählungen ›Tausendundeine Nacht‹ vorstellte. Sein schwarzbraunes Gesicht, ein Anzeichen dafür, dass er aus dem südlichen Teil Indiens stammte, zierten zwei große mandelförmige Augen. Sie waren dunkel und glänzten wie ›Carbonados‹, wie oft auch die ›Schwarze Diamanten‹ genannt wurden.
»Es ist kaum zu glauben, wie sie da schwimmt«, murmelte er mit einem befremdlich anmutenden Lächeln. Der Umstand schien ihn ganz offensichtlich mehr zu amüsieren als zu erschrecken. Aber vielleicht war es auch nur seine sehr spezielle Art mit dieser bizarren Situation umzugehen. »Es ist keine vier Stunden her, da war sie noch das blühende Leben, hat gestrahlt, gelacht und vom köstlichen Wein seiner Lordschaft getrunken. Es ist einfach nicht zu fassen, wie schnell sich doch alles verändern kann. So rasch kann es gehen, eben bist du noch mitten im Leben und schon kurz darauf tot.«
Plötzlich neigte er leicht seinen Kopf. Er vernahm sich ihm nähernde Schritte und drehte sich herum. Gleich darauf schälte sich seine Lordschaft aus dem Dunkel.
»Hey! Sharukh!«, rief sein Herr verärgert aus. »Ich suche dich schon überall! Nie bist du da, wenn man dich braucht! Was treibst du denn hier?«
Seine Lordschaft war ein Mann Mitte der Fünfziger, mit gebogener Nase und einem rostbraunen Vollbart, wie man ihn bei einem Schotten vermutet hätte. Seiner mehr als deutlich zum Ausdruck gebrachten Verärgerung ließ er noch ein abfälliges Knurren folgen.
»Was machst du hier bloß?«, wiederholte er in befehlendem Kasernenton.
Das Antlitz seiner Lordschaft Sir William Dwerryhouse wurde düster. Mit einem scharfen Blick sah er seinen Diener an, so wie er es immer dann tat, wenn er ihm deutlich zu verstehen geben wollte, wer von ihnen hier das Sagen hatte. Und bislang hatte es bei Sharukh nie seine Wirkung verfehlt. Auch diesmal wand sich der Inder wie ein Wurm. Die Situation war ihm mehr als unangenehm.
»Mylord, ... ich ... ich machte doch nur ... einen Spaziergang«, stotterte er erklärend, mit unterwürfigem Tonfall.
»Einen Spaziergang?«, knurrte Lord Dwerryhouse ihn an und betrachtete Sharukh geringschätzig von oben nach unten. »Bei diesem Wetter? Und dann auch noch im Schlafrock und mit diesen grotesken Schnabelschuhen? Mal ganz abgesehen von dem albernen Turban!« Ein spöttischer Zug lag in seinen Mundwinkeln. »Warum musst du eigentlich immer wie ein Clown herumlaufen?« Es war eine rhetorische Frage, auf die seine Lordschaft keine Antwort erwartete. Dwerryhouse wurde wieder sachlich: »Und jetzt sofort zurück ins Haus!«
Trotz des scharfen Kommandotons bewegte sich sein indischer Diener nicht vom Fleck und wies stattdessen mit leicht zittriger Hand auf das Wasserbecken.
»Mylord, da ... da ...«, begann er stammelnd, »schwimmt jemand ... im Bassin! Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ... das muss Miss Sandford sein!« Mit ängstlichen Augen sah er seine Lordschaft an. »Sie scheint allem Anschein nach ...« Er verschluckte den Rest.
Lord William Dwerryhouse wurde steif. »Du verschwindest jetzt sofort im Haus, Sharukh!«, wiederholte er seine Anweisung.
»Wie Sie wünschen, Mylord«, dienerte der Hausangestellte und machte sich davon.
Seine Lordschaft trat näher an das Becken heran. Sein Diener hatte recht, es war tatsächlich Meagan Sandford, die langsam über die Wasseroberfläche dahintrieb. Er konnte zwar ihr Gesicht nicht erkennen, weil sie auf dem Bauch lag, aber ihre langen blonden Haare und das knallrote Abendkleid erkannte er auf Anhieb wieder. In ihrem Rücken steckte ein Messer. Und er registrierte den sehr auffälligen ›Pakka‹-Holzgriff! Es war eines seiner Jagdmesser! Sein ›Cudeman Hirschfänger‹!
»Um Gottes willen!«, stieß er entsetzt aus. »Auch das noch. Nicht schon wieder!« Sein rechter Mundwinkel hing leicht nach unten und sein rechter Arm pendelte ziemlich gefühllos leicht hin und her. Dabei war seine Hand verkrampft und nicht nur sie zitterte. Es war das typische Zittern eines Mannes, der einen Schlaganfall hinter sich hatte. Mit ängstlichen Augen starrte er auf den Körper im Wasser. Dwerryhouse wirkte deprimiert – eine große Mutlosigkeit, gepaart mit Resignation und Zweifel, hatte ihn ergriffen.
Der Lord fühlte wie ihm der Schweiß ausbrach.
Es war also tatsächlich passiert! Und was jetzt? Sie war tot und augenscheinlich ermordet worden. Scotland Yard, die Mordkommission, würde sich einschalten. Er sah jetzt schon die Regenbogenpresse mit ihren überdimensionalen, plakativen Schlagzeilen vor sich. Nur soweit wollte er es gar nicht erst kommen lassen. Die Frau musste schnellstens aus dem Wasserbecken gefischt und bestmöglich an irgendeiner geeigneten Stelle im Park vergraben werden. Inständig hoffte er darauf, dass später niemand auf die Idee kam in seiner großzügigen Gartenanlage nach ihr zu suchen. Aber warum sollte es dazu kommen? Schließlich wusste außer seinem Diener ja niemand, dass Meagan Sandford bei ihm zu Gast gewesen war.
Während er auf die Leiche der jungen Frau starrte und seinen defätistischen Gedanken nachhing, vernahm er plötzlich ein knackendes Geräusch. Er erschrak und wirbelte auf der Stelle herum.
Im Schatten seiner Teufelssträucher war wie aus dem Nichts eine Person erschienen.
»Wer sind Sie?«, rief Lord Dwerryhouse geistesgegenwärtig. Er hatte nicht damit gerechnet, in dieser ihn sehr belastenden Situation von jemandem überrascht zu werden. Er riss sich zusammen und schaffte es ruhig zu bleiben.
Ein schauriges Lachen ertönte.
»Wer ich bin, Sir William?«, echote die weibliche Stimme. Sie klang erstaunt und amüsiert zugleich, gerade so, als wundere sie sich darüber, dass seine Lordschaft diese Frage überhaupt an sie richtete, so als müsse er doch genau wissen, wen er da vor sich hatte. Noch einmal lachte sie. »Wer ich bin? Ich bin Diejenige, die sich um die Seelen der von dir ermordeten Frauen kümmert! Schwimmt nicht gerade wieder eines dieser armen Geschöpfe in dem Becken?« Sie deutete in die Richtung und wieder hallte das teuflische Lachen in Dwerryhouses Ohren. »Du willst mir doch nicht allen Ernstes weismachen, sie sei freiwillig ins Wasser gegangen! Das Messer in ihrem Rücken, ist das nicht dein Jagdmesser?«
Unwillkürlich begann Lord Dwerryhouse zu zittern. Er bemühte sich, sich nichts anmerken zu lassen und es gelang ihm sogar Entschlossenheit zu zeigen.
»Ich habe gefragt, wer Sie sind!«, forderte er die Person noch einmal mit kräftiger Stimme auf. »Und kommen Sie mir nicht mit diesem Quatsch, Sie seien Diejenige, die sich um irgendwelche Seelen kümmert! Ich bin schon lange kein kleines Kind mehr und Geister gibt es nicht!« Er geriet in Rage. »Als Geist wissen Sie sicher, wie das Mädchen heißt und auch wie sie in das Wasserbecken gekommen ist. Mich interessiert vielmehr, wie Sie hier hereingekommen sind. Das Gelände ist von hohen Mauern umgeben und das Zufahrtstor ist fest verschlossen!« Erneut hörte er ihr schauriges Lachen. Aber diesmal hatte er bereits damit gerechnet und es erschreckte ihn nicht mehr.
»Mauern und eiserne Tore ... ja, glaubst denn wirklich, die würden mich aufhalten?«, erwiderte die Stimme. »Du hast diese junge Frau ermordet, Sir William. Gerade einmal zweiundzwanzig Jahre alt ist sie geworden. Du hast sie getötet! Meinst du nicht, dass Meagan Sandford noch gern gelebt hätte? Aber machen wir uns nichts vor! Ein junges Ding, welches sich mit seiner Lordschaft einlässt, hatte ja noch nie eine hohe Lebenserwartung!« Die Stimme hatte an Schärfe zugenommen und wurde anklagend. »Zu oft schon geschah es in der Vergangenheit und es wird wohl auch in Zukunft wieder geschehen. Ich weiß es! Ich muss es wissen! Denn ich kümmere mich um ihre armen Seelen!«
Dwerryhouse wollte etwas erwidern, es lag ihm auch bereits auf der Zunge, aber er brachte keinen Ton über die Lippen – ihm versagte die Stimme. Mit Unbehagen stellte er fest, dass er diesem ungerufenen Geist der Vergangenheit ausgeliefert war. Immer wieder holte ihn seine Vergangenheit ein, kaum, dass er glaubte ihr entkommen zu sein. Er konnte ihr einfach nicht entrinnen. Das alles konnte doch gar nicht real sein, dachte er. Wollte ihn dieses Wesen auf besonders perfide, makabre Art erpressen? Ein Geist, wie lächerlich! Den würde er sich jetzt mal genauer ansehen. Kaum hatte diesen Gedankengang zu Ende gebracht, wagte er sich auch schon einen Schritt weiter vor, um die unheimliche Stimme näher in Augenschein zu nehmen.
Dann sah er sie!
Der Geist war eine schlanke Frau mit langem weißen Engelshaar, das ihr zu allen Seiten weit über die Schultern fiel. Ihr Gesicht wirkte ein wenig verbraucht, schon älter und auch der Halsansatz war nicht mehr ganz so straff. Spuren des Alters zeigten auch ihre Hände, die aus den weiten Ärmeln ihres weißen Kleides schauten.
Diese Frau sollte er fürchten?
Dwerryhouse wollte schon ein selbstgefälliges Grinsen aufsetzen, als ihm auffiel, dass ihre Füße gar nicht den Boden berührten.
Die Frau, ... sie schwebte gut einen halben Yard über dem Beet.
Erschrocken wich er einige Schritte zurück und stieß dabei gegen die Kante des Beckens. Er taumelte und fast wäre er rücklings ins Wasser gestürzt, aber er schaffte es gerade noch rechtzeitig sein Gleichgewicht zurückzugewinnen.
»Wie heißen Sie?«, stöhnte er gequält.
Die gespenstische Frau stieß ein spöttisches Lachen aus.
»Was bedeutet schon ein Name? Namen sind wie Schall und Rauch!«, erwiderte sie abfällig. »Aber, wenn du es unbedingt wissen willst: Man nennt mich Rasriria!« Die Frau mit dem Engelshaar machte eine kleine Pause. »Geh ins Haus zurück, Sir William! Für dich gibt es hier nichts zu tun. Ich werde mich um das tote Mädchen kümmern und es mit mir fortnehmen.«
Der Widerstand seiner Lordschaft schien gebrochen, denn Dwerryhouse wandte sich um und ging, scheinbar gehorsam, auf das große Herrenhaus zu. Doch kaum glaubte er sich außerhalb von Rasririas Blickfeld, machte er einen für ihn erstaunlichen Satz zur Seite und verschwand in einem Gebüsch. Er war bestenfalls achtzig Yards vom Wasserbecken entfernt. In der herrschenden Dunkelheit konnte er von seiner Position aus nichts sehen, aber der Lord setzte auf sein Gehör.
Aber so sehr er auch lauschte, es tat sich nichts. Nicht das geringste Geräusch war zu vernehmen. In der Hoffnung, dass sich doch noch etwas tat verharrte er in seinem Versteck. Als nach gefühlten zehn Minuten immer noch nichts zu hören war, verließ er seinen Platz und schlich auf leisen Sohlen zum Becken zurück.
Verwundert sah er sich um. Die seltsame weibliche Geistererscheinung war weg! Aber die tote junge Frau trieb nach wie vor auf der Wasseroberfläche vor sich hin. Hatte Rasriria nicht gesagt, sie wolle Meagan Sandford mitnehmen? Warum war sie dann immer noch da?
Noch einmal lauschte seine Lordschaft angestrengt. Aus einer Ecke des weiträumigen Parks kamen seltsame Laute, wie er sie seinerzeit oft in Indien vernommen hatte, wenn er des Nachts durch die Grünanlagen Bombays und Kalkuttas gegangen war. Es waren Geräusche, die sich nicht genau definieren ließen.
»Verdammt! Da ist doch jemand!«, rief er laut in die entsprechende Richtung.
Ein höhnisches Gekicher drang an sein Ohr. Es war ganz nah. Panisch drehte er sich im Kreis.
»Ich bin es, Rasriria! Ich bin immer noch hier, Sir William«, raunte sie. » ... immer noch ...«
So sehr Dwerryhouse sich auch anstrengte, es gelang ihm nicht die Frau auszumachen. Sie konnte keinen Yard entfernt sein, dessen war er sich sicher und dennoch konnte er sie nicht sehen. Nirgends konnte er die Umrisse ihres Körpers erkennen. Es schien, als habe sie sich aufgelöst.
Alles in ihm drängte danach laut zu schreien, aber ihm war bewusst, dass all sein Rufen sinnlos war. Es waren die Schatten seiner Vergangenheit. Sie kamen zurück und waren nicht aufzuhalten. Mit geschlossenen Augen versuchte er innezuhalten und sein Selbstbewusstsein zurückzugewinnen. Alles wurde irgendwie traumhaft. Ganz langsam zerfloss all das Unwirkliche und verlor seinen schweren, gefährlichen Sinn. Und trotz aller Kontrolle, die er über sich zu gewinnen hoffte, spürte der Lord deutlich das Hochschnellen seines Pulses.
Dwerryhouse erschrak erneut. Es war wieder soweit. Und es gab nichts, aber auch rein gar nichts, was er dagegen tun konnte.
Wieder einmal fühlte er dieses verdammte blaue Gift; fühlte, wie es von ihm Besitz ergriff und wild in seinen Adern zu pochen und zu brennen begann.
Er musste hier weg!
Schnellstens!
Also sah er zu, dass er fortkam. Mit weit ausholenden Schritten ging seine Lordschaft zur Villa zurück. Als er die große Halle des Hauses betrat, wartete sein Diener Sharukh bereits erwartungsvoll auf ihn.
Auf einem silbernen Tablett reichte er seinem Herrn ein Glas Wasser und ein Röhrchen eines Medikaments. Hastig nahm sich Sir William Dwerryhouse zwei der hellgelben Tabletten und spülte sie hastig, mit einem Schluck aus dem Glas, herunter.
Kaum hatte er das Glas zurückgestellt, warf er seinem tadellos gekleideten Diener einen prüfenden Blick zu.
»Warst du nicht gerade im Park?«, erkundigte er sich.
»Aber das wissen Sie doch, Eure Lordschaft. Ich war etwas spazieren, wie ich es immer des Abends mache«, antwortete der Angestellte erstaunt. »Sie wünschten mich zurück ins Haus. Ich habe Sie so verstanden, dass Sie mich in anderer Kleidung zu sehen wünschten.«
Lord Dwerryhouse nickte, lächelte verkniffen und winkte wohlgefällig ab. »Schon gut, Sharukh, schon gut«, erwiderte er besänftigend. »Dann hast du das Mädchen, in seinem roten Kleid, ja auch gesehen. Sie schwamm im Becken schwamm und scheint tot zu sein. Erstochen!«
»Ich vermutete es, Sir!«, antwortete der Inder, sachlich kurz.
»Hast du draußen etwas gehört?«, wollte Dwerryhouse von ihm wissen. »Ein seltsames Lachen oder etwas Anderes?«
»Nein, Sir!« Die Mandelaugen seines Dieners sahen ihn verwundert an. »Absolut nichts!«
Sir William Dwerryhouse starrte sinnierend vor sich hin. Da war etwas, das gewaltig an dem Fundament seines Daseins rüttelte. Er spürte, wie eine unerbittliche Hand aus dem Dunkel eisig kalt nach ihm griff und fühlte sich unsicher wie schon lange nicht mehr.
»Hast du schon einmal von einer Rasriria gehört?«, setzte er nach.
Sharukh lächelte.
»Ja, Sir!«, erklärte er. »Aber was man sich über sie erzählt sind reine Märchen. Sie soll eine Frau sein, die sich um die Seelen Verstorbener kümmert. Aber Rasriria ist eben fiktiv - eben eine Legende.«
Seine Lordschaft nickte.
»Das habe ich mir gedacht«, stimmte er seinem Diener zu. »Ich wusste, sie ist nicht real. Sie kann es nicht sein.«
»Was meinen Sie damit, Sir?«, Sharukh sah seine Lordschaft irritiert an.
Er bekam auf seine Frage keine Antwort mehr, denn kaum hatte er sie ausgesprochen, wurde das Gespräch von der laut tönenden Glocke der Haustür unterbrochen. Lord Dwerryhouse zuckte merklich zusammen.
»Um diese Zeit?« Er warf einen Blick auf die Standuhr. »Wer kommt jetzt noch? Und überhaupt, Sharukh!« Er sah seinen Diener verärgert an. »Wie oft habe ich dir schon aufgetragen, die Glocke leiser zu stellen?«
»Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Eure Lordschaft«, reagierte Sharukh betreten und senkte dabei devot sein Haupt. »Ich habe es vergessen.«
Dann eilte er fort.
Sir William Dwerryhouse ließ sich in einen der Ledersessel fallen, die vereinzelt in der Halle standen. Die Situation war dabei ihm den Verstand rauben. Eine Leiche in seinem Garten, im Wasserbecken, ermordet mit einem seiner Jagdmesser, eine gespenstische Gestalt, die es nicht geben konnte und aufgewühlte alte Erinnerungen, die er längst begraben zu haben glaubte. Eine große Mutlosigkeit nahm von ihm Besitz.
»Ich habe es wieder in den Adern«, murmelte er kaum hörbar vor sich hin. »Ich fühle es ganz deutlich. Das Gift, es arbeitet wieder. Dieses mörderische blaue Gift, es will mich einfach nicht loslassen.«
Kapitel 2
D
er Wetterfrosch, ein Laubfrosch, dem in einer eigentlich nicht zutreffenden Weise unterstellt wird oder wurde, das Wetter vorhersagen zu können, verdankt seinen Mythos der Beobachtung, dass besonders die europäischen Laubfrösche bei sonnigem Wetter an bodennahen Pflanzen hochklettern, weil bei einer solchen Wetterlage die Insekten, die ihnen als Nahrung dienen, höher fliegen als bei kaltem Wetter. Aus diesem Verhalten heraus entstand die irrige Vorstellung, die Laubfrösche könnten das Wetter nicht nur anzeigen, sondern gar vorhersagen, und so sperrte man in früheren Zeiten dazu Frösche in Gläser, in denen sich eine kleine Leiter befand. Stieg der Frosch die Leiter nach oben, bedeutete das demnach gutes Wetter, blieb er unten war es schlecht. Nichts lag näher, als Meteorologen in einer spöttischen Übertragung als ›Wetterfrösche‹ zu bezeichnen, und diese hatten für heute schlechtes Wetter vorhergesagt. Windig, kalt und ausgesprochen regnerisch sollte es ihren Erkenntnissen nach werden. Von dieser Prognose war tagsüber noch nicht viel zu spüren gewesen, doch jetzt am späten Abend schien sich einer jener Stürme zusammenzubrauen, wie sie der Herbst nur allzu gern mit sich brachte. Und es war dunkel geworden – sehr dunkel.
Detective Chief Inspector Blake vom New Scotland Yard harrte fröstelnd der Dinge, die da möglicherweise kommen würden. Die Straße lag einsam und verlassen da. Nur die erleuchteten Fenster der zahlreichen Villen in dem Nobelviertel des Londoner Westends schienen etwas Wärme und Schutz zu verheißen. Das stete Heulen und der feuchte modrige Geruch des sterbenden Jahres hatte etwas Bedrückendes. Nach den letzten abenteuerlichen Aufträgen rief diese Atmosphäre ein unheimliches Gefühl in ihm wach. Er hatte erlebt, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gab als die Schulweisheit glauben machen wollte. Er versuchte dieses seltsame Befinden nicht weiter aufkommen zu lassen, und beruhigte sich damit, dass es einfach daran liege, dass er sich augenblicklich auf verlorenem Posten glaubte.
Seine momentane Situation verdankte er einem höchst seltsamen, in seinen Augen völlig unnötigem Auftrag, den man ihm und Detective Sergeant Cyril McGinnis übertragen hatte. Merkwürdig war der Auftrag gleich in mehrerlei Hinsicht, denn zum einen bekamen sie ihre Anweisungen in der Regel vom Chief Superintendent, nicht wie in diesem Fall unmittelbar von oberster Stelle, nämlich vom Chief Constable Sir Reginald Endicott persönlich, und zum anderen sprang die Mordkommission nicht direkt wegen eines anonymen Anrufes, sondern überließ das zunächst einmal dem Metropolitan Police Service – den Kollegen vom ›MPS‹.
Ungeachtet all dessen stand er hier, während sein Sergeant einen Background-Check erledigte und beobachtete das prächtige Herrenhaus von Lord William Dwerryhouse. Eigentlich wäre es die Aufgabe seines Sergeants gewesen auf Beobachtungsposten zu stehen, aber der Chief Constable hatte darauf bestanden, dass er es höchst persönlich tat.
Er sollte die Augen aufhalten, das Haus beobachten und wenn erforderlich klingeln, so hatte es ihm Sir Reginald im persönlichen Gespräch in dessen Büro gesagt. Dort würde sich etwas mit einem Mädchen namens Meagan Sandford abspielen, hatte der Chief Constable weiter ausgeführt. Ein direkt bei ihm eingegangener anonymer Anruf habe von Mord gesprochen und von einer Leiche im Swimmingpool. Auf seinen Einwand, dass dies doch zunächst durch den ›MPS‹ abgeklärt werden könne, hatte Sir Reginald Endicott nur lakonisch geantwortet, dass mit Lord Dwerryhouse etwas nicht stimme, die Situation Fingerspitzengefühl verlange und er da genau der Richtige sei. Und nun hatten er und McGinnis diese ominöse Angelegenheit am Hals.
Bislang hatte sich nichts Nennenswertes ereignet. Die Villa lag still und verlassen da. Der alte Prachtbau stammte noch aus einer Zeit als Grund und Boden in London preiswert zu haben waren. Entsprechend üppig war das Grundstück ausgefallen. Das war auch der Grund, warum das Haus des Lords gegenüber den anderen Villen der Nachbarschaft, die in Größe nichts nachstanden, ungemein protzig und teuer wirkte. Hinzu kam noch die exponierte Lage im exklusiven Londoner Westend.
Das Westend war für Blake wie ein Dorf. Eingebettet im Grün, mit all den vielen uralten Bäumen, den prunkvollen Herrschaftshäusern, die eher von Menschen bewohnt wurden, die offen der Nostalgie anhingen, konnte das Gefühl aufkommen, dass man sich in einem Kurort aufhielt. In dieser Gegend wurde noch allergrößter Wert auf Etikette, Privatsphäre und Stille gelegt – alles andere passte in keiner Weise zu dem hier vorherrschenden altbritischen, konservativen Lebensstil.
Chief Inspector Blake konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, was ihm bevorstehen sollte. In ihm herrschte nur ein Wunsch vor, nämlich der, dass er möglichst rasch von seinem Beobachtungsposten fortkam. Er zog seine altmodische silberne Taschenuhr mit dem Sprungdeckel hervor, klappte sie auf und sah nach der Zeit. Eigentlich tat er es ohne Grund. Oder nein, er tat es, um überhaupt etwas zu tun.
Es war jetzt exakt vier Minuten nach zehn abends.
Bereits seit kurz vor acht war er nun schon vor Ort, mittlerweile zitternd und frierend. Nur einmal waren zwischenzeitlich Geräusche aus dem Park, hinter der großen das Grundstück einschließenden Mauer, gekommen. Aber das hatte für ihn nach irgendwelchem Viehzeug geklungen – vermutlich eine Katze auf Mäusejagd.
Tiefdunkel war es inzwischen geworden und in dem zunehmend stärker gewordenen Wind, schien alles zu schwanken. Die Baumkronen wiegten sich, die Sträucher neigten sich und selbst die alten Bogenlampen bogen sich. Ja, selbst das reiche Gitterwerk vor den Häuserfronten klapperte leicht. Staub wirbelte auf und geriet Blake in die Augen.
Nicht weit entfernt sah es so aus, als würde eine schemenhafte Gestalt hin und her schleichen. Aber das war relativ weit weg und er hatte nur den Auftrag, die Hausnummer 17 im Blick zu behalten. Dennoch entging auch das nicht seinem kriminalistisch geschulten Auge. Irgendetwas daran wirkte seltsam und es erregte instinktiv seine Aufmerksamkeit. Er spürte eine aufkommende Unruhe.
Jetzt wiederholten sich auch die seltsamen Geräusche hinter der Grundstücksmauer. Diesmal waren sie etwas lauter, aber es änderte nichts - auch jetzt konnte er sie nicht eindeutig zuordnen. Sie klangen nicht menschlich, schienen aber auch nicht tierischen Ursprungs zu sein. Es klang anders - beunruhigend anders!
Blake wurde es zu bunt. Da er sich beobachtet wähnte, ging er ein Stück weiter und sah dabei in einer Art zu Boden, als habe er etwas verloren und suche danach. Gleich an der nächsten Ecke bog er in die Nebenstraße ein. Als er im Schutz des Eckhauses einige Minuten gewartet hatte, glaubte er, sich entfernende Schritte zu vernehmen.
Langsam ging er den Weg wieder zurück. Von der schemenhaften Gestalt war nichts mehr zu sehen. Allerdings bedeutete das keineswegs, dass sie nicht mehr da war – möglicherweise hatte sie sich nur ein anderes Plätzchen gesucht.
Er fragte sich, ob es sich bei den Schritten, um die einer Frau gehandelt haben könnte. Aber er kam zu keinem abschließenden Ergebnis.
Dann war er es endgültig leid. Er wollte der Sache ein Ende machen. Noch länger um das Haus zu schleichen, machte in seinen Augen keinen Sinn mehr.
Zielstrebig hielt er auf die Villa zu und staunte über die unverschlossene Gittertür. Damit hatte er nicht gerechnet. Über einen kurzen Kiesweg schritt er auf das Herrenhaus mit seiner großzügigen Freitreppe zu. Schwungvoll nahm er mit zwei Sätzen die vier weißen Marmorstufen.
Entschlossen drückte er auf den Bronzeknopf, der aus einer ziselierten, an der Wand verschraubten, Bronzeplatte hervorragte. Geduldig wartete er einige Minuten, aber da niemand reagierte, klingelte er erneut.
Die dicken Glasscheiben der Tür waren von innen mit Gardinen verhangen. Eingeschaltetes Licht hätte Blake direkt sehen können, aber es blieb dunkel.
Rein zufällig bemerkte er dann eine kaum merkliche Bewegung der Gardinen. Er war sicher, dass ihn jemand, der lautlos über die Fliesen der Eingangshalle gehuscht war, durch einen minimalen Spalt beobachtete.
Noch einmal betätigte Blake die Klingel.
Endlich flammte Licht auf. Gleich darauf hörte er, wie sich jemand an der Verriegelung zu schaffen machte, und dann öffnete sich die Tür.
Blake sah sich einer höchst merkwürdigen Person gegenüber. Ein kleiner Mann von höchstens fünf Fuß Körper-maß, dunkler Hautfarbe und rabenschwarzen Haaren, die streng nach hinten gekämmt waren und mit einem Wachs glattgebügelt geworden zu sein schienen, in einem schwarzen Livree mit Goldbesatz, stand vor ihm. Seine wie schwarze Diamanten funkelnden Augen betrachteten ihn voller Neugier.
»Sie wünschen, Sir?«, erkundigte er sich steif.
»Detective Chief Inspector Isaac Blake von Scotland Yard«, stellte sich Blake vor. »Könnte ich wohl seine Lordschaft sprechen?«
»Etwas spät, finden Sie nicht auch?«, erwiderte der Mann, mit den auf Hochglanz polierten Lackschuhen. »Aber da Sie von Scotland Yard sind ... bitte sehr, Sir.« Er trat einen Schritt zurück und ließ Blake hinein. »Ich heiße Sharukh Bhattacharya und bin der Sekretär seiner Lordschaft.«
»Es wird nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen«, stellte Blake in Aussicht. »Ich habe nur einige Fragen an Sir William.«
Sharukh Bhattacharya, wie er sich nannte, schloss die Tür und ging voraus. Blake musste ihm nur wenige Yards folgen, als sich in der Halle ein Mann aus einem Sessel erhob und auf ihn zukam.
»Seine Lordschaft, wenn ich mich nicht täusche?«, erkundigte sich der Chief Inspector mit aller Höflichkeit, die die vorgerückte Stunde seines Besuchs gebot.
»Erraten«, antwortete Lord Dwerryhouse mit einem amüsierten Lächeln. »Aber das war ja auch nicht sonderlich schwer.« Gleich darauf wurde er ernst. »Was führt Sie zu mir, Chief Inspector Blake?«
»Ich hätte nur ein paar Fragen, Sir“, erklärte Blake und fügte entschuldigend hinzu: „Leider dulden sie keinen Aufschub, daher auch mein so spätes Erscheinen in Ihrem Haus.«
»Schon gut, Chief Inspector“, winkte der Lord ab. „Lassen wir das. Keine weiteren Entschuldigungen mehr. Bitte kommen Sie.«
Blake folgte Lord Dwerryhouse in einen kleinen Salon, der in ihm den Eindruck erweckte, als wäre er gezielt für derartige Gäste eingerichtet worden, die man rasch abfertigen wollte. Der Raum war geschmacklos und kalt.
Kaum war er eingetreten, betrachtete ihn der Lord von oben nach unten. Er tat dies mit einer gewissen von Argwohn durchsetzten Höflichkeit. Seine Miene war zwar noch freundlich, doch eher abweisend.
Aber auch der Chief Inspector studierte kritisch sein Gegenüber und sein Urteil fiel rasch. William Dwerryhouse schätzte Blake auf Ende vierzig bis maximal Mitte fünfzig, auch wenn er bedeutend älter aussah. Auffallend war die leicht gebeugte Haltung in Verbindung mit dem kraftlosen Händedruck. Das Gesicht zeigte augenblicklich einen etwas leeren und abwesenden Ausdruck. Seine Lordschaft schien ein besorgter Mann zu sein. Er machte den Eindruck, als habe er erst vor nicht allzu langer Zeit einen Nervenzusammenbruch erlitten. In Blakes Augen gab er sich die größte Mühe, seine körperliche Hilflosigkeit zu kaschieren, indem er eine nicht vorhandene Forschheit vortäuschte.