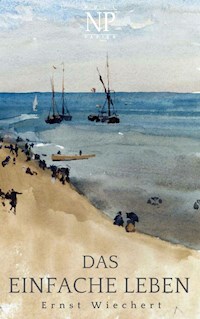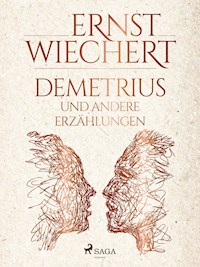0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wiecherts Roman "Die blauen Schwingen" erschien erstmals 1925.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die blauen Schwingen
Die blauen SchwingenVorwort1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.ImpressumDie blauen Schwingen
Vorwort
Die Schatten des Krieges liegen tausendfältig über diesem Werke. Es ist begonnen worden an der galizischen Front und beendet in den Stollen der Champagne. Österreichische Offiziere sangen mir allabendlich das Lied von den Kranichen, weil sie wußten, daß es Gestalt werden sollte in diesen Blättern, und als die Blätter beendet waren, fiel schon die Nacht des Schicksals über ihr Heimatland. Vaterland starb mir und Kind in jener Zeit. Und die Seele, die noch zwischen den Dingen stand, schrieb müde Worte, die am Sinn des Seins verzagten. Sie gab ihn noch nicht der Wirrnis des Lebens, sondern sie suchte ihn noch darin.
Ernst Wiechert
1.
Harro saß auf der Mittelbank des Bootes und ließ mit dem Winde die ausgebreiteten Netze von seinen Knien über die Bootswand gleiten, gedankenlos die Finger öffnend, wenn Borke und Blei in regelmäßigen Abständen seine Hände berührten. Seine Augen hingen abwesend im Abendrot über grauem, kaltem Wasser, und das dumpfe Brausen der Rohrkämpe und der Erlenkronen hielt seine Seele wie ein Traum. Eine schwere und klagende Melodie, an deren Gestaltung er den ganzen Tag gerungen hatte und die seine Geige nicht wiedergeben wollte, floß wie ein ferner und formloser Strom durch sein Inneres, lähmte Wachsein und ruhiges Erleben und hing gleich einer düsteren Wolke über fahl verdunkeltem Lande. Blasse Gesichter formten sich schnell vergehend im gleitenden Gewebe, der Vater, hell, schimmernd, wie ein Heiliger unter Tieren, und der andere Immanuel, der Stiefvater, der von der Bank auf der Reiherinsel ihm nachsah, der Fischmensch, der Leidbringer, der gemeine Melodien pfiff, und Gestern und Morgen standen auf als graue Wände, zwischen denen das Boot dahintrieb, endlos, hoffnungslos.
Mit haßvoller Gebärde warf er das Ende des Netzes über die Kahnwand und nahm das nächste Gewebe über seine Knie. Und wie Borke und Blei wieder durch seine Finger glitten, versank er wieder in der Melodie und hob mit leidendem, fast gequältem Antlitz Ton um Ton aus der vergleitenden Flut ins Bewußtsein seiner Seele.
Bis der Wind ihm Geigenklang ans Ohr trug und ihn zu leiser Verwirrung weckte. Da warf er nach einem achtlosen Blick zur fernen Reiherinsel das letzte Netz als Bündel ins Wasser und trieb mit schnellen Bewegungen den Kahn durch rauschendes Schilf zum Ufer. Dann lief er durch lichten Wald und blühende Heide zur Höhe hinauf und blieb hier schneller atmend stehen, getroffen von einem Blick gleich dem seiner Traumwelt und langsam, willenlos in sie zurückgleitend.
Vor dem Abendrot stand die scharfbegrenzte Masse einer zerwühlten Heidekiefer, und an ihrem Stamm lehnte ein Mensch, den Kopf an die Rinde zurückgelegt, und hob Geige und Bogen wie ein Entrückter in das flammende Licht des Unterganges. Um ihn lag die graue und schwarze Herde der Schafe in der brennenden Heide, und schweres Gewölk, mit totem Weiß durchsetzt, trieb über die weite, kieferngesäumte Landschaft, als steige es wie schwelender Rauch über den Feuerschein im Westen. Und wie vergehender Menschenlaut aus Feuertod floß das Lied der Geige in den Wind, eintönigem Gebete gleich aus Märtyrermund, steil sich aufwärtshebend zu wartendem Gotte, verzückte Auferstehung kündend, Glanz in himmlischem Saal, und wieder sinkend zu Schmerzlaut und Klage und bang nach Hilfe rufend über einsame Welt.
Schritt für Schritt, einem Nachtwandler gleich, folgte das Kind dem rufenden Ton, bis es neben dem Hunde sich niederkauerte, der freudig seine Hände leckte. Über seinen blassen Lidern zuckten die Adern, und seine feingegliederten Hände bebten schmerzhaft wie im Fieber. So erlitt es zitternd die Gewalt der Melodien, die über seine Seele brachen, und die das Leid formten, das es erfüllte. Leid war das Leben und Sehnsucht die Tage, und beides war schwer, aber beides war süß; denn die anderen trugen es nicht, und es war der Auserwählten Krone.
Über Frühlingswälder gleitet die Geige, wo der Wind unter des Habichts Flügeln steht, über Stoppelfelder und Winterweg. Und Herbststurm rauscht unter Krähenflug und wühlt im Röhricht und klagt im dunkelnden Kiefernwald. Was wird der Tage Zukunft sein? Was steht für ein Licht in Majas Augen, und was rauscht in den Nächten durch das schlaflose Blut? O Rätsel der Ferne, o Schleier, die ihr verhüllt! Wann werde ich wissen, und was wird sein?
Die Geige erstirbt. In halben Tönen fällt das Lied, mit müder, unhaltbarer Gebärde. Die Feuer verblassen, und die Kiefer braust im schwereren Wind. Da dreht der Zigeuner sich um und hinkt zu Harro hin. »Trauriges Lied,« sagt er mit gütigem Lächeln, »Sommer vorbei ...«
Schwermütig hebt das Kind die Augen zum Gesicht des Hirten. »Mischa ... Gott ist in dir ... kann ich nie spielen wie du, dann ... geh ich in den See.«
Mischa lächelt nur und hebt die braune Hand mit dem Bogen. »Warten, Kindchen ... bist ein Musikant, groß, sehr groß, aber warten ... zu mir kommen, in den Hof, und spielen ... jetzt heim ... fetter Mann wartet.« Er strich dem Kinde übers blonde Haar und trieb die Schafe auf.
Lange sah Harro ihm nach, wie er hinkend über die Heide schritt, ein gelähmter Falke, dessen graues, langes Haar im Winde flog. Dann ging er zum Ufer hinab.
An den Rohrkämpen blickte er lange über die fahlen, wogenden Halme. Dort lagen die Krebsreusen, die großen Netze, dort trieb er die Hechte, wenn das Garn davorlag. Dort lag er im Boden des Kahnes, wenn er seine Eltern nicht mehr ertrug. Wenn die Melodien ihn überstürzten, die so quälten und so unentrinnbar waren. Wenn die schweren Wetter aufzogen, die nicht über das Wasser konnten und unter deren Blitzen die Tiefen fahl erglühten. Dort lag er, verkrochen wie ein Wild, und lauschte dem wirren, geheimnisvollen Laut, mit dem das Schilf die Blätter regte, und starrte in das Spiegelbild des Mondes, in dem das Kraut des Grundes schimmerte, und malte sich Bilder der Nixen in leuchtende Flut und lag hingegeben über dem Rand des Kahnes, dem Tode näher als dem qualvoll wachsenden Leben.
Und nahm, wie heute, das Ruder zur Hand, wenn die Schleier nicht fielen, und mühte sich gegen das schwer treibende Wasser, tote Müdigkeit im Herzen. Die Stimmen des Waldes verklangen, nur das große Abendrauschen, das mit den Wolken über die Erde ging, lag auch über der grauen Flut. Im Westen, wo nur noch fahler Schein aus zerklüftetem Gewölke über das Moor fiel, klagte der hohe Ruf der Regenpfeifer, und im Norden drohte die Reiherinsel wie eine finstere Schanze zwischen Himmel und See.
Nach einer halben Stunde schloß Harro das Boot an und ging den Steig zur Hütte hinauf. Seine schmalen Schultern im grauen Kittel beugten sich noch mehr, und er hob die Augen nicht von dem dunklen Fußpfad.
Inzwischen saß Herr Immanuel Parplies auf der Bank vor der Hütte und rauchte seine Sonntagabendzigarre. Während Frau Brigitte, die weder Wasser noch Wind, noch wolkenumhüllte Abendstimmungen liebte, im Innern des kleinen Hauses am leicht geheizten Ofen sich wärmte, in ein Buch aus ihres Mannes Geheimlektüre vertieft und ab und zu aus einem hohen Likörglase nippend, drückte ihr Gatte seinen kurzen, wohlgenährten Körper in die Ecke der Bank, faltete seine schwammigen Hände, unter deren Nägeln ab und zu ein paar Fischschuppen zu kleben pflegten, und blickte mit etwas schläfriger Aufmerksamkeit in die fallende Dämmerung.
Der Anblick des unruhigen Wassers bewog wider Erwarten den aus windgeschützter Behaglichkeit Zuschauenden nicht zu Gefühlen des Mitleids oder auch nur der Teilnahme für sein Stiefkind, sondern er diente ihm nur dazu, seine Gedanken gemächlich zurückwandern zu lassen zu den Zeiten, da es ihm noch nicht vergönnt gewesen war, den Sonntagabend so beschaulich zu genießen; da er vielmehr selbst Tag und Nacht in aufreibender Arbeit um die Gestaltung eines geldbringenden, geruhigen Zukunftslebens gerungen hatte.
So überdachte Herr Immanuel seinen Lebensweg. Die Stunde zwischen dem Essen und dem Schlafe erfüllte ihn um so mehr mit einer Art von Poesie, je mehr er der demütigenden Niedrigkeit sich erinnerte, aus der er aufgestiegen war, und je heimbewußter sein Ohr dem dumpfen Rauschen der Wellen zu seinen Füßen lauschte und dem heiseren Schrei, mit dem die Reiher von ihren Horstbäumen den ersten Herbstwind grüßten.
Es war die Melodie seines Kinderlandes, und wenn er träumte, was selten geschah, so glitt durch alle seine Träume das graue, schwere, ziehende Wasser jener Tage, mit Netzen, die sich quälend verwirrten, und Fischen mit unförmlichen Köpfen, deren tote Augen grauenerregend aus kalter Tiefe nach ihm blickten.
Sein Vater war ein Fischer gewesen. Verschlossene Fischkästen, die mit einem Hieb geöffnet werden mußten, verbotenes Garn, das besser fing als erlaubtes. Ausheben fremder Netze: alles das waren Dinge, die zu Immanuels nächtlicher Schule gehört hatten. Dumpfe Krugstuben tauchten auf, in deren Winkeln er frierend hockte, den Flüchen lauschend, in deren Mittelpunkt die Gestalt des Fischereiaufsehers stand; graue Mauern eines hohen Hauses mit schweren Toren, hinter denen zu Zeiten der Vater oder die Mutter verschwand. Und frühe hatte er erkannt, wie wenig dumpfer Haß und scheuer Nebenweg geeignet waren, aus Trübe und Not dieses Lebens zu entfernen. Das rastlos Tätige seiner Natur, durch frühe Erfahrung geregelt, suchte nach neuer Waffe in schwerem Kampf und fand, was die plumpe Hand der Eltern nicht zu Übung und Macht hatte formen können: die Maske als zweites Gesicht.
Frühzeitig besaß er den frommen Augenausschlag, den scheu anschmiegenden Händedruck, die sittliche Entrüstung gegen Bedenkliches, so daß Wohlwollen, Mitleid und Förderung ihm gutgläubig und weichherzig zuteil wurden. Er war ein guter Schüler, der unverdächtigt die halbe Obsternte des Schulgartens stahl, um sie in einsamen Walddörfern gewinnbringend zu verkaufen. Er war ein guter Konfirmand, der oft in der Pfarrküche zu Mittag aß und dem bei Pastor Laue schon ohne eigenes Zutun zustatten kam, daß er Immanuel hieß. Und wenn der Pfarrer in der Konfirmationsstunde gegen die Schandbuben donnern mußte, die ihm die gemästeten Enten aus dem Stall gestohlen hatten, und versicherte, daß den Betreffenden die Hand aus dem Grabe wachsen werde, dann besah Immanuel nur leicht lächelnd seine griffgeübten Hände und trug seine eigenen Gedanken über Schuld und Sühne. Doch sagte er stockend und mit niedergeschlagenen Augen, als am Schluß der Stunde eine Frage des Pastors ihn scheinbar unvorbereitet traf: »Herr Pfarrer ... ich habe gedacht ... steht nicht, daß dem Schalksknecht vergeben wird? Und müssen den armen Kindern wirklich ... die Hände verfaulen?« Da bereute der Gefragte, der ein etwas weichmütiger und argloser Hirte des Herrn war, seine harten Worte, tröstete Immanuel und erzählte am Mittagstisch gutgläubig und von Herzen froh, daß heute der Herr seinen Unterricht gesegnet habe. Und Immanuel versäumte von Stund an keinen Gottesdienst in der alten Dorfkirche ...
Er stäubte lächelnd die Asche von seiner Zigarre und blickte eine Weile dem Reiher nach, der taumelnd durch schwerer rauschenden Wind nach dem jenseitigen Ufer schwankte ...
Dann war die Lehrzeit gekommen in der großen Fischereipacht und die Bekanntschaft mit Rosenheimer, bei dem er bald darauf seine Ersparnisse arbeiten ließ. Mit Lea Rosenheimer war es nichts geworden, denn Immanuel war zurückgesprungen wie ein Fuchs vor dem Eisen, das schlecht verwittert ist. Es war ein Gebiet, auf dem ihm Erfahrung mangelte. Und kaum war ihm diese Erkenntnis gekommen, als er auch schon auf diesem Felde, dessen Wichtigkeit er in vollem Umfange ermaß, zu beobachten, zu vergleichen, zu verknüpfen begann. Und aus den ersten gelungenen Proben einer selbstgefundenen Lebensweisheit zog er neue Kraft und Sicherheit für die Gesamtheit seines Vorwärtsstrebens.
Dabei blieb er weiter bescheiden, selbst unterwürfig im Verkehr mit anderen, lächelte mit den Fröhlichen, sah bedenklich zu ernsten Fällen, schüttelte schmerzlich-überrascht den Kopf bei traurigen Vorkommnissen und festigte so ohne Unterbrechung den Grund des Wohlwollens und der Achtung, auf dem er weiterbaute.
Doch fehlte es nicht an leisen Schwankungen seines Lebensschiffleins, und ihre Ursache lag, zwar sorgsam verhüllt, aber nicht gebändigt, in seiner oft wechselnden, nach schwerer Arbeit triebhaft aufsteigenden Neigung zum weiblichen Geschlecht. Er war kein Freund der Feder, aber über sein Liebesleben führte er gewissenhaft und mit peinlicher Ausführlichkeit ein Tagebuch, das er in der Erinnerung an seine Schulzeit nicht ohne Witz das »Herbarium« nannte. Der siebente Fall war rot angestrichen, denn er hatte ihm einen Prozeß gebracht, und Geschäftsdummheit war ihm verhaßt.
Und dann kam der Krieg.
Immanuel schrie Hurra, trank sich einen leichten Rausch und besprach mit vielen Reservisten die Anmarschwege auf Paris und Petersburg. Aber als er abends wieder am Boote stand, hatte er Sorgenfalten in der Stirn und blickte mit fragender Unruhe auf Rosenheimer. »Parpliesche,« sagte dieser, ihm auf die Schulter klopfend, »es wird ä Pleite, aber nu ... villaicht wirds sain ä faine Pleite!« Mit diesen rätselhaften Worten entließ er ihn.
Immanuel war Landsturm ohne Waffe und kam frei, dank einer veralteten Sehnenzerrung aus vergangenen Tagen. Nach einem Monat hatte er seinen Vertrag mit Frau Brigitte abgeschlossen und übernahm aushilfsweise die große Fischereipacht von Johannes Bruckner, der seit drei Monaten im Osten stand. »Volksernährung« schien ihm ein durchaus zuverlässiger Boden in unberechenbar schwankenden Zeitläuften.
Im ersten Kriegsfrühling kam Johannes auf Urlaub, weicher und träumerischer als je, umfing sein Kind mit überströmender Liebe und fand auch jetzt nicht den Weg zurück zu der ihm lange fremd gewordenen Frau. Vier Wochen nach seiner Rückkehr zur Front kam das Telegramm, daß sie ihn in Galizien begraben hatten.
Harro fiel in eine schwere Krankheit, Frau Brigitte jammerte laut, und Immanuel wartete.
Sie machte es ihm nicht zu schwer. Sie war jung in die Ehe getreten, hübsch, gesund und gutmütig. Sie kannte kein anderes Unglück als Begehrlichkeiten und kein höheres Glück als deren Erfüllung. Nach ihres Mannes Tode zeigte sie eine gelegentliche Neigung zu süßen, leise berauschenden Getränken. Immanuel unterstützte vorsichtig diese plötzlichen Zugriff erleichternde Schwäche und beklagte in geeigneten Zwischenräumen den Gefallenen und das Los einsamer Witwen. So gewann er in kluger Benutzung seiner Erfahrungen ohne bedeutende Mühe die reife Frucht und somit Grund und Ausmaß eines Lebens, nach dem er hartnäckig, klug und mit aller ihm möglichen Hingabe gestrebt hatte. Er war im Hafen.
Nach einem Jahr hatten sie geheiratet. Schatten fielen in ihr Leben nur durch das Kind, in dessen frühreifem, leidvollem Antlitz Erbitterung und Verachtung durch eine kindlich-unfertige Maske schienen, und dessen klare, sehr ernste und wie aus weiten Fernen kommende Augen mit peinvollem Suchen auf den Zügen seines Stiefvaters haften konnten. »Wir kriegen ihn noch«, sagte Herr Immanuel, aber es blieb als schwerer Schatten über seinem breiten Sonnenweg.
Indessen stiegen seine Einlagen bei Rosenheimer, seine Lebensführung gewann an Breite und Behaglichkeit, und an Sonntagen entbehrte seine Kleidung nicht einer soliden, mitunter etwas pomphaften Eleganz. Die religiösen, sittlichen und politischen Grundsätze, die er früher wie ein schmiegsames Kleid getragen hatte, umgaben ihn jetzt bei gesteigertem Selbstbewußtsein gleichsam wie ein klirrender Panzer. Wenn er früher einen der Dorfjungen beim Angeln in seinen Gewässern erwischt hatte, so hatte er leise ein Haselstöckchen geschnitten, mit sicherem Griff den Übeltäter gepackt und ihm ein Dutzend übergezählt, alles freundlich lächelnd und ohne ein Wort zu verlieren. Nunmehr aber, wenn er seinen Sonntagspaziergang machte und einen von dem »Otterngezüchte« zwischen den Fingern hielt, faßte er ihn bei beiden Ohren und brüllte dem Missetäter ins Gesicht: »Wie heißt das dritte Gebot? Du Saubengel, miserabler, wie heißt das dritte Gebot?« Und die Ohrfeigen fielen hageldicht. Auf dem Heimweg schüttelte er dann mißbilligend das Haupt und sagte: »Laue wird alt. Es muß ein neuer Hirte unter diese Schafe.«
Während Herr Immanuel sich so in behaglich erinnernder Art rückwärtsschauend an dem Bau seines Lebens erfreute, trat Harro in den Lichtschein der Hütte.
Herr Immanuel nahm vorsichtig die Zigarre aus dem Munde, sah von der Seite auf sein Sorgenkind und sagte mit leicht klagender Stimme: »Guten Abend, mein Sohn! Du bleibst lange aus.«
Harro stellte das Ruder in den Geräteschuppen und antwortete teilnahmslos: »Ich war bei Mischa.« Dann stand er noch, als ob er auf weitere Fragen wartete, und da sein Stiefvater zu den Baumwipfeln aufsah, öffnete er leise die Türe und ging hinein.
Frau Brigitte saß im Lehnstuhl und hob gerade das Likörglas zu den Lippen. Sie bedeckte das Buch, in dem sie gelesen hatte, mit ihrem Taschentuch und antwortete verstimmt auf seinen Gruß. Als er dann an der Tischecke sein Abendbrot aß und sie verstohlen seinen schmalen Körper und das leuchtende Haar betrachtete, das auch sein Vater gehabt hatte, drängten vergangene Zeiten sich scheu durch die schwerfälligen Tore ihres Bewußtseins, und sie sagte mit einem Anflug von Zärtlichkeit: »Weshalb bleibst du nicht bei uns, Harro? Mußt du immer zu Mischa laufen und bis in die Nacht fortbleiben? Damit man sich Sorgen um dich macht?«
Harro hob die Augen und lächelte bitter. »Hast du dich gesorgt, Mutter?« fragte er leise.
Sie vermied seinen Blick, weil seine Augen die seines Vaters waren, groß, fragend, in den Dingen versinkend. »Gesorgt!« wiederholte sie gekränkt, unsicher in nicht ganz natürlicher Empfindlichkeit. »Du und der Vater ... Gott hab ihn selig ... ihr habt immer getan, als ob ich mich um nichts sorge. Immer war ich allein, und hab' dich mit Schmerzen geboren!«
»Laß den Vater schlafen!« sagte Harro streng. »Er ist für uns beide gestorben.«
»Mein Gott,« erwiderte sie ungeduldig, »Millionen sind gefallen. Das ist nun einmal der Krieg.« Und sie stand auf und öffnete das Fenster, um etwas Luft über ihre erhitzten Schläfen ziehen zu lassen.
Als sie wieder im Lehnstuhl saß und die Kämme aus ihrem Haar zu nehmen begann, erschien Herrn Immanuels Antlitz im offenen Fenster. »Wenn man dreizehn Jahre alt ist, mein lieber Sohn,« sagte er nachsichtig, »macht man seiner Mutter keine Vorwürfe, denn die Eltern haben mit ihren Kindern immer das Beste im Sinn. Und schon der Dichter sagt, daß Mutterliebe die treueste auf Erden ist. Ich jedenfalls hätte mein Muttchen nie so kränken können ... Und nun geh schlafen, mein Sohn,« schloß er seufzend. »Früh zu Bett und früh wieder auf ist eine goldene Lebensregel, und ich bin immer gesund dabei geblieben.«
Harro bemühte sich nicht, ein verächtliches Lächeln zu unterdrücken. Als er seiner Mutter die Hand gab, zog sie seinen Kopf an ihre Schulter und schüttelte ihn. »Du dummer Junge,« sagte sie gutmütig und gähnte verstohlen. Harro hielt zitternd den Atem an.
Draußen sagte er noch einmal leise »Gute Nacht«, empfing einen wohlwollenden Gegengruß und ging dann nach seiner Rohrhütte, die eine Strecke aufwärts am andern Netzschuppen stand. Er entzündete die kleine Lampe, setzte sich auf sein schmales Bett und bedeckte das Gesicht mit beiden Händen. So saß er lange.
Die Nachtfalter schwirrten durch das Fenster und brausten um die stille Flamme. Der Wind wühlte mit hohlem Laut in den Wipfeln der Espen, fiel sausend in die Fichten des Uferhanges und klirrte im Röhricht. Dann hörte man nur das schwere Rauschen des Wassers. Mit beiden Händen gab das Kind seine Seele dem Tönen und dem Rhythmus der Nacht. Wieder fühlte es das schmerzliche Lustgefühl, einsam und unglücklich zu sein, und wieder glitt es durch dieses Gefühl tiefer in wahre Einsamkeit und wahres Unglück hinab.
Bis er endlich mit krampfhaftem Entschluß wie aus schweren Träumen sprang, die Hand vor geblendeten Augen, und das Fenster schloß. Dann rückte er das Notenpult neben die Lampe, stellte Herrn Ruhoffs Etüden darauf und spielte mit Andacht und Hingabe eine Stunde lang Läufe und Doppelgriffe.
Darauf streifte er schnell die Kleider ab, löschte die Lampe und hüllte sich frierend in die Decken. Eine Weile blickte er noch mit offenen Augen in das Dunkel, in dem die Gesichte seiner Träume standen, die Heide, auf der sein Vater sterbend lag, Mischa und die Schule, Majas schimmerndes Antlitz und zuletzt der große Saal mit tausend Kerzen und der Strich seines Bogens, an dem die Augen der Menge hingen.
Schwer aufseufzend schlief er dann ein.
2.
Still und flammend stand der Herbst um die Seen. Alle dunklen Waldwege waren Brücken zwischen Feuermeeren. Weißbuchenäste vergoldeten den Fichtenwald, und auf einsamer Lichtung brannte die rote Fackel des Ahorns. Nur der Kranich rief aus verschleiertem Blau, und von den Ablagen rollten die letzten Stämme hinab. Verklang dann das Holpern der Rückerwagen und der weite Widerhall in blauer Dämmerung, dann schärften sich fremdartig alle Linien des Horizontes, und die jungen Birken standen als Wächter, goldgerüstet, vor dem dunkelnden Dom. Sehr weit war die Welt, hallend wie ein leeres Haus.
Harro schloß die Tür seiner Hütte und blickte erschrocken über das leuchtende Land. So überfiel ihn Farbe und Glut und Kranichschrei. Und er lauschte, ob die Geige nicht klänge in dem Kasten, den er in der Hand hielt. Dann verabschiedete er sich von seiner Mutter. »Sei hübsch artig«, sagte Frau Brigitte, »und gieß' den Kaffee nicht um, und iß nicht zu viel, denn das kann sie nicht leiden.«
Herr Immanuel kam pfeifend im Alltagsgewand vom See herauf. »Ah, Harro, der Geigerkönig!« meinte er gemütlich, indem er ihn von der Seite betrachtete. »Was wird der Junge mal für ein Herbarium haben!« dachte er seufzend. »Du, Harro,« sagte er dann, »im Kahn liegen Fische für Frau Ruhoff. Die gib ihr ab und bestelle Grüße von Haus zu Haus.«
Harro nickte und ging zu den Booten. Langsam ruderte er nach dem Schwarzen Fluß. Sein Herz war ihm leicht. Der Krebsfang war zu Ende, und der Stiefvater hielt einen Gehilfen. Noch immer war er im Morgennebel auf dem Wasser und warf vor Abend die Stellnetze aus, aber die Glieder waren nicht mehr so dumpf und schwer, und es blieb Zeit, aus Herrn Ruhoffs Büchern in sich zu reißen, was von dem großen Rätsel sprach.
Der Kahn glitt langsam in die Rohrkämpe, über denen der Blick nur den Himmel fand. Dann wurde das Wasser dunkler, und hinter der letzten Rohrwand trieb mit leise ziehenden Wirbeln der Schwarze Fluß in die Tiefe des düsteren Fichtenwaldes. Harro zog die Ruder ein und ließ das Boot treiben. Wie ein feiner Spiegel empfing seine Seele die veränderte Landschaft. Blutbuchen leuchteten auf den Hängen, und unter müdem Wind verstreute der Wald das langsam fallende Laub. Der Häher rief, und die dunkle Straße floß wie durch eine gestorbene Stadt. »Hier müßten alle Toten einmal einziehen,« dachte Herro, »und auf den beiden dunklen Saiten müßte eine Geige klingen ... und mein Vater würde einen Stern über seiner Wunde tragen ...«
In der Birke, die über der Strömung hing und unter deren schwimmenden Asien das Boot hindurch mußte, lachte es leise auf. »Harro,« rief es, »nimm mich mit, du Märchenprinz!« Und ehe er antworten konnte, saß sie im Kahn, eine Wildnis von leuchtenden Zweigen im Arm.
»Wie wild du bist, Maja,« sagte er nur.
Sie strich ihr rotes Kleid über die Füße und begann aus Vogelbeerbüscheln einen Kranz zu flechten. »Weißt du, wie lange ich fort bin?« fragte sie strahlend. »Seit Mittag! Vater schmökert im Ekkehard, dem Meister aller Meister, und bei Mutter war wieder Sturm. Zwei Goldreinetten waren gemaust. Aber ich, an der Ablage war ich, in den Brüchen, auf dem Signal! Die Reiherinsel hab' ich gesehen, Eichkatzen hab' ich gejagt, die ebenso erstaunte Augen machen wie mein lieber Harro ... ach ihr, ihr ... weshalb kann ich nicht fliegen?« Und sie hob die Arme mit dem roten Laub und ließ sie mit tiefem Seufzer sinken.
»Du, Maja,« sagte er nach einer Weile leise, »du müßtest einen Purpurmantel tragen ...«
»Ach Harro, Harro,« erwiderte sie leise und sah ihn nachdenklich an, »es gibt doch keine Märchen mehr ...« Und sie ließ die abgefallenen Vogelbeeren durch die Finger gleiten.
Als der Kranz fertig war, sah sie prüfend auf Harro. Dann kam sie mit ernstem Gesicht durch den schwankenden Kahn auf ihn zu, kniete neben ihm nieder und drückte ihm den Kranz über die Schläfen. Dann legte sie ihre Arme auf seine Knie und blickte lange und forschend über Kranz und Augen. Und als er, erblassend und schwer atmend, versuchte, die roten Trauben aus seinem Haar zu nehmen, hielt sie seine Hände fest und sagte mit veränderter Stimme: »Wenn du mich ein klein bißchen lieb hast, Harro, dann nimm ihn nicht fort.« Dann ging sie zurück, flocht sich Blutbuchenlaub ins Haar und blieb den Rest der Fahrt schweigsam.
Langsam lichtete sich der Wald. Frische Schollen glänzten zwischen Stoppelfeldern, und hinter der nächsten Biegung lag das Dorf auf der Uferhöhe, Frieden fallenden Laubes über den Rohrdächern, Astern hinter allen Zäunen und jene weite Stille, die nur Kinderruf aus reifenden Apfelbäumen kennt.
Vor der Weinlaube hinter dem Bootsstege saß Herr Leberecht Ruhoff in seinem blauen, bis auf die Knie fallenden Rock, die Hände über dem Stock gefaltet, während der leise Uferwind in seinem langen, grauen Haar spielte.
Maja warf mit beiden Armen Laub und Äste in die Flut, setzte den linken Fuß auf den Kahnrand und sang nach einer ihrer unzähligen eigenen Melodien:
»Sie kommen angefahren, Dein Sohn mit Schwert und Schild, In sonnenhellen Haaren Dein Töchterlein Gunild.«
Herr Ruhoff sprang auf mit der eigentümlichen Unsicherheit der Alternden und Kurzsichtigen, rückte die Brille zurecht und kam eilend an den Steg. »Meine Kinder, meine Kinder!« sagte er mit seiner hohen, feinen Stimme, als der Kiel an die Bretter stieß.
»Vater,« sagte Maja zärtlich, indem sie die Arme um seinen Hals legte und den Kopf rückwärts nach Harro wandte, »sieht er nicht aus wie ein Königssohn?«
»Ja, mein Kind, aber du mußt ihm eine Harfe geben. kein Schwert.«
Harro sprang errötend aus dem Kahn. »Guten Tag, Onkel Leberecht ... es ist alles so schön heute ...«
Als sie den Steg verließen, nahm Harro die Fische aus dem Boot. »Harro,« sagte Herr Ruhoff strahlend, »das ist das große Los! Sie war heute wieder problematisch,« setzte er geheimnisvoll hinzu, und hundert kleine Fältchen stahlen sich unter der Brille hervor. »Zwei Goldreinetten, Baum 1 b im a-Ouadrat. Es war sehr böse. Aber jetzt mußt du vorangehen.«
Harro trat tapfer auf die große Frau zu, die in der offenen Hauslaube stand und sich mit beiden Händen ihr glattgekämmtes Haar noch straffer zurückstrich. Herr Leberecht stieß etwas unvermutet seinen Stock in einen Maulwurfshügel und hob warnend seinen Zeigefinger gegen Maja.
»Guten Tag, Frau Lehrer,« sagte Harro leise und schlug seine Augen voll zu ihr auf. »Die Eltern lassen grüßen, und ... mein Stiefvater schickt diese Fische, und ... ich habe mich so gefreut, daß ich kommen durfte.«
Frau Ruhoff sah ihm starr in die Augen, strich ihm mit einer scheuen Handbewegung das Haar aus der Stirne, und während sie mit einem leise gebrochenen Klang in der Stimme sagte: »Mein Kind, sie sollen dir keine Blutstropfen ins Haar legen,« nahm sie ihm den roten Kranz von den Schläfen und barg ihn in ihrer Schürze. Dann wurdet: ihre Züge wieder unbewegt, sie nahm ihm wortlos das Netz mit den Fischen ab, und indem sie es wägend hob und senkte, sagte sie spöttisch: »Fünf Pfund! Ist ein starker Mann, der Herr Immanuel. Maja, Tisch decken!«
»Na also!« rief Herr Ruhoff strahlend, ließ sein eingebildetes Wild leben und kam die Stufen herauf.
Sie saßen zu vieren um den Kaffeetisch. Herbert Ruhoff war im Kriege geblieben, vermißt seit einer der Winterschlachten im ersten Jahre. Seine Mutter wartete noch immer auf ihn.
»Jetzt sieht er gar nicht mehr aus wie ein Königssohn,« sagte Maja vorwurfsvoll.
Frau Hella schüttelte ihre kräftige Faust durch das lichte Weinlaub nach dem Gartenzaun, von dem es raschelnd davonstob. »Diebsgesindel!« rief sie mit hallender Stimme. Dann sah sie von ihrer Tochter zu Harro und sagte ruhig: »Unsinn! Pelzmützen sind besser als Königskronen.«
Herr Leberecht war erschrocken zusammengezuckt und hatte seine hellen Augen aufgerissen wie ein Käuzlein vor einer Kerzenflamme. Nun machte er es sich wieder heimlich am Tisch, sah lächelnd von einem zum andern und sagte freundlich: »Immer Theater spielen, Maja! Das Leben ist auch so bunt genug.«
»Ja, weiß Gott!« seufzte seine Frau. Dann saß sie wieder kerzengerade auf ihrem Stuhl, zog Bleistift und Notizbuch aus der Schürzentasche, rechnete ein paar Zahlen zusammen und sah eine Weile nachdenklich über den Fluß. »So,« sagte sie endlich. »Nun soll Harro erzählen, was er jetzt den ganzen Tag treibt. Aber nichts auslassen!« setzte sie streng hinzu. »Ich weiß Bescheid.«
Harro machte ein gehorsames Gesicht, faltete befangen die Hände unter dem Tisch und erzählte. »Vor der Schule muß ich die Stellnetze aufnehmen. Dann ...«
»Halt! Wo stehen sie?«
»Am Moor.«
»Wann stehst du auf?«
»Wenn es hell wird ... Dann hänge ich sie auf und nehme die Fische heraus. Manchmal geht es sehr schnell, manchmal ist es sehr schwer, wenn viele Hechte drin sind. Dann fahre ich zur Schule.«
»Um die Zeit steht meine Tochter auf,« warf Frau Ruhoff ein.
»Wenn ich zurück bin, mache ich die Schularbeiten, spiele eine Stunde Geige und liege an den Reiherbäumen. Dann lege ich die Stellnetze wieder aus und bleibe am Moor. Da steht eine Kiefer am Rande, die hat oben einen bequemen Ast, da sitze ich eine Weile ...«
Er lehnte sich zurück und sah über den Garten. »Dann steht die Sonne über den Blutbuchen,« fuhr er selbstvergessen fort. »Es ist so still wie in der Kirche. Alle sind fort, die häßlich und böse sind. Und ich denke, wie ich groß sein werde und fortgehen und Geige spielen vor vielen Menschen ... Dann geht die Sonne unter, und das Wasser wird schwarz. Und ich möchte eine große Schwester haben, und ich bin wohl etwas traurig, wenn ich so allein bin ...«
Maja hatte regungslos zugehört, die Arme aufgestützt und die linke Wange in ihre Hände geschmiegt. Ihre Oberlippe war leicht gehoben und ließ ihre Zähne durchschimmern, wie immer, wenn sie ihr Äußeres vergaß. »Es ist schade, Harro,« sagte sie, auffahrend und ihre Haarschnecken festerdrückend, »daß du nicht fünf Jahre älter bist ...«
»Geht in den Garten, Kinder,« sagte Frau Hella in Gedanken. »Ich habe zu tun. Harro, du bleibst zum Abendessen.«
Die drei standen gehorsam auf, denn auch Herr Leberecht war gemeint. »Jetzt gehen wir in die Schlaraffei!« rief Maja.
Der Obst- und Wirtschaftsgarten war bei Ruhoffs nach der Hausfrau Angaben in Quadrate geteilt, die auf einer kunstlosen Zeichnung mit Buchstaben benannt waren. Jeder Obstbaum und jedes Gemüsebeet hatte seine Nummer, so daß der rätselvolle Ausspruch: »Baum 1c im b-Quadrat wird einen Scheffel Birnen geben« im Schulhause eine jedem verständliche Sprache war. Frau Hella behauptete, Ausgaben und Erträge ließen sich so viel leichter berechnen und vergleichen. Alles andre hieß bei ihr die »Schlaraffei«.