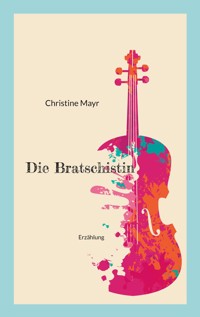
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Macbetta ist ihrer Tochter die beste Mutter, die sie sein kann. Das reicht aber nicht, denn ihre wahre Liebe ist die Bratsche. Violetta spürt das und fängt an, ihrer Mutter das Leben zur Hölle zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Macbetta verliebt sich als Volksschülerin in eine Bratsche und tut alles, was es braucht, um Solistin zu werden. Als sie Violetta bekommt, legt sie ihre Ambitionen auf Eis und widmet sich ihrer Tochter und dem Ensemble-Spiel. Pubertäre Konflikte zerren an ihren Nerven, gehen aber vorüber. Kritisch wird es, als sie ihre Sololaufbahn wieder aufnehmen will. Aus heiterem Himmel wird sie von Violetta mit herben Vorwürfen konfrontiert. Alle Versuche, sich zu erklären, wirken wie Öl ins Feuer. Erst kurz vor ihrem ersten Auftritt entspannt sich der Bogen und Violetta sagt sogar zu, sich das Konzert anzuhören. Doch in der Aufregung vor dem großen Abend macht Macbetta einen fatalen Fehler.
Ich wollte doch nur spielen. Macbetta
Inhaltsverzeichnis
PRELUDIO
ERSTER SATZ: ALLEGRO
REZITATIV
ZWEITER SATZ: ALLEGRO MA NON TROPPO
INTERMEZZO
DRITTER SATZ: FURIOSO
DANKE
DIE AUTORIN
PRELUDIO
Sie läuft. Rennt. Barfuß. In einem langen Kleid. Hört die Stimmen hinter sich. Weiter. Weiter. Das Pflaster ist feucht. Sie rutscht aus. Stolpert über den Saum des Rocks. Weiter, sie muss weiter. Rappelt sich auf. Rafft den Stoff mit beiden Händen. Achtet nicht auf die Stimmen. Polizistinnen. Sie rufen sie. Aber sie muss weiter, weiter. Zum Fluss, zum Wehr. Wo das Wasser in die Tiefe stürzt. In wilder Freude. Hinaus aus dem Gefangensein hinter der Staumauer. Befreit gischtend. Das Gitter des Zauns aus festem Draht. Der Handlauf aus Metall. Sie stemmt sich in die Höhe. Bohrt ihre Zehen in die Fugen des Gitters. Das Wasser schreit. Aus tiefem Schlund. Reißt seine Arme auf, tausend Arme. Ein gieriger Rachen. Die Tiefe brüllt. Tosende Dunkelheit. In der Gasse geht ein Fenster auf. Musik. Sie beugt sich vor. Entzieht ihren Zehen den Halt. Nimmt die Hände vom kalten Metall. Beugt sich tiefer. Jetzt hört sie es. Das Vorspiel zum dritten Akt. Ein roter Rock bauscht sich in der Luft. Jetzt fällt es ihr ein. La Traviata.
Das Wasser fängt sie auf. Umschließt sie. Mit tausend Armen. Mit tausend gütigen Armen. Und doch wird die Hölle ihre Buße sein. Denn sie ist die Schuld.
ERSTER SATZ: ALLEGRO
“Èpermesso, Signorina?”
Die Stühle der kleinen Bar in Medicittàs Altstadt sind alle besetzt, nur an Macbettas Tisch ist noch ein Platz frei. Mit einer Handbewegung erlaubt sie dem jungen Mann, sich zu ihr zu setzen.
Die Herbstsonne wärmt noch, stärker als zu Hause, und der Kaffee schmeckt um viele Facetten reicher. Macbetta ist glücklich. Seit zwei Wochen ist sie hier und fühlt sich schon daheim. Der Klang der Sprache, den sie fast so liebt wie den ihrer Viola. Das Schnattern der Italienerinnen, das Lachen der Italiener, die vereinzelten Wortfetzen aus anderen Sprachen, die sie nicht kennt.
Im Geschäft gegenüber trägt eine Schaufensterpuppe ein tiefrotes Kleid mit asymmetrischem Ausschnitt. Die linke Schulter ist unbedeckt, an den rechten Arm schmiegt sich Seide bis zur Hand. Ein golden gesäumtes Bändchen hält den Ärmel am Mittelfinger fest. Macbetta kann es fühlen. Wie der weiche Stoff ihrem Handgelenk schmeichelt, wie das Holz der Viola ihre Schulter berührt, ihre Haut kühlt. Sie schließt kurz die Augen. Sieht sich in der Aula der Universität beim Abschlusskonzert. Fühlt, wie das feine Tuch bei jeder Bewegung des Bogens ihren Arm streichelt. Hört, wie die Töne der Saiten zum Publikum fliegen.
Die Università Musicale di Medicittà ist international sehr angesehen. Wer es hier schafft, ist für alle großen Bühnen der Musikwelt gerüstet. Hier wird sich Macbetta ihren Traum erfüllen. Den Traum, den sie träumt, seit sie zwölf war. Solistin werden. Vorne stehen, neben der Dirigentin, vor den anderen. Nicht als Tuttistin in einem Orchester landen.
„Ich will nicht unter denen sein, die den Teppich für die Solistinnen weben“, hat sie zu ihrer Mutter gesagt. „Ich will die sein, für die der Teppich gewoben wird. Lass mich die Aufnahmeprüfung für Heggenburg machen.“ Das Musikalische Oberstufengymnasium Heggenburg ist in der Musik das, was Stams im Sport ist: eine Talenteschmiede, in der nur die Besten aufgenommen werden. Was für Macbetta allerdings bedeuten würde, Albruggen zu verlassen und auf ein Internat zu gehen.
Bruna war nicht wirklich überrascht vom Ansinnen ihrer Tochter und konnte der Vorstellung, dass die in ein Internat entschwinden würde, einiges abgewinnen. Weil Macbetta mit ihrem Instrument entschwinden würde. Auch wenn Brunas Anfangsmeuterei gegen die Bratsche von der töchterlichen Begeisterung niedergeschlagen worden war, ertrug sie die häuslichen Übungseinheiten nur, indem sie ihre Ohren unter Kopfhörern vergrub und ihre eigene Musik hörte. „Warum nicht?“, sagte sie deshalb. „Du hast bis jetzt jeden Wettbewerb gewonnen, zu dem du angetreten bist. Die nehmen dich bestimmt.“
Sie chauffierte ihre erfolgshungrige Tochter zur Aufnahmeprüfung und wartete mit ihr im kühlen Flur des altehrwürdigen Gebäudes auf den großen Moment. Macbetta wirkte ruhig und als sie aufgerufen wurde, sprang sie auf.
Bruna wünschte ihr alles Gute und klopfte ihr auf die Schulter. „Du machst das.“
„Nun, Fräulein Aegerli, was haben Sie uns mitgebracht?“
Vor Macbetta saß eine Reihe von Jurorinnen und Juroren.
„Stamitz, Hoffmeister und Bartok“, sagte sie und legte die Noten auf den Ständer. Sie spannte den Bogen, setzte die Bratsche an und suchte den besten Stand für ihre Füße.
Griff nach den Saiten und schloss die Augen. Wartete drei Atemzüge ab. Cäcilia geh dich anziehen. Sie hörte den Geigenbauer, bei dem sie ihre erste Bratsche bekommen hatte. Sie sah sein Lachen und erinnerte sich an das wunderbare Gefühl, als er sie Bratschistin genannt hatte. Sie, die kleine Betti mit dem großen Instrument in den Armen.
Dann legte sie los.
Nach dem letzten Ton blieb es still. Macbetta öffnete die Augen und lächelte. Sie war gut gewesen, sehr gut. Besser denn je. Egal, ob ihr mich nehmt oder nicht, ich bin mit mir zufrieden. Sie ließ Bogen und Viola sinken. „Sie haben ja gar nicht auf die Noten geschaut“, sagte die Jurorin und Macbetta wusste nicht, ob das als Kompliment oder Kritik gemeint war. „Bitte nehmen Sie noch einen Moment draußen Platz.“ Nach ein paar Minuten ging die Tür auf.
„Wir sehen uns im Herbst. Wir freuen uns auf Sie“, sagte die Prüferin.
Der dunkelhaarige Wuschelkopf an ihrem Tisch bestellt einen Macchiatone. Macbetta schaut auf. Dieses Getränk kennt sie nicht. Darf ich fragen, was das ist, würde sie gerne sagen, aber etwas hält sie zurück. Er sieht ihren fragenden Blick und lächelt sie an. Das macht ihr Mut. „Was ist das, ein Macchiatone?“, fragt sie.
„Das ist ein Macchiatto mit etwas mehr Milch. Darf ich dich auf einen einladen?“
Sie trinkt ihren Kaffee normalerweise schwarz, aber. Das Lächeln des Ragazzo ist einfach zu einladend. Sie spürt, wie ihr die Wärme ins Gesicht steigt. Nicht die Wärme der italienischen Sonne. „Gern“, sagt sie und die Wärme wird zur Glut. Hoffentlich merkt er das nicht.
Er schnalzt mit der Zunge und deutet dem Kellner mit Zeige- und Mittelfinger: zwei.
„Du bist auch an der Uni, nicht wahr? Ich habe dich vor ein paar Tagen dort gesehen.“
„Ja, ich studiere Viola. Und du?“
„Dirigieren. Ist mein letztes Jahr. Ach, entschuldige, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Sono Fabio.“
„Macbetta. Piacere.“
„Macbetta … Was für ein ungewöhnlicher Name. Macbetto kenne ich, Lady Macbeth auch.“ Er schmunzelt. „Ich bezweifle, dass du eine machtgierige Anstifterin zum Königsmord bist.“
„Wer weiß?“ Macbetta schmunzelt auch.
Der Kellner bringt zwei dickwandige Kleingläser mit üppigem Milchschaum. Eine Achtelnote aus Kakao ziert die Oberfläche. Ach, wie entzückend! Fast ein Grund, dem Espresso zu entsagen und auf Kaffee mit Milchschaum umzusteigen.
„Wohnst du im Studentenheim?“
„Nein, ich habe ein privates Zimmer bei einer alten Dame.
Sie hat eine große Villa oberhalb der Uni, mit einem verwilderten Garten. Sie vermietet vier Zimmer und ist sehr nett, aber auch ein bisschen anstrengend.“ Macbetta löffelt sich einen Hub Milchschaum in den Mund. „Sie hat sich anscheinend zum Ziel gesetzt, mein Italienisch zu perfektionieren. Wann immer ich auftauche, fängt sie mich ab, um mit mir zu parlieren. Parlieren, so sagt sie.“
Macbetta lacht. „Sie ist ein bisschen altmodisch. Die Zimmer, die sie selbst bewohnt, sind mit Kitsch und Kunst vollgestopft. Sie hat mir am ersten Tag das ganze Haus gezeigt. Bis unter den Dachboden hängen überall Bilder, die sie selbst gemalt hat. Zu jedem gibt es eine Geschichte.“
Sie verrollt die Augen. „Ich glaube, meine Zeit hier wird nicht ausreichen, um alle Bilder-Geschichten zu hören.“
Fabio schmunzelt und auf seiner Stirn bildet sich ein Herzchen. „Ich glaube, ich kenne die Frau. Heißt sie Baldacci?“
„Ja.“
„Die ist berühmt in Medicittà. Beherbergt immer Studentinnen der Uni und labert sie voll. Aber sie hat ein großes Herz, was man so hört.“
„Ganz bestimmt.“
„Il conto, per favore!“, ruft Fabio und bezahlt auch Macbettas Kaffee.
„Grazie.“
„Di niente. Magst du mir deine Telefonnummer geben?
Dann zeige ich dir einmal die Stadt. Wenn es dich interessiert.“
„Gern. Sehr gern.“
„Man kann ja nicht immer nur studieren.“
„So ist es.“ Betti nimmt den Bon, den der Kellner unter den Aschenbecher gesteckt hat und sucht in ihrem Rucksack nach einem Stift.
„Da, bitte.“ Fabio zieht einen Fineliner aus der Brusttasche seines Hemds und reicht ihn Betti. Sie schreibt ihre Nummer darauf, gut leserlich, und schiebt Fabio den Zettel zu.
„Ich muss“, sagt Fabio. „Es hat mich sehr gefreut, Macbetta. Ci vediamo.“
„Wir sehen uns.“
Betti bleibt sitzen und schaut der gedrungenen Gestalt nach. Er dürfte kaum größer sein als sie. Fabio, sagt sie leise zu sich. Stöckelschuhe werde ich keine tragen, wenn ich dich treffe. Dann geht auch sie. Das rote Kleid in der Auslage gegenüber hat sie vergessen.
Das Schuljahr in Heggenburg begann mit einem Gottesdienst. Macbetta trat in den hohen, kühlen Raum der Klosterkirche und tauchte zwei Finger in das Weihwasserbecken hinter dem Eingangsportal, das leise quietschend zuschwang. Sie bekreuzigte sich und deutete einen Knicks an. Die Gebetsreihen waren schon gut gefüllt, und Macbetta schaute, wohin sie sich setzen könnte. In einer der hinteren Reihen entdeckte sie ein bekanntes Gesicht und schlüpfte zu ihm in die Bank. „Hallo Lorenz“, sagte sie leise, und das Gesicht wendete sich ihr zu. „Hallo Betti! Ich habe schon gehört, dass du kommen wirst.“
Ich muss ihm sagen, dass ich jetzt Macbetta bin. Aus der Betti bin ich herausgewachsen. In diesem Moment kündigte ein Klingeln den Auftritt des Priesters an. „Wir reden später weiter“, flüsterte sie und stand auf. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Zeremonie begann, und Macbetta machte automatisch all das Hinsetzen und Aufstehen mit, das eine katholische Messe mit sich bringt. Sie ist oft genug in Kirchen gesessen, um die Bewegungsrituale im Schlaf zu kennen. Lorenz machte ihr alles lustlos nach.
Im dritten Jahr fuhr die Klasse nach Verona. Der Zug hatte an der Grenze eine halbe Stunde Aufenthalt, und die Flinken nützten das, um etwas zu essen zu besorgen. „Urlaub in Italien beginnt mit einer Brennerjause“, behauptete Lorenz, bevor er lossprintete. Obwohl es keineswegs Urlaub war, was sie vorhatten. Sondern eine fächerübergreifende Schulwoche. Sprache und Musik. In jenem Land, dessen Sprache Musik in Macbettas Ohren ist und dessen Musik zu ihrer Seele spricht.
Sein Platz beim Fenster war noch leer, als das Pfeifen des Schaffners ertönte, dem das Klacken der sich schließenden Türen folgte. Mit einem Ruck setzte sich der Zug in Bewegung, und Lorenz riss die Tür zum Abteil auf. „Puh, das war knapp“, stöhnte er und ließ sich in den Sitz fallen.
„Das war vielleicht ein Zugang, in der Macelleria.“ Er klappte das Tischchen auf, das in der Fensterbank steckte, und legte seine Beute ab. Ein Papiersäckchen und zwei kleine Pakete. Aus dem Säckchen fischte er etwas, das aussah wie eine Semmel mit Elvis-Tolle. „Ölbrot“, erklärte er und enthüllte, was in das Wachspapier eingeschlagen war: Salami und Gorgonzola. Der Duft schmeichelte sich in Macbettas Nase, und sie dachte an ihre eigene Jause, die in einer Aluminiumbox auf ihren Hunger wartete.
Schwarzbrotscheiben und Kaminwurzenpärchen. „Du schaust drein, als ob du noch nie eine Brennerjause gesehen hättest“, stellte Lorenz grinsend fest. „G’lustet’s dich?“
„Das riecht schon sehr italienisch.“
„Ich lass dich kosten.“
Lorenz fingerte ein Schweizer Messer aus seiner Hosentasche und halbierte das Brötchen. Er bestrich die Hälften mit dem weichen Käse und legte Wurstscheiben darauf.
„Prego, Signorina“, sagte er und reichte Macbetta eine davon. Das war der Moment, in dem sie sich verliebte.
„Ich komme wieder“, flüsterte sie der Landschaft zu, die sich sachte und lichter werdend gen Süden senkte. Sie schob den Panino-Salami-Gorgonzola-Bissen in ihrem Mund hin und her, bis auch die letzte Zelle ihres Gaumens den Geschmack verkostet hatte.
Untergebracht waren sie in einem von Ordensschwestern geführten Bildungshaus. Der ehemalige Klostertrakt strahlte eine asketische Ästhetik aus, die Macbetta gefiel.
Die Fenster wirkten frisch erneuert, und das Fischgrätenmuster des Parketts glänzte kastanienrot. „Anders als in unserer Schule“, sagte Lorenz, „wo wir auf rohen Brettern knien müssen.“ Macbetta seufzte zustimmend. „Weißt du, wie oft ich mir Schiefer aus der Haut ziehen musste?
Immer wenn ich gewetzt habe, weil das Gemurmel mit den Rosenkränzen nicht und nicht aufhören wollte.“
Jede Schülerin bekam ihre eigene kleine Zelle, in der ein hölzernes Kreuz das dominante Einrichtungsstück war.
Davon abgesehen schöne Zweckmäßigkeit ohne Firlefanz.
Macbetta packte ihren Koffer aus und war zufrieden.
Auch mit dem Abendessen, zu dem sie bald gerufen wurden. Über dem Buffet hing der Duft von Kräutern und wehte Bilder von Sonnenbädern, Amphitheatern und Skulpturen aus weißem Marmor durch Macbettas Kopf.
In den Terrinen dampfte Pasta, wahlweise in Form von Spiralen oder Röhrchen, dazu Fleischsugo oder Käsesauce. Macbetta holte sich vorher einen Salat aus grob geschnittenen Tomaten und Zwiebeln. Als Nachtisch gab es Panna Cotta, und während sie den festen Pudding mit Karamell löffelte, erneuerte sie ihr Zuggelübde. Italien, ich komme wieder.
Abgesehen von den Kruzifixen in den Zimmern drängte sich der Katholizismus nicht so auf wie in der Schule. Die Nonnen erkannte sie nur an deren farbneutraler Kleidung, und auf dem Programm für die Woche stand weder eine Andacht noch eine Messe. Das Bon dì, das man einander zuwarf, bemühte nicht bei jedem Gruß einen Gott.
Nach dem Abendessen stand ein Get-together im Kaminzimmer an, bei dem die Details für die Verona-Woche bekannt gegeben werden sollten. Ausklingen würde der Tag mit einem Vortrag über ein Stückchen italienischer Musikgeschichte, gehalten von einem Mitglied des hiesigen Orchesters. Vorher klopfte Macbetta an Lorenz‘ Tür.
„Kannst du mir mal eine Nagelfeile leihen? Ich habe meine zu Hause vergessen.“ Er warf einen Blick auf ihre Hände. „Mir ist noch nie aufgefallen, dass du so lange Finger hast“, sagte er und wurde ein bisschen rot. Macbetta hatte keine Idee, was sie darauf sagen sollte. Seit er im Zug sein Brot mit ihr geteilt hatte, war die kumpelhafte Vertrautheit zwischen ihnen einer sirrenden Sehnsucht gewichen, die Macbetta neu war. „Komm herein.“ Er ging in das Zündholzschächtelchen von Bad und sie sah sich im Zimmer um. „Bei dir hängt ja gar kein Kreuz“, sagte sie.
„Das habe ich abgehängt. Solange ich hier bin, darf es auf dem Kasten ruhen. Ich mag keine toten Männer herumhängen haben.“
„Aha.“ Sie nahm die Feile entgegen, die er ihr reichte.
„Die ist aus Glas. Lass sie bitte nicht auf die Fliesen fallen, sonst zerbricht sie.“
„So etwas kenne ich gar nicht.“
„Ist gut zu den Nägeln“, sagte Lorenz und wurde noch ein bisschen mehr rot. „Wiedersehen macht Freude“, versuchte er einen Scherz. Aber als er erkannte, dass Macbetta das vielleicht nicht auf die geliehene Feile beziehen könnte, wurde er feuerrot. „Wir sehen uns“, sagte er und öffnete die Tür. „Bis später.“
„Treffen wir uns beim Brunnen vor der alten Uni?“
Der Ragazzo mit dem Herzchen auf der Stirn hat sich eine Woche Zeit gelassen, bis er Macbetta anruft. Doch sie ist ohnehin so beschäftigt, dass sie nicht ins Grübeln kommt, ob er es mit der Stadtführung ernst gemeint hat. Zwischen Vorlesungen über Musikgeschichte, Gehörbildung, Harmonielehre, Bratschenunterricht und Üben ist gerade einmal genug Freiraum geblieben, um sich im Campus zurechtzufinden und sich durch die Cornetti zu kosten, die die Bars auf dem Weg von der Casa Baldacci zur Universität anbieten. Nach drei Morgen mit Signora Baldaccis Wortschwall über Toast mit Orangenmarmelade („Aus Sizilien! Biologischer Anbau!! Die allerbeste Marmelade!!!“) hat sie der Hausherrin mit allen ihr zur Verfügung stehenden Höflichkeitsfloskeln erklärt, dass sie unter der Woche keine Zeit fürs Frühstücken habe. Dass sie aber samstags und sonntags liebend gern das ausgezeichnete Frühstück genießen würde. Sie hatte mitbekommen, dass die Madamina an Samstagen früh zum Einkaufen fuhr. („Zum Esselunga. Immer zum Esselunga. Das ist der beste Supermarkt, den es gibt! Ich nehme Sie einmal dorthin mit. Den müssen Sie kennenlernen. Es gibt keinen Besseren!“) Das war Macbettas Chance, ihren Kaffee in Ruhe zu trinken. Und am Sonntag – nun, da würde sie sich eben auf Sprachperfektionierung alla Baldacci einstellen.
Von der Stadt kennt sie bisher nur die beiden Straßen, die von ihrer Unterkunft hinunter zur Universität führen. Die eine, die Via IV Novembre (Gibt es eigentlich einen einzigen italienischen Ort, in dem keine Straße an die Niederlage der Österreicher 1918 erinnert??), eine herrschaftliche Avenue mit breiten Trottoirs, neigt sich in einem sanften Bogen zum Ponte della Vittoria (Und an welchen Sieg soll diese Brücke wohl erinnern??). Die andere führt etwas direkter, dafür steiler abfallend und mit Treppenpassagen durchsetzt, zu einer schmalen Fußgängerbrücke, die namenstechnisch historisch unbelastet ist. Sie firmiert im Hause Baldacci simpel als Il Ponticello.
Und, ja, der Brunnen vor der alten Uni ist Macbetta schon untergekommen. An dem Abend nach ihrer Ankunft, als sie zum historischen Zentrum der Stadt hinaufspaziert ist, um sich einen ersten Eindruck von Medicittà zu verschaffen. Er ist der Blickfang des Hauptplatzes. Auf seinen Stufen hat sie in Gesellschaft fotografierender Touristinnen ein Eis geschleckt und sich an ihr Zuggelübde vor zwei Jahren erinnert. Italien, ich bin wieder da.
Es ist ein Sonntag Ende Oktober, und vom Fluss ziehen vereinzelt Nebelschwaden herauf. Die touristischen Schnattergänse und ihre Gänseriche sind großteils abgereist. Es beginnt die Zeit, in der Medicittà wieder ihren Bewohnern und der Musik gehört. Der Stein der Brunnenfassung, auf den sich Macbetta setzt, um auf Fabio zu warten (Ist der als Dirigent auch unpünktlich?), trägt schon herbstliche Kühle. Macbetta umkreist deshalb lieber das großzügig angelegte Wasserbecken, in dessen Mitte eine mächtige Statue aus vielen Öffnungen Wasser speit.
„Das ist ein Pallone-Spieler“, sagt eine Stimme plötzlich neben ihr.
„Fabio!“
„Entschuldige die Verspätung. Mamma wollte unbedingt noch zwei Pflanzen vor dem Frost retten.“ Er verdreht die Augen.
Macbetta kann ihm unmöglich übelnehmen, dass er sie hat warten lassen. „Wie war das? Was hat es mit dieser Statue auf sich?“
„Sie stellt einen Pallone-Spieler dar. Pallone ist ein altes, eigentlich vergessenes Ballspiel, das im siebzehnten, achtzehnten Jahrhundert hoch in Mode war. Da ist diese Skulptur entstanden. Übrigens von einem Österreicher entworfen, demselben, der den Garten in Salzburg gestaltet hat, den … Mozartgarten?“
„Ich glaube, du meinst den Mirabellgarten.“
„Genau. Aber der Name des Baumeisters fällt mir im Moment nicht ein.“ Fabio entziffert das Schild, das auf dem Sockel der Statue angebracht ist.
„Johann Bernhard Fischer von Erlach“, liest er vor.
„Ja, der Name sagt mir etwas.“
Fabio deutet auf die Stellen, aus denen das Wasser fließt.
„Das sind die Stacheln des Schlagärmels, den die Pallone-Spieler getragen haben. Mit denen haben sie den Ball geschlagen.“
„Schaut ziemlich martialisch aus.“
„Goethe hat das nicht so gesehen. Er hat gefunden, dass das Spiel große Ästhetik hat. Manche Bewegungen der Spieler seien so schön, dass man sie in Marmor nachbilden sollte. Was hier ja geschehen ist.“
„Du hast Goethe gelesen?!“
„Na ja, nur ein paar Seiten der Italienischen Reise.“ Fabio wendet sich zum Gehen. „Dort oben, das ist die alte Uni.





























