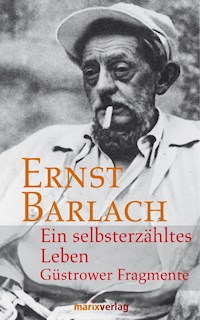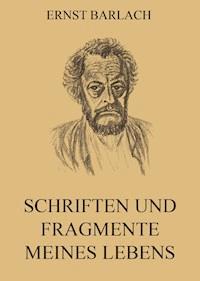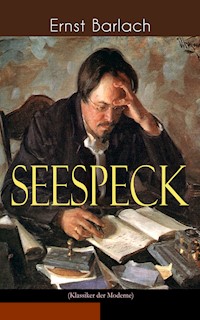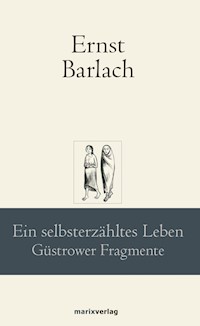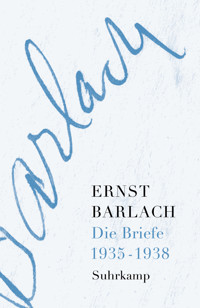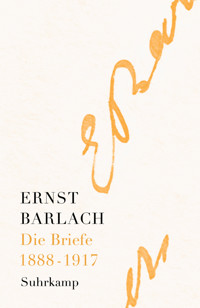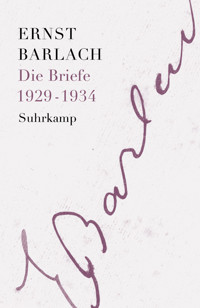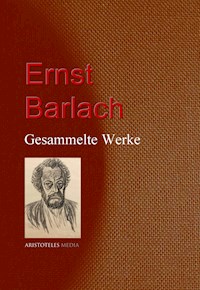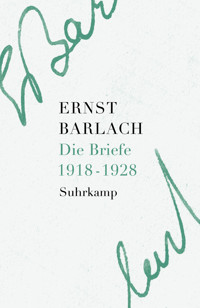
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ernst Barlach nimmt unter den Künstlern der Moderne einen besonderen Platz ein. Über Barlachs Der tote Tag befand Thomas Mann, es sei das »Stärkste und Eigentümlichste …, was das jüngste Drama in Deutschland hervorgebracht hat«. Über seine Plastiken hielt Bertolt Brecht fest: »Sie haben viel Wesentliches und nichts Überflüssiges.« Als Neil MacGregor 2014 für seine Londoner Ausstellung »Deutschland – Erinnerungen einer Nation« nach einem ikonischen Exponat suchte, entschied er sich für Barlachs »Schwebenden« aus dem Güstrower Dom.
Anlässlich des 150. Geburtstages von Ernst Barlach erscheinen seine Briefe in einer vierbändigen Ausgabe. Sie enthält neu aus den Originalen transkribierte Texte mit einem kontextbezogenen Kommentar. Ein Viertel der gut 2200 Briefe wird hier zum ersten Mal veröffentlicht.
Mit den Briefen schrieb Barlach den Roman seines Lebens. Der Bogen reicht von Sinnsuche und Selbstaussprache über Künstlerwerdung und Meisterschaft bis hin zu Verzweiflung und Vereinsamung. Der alleinerziehende Vater gibt Nachricht, der selbstbewusste Künstler verhandelt, der Einzelgänger zieht sich zurück, der politisch interessierte Beobachter kommentiert. Der hier schreibt, ist belesen in vielen Literaturen, bewandert in der Kunst und begabt, von sich zu sagen. Er ist feinfühlig und unbescheiden, neugierig und starrsinnig, er bittet und ignoriert. In seinen Briefen wird Barlach kenntlich als Mensch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1101
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
ERNST BARLACH
Die Briefe Kritische Ausgabe in vier Bänden
Ein Editionsvorhaben der Ernst Barlach Stiftung Güstrow und des Ernst Barlach Hauses Hamburg an der Universität Rostock
ERNST BARLACH
Die Briefe
Band II: 1918-1928
Herausgegeben von Holger Helbig, Karoline Lemke, Paul Onasch und Henri Seel unter Mitarbeit von Volker Probst, Franziska Hell und Sarah Schossner
Suhrkamp
Inhalt
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
Bildteil
Personenregister
Ortsregister
Werkregister
1918
471 an Karl Barlach, Güstrow, 2. Januar 1918
Lieber Vetter,
ich freue mich, daß Dir die Gruppe1 im Hause behagt. Wenn Du mir einmal eine, wenn auch beiläufige, kleine Zeichnung von der Elbe2 stiften willst, werde ich sehr zufrieden sein. Ich sende Dir gleichzeitig mein letztes Drama, im Text.3 Lies es aber nur, wenn es Dir einmal so kommt und Du nichts Besseres vornehmen magst. Ich erwarte keineswegs eine baldige Quittung. Uns gehts so ziemlich befriedigend. Prosit Neujahr!
Herzlichen Gruß Dein Vetter Ernst. |
Güstrow i. M.
Schwerinerstr. 22
2. Jan. 1918
Postkarte, 1 Bl. mit 2 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, Anmerkung des Empfängers, 8,9 × 13,9 cm; Ernst Barlach Haus Hamburg; Barlach 1968/69; [383]
1Gipsmodell der Figurengruppe Trauer (↘ 464, Anm. 6).
2Zu Karl Barlachs künstlerischer Tätigkeit ↘ 464, Anm. 1.
3Der Textband des Dramas Der arme Vetter (ohne Lithografien) erschien 1918 im Verlag Paul Cassirer.
472 an Hans Franck, Güstrow, 3. Januar 1918
Güstrow i. M.
Schwerinerstr. 22
3. 1. 18
Sehr geehrter Herr,
ich danke Ihnen bestens für die übersandten Bücher,1 von denen das Drama2 stark auf mich gewirkt hat. Ich lebe seit 1910 in Güstrow und finde hier, im Gegensatz zu Berlin, die äußere Gleichförmigkeit der Alltäglichkeit, die ich brauche. Eine Künstlerin, gleichfalls in Mecklenburg wohnend,3 klagte mir über mangelnde Anregung, welch ein Misverständnis dessen was nottut!
Mit ergebenstem Gruß
Ihr EBarlach
Brief, 1 Bl. mit 1 beschriebenen Seite, schwarze Tinte, 24,5 × 15,6 cm; Getty Research Institute Los Angeles (910172); Berswordt-Wallrabe 1998
1Franck sandte EB regelmäßig Exemplare seiner Aufsätze, Bücher und Manuskripte, oft mit einer persönlichen Widmung versehen. EB bedankte sich mit Druckgrafiken (Baudis 1998, 12f.).
2Vermutlich das Manuskript zu Hans Francks Drama Freie Knechte (↘ 485).
3Vermutlich Sella Hasse, mit der EB im Jahr zuvor in Briefkontakt stand, jedoch eine persönliche Begegnung ablehnte (↘ 463).
473 an Karl Barlach, Güstrow, 10. Februar 1918
Güstrow i. M.
Schwerinerstr. 22
10. 2. 18
Lieber Vetter,
ich bin nicht eingenommen genug von mir um zu glauben, Dir bei Gelegenheit des Todes Deines Vaters1 etwas sagen zu können, das Dir von Wert sein könne. Ich könnte eigentlich so viel sagen, daß es nicht im Briefe zu erledigen wäre, denn die Begriffe Sohn u. Vater haben für mich eine ungeheure Weite, aber das wären vermutlich Dinge, die zu hören Dir im Augenblick nicht paßlich wären. Ein Vater, den man wie ich im Alter von 14 Jahren verliert, ist etwas | unbegreiflich Anderes als der, welcher Einem als erwachsener Mann entrissen wird. Mag sein, daß mir aus meinen Erfahrungen soviel Mystik in den Vaterbegriff geflossen ist und daß diese Dinge Dir anders vorkommen. Aber, wie das Alles sein möge, eine originelle, starke Persönlichkeit verschwinden zu sehen, muß eine Erschütterung mit sich bringen, die nicht leicht überwunden wird. Es ging mir einmal mit der Todesnachricht von einem älteren Freunde,2 der stärksten u. ja – mächtigsten Jugenderfahrung, die ich gemacht, so, daß ich einige Stunden auf u. ab gehen mußte u. den Gedanken: »er ist tot« so unüberwindlich fand, daß meine Vorstellungskraft ihm gegenüber versagte. Onkel Karl stelle ich mir etwa so vor, daß sein Fehlen, sein Nichtdasein | im ersten Augenblick als etwas Unmögliches erscheinen muß für die, welche ihm nahe standen. Ich wäre Dir dankbar, wenn Du mir gelegentlich das Nähere über seine letzten Tage schreiben wolltest.
Unsre Unterhaltung über den Armen Vetter ist wohl einstweilen überflüssig geworden. Ich kann aber um eins nicht herum. Ich lebe mit den Gestalten jahrelang so, daß sie mir so unpsychologisch vorkommen, wie uns das Leben um uns. Sie handeln so, weil sie müssen, die Natur schafft es, nicht die Überlegung oder Konstruktion. Ich fühle nicht, daß ich schreibe, dichte, schaffe, sondern ich schreibe nieder was geschieht, was ich erfahrend wahrnehme. Ich wäre versucht, beteuernd zu sagen: es war in Wirklichkeit so. Iver3 steht auf einem andern Stern, gehört nicht hierher. Das Gefühl habe ich jahrelang mit mir getragen: man ist hier überflüssig. Ich dächte sowas | genügt, um einen zu zermürben. Ich weiß wohl, was Frl. Isenbarn im letzten Akt thut ist ein bischen verrückt.4 Aber kann man mit solchen Erlebnissen vernünftig sein, kann man rechnen: ich bin ja frei? Handelt man konsequent, kann man anders als mit schwindelndem Kopf folgen?
Aber natürlich, was nicht überzeugt ist nicht überzeugend u. überreden zur Überzeugtheit5 kann man Niemand!
Ich bin bis 30. April zurückgestellt. Leider haben wir Ursache zu glauben, daß Hans in großer pekuniärer Bedrängnis ist.6 Eine Karte, die sehr spät ankam u. noch vom Herbst war, ließ es schließen. Von den beiden Amerikanern7 verlautet natürlich nichts. Man hofft das Beste, aber das Hoffen wird auch mürbe mit der langen Zeit. Meine Mutter grüßt bestens und bittet mich Dir in treuer Verwandschaftlichkeit Ihr Beileid auszusprechen.
Herzlich, Dein Vetter Ernst.
Brief, 1 DBl. mit 4 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, Unterstreichungen des Empfängers, 22,1 × 14,0 cm; Ernst Barlach Haus Hamburg; Barlach 1968/69; [384]
1Carl Richard Barlach verstarb am 1. 2. 1918 in Neumünster.
2Nicht ermittelt.
3Hans Iver, Hauptfigur im Drama Der arme Vetter.
4Fräulein Lena Isenbarn, Figur im Drama Der arme Vetter, bekennt sich in der 12. Szene des Stücks zum verstorbenen Hans Iver. Nachdem sie sich von ihrem Verlobten Siebenmark losgesagt hat, dient sie als »Magd eines hohen Herrn. […] Der hohe Herr war ihr eigener hoher Sinn – und dem dient sie als Nonne – ja, ihr Kloster ist die Welt, ihr Leben – als Gleichnis« (AV, 630).
5Mögliche weitere Lesart: »Überzeugung« (Barlach 1968/69, I 521).
6EBs Bruder Hans versuchte in dieser Zeit, den ukrainischen Teil Russlands (RSFSR) zusammen mit seiner Frau Olga zu verlassen und nach Deutschland zurückzukehren. Aufgrund der politischen Lage war eine Rückkehr äußerst schwierig: Die Ukraine strebte während des Ersten Weltkriegs und der russischen Oktoberrevolution, besonders intensiv 1917, nach Unabhängigkeit und geriet gleichzeitig aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zwischen die politischen und wirtschaftlichen Interessen der im Krieg streitenden Großmächte, vor allem Deutschland und Russland. Zudem wurde Hans Barlach in der Zeit des Ersten Weltkriegs inhaftiert (↘ 393; GT, 233; Briefe 1968/69, II 873). In dieser Zeit versuchte EB den Kontakt zu seinem Bruder zu halten und ihn finanziell zu unterstützen.
7EBs Brüder Joseph und Nikolaus Barlach lebten seit 1910 bzw. 1911 in den USA. Die Vereinigten Staaten waren im April 1917 in den Ersten Weltkrieg eingetreten.
474 an August Gaul, Güstrow, 18. Februar 1918
18. 2. 18
Güstrow
Lieber Gaul,
selbstverständlich komme ich auf den ersten Anruf, wenn die Sache1 es nötig macht. Neulich wäre ich fast zu einem Begräbnis2 fortgekommen, ich stand mit gepacktem Koffer auf dem Bahnhof, aber der Zug war seit einigen Wochen ausgefallen und so tappte ich tiefbeglückt wieder heim. Man wird immer chinesischer3 und bildet sich schließlich ein, es sei ein Opfer, mal auf Reisen |4 zu gehen. Sie sehen also wie wichtig es mir ist, diesen Auftrag zu bekommen, da ich so freudig ja sage. Ich hoffe, daß ich das Paar anständiger Stiefel, hinter denen ich jetzt ca. 4 Monate her bin, in einigen Tagen, wenigstens in dieser Woche, haben werde.
Wenn es sich einrichten ließe, daß ich Sie sprechen kann, bevor ich mich dem Kultusminister5 darstelle, wäre es um so besser. Ich würde Ihnen, da ich doch wahrscheinlich Abends fahre, gleichzeitig ein Telegramm senden, und Sie bitten, wenn es angeht, am Morgen | früh des nächsten für mich dazusein, könnte ich aber mit dem Mittagszug reisen, d. h. gäbe es nicht die gleiche Überraschung wie neulich, so würde ich Sie für den Abend benachrichtigen, und Sie, sollte ich im Hotel Baltic, am Stettiner Bahnhof,6 keine Äußerung von Ihnen vorfinden, anrufen, ehe ich hinausfahre.
Ich bin durch die Vergegenwärtigung aller Umstände, die Sie zu bestehen haben, ein bischen beschämt, hier so ruhig zu sitzen und abzuwarten.
Viele Grüße!
Ihr ergebener
EBarlach
Brief, 1 DBl. mit 3 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, 22,1 × 14,0 cm; Ernst Barlach Haus Hamburg; Barlach 1968/69; [385]
1August Gaul vermittelte EB den Auftrag des Preußischen Ministeriums für Geistliche und Unterrichtsangelegenheiten, ein Kruzifix zur Aufstellung auf Soldatengräbern zu gestalten (Laur II 262-265). Es kam nicht zur Ausführung. Erst 1931 wurde ein Bronzeguss der zweiten Fassung für die Elisabethkirche in Marburg angefertigt.
2↘ 473.
3Vermutlich eine Anspielung auf die taoistische Handlungsmaxime des Wuwei, eine beschränkende Anpassung des Handelns an die gebotenen Gegebenheiten. EB befasste sich mit chinesischer Literatur und Philosophie in Nachdichtungen und Übersetzungen (↘ 191; ↘ 197).
4↘ Bildtafel 1.
5Friedrich Schmidt-Ott war von August 1917 bis November 1918 Preußischer Minister für Geistliche und Unterrichtsangelegenheiten.
61911 nach einem Entwurf des Schweizer Architekten Hans Bernoulli (1876-1959) erbautes Hotel in der Invalidenstraße 120-121.
475 an Karl Barlach, Güstrow, 24. März 1918
Güstrow 24. 3. 18.
Lieber Vetter,
wir sind über die Drangsal, die Dir die kommenden Wochen bringen werden, sehr bedenklich, es will uns bedünken, als nähmest Du Dir etwas Unmögliches vor, Doch hapert es natürlich aus so weiter Entfernung und bei der Uneingeweihtheit in die Umstände an guten Ratschlägen, man denkt: Arzt hilf Dir selber.1
Wir sind in ziemlicher Bestürzung, soweit die großen Ereignisse,2 die alle Welt erfüllen noch Raum für persönliche Sorgen lassen. Ich will aber gleich zugeben daß der Raum doch wohl noch ziemlich groß ist. Wohnungsnot: wir müssen zum Herbst umziehen und Wohnungen sind nicht nur knapp sondern infolge der Zuzüge durch Lagerbeamtenfamilien ganz unauftreibbar geworden.3 |
Alles kauft Häuser, aber ich möchte um die Welt nicht genötigt sein, irgendetwas dergleichen zu müssen, wo kein anderer Segen darin steckt, als der, zur Not unter Dach u. Fach zu kommen. Eigentlich wollte man uns schon (Hausverkauf) mit der Behauptung: Kauf bricht Kontrakt, zum Juli herausscheuchen, aber zum Glück – bricht Kauf den Kontrakt ja nicht.4 So riskieren wir irgendwohin zu kommen, wo man bei erster bester Gelegenheit wieder entflieht und das Bedauerliche ist, daß ich zum Herbst möglicherweise, ja wahrscheinlich keine genügenden Reklamierungsgründe mehr habe und meine Mutter vor einer Aufgabe steht, die ihre Kräfte übersteigt. Schon dieser erste Schreck machte sie ganz konfus.
Nun möchte ich ja einen Schicksalswink herauslesen, Güstrow zu verlassen,5 auf den ich gewissermaßen seit Jahren warte, aber bei den unsichern Zeitläuften will mir das doch zu riskant erscheinen und dann: wohin denn eigentlich? |
Ein Auftrag für einen Christus,6 der auf Kriegergräbern in Eisenguß bestimmt ist, angebracht zu werden, ist wie die Nachrichten sagen, ziemlich gesichert. Der erste hochofficielle. Aber die Ämter arbeiten langsam, ich soll, ich weiß nicht warum und wozu, mich vorher dem Kultusminister7 präsentieren und warte seit mehreren Wochen auf einen Wink, der nicht kommen will.
Von Hans ist alles still geworden, die letzte Nachricht war vom Herbst und ziemlich traurig, er hatte Geldsorgen und ich bin keineswegs überzeugt, daß meine Sendung ihn erreicht hat.8 Indessen ist doch Hoffnung, nun bald aus den Zweifeln gerissen zu werden.
Eine Arbeit wie Deinen Lebensroman9 soweit gefördert zu sehen, ist sicher befreiend und giebt gute Aussicht, auf das kommende Veredelungsgeschäft. Leider mußt Du wohl fürs erste davon ganz zurückstehen. Vor Allem aber berührt mich Deine Mitteilung betreffs Deiner Frau Käthe. Das heißt, der Sache einen Schluß geben, wie er wohl nicht schöner sein könnte. |
Im Übrigen: unsere Kugeln erreichen Paris, das Ganze scheint ins Wogen und Wühlen zu kommen. Aber die nagenden Zweifel über die Tragweite des Geschehenen und Kommenden bleiben bestehen. Sie nagen wirklich und man möchte glauben, dieselben Zweifel erfüllten die kämpfenden Heere und trieben sie zur wildesten Drangabe aller Kräfte. Man denkt: jetzt oder nie, man wird von Hoffnungen u. Sorgen aus dem Bett und aus dem Hause gejagt. Hoffen wir!
Besten Gruß!
Dein Vetter Ernst
Brief, 1 DBl. mit 4 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, 22,1 × 14,3 cm; Ernst Barlach Haus Hamburg; Barlach 1968/69; [386]
1Zitat aus Lk 4,23: »23Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet freilich zu mir sagen dies Sprichwort: Arzt, hilf dir selber! Denn wie große Dinge haben wir gehört, zu Kapernaum geschehen! Tue also auch hier, in deiner Vaterstadt.«
2Vermutlich bezieht sich EB auf die deutsche Frühjahrsoffensive 1918 an der Westfront, die am 21. 3. 1918 begonnen hatte.
3Zum 1914 eingerichteten Gefangenenlager ↘ 389, Anm. 4. Durch den Zuzug von Mitarbeitern für das Lager kam es zu einem Engpass auf dem Güstrower Wohnungsmarkt.
4Anspielung auf § 566 BGB (1896), Kauf bricht nicht Miete.
5EB erwog mehrfach, wieder aus Güstrow fortzuziehen (↘ 251; Caspers 2003, 98f.). Als sich nach dem Tod August Gauls 1921 die Möglichkeit ergab, dessen Atelier in Berlin zu übernehmen (↘ 650), entschied sich EB dagegen (↘ 681).
6Kruzifix.
7Friedrich Schmidt-Ott.
8Zur Situation des Bruders ↘ 473, Anm. 6. Am 3. 3. 1918 war der Frieden von Brest-Litowsk geschlossen worden, nach dem Russland u. a. die Unabhängigkeit der Ukraine und Finnlands anerkennen musste.
9Das Schweigen des Hans Brandt (↘ 457, Anm. 2).
476 an Wilhelm Schmidtbonn, Güstrow, 14. April 1918
Güstrow i. M.
Schwerinerstr. 22
14. 4. 18
Sehr geehrter Herr,
haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeilen! Sie werden nicht erstaunt sein, wenn ich sage, daß mir Beifall für Arbeiten, bei denen ich so wenig an Publikation und Erfolg irgendeiner Art gedacht habe wie die von der Sie sprechen, mir überraschender ist als jeder frühere. Ich höre daß der arme Vetter von der Freien Volksbühne angenommen ist.1
Mit ergebenstem Gruß
Ihr EBarlach
Postkarte, 1 Bl. mit 1 beschriebenen Seite, schwarze Tinte, 8,9 × 13,9 cm; Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn; unveröffentlicht
1Die Freie Volksbühne Berlin e. V. wurde 1890 mit dem Ziel gegründet, sozial schwächer gestellte Bevölkerungsgruppen etwa durch niedrige Eintrittspreise zu erreichen. Es sollten auch umstrittene, gesellschaftskritische Stücke wie von Henrik Ibsen und Gerhart Hauptmann gespielt werden. 1915 übernahm Max Reinhardt die Leitung des Theaters. Eine Aufführung von EBs Drama Der arme Vetter konnte nicht ermittelt werden. In Berlin bemühte sich vor allem das Preußische Staatstheater am Gendarmenmarkt um die Aufführung von EBs Stücken (Rischbieter 2007, 63).
477* an Preußisches Ministerium der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten, Güstrow, 23. April 1918
Nicht ermittelter Brief, den EB im Brief an August Gaul vom 23. April 1918 (↘ 478) erwähnt.
478 an August Gaul, Güstrow, 23. April 1918
Güstrow i. M.
Schwerinerstr. 22
23. 4. 18
Lieber Gaul
heute morgen erhielt ich vom Kultusminister1 die Anfrage, ob ich zu der fraglichen Arbeit bereit wäre, der Brief war an meine alte Adresse in Friedenau gerichtet und hat auf diesem Umwege eine Verzögerung erlitten. Ich habe natürlich sofort bejahend geantwortet. – Danach scheint es, daß eine Citierung meiner Person nach Berlin nicht mehr geplant ist, sollte sie aber doch noch nötig machen, so bin ich nach wie vor bereit zu kommen. |
Ich bin hier in Nöten, muß umziehen und finde bei der ausgesprochenen Wohnungskrisis kein ordentliches Quartier. Habe schon um Häuser gehandelt, aber es giebt entweder blos Armeleutewohnungen oder Häuser, die weit über meine Verhältnisse hinaus kosten. Hoffentlich findet sich noch etwas. Aber das Alles kostet unermeßlichen Zeitaufwand.
2/3 Lebensgröße soll der Christus2 haben, 4000 M Honorar giebts, 2 Monate Termin. Das wird sich ganz gut machen lassen, ich habe auch schon vorgearbeitet.
Meine Reklamation3 wird gewiß von Erfolg gewesen sein, sonst | hätte ich schon irgendetwas gehört.
Ich hätte Sie doch gerne gesprochen, und vielleicht wird mein Kommen ja noch notwendig.
Einstweilen besten Dank für Ihre guten Sekundantendienste!4
Viele Grüße
Ihr ergebener
EBarlach
Brief, 1 DBl. mit 3 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, 29,2 × 21,0 cm; Ernst Barlach Haus Hamburg; Barlach 1968/69; [387]
1Friedrich Schmidt-Ott.
2Kruzifix.
3EBs Freistellung vom Militärdienst.
4Gauls erfolgreiche Bemühungen um EBs Freistellung vom Militärdienst und um den Auftrag für das Kruzifix (↘ 474), der ihn ebenfalls vor einer erneuten Einberufung schützen sollte.
479 an Adolf von Hatzfeld, Güstrow, 25. Mai 1918
Güstrow d. 25. Mai 1918
Schwerinerstraße 22
Sehr geehrter Herr v. Hatzfeld,
entschuldigen Sie, daß ich es bisher versäumt habe, Ihnen für die Übersendung eines mit freundlicher Widmung versehenen Exemplars Ihres Franziskus'1 zu danken. Es ist seit einiger Zeit in meinen Händen und gehört zu meinen liebsten Büchern. Dieser Ausdruck wird Ihnen vielleicht recht allgemein erscheinen, indessen bitte ich Sie, ihn nicht so zu nehmen. Ich schrieb Ihnen schon, daß ich es in meiner Zeichnung2 besser zu sagen verstehe, wie das Buch auf mich gewirkt hat, als ich in Worten vermöchte, als ich mich schriftlich zu unternehmen getraute. Eine Erschütterung, die man empfunden, möchte man nicht zergliedern, sondern sie lieber als etwas Elementares in sich bewahren, wenigstens gegenüber Bekenntnissen wie den Ihrigen.
Mit herzlichem Dank und ergebenstem Gruß bin ich
Ihr sehr ergebener
EBarlach
Brief; Standort unbekannt (Maschinenabschrift in Universitäts- und Landesbibliothek Münster und Materialsammlung Friedrich Droß); Barlach 1968/69; [388]
1Adolf von Hatzfelds Novelle Franziskus (↘ 466, Anm. 1). Das besagte Exemplar ist im Güstrower Nachlass EBs überliefert und mit der Widmung »Ernst Barlach / aus Freude und Dankbarkeit. / Adolf v. Hatzfeld / München, 4. April 1918.« versehen. EB klebte eine Pause der Zeichnung Der Puppenspieler (1921/22; Wittboldt/Laur 1820) in die Novelle ein.
2EB entwarf als Einbandillustration eine kniende Gewandfigur mit Augenbinde (↘ 466, Anm. 1). Er entwickelte die Figur 1930 und 1937 in der Plastik Der Zweifler weiter (Laur II 469, 612; Laur/Probst 2000, 24f.).
480 an Karl Barlach, Güstrow, 6. Juni 1918
Güstrow 6. Juni 18
Lieber Vetter,
ich freue mich, wieder etwas von Dir zu hören und daß dies etwas über Euch einigermaßen tröstlich lautet. Ich mußte diese Tage öfter mal an Dich denken, ich nehme an, daß wir uns in Gedanken begegnet sind. Von Hans haben wir gehört. Sein Brief war vom Mai und er schreibt in der Hoffnung, nächstens mit dem Dampfer abreisen zu können, allerdings sei der Fluß noch gefroren. Geld, das ich ihm Anfang des Jahrs gesendet, ist zwar angekündigt aber nicht ausgehändigt. Hoffentlich, wenn er noch dort ist, bekommt er meine kürzliche Sendung, die durch die Güte der deutschen | Kommission besorgt wird. Inzwischen hören wir von der Rückkehr so Mancher, aber von ihm noch nichts weiter. Doch sind wir vorläufig einigermaßen ruhig, nach Schrift und Ton ist er leidlich bei Laune, nur mit seiner Frau1 ist er nicht recht zufrieden, sie hat nämlich noch kein Deutsch gelernt. Er bildet sich nämlich ein, der Gute, daß er einen deutschen Haushalt hat, wenn er von einer deutschsprechenden Frau geleitet wird.
Mein Christus liegt in Gips auf einem Bett,2 noch sollen seine Arme angeheftet werden und noch dies u. das gebessert werden, aber wie er ist, so bleibt er nun und wie er ist, weiß ich selber nicht, nur, daß er so gut ist, wie ich ihn machen konnte.
Wegen einer neuen Wohnung ist übermorgen Termin vorm Mieteinigungsamt. Ich habe Jemand, der seit langem unbillig billig wohnte, durch | zeitgemäßes Gebot »ausgemietet.« Es ist die Etage auf dem Grundstück, wo ich mein Atelier habe3 und nach Allem was man beim Suchen sieht und hört, dürfen wir froh sein, so unterzukommen. Hauskauf hat sich zerschlagen und jetzt bin ich froh darüber, so etwas soll nicht übers Knie gebrochen werden. Der arme Vetter soll, soviel ich weiß, zuerst in Hamburg im Februar aufgeführt werden.4 Ich selbst habe mit diesen Dingen nichts zu thun, muß also Dein freundschaftliches Hilfsangebot dankend ablehnen. Dies Ganze ist mir fast gleichgiltig. Ich denke an andere Arbeiten und glaube an keinen großen Erfolg, obgleich ich für meine Begriffe bühnenmäßig wirksame Bilder u. Scenen vor mir seh, als ich das Stück machte. Man wird ja sehen und sich vorher nichts Unnützes, weder Gutes noch Böses, denken. |
Ach der Krieg! Ich dachte neulich etwas, woran, wie ich gelesen, auch Andre gedacht haben. Wenn d. Wahnsinn der Menschen zu Vernunft kommen soll, so müssen höhere Mächte eingreifen. Z. B. die Pest oder die Cholera. Sie kann man nicht beschießen und sie wird die Heere auseinandersprengen. Die Dinge sind den Menschen über den Kopf gewachsen, sie scheinen mir ohnmächtig, da keine überlegenen, elementaren Köpfe und Geister zur Hand sind, sie zu ordnen – – ich soll wieder ein lithographisches Werk zeichnen5 und sehne mich nach jener Unschuld des Gemüts, die jetzt nur in Form eines Ersatzes als künstlich konstruierte Wurstigkeit erzielt werden kann, man behält ein bitteres Gefühl als Bodensatz als trübes Zeichen übler Beschaffenheit.
Uns gehts soweit gut. Grüß Deine Frau Käthe6 u. Deine Mutter,7 wenn sie kommt.
Mit besten Wünschen
Dein Vetter Ernst.
Brief, 1 DBl. mit 4 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, 22,1 × 14,3 cm; Ernst Barlach Haus Hamburg; Barlach 1968/69; [389]
1Olga Barlach.
2Kruzifix. EB fertigte zwei Gipsmodelle für die geplante Ausführung in Eisenguss an (Laur II 263f.; ↘ 492).
3EBs Atelier befand sich von 1911 bis 1926 in der Schützenstraße 30 in Güstrow.
4Die Uraufführung des Dramas Der arme Vetter fand am 20. 3. 1919 in den Hamburger Kammerspielen statt.
5EB hatte die Arbeit an den Lithografien zum Drama Der arme Vetter bereits im Dezember 1917 abgeschlossen (↘ 467). Das Mappenwerk erschien 1919 in der Pan-Presse des Verlags Paul Cassirer in Berlin (Laur I 54). Um 1917/18 entstanden außerdem lithografierte Einzelblätter nach früheren Zeichnungen mit apokalyptischer Thematik, deren genaues Entstehungs- und Erscheinungsdatum nicht ermittelt werden konnte (Laur I 38-51). Die Drucke wurden erstmals im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels 1917, dann erst wieder im Verlag Paul Cassirer 1919 angekündigt.
6Katharina Dorothea Barlach.
7Ottilie Barlach.
481 an Wilhelm Frieg, Güstrow, 10. Juni 1918
Güstrow 10. Juno 1918
Lieber Herr Frieg,
sollten Sie, was aufs Höchste zu wünschen wäre, in dieser Zeit einmal nach Güstrow kommen, so ist eine Anmeldung durchaus nötig. Die Tage sind jetzt kritisch in gewissem Sinne. Am Donnerstag habe ich Besuch, da würden 2 Welten zusammenstoßen u. sich vielleicht fressen. Demnächst fahre ich nach Rostock, um mir einen Former1 (nicht Farmer) zu suchen, der mir womöglich meinen Christus2 formt. Sodann | (aber nicht gleich, lieber Herr Frieg, überhaupt sind Sie bestens willkommen, daß Sie nur nichts falsch verstehen, selbst ohne Gastgaben, vollständig)
also sodann folgt die Zeit des Formens (nicht Farmens) und sollten Sie einen dieser Tage erwischen, Gott gnade Ihnen und mir, es wäre ein verpfuschter Tag und ich bitte Sie zu bedenken
1) erstens wieviel gute Tage haben wir im Leben u.
2) zweitens: soll man sich einen dieser wenigen guten verderben lassen durch ein elendes Aas von Zufall?
Eine nicht aufzuwerfende Frage! (Zitat aus Shakespeare)3 |
Ich habe bei dem Christus Blut geschwitzt und er ist noch nicht mal fertig, es wäre brav, wenn Sie mich einmal für einen Tag davon erlösten.
Aber bitte (diesmal!) schreiben Sie vorher, damit ich Unheil verhüten kann, wenn welches daraus entstehen könnte, daß obgleich Ihr Kommen immer gut, doch die Zeit Ihres Kommens einmal schlecht sein sollte.
Sonst auf Wiedersehen! Ihr sehr ergebener
EBarlach
Brief, 1 DBl. mit 3 beschriebenen Seiten; Standort unbekannt (Fotokopie in Materialsammlung Friedrich Droß); Barlach 1968/69; [390]
1EB entwickelte seine plastischen Werke, wie in der Bildhauerkunst seit der Antike üblich, zunächst in Ton. Da dieses Material sehr empfindlich ist, wird das Tonmodell anschließend in ein dauerhafteres Material, meistens Gips, übertragen. Das Tonmodell blieb nur in seltenen Fällen erhalten. In der Regel nahm EB das Abformen selbst vor. Für das Kruzifix versuchte EB, in der näheren Umgebung handwerkliche Unterstützung für diesen Arbeitsschritt zu finden (↘ 463; Probst 2001a, 62-65; Wittkower 1974, 8-11).
2Kruzifix.
3Zitat Falstaffs aus William Shakespeares König Heinrich IV., Teil 1 (Shakespeare 1964b, 433-435; ↘ 422, Anm. 3). EB besaß die Bände zwei und drei von Shakespeares Sämmtliche Dramatische Werke in drei Bänden, in denen er Unterstreichungen und Notizen vornahm, sowie Band drei von Shakespeares Dramatische Werke. Neue Ausgabe in neun Bänden (1854).
482 an Oda Hardt-Rösler, Güstrow, 14. Juni 1918
Güstrow i. M.
Schwerinerstr. 22
14. 6. 18
Sehr geehrte gnädige Frau,
selten hat das Zutrauen zu meinem Schaffen mich mehr beglückt, als dasjenige, das Sie mir bezeigen. Doch weiß ich heute nicht, wie weit ich mit meiner Zustimmung zu Ihrem Vorschlag1 gehen kann. Es kommt wohl nur eine Arbeit für Bronce in Frage, da Holz sich im Freien von selbst verbietet und Arbeit in Stein mir nicht liegt, da ich thatsächlich niemals in Stein gearbeitet habe. Bronce aber ist | in dieser Zeit der Beschlagnahmungen nicht aufzutreiben. Es kommt hinzu, gnädige Frau, daß ich meiner selbst nicht sicher bin, nur von einem Termin zum andern vor Einberufung geschützt bin und durch Arbeiten und sehr lästige Hinderungen, die aus der Zeit entspringen und einen unverhältnismäßigen Aufwand von Kräften beanspruchen, von der Erfüllung von neuen Verbindlichkeiten abgehalten bin.
Ich möchte auch einem Vorschlage wie Sie ihn als Ausgleich und Entgelt für mich machen, nicht zustimmen. Sollte es mir gelingen, etwas zu finden, das mir Waldemar Röslers würdig dünkte, so sollte ich denken, daß sich | leicht eine Formel finden läßt, unter der ich Ihnen die Ausführung der Arbeit für den gedachten Zweck anheim geben könnte. Einen Auftrag mit Verpflichtung, gegen ein Werk Röslers ein anderes von mir zu geben, möchte ich nicht übernehmen. Vor Allem darum, weil mir seit je der Begriff Auftrag unangenehm ist, es giebt da immer und unausbleiblich Verdruß und Misverständnis und ich kann nur zufrieden sein, wenn ich ganz frei bin. Eine Arbeit wie ich sie Ihnen, gnädige Frau, vielleicht zur Verfügung stelle, können Sie dann Ihrerseits ganz frei behandeln und ich brauche Ihnen nicht erst zu versichern, daß die Abmachungen, die ich Ihnen vorschlagen werde, | solche sein werden, daß Sie ihnen unbedenklich zustimmen können. Nur, daß ich diese Monate an diese Sache nicht anders als in Gedanken gehen kann, muß ich Sie bitten, einstweilen anzuerkennen.
In der Hoffnung, daß Sie in meiner Beantwortung Ihrer Frage eine befriedigende wenn auch nur vorläufige Lösung der Angelegenheit sehen werden bin ich mit größter Ergebenheit
Ihr EBarlach
Brief, 1 DBl. mit 4 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, 21,8 × 14,3 cm; Max Beckmann Gesellschaft e. V.; Barlach 1968/69; [391]
1Hardt-Rösler bat EB um ein Grabmal für ihren verstorbenen Mann, den Maler Waldemar Rösler (1882-1916). EB lehnte den Auftrag letztlich ab.
483 an Hans Franck, Güstrow, 10. Juli 1918
Sehr geehrter Herr Franck,
ich sende Ihnen mit größtem Vergnügen mein Exemplar »toter Tag«. Es ist das einzige u. ich bitte es mir gelegentlich einmal wiederzuschicken. Ich danke Ihnen bestens für Ihren Aufsatz,1 seit langem unfähig über Kunst zu lesen, fand ich mich doch beim orientierenden Durchgehen erst einmal freudig berührt. Ich verspare mir das Lesen auf eine besondere Stunde.
Besten Gruß
Ihr EBarlach |
Güstrow i. M.
Schwerinerstr. 22
10. 1. 18
Postkarte, 1 Bl. mit 2 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, 8,9 × 13,9 cm; Getty Research Institute Los Angeles (910172); Berswordt-Wallrabe 1998
1Nicht überliefert. Hans Franck verfasste zahlreiche Aufsätze über Schriftsteller und Künstler wie Gerhart Hauptmann, August Strindberg und Eberhard Viegener. Im Februar 1919 erschien in den Hamburger Nachrichten ein Beitrag über den mit EB befreundeten Schriftsteller und Kunstkritiker Theodor Däubler. Möglicherweise erhielt EB das Manuskript dieses Texts (Berswordt-Wallrabe 1998, 156).
484 an August Gaul, Güstrow, 14. August 1918
Güstrow i. M.
Schwerinerstr. 22
14. 8. 18
Lieber Gaul
mein Christus1 ist seit Ende Juli aus dem Atelier, ich darf also wohl annehmen, daß er heil in Berlin angekommen ist, da ich andernfalls doch wohl Nachricht bekommen hätte.
Darf man gratulieren? Ich las, daß Sie im Auftrage des Kriegsministeriums einen Denkstein in der Schweiz bauen werden2 und nehme einstweilen zuversichtlich an, daß Sie sich dort wohlaufgehoben fühlen.
Mir gehts soweit ganz gut. Daß | ich wieder mal loszueisen war, wissen Sie bereits, wie ich aus Ihrer freundlichst beigesteuerten Unterschrift des Schriftsatzes von Kestenberg ersehe.3 Die Leute hier wollen mir wohl und tun was sie können, aber es geht natürlich nicht ganz ohne Papiere und Versicherungen ab.
Neulich hatte ich einen Brief von Wallfried,4 er ist Viecefeldwebel bei einer Flakbatterie im Westen. Da ist er wenigstens auf seine Art etwas Ganzes, aber es ist anzunehmen, daß das alte Lied wieder anhebt, sobald er wieder frei ist.
Von Frau Rößler5 bekam ich den Auftrag, für R. einen Denkstein, Relief, zu machen6 – gegen ein Werk von Rößlers Hand. Ich habe zunächst diese Art von Vergeltung abgelehnt und mich | bereit erklärt, wenn die Zeiten Bronceguß erlauben, eine Arbeit zur Verfügung zu stellen. Ich fürchte aber ein bischen, daß es auch so noch Misverständnisse giebt und sie sich über das Drum und Dran irgend einer Täuschung hingiebt.
Ich hätte Sie sehr gerne wieder mal gesprochen, komme mir selbst aber immer so unabkömmlich vor, daß es direkt eines zwingenden Anlasses bedarf, ehe ich mich nach Berlin aufmache. Glücklich bin ich wieder bei einer Arbeit in Holz,7 alles andre will mir auf gewisse Art immer als Abhaltung vom Besseren erscheinen. Der Christus hat mir manchen schweren Tag gemacht, aber am Ende hatte ich doch das Gefühl, daß er so sein müßte wie er wurde. Hätte ich Weiteres zu bestimmen würde ich ihn an ein recht breites Kreuz reliefartig hängen. Da es aber viele verschiedenartige | Gelegenheiten ihn anzubringen giebt, läßt sich so etwas natürlich nur von Fall zu Fall bestimmen. Ich hoffe, Ihnen zugleich eine Photographie senden zu können.
Ihr Atelier ist mir immer ein erfreulicher Ort. Warum? Weil es da ganz schweigt von dem ganzen widrigen Geschwätz über Richtung, dem ich seinen Wert gerne lasse, das aber doch allmählich zur Kulturfratze geworden ist? So fühle ich mich immer sehr zufrieden, wenn ganz abseitsstehende Leute meine Arbeiten gutheißen. Man soll immer »Vertreter« von Etwas sein, man soll irgendwohin »gehören«, als ob es nicht genügte, daß man man selbst ist! Sie hier zu sehen wird wohl auch einmal einen zwingenden Anlaß erfordern, aber – wenn, dann schneiden wir tief in unsern Schinken und alten Burgunder giebt es auch noch. Also darum brauchten Sie es nicht zu scheuen, nordwärts zu gondeln.
Für heute herzliche Grüße.
Ihr ergebenster
EBarlach
Brief, 1 DBl. mit 4 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, 22,2 × 14,3 cm; Ernst Barlach Haus Hamburg; Barlach 1968/69; [392]
1Kruzifix.
2August Gauls Gefallenenmal Luzern (1918/19). Im Ersten Weltkrieg wurden über die neutrale Schweiz sowohl französische als auch deutsche Verwundete und Gefangene ausgetauscht, die zuvor in Lagern und Lazaretten interniert waren. Für die Verstorbenen wurden an verschiedenen Orten Friedhöfe eingerichtet. Hierfür sollte Gaul im Auftrag des Preußischen Kriegsministeriums mehrere Grabmale gestalten, von denen jedoch nur der Gedenkstein auf dem Friedhof Luzern in Form eines mehrfach gestuften Steinblocks mit bekrönendem Stahlhelm und einem Adlerrelief an der Vorderseite ausgeführt wurde (Gabler 2007, 244).
3Vermutlich verfasste Kestenberg eine Eingabe, um EBs Freistellung vom Militärdienst sicherzustellen. Zu August Gauls Bemühungen um eine Freistellung ↘ 418, Anm. 1.
4Rudolph Amandus Wallfried.
5Oda Hardt-Rösler.
6↘ 482, Anm. 1.
7Der Mann im Stock (1918; Laur II 268).
485 an Hans Franck, Güstrow, 30. August 1918
Güstrow 30. 8. 18
Sehr geehrter Herr Frank,
die Aufmachung meiner Sendung zeigt Ihnen an, daß ich eilig aber mit bestem Willen versucht habe Ihrem Wunsch hinsichtlich eines Titels zu entsprechen. Doch lassen Sie mich erst einmal danken! In Wurf und Schmiedung Ihres Dramas1 liegt Antike. (Ich will sagen und meine: Größe.) Daß mich etwas, nichts Einzelnes, keine Einzelheit, stört will ich nicht verschweigen, ich bin es Ihnen schuldig. Trotzdem – wie ich oben sagte! Leider habe ich nur allzu schnell lesen müssen, da mich Arbeiten hetzen. Aber ich sage zum dritten Mal: Ihr Werk ist zwingend wie antike Tragödie. |
Was Sie mit meinem Versuch* zu Titeln anfangen können weiß ich nicht. Ich bin nie glücklich wo etwas Plakathaftes ins Spiel kommt u. was ich für mich selbst in dieser Art gemacht, will mir keineswegs gefallen, ich tue es auch so leicht nicht wieder. Dennoch können Sie am Titelblatt zum armen Vetter sehen (nicht Umschlag), daß die hier angewandte Art reproducierbar ist.2 Es kommt nur darauf an, ob Sie das Ihnen so schnell und flüchtig Gewidmete verwendbar finden.
Sie sprechen von einer Sonderausgabe.3 Dazu würde es mich nicht reizen. Die Vorgänge liegen tiefer im Innern als daß sie einen »Stoff« für malerische Phantasie ergäben. Und zweitens: ich bin auf länger als mir lieb ist und zu mehr Arbeit verpflichtet,4 als daß ich mir etwas Weiteres auf die Seele laden könnte. Drittens bin ich Cassirer allerdings zu weit verbunden.
Seien Sie bestens gegrüßt von Ihrem ergebenen
EBarlach
* geht zugleich eingeschrieben ab
Brief, 1 Bl. mit 2 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, 24,3 × 19,3 cm; Getty Research Institute Los Angeles (910172); Berswordt-Wallrabe 1998
1Hans Francks Drama Freie Knechte (1919) erschien mit den leicht voneinander abweichenden Zeichnungen Gefesselte Bäuerin einmal in Kohle und einmal mit der Feder ausgeführt auf dem Einband (1918; Wittboldt/Laur 1569f.).
2Die Handzeichnung Titelentwurf zum Drama»Der arme Vetter« (1917; Wittboldt/Laur 1462), die als Innentitel der einfachen Ausgabe des Texts von 1918 verwendet wurde, war fotomechanisch reproduziert worden. Aufgrund der damaligen technischen Möglichkeiten mussten Abstriche in der Qualität der Wiedergabe gemacht werden. Dagegen wurde z. B. die Titelillustration zu Adolph von Hatzfelds Novelle Franziskus (1919) von EB als Lithografie ausgeführt, die für die Vervielfältigung vorgesehen war.
3Der Brief Hans Francks an EB ist nicht überliefert. Vermutlich bat er EB um weitere Illustrationen für sein Drama Freie Knechte.
4Das Kruzifix war gerade nach Berlin versendet worden (↘ 484), die Mappe Der arme Vetter befand sich im Druck, was mit Reisen nach Berlin verbunden war. Zudem arbeitete EB an der Holzskulptur Der Mann im Stock. Zwei Monate später versuchte EB, brieflich ein Treffen mit Reinhold von Walter zu vereinbaren (↘ 487; ↘ 488). Vermutlich bestand bereits der Plan, ein kurz darauf begonnenes gemeinsames Buchprojekt zu verwirklichen. Außerdem arbeitete EB an der Niederschrift des Dramas Die echten Sedemunds (1920).
486 an Unbekannt, Güstrow, 1. September 1918
Güstrow i. M.
Schwerinerstr. 22
1. 9. 18
Sehr geehrter Herr,
ich bitte Sie sich wegen der fraglichen Angelegenheit1 an Paul Cassirers Verlag, Berlin, Viktoriastrasse 2 zu wenden, ich selbst könnte Ihnen wegen einer Ausstellung meiner graphischen Blätter, vielleicht demnächst erscheinender Mappen usw. nichts Entscheidendes sagen.2
Hochachtungsvoll
EBarlach
Brief, 1 Bl. mit 1 beschriebenen Seite, schwarze Tinte, 22,3 × 14,2 cm; Universitätsbibliothek Leipzig, Kurt-Taut-Slg./1/A-B/B/78 (Leihgabe Leipziger Städtische Bibliotheken); unveröffentlicht
1Nicht ermittelt.
2Die Mappe Der arme Vetter mit Textband und Illustrationen befand sich zum Zeitpunkt des Briefs im Druck.
487 an Reinhold von Walter, Güstrow, 3. Oktober 1918
Güstrow 3. 10. 18
Sehr geehrter Herr v. Walter,
ich bedaure, daß wir uns verfehlt haben, bitte kommen Sie womöglich morgen, Freitag, zwischen ½ 5 u. 6 Uhr zu mir, sonst würde es mir am Montag am besten passen.
Besten Gruß
Ihr ergebener
EBarlach
Brief, 1 Bl. mit 1 beschriebenen Seite, schwarze Tinte, 22,1 × 14,2 cm; Privatbesitz, Barlach 1968/69; [393]
488 an Reinhold von Walter, Güstrow, 22. Oktober 1918
Güstrow 22. 10. 18
Sehr geehrter Herr v. Walter,
ich würde mich freuen, wenn ich Sie morgen d. 23. d. M., Mittwoch also, sehen könnte. Leider ist es so früh dunkel u. ich habe noch immer kein Licht in meinem Atelier, kommen Sie also bitte gegen 5 Uhr, lieber etwas früher als viel später! Hoffentlich wirft eine frische Krankheit nicht wieder einen Stein auf unseren Weg!
Besten Gruß! Ihr ergebener
EBarlach
Brief, 1 Bl. mit 1 beschriebenen Seite, schwarze Tinte, 22,3 × 14,4 cm; Privatbesitz; Barlach 1968/69; [394]
489 an Reinhard Piper, Güstrow, 30. Oktober 1918
Güstrow
Schwerinerstr. 22
30. 10. 18
Lieber Herr Piper,
schönen Dank für Ihren Gruß aus Bamberg, hoffentlich sind Sie wohlauf in dieser schlimmen Zeit, was man so wohlauf nennen kann.
Ich habe wenigstens die Hände voll Arbeit und also ein Gegenmittel gegen so manches Übel sowohl 〈des〉 Leibes wie der Seele. | Freue mich, wenn Ihnen mein »armer Vetter«, der übrigens diese Tage in den Hamburger Kammerspielen aufgeführt wird,1 etwas zu sagen hatte. Er erscheint auch2 mit 34 Lithographien,3 ich denke noch in diesem Jahre. Eine andre Mappe4 ist in Arbeit, andre Pläne, für Plastik u. litterarische treiben mich, kurz ich lebe mit allen Kräften außerhalb der Zeit, in der ich immer noch wieder Soldat werden kann, vorläufig Ende November.
Ich wäre dem Schicksal sehr dankbar wenn es mich einmal wieder mit Ihnen in persönlichen Verkehr brächte, ich denke immer noch daran, daß Sie vor Kurzem eine mecklenburger Entdeckungsfahrt planten, die Sie gewiß, wo nicht nach Güstrow, so doch nach Rostock, Doberan, Wismar bringen würde. Es lohnt sich sicher! Zur Zeit freilich ist reisen eine Strafe, bessere Zeiten werden kommen!
Ich sende Ihnen herzliche Grüße
Ihr ergebener
EBarlach
Brief, 1 DBl. mit 3 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, 16,8 × 12,4 cm; Ernst Barlach Gesellschaft Wedel als Depositum der Kulturstiftung Schleswig-Holstein; Barlach/Piper 1997
1Die Uraufführung von Der arme Vetter fand am 20. 3. 1919 in den Hamburger Kammerspielen statt (↘ 480; ↘ 501).
2Mögliche weitere Lesart: »noch« (Barlach/Piper 1997, 125).
3↘ 480, Anm. 5.
4Illustrationen zu Reinhold von Walters Gedichtband Der Kopf (1919). Zu EBs Bemühungen, von Walter zu treffen (↘ 487; ↘ 488).
490 an Karl Barlach, Güstrow, 2. November 1918
Güstrow i. M.
Schwerinerstr. 22
2. Nov. 1918
Lieber Vetter,
wir konnten im alten Heim wohnen bleiben, in Anbetracht der Weltlage und unserer besonderen Verfassung ein wahres Glück – Hauskauf, Miete, Mieteinigungsamt, Mietkrakehl füllten teils gelingend teils mis-lingend den Sommer aus.
Drum sei verflucht der Krieg,
Verflucht das Werk der Waffen,
Es hat der Weise nichts mit seinem
Wahn zu schaffen.1
Ich bin kein Weiser, der alte Li-Tai-Pe (600 n. Chr.) vermutlich auch nicht, aber ich stimme bei, es ist höchste Zeit, daß man wieder an Anderes zu denken hat, als an Fraß und Quark. | Von Hans hatten wir heute Nachricht, er ist in Charkow und beaufsichtigt die Centralheizung der Kommandantur. Glücklich ist er über ein endlich doch erhaltenes Paket mit allerlei notwendigen Siebensachen. Was wird werden, wenn wir auch dort räumen?
Das Temperament will es nicht erträglich finden, vor Amerikanern zu kapitulieren,2 denn sie werden sich die entscheidende Wirkung anmaßen. Aber … ich sehe sie in ruhigeren u. (hoffe ich) lichteren Augenblicken nur als Henkersknechte an, laß sie sich blähen. Mir scheint, der Krieg müßte mit dem Namen »Hungerkrieg« in die Weltgeschichte kommen. Siegreiche Fahnen müssen sich senken vor Siegern? Kaum, die Situation ist tragisch. Ich hoffe immer, Wilhelm II. endet zum mindesten kaiserlich, nur damit er als Charakter dasteht. |
Im Übrigen fühle ich gleich Dir ziemlich lässig völkisch. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagte Jemand3 und man kann es nachsprechen u. fühlen. Die Juden gingen unter aber schenkten der Welt das Buch.4 Weltüberwindung ist durch Kanonen allein wertlos, wenn es nicht innerlich zugleich geschieht. Kann es innerlich geschehen, so sind Kanonen überflüssig. Wir sind, wenn überhaupt zu was nütze, so zu etwas Besserem als dem merkantilen Imperialismus,5 dem sich schon 2 Riesen ergeben haben. Wollten wir auch so ein Riese mit Schwundherzen werden? ich fürchte, wir hatten den Ehrgeiz, aber vielleicht zu unserm Glück giebt es auf unserm Stern keinen Platz für 3 von der Sorte. Wir müssen eine andre Richtung einschlagen.
Ich hätte mich am Sonntag, der an d. Elbe schön friedlich und sonnig war, | allerdings gerne mit Dir ausgesprochen und mußte mir genügen lassen, einen Blick durch die Scheiben in Deine altväterisch-freundliche Behausung zu werfen. Ich trottelte bis Blankenese und kam auf dem Rückweg noch einmal vorbei. Dann saß ich ein Weilchen im Hamburger Ratsweinkeller, sah eine Nachmittagsvorstellung und suchte zum Abend die Freunde von damals vor 15 Jahren auf.6 Es waren ganz die alten und somit war der Tag doch noch gerettet.
Meine Mutter ist wieder recht kümmerlich und der Klaus gleichfalls. Unterernährung macht sich an ihm in allerlei Übeln bemerkbar. Ich unterdrücke knapp Ausfälle gegen vollgefressene Gutkutschpferde und ihre feisten Besitzer, aber ich fürchte, wenn die Dinge nicht halbwegs gelinde ablaufen, daß sich das Alles furchtbar rächt.
Wenn Dich eine Dienstreise herführen sollte bist Du bestens willkommen.
Sei herzlich gegrüßt von Deinem
Vetter Ernst
Brief, 1 DBl. mit 4 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, 22,2 × 14,4 cm; Ernst Barlach Haus Hamburg; Barlach 1968/69; [395]
1Zitat aus Li-tai-pes (Li Bai) Gedicht Fluch des Krieges nach der Übertragung Klabunds in »Dumpfe Trommel und berauschtes Gong«. Nachdichtungen chinesischer Kriegslyrik (1915): »So sei verflucht der Krieg! Verflucht das Werk der Waffen! / Es hat der Weise nichts mit ihrem Wahn zu schaffen. / Er wird die Waffe nur als letzte Rettung schwingen, / Um durch den Tod der Welt das Leben zu bezwingen« (Li-tai-pe 1916, 41). EB verwendete das Zitat ein weiteres Mal auf der Zeichnung Aus einem neuzeitlichen Totentanz, die er 1933/34 nach der gleichnamigen Vorzeichnung und Lithografie von 1916 anfertigte (Wittboldt/Laur 2498).
2Am 3./4. 10. 1918 hatte sich der kurz zuvor berufene Reichskanzler Prinz Max von Baden (1867-1929) mit einem Waffenstillstandsangebot an die USA gewandt. Diese bestanden auf der Einhaltung des von Präsident Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) entwickelten 14-Punkte-Plans, der vor allem die Rückgabe der von Deutschland besetzten Gebiete, Abrüstung und demokratische Wahlen vorsah. Die deutsche Seite war zunächst nicht bereit, auf die Forderungen einzugehen. Erst als die Niederlage Deutschlands offensichtlich wurde, kam es am 11. 11. 1918 zum Waffenstillstand (Winkler 2018, 23f.).
3Zitat aus Joh 18,36: »36Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, daß ich den Juden nicht überantwortet würde; aber nun ist mein Reich nicht von dannen.«
4Die Bibel.
5Bestreben einer Großmacht, den politischen und vor allem wirtschaftlichen Einfluss auf Kosten anderer auszudehnen.
6Zu EBs Freunden der Hamburger und Wedeler Zeit von 1901 bis 1904 gehörten u. a. die Bildhauer Hermann Cornils und Karl Garbers sowie die Maler Julius Wohlers und Thomas Herbst.
491* an Unbekannt, Güstrow, 4. Dezember 1918
Nicht überlieferter Brief an einen Redakteur, den EB im Brief an Reinhard Piper vom 4. Dezember 1918 (↘ 492) erwähnt.
492 an Reinhard Piper, Güstrow, 4. Dezember 1918
Güstrow i. M. 4. 12. 18.
Schwerinerstr. 22
Lieber Herr Piper,
haben Sie vielen Dank für Ihr interessantes Buch.1 Ich antworte mit gleichfalls russischen Gegenständen, meine ersten Holzschnitte, die ich für eine Petersburger Phantasie von R. v. Walter,2 einen Balten, der hier augenblicklich als Dolmetsch im Gefangenenlager tätig ist, mache. Glücklich der, der arbeiten kann! Übrigens antwortete ich eben einem Redakteur,3 der über Forderungen der Kunst ans neue Staatswesen | etwas von mir haben wollte, ich müßte dazu mehr Gelassenheit gegenüber d. Zeit haben. Eigentlich hätte ich wohl schreiben sollen, daß ich zuviel Gelassenheit g. d. Z. habe. Ich bilde mir ein es wird überall mit Wasser gekocht und Staat und Kunst ist immer ein Mißton, höchstens giebt es eine andre Sorte officieller Impotenten. Übrigens (als Ulk) hatte ich kurz vor Torschluß von der alten Regierung, Kultusminister u. Kriegsminister, einen Auftrag für einen Christus,4 zur Aufstellung auf Kriegerfriedhöfen. Ich habe 2 ausgeführte Arbeitengeliefert5 und sie liegen jetzt irgendwo im Kultusministerium Berlin und Adolf Hoffmann6 hat zu entscheiden. | Überhaupt: Da man nicht soviel heulen kann wie es nötig wäre, kommt Einem fast ein Lachen an.
Also Ihr russisches Buch 〈ist〉 sehr interessant. Kommen Sie nur einmal selbst ins Land, ins freie Land Vandalia. (Wer weiß wie lange es frei bleibt!) Und seien Sie bestens gegrüßt von Ihrem ergebenen
EBarlach
Brief, 1 DBl. mit 3 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, Anmerkungen des Empfängers, 22,3 × 14,3 cm; Ernst Barlach Gesellschaft Wedel als Depositum der Kulturstiftung Schleswig-Holstein; Barlach 1952; [396]
1Dmitri Mereschkowskis Vom Krieg zur Revolution. Ein kriegerisches Tagebuch (1918). Der Band befindet sich in der Bibliothek EBs mit einer handschriftlichen Widmung Reinhard Pipers vom 14. 11. 1918.
2EB illustrierte Reinhold von Walters Langgedicht Der Kopf mit zehn Holzschnitten (Laur I 55; ↘ Bildtafel 2). Das Gedicht fängt mit einer bildreichen Sprache die Stimmung im vorrevolutionären St. Petersburg ein. Für das 1919 bei Cassirer in der Pan-Presse erschienene Buch verwendete EB, nach Versuchen von 1910 (↘ 242), zum ersten Mal die Holzschnitttechnik. Sie wurde in den folgenden Jahren das von ihm bevorzugte drucktechnische Verfahren für Buchillustrationen.
Untergang aus dem Zyklus Der Kopf (1919)
3↘ 491*.
4Kruzifix.
5Die für den Auftrag zuständige Fachkommission in Berlin fürchtete, EBs erste Fassung des Kruzifixes (↘ Bildtafel 3) könnte vom Kaiserhaus abgelehnt werden. EB zeigte Christus nicht wie häufig in Kreuzigungsdarstellungen mit zur Seite geneigtem Haupt, sondern mit aufrechter Kopfhaltung; das Gesicht des Leidenden ist dem Betrachter zugewandt. Auf Bitten der Kommission fertigte EB eine zweite Fassung, Kruzifix II, mit ›milderem‹ Gesichtsausdruck an (Laur II 264; Caspers/Giesen 2007, 124f.).
Kruzifix I (1918)
Kruzifix II (1918)
6Adolf Hoffmann war von November 1918 bis Januar 1919 zusammen mit Konrad Haenisch (1876-1925) Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Er schied nach dem Spartakusaufstand (↘ 495) im Januar 1919 aus, Haenisch blieb bis 1921 im Amt.
493 an Reinhard Piper, Güstrow, 19. Dezember 1918
Güstrow i. M.
Schwerinerstr. 22
19. 12. 18
Lieber Herr Piper,
daß Sie meine Holzschnittexperimente1 freundlich aufgenommen haben, freut mich sehr, mir gefällt das Verfahren sowohl wie der Zwang zum Harten und Einfachen. Für die 5 alten Blätter sage ich Ihnen meinen besten Dank, ich behalte sie sehr gerne, die andern bekommen Sie als eingeschr. Drucksache zurück. Sie sind sehr interessant und bilden gleichsam Gegenpole. Bei näherem und öfterem Besehen sind mir doch die Unoldschen Schnitte die lieberen, wenn ich bei den andern auch einen großen Stimmungswert nicht absprechen kann.2 |
Ich habe persönlich alle an mich ergangenen Aufforderungen zur Teilnahme an der Neugestaltung der Kunstdinge abgelehnt.3 Aber es wird gearbeitet werden müssen. Die Masse hat das Wort und wird es wohl behalten, was bleibt übrig als die Hoffnung und Aufgabe, die Masse zu heben? Für diejenigen aber, die Trieb und Überzeugung genug von ihrer Sache haben, ist kein Zwang zum Organisieren und Propagandieren anzuerkennen. Meine Pflicht gegenüber dem Neuen kann ich einzig so ansehen, daß ich unablässig den Wert, die Qualität meiner Arbeit zu steigern suche. Alles andre können die Andren besser. Hinsichtlich vielleicht bald geforderter Leistungen wird der Massengeschmack sich ebenso durchsetzen wie früher. Kunst ist eine Sache allertiefster Menschlichkeit, eine Probe auf den Feingehalt von Geist und Seele, Rechte und Freiheiten werden ihr nicht dienstlich und förderlich sein. (Olle Kamellen.) Ich fürchte wir werden eine große Proletarisierung4 erleben, eine Entindividualisierung in der Breite, Massenstempelung durch sogenannte Zivilisation à la Amerika. | Die neuen Dogmen werden den alten das Wasser nicht reichen können. Glaube u. sein Ersatz Aberglaube, der immerhin nun eine Ahnung des Unbegreiflichen u. Anerkennung des Unheimlichen, überhaupt des Problems: »Mensch, wieso, wozu u. warum« enthält – – werden allerlei platten Formulierungen Platz machen müssen. Aufklärung u. Nützlichkeit werden reißenden Absatz für ihren billigen Schund finden. Die Menschen sind nicht gleich, was sollen sie mit gleichen Rechten. Indessen wird (mancher) Billigkeit zum Segen Vieler werden, überhaupt, wie ich schon sagte, es wird überall mit Wasser gekocht und wo Geist u. Tiefe, Liebe und Freude ist, wird sie weiter bestehen. Ich wünsche dem wahrhaft deutschen Volk, dem wahren Volk, das man zwischen den Zeilen suchen muß, eine Art Eiszeit, die Isolierung, Einfachheit, Krystallisierung ermöglicht, damit es einst als ein sichtbar Neues u. Festes dasteht.
Inzwischen hoffe ich auf Verwirklichung Ihrer mecklenburgischen Absichten. Da werden Sie auch meinen Klaus näher anschauen können. Ich grüße Sie und Ihre Frau bestens.
Ihr ganz ergebener
EBarlach
Brief, 1 DBl. mit 3 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, Anmerkungen des Empfängers, 22,3 × 14,1 cm; Ernst Barlach Gesellschaft Wedel als Depositum der Kulturstiftung Schleswig-Holstein; Barlach 1968/69; [397]
1↘ 492, Anm. 2.
2Holzschnitte von Max Unold (1885-1964) zu Gustave Flauberts Die Legende von St. Julian dem Gastfreundlichen (1918) und von Walther Teutsch (1883-1964) zu Friedrich Schlegels Lucinde (1918) (Barlach/Piper 1997, 537). Die Münchener Maler Unold und Teutsch orientierten sich als Druckgrafiker an der Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts, standen dem Expressionismus nahe und waren Mitglieder der Münchener Secession (Probst 2001, 277).
3Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und damit auch dem Ende einer strengen, konservativen Einflussnahme des Kaiserhauses auf das kulturelle Geschehen herrschte unter Künstlern und Intellektuellen eine Aufbruchstimmung. Im November 1918 erhielt EB Besuch von Leo Kestenberg und Hugo Simon aus Berlin. Beide waren politisch aktiv, traten für Reformen in Kultur und Bildung ein, z. B. im Arbeitsrat für Kunst, und versuchten, EB für ihre Arbeit zu gewinnen.
4Hs.: Proletalisierung.
494 an Friedrich Düsel, Güstrow, 28. Dezember 1918
Güstrow i. M.
Schwerinerstr. 22.
28. 12. 18.
Lieber Friedrich,
wie gerne hätte ich ein paar Worte über Euer Ergehen gehört. Uns geht es gut und der Klaus mit seinem Straußenmagen hat die Bücher aus Berlin mit Wohlgefallen übergeschluckt. NB, ein Straußenmagen ist bildlich gemeint, sonst stimmts garnicht. In Güstrow ist man mit Räten ebenso versehen wie überall;1 trotzdem ist guter Rat teuer, eine Redensart, die ich gehört habe. Wir warten, wie wohl sonst noch manche, auf den kommenden Mann, der der Kerl danach ist. Kestenberg sitzt jetzt im Kultusministerium2 und sein Freund Simon, mit dem er mich hier vor wenig Wochen heimsuchte, ist Finanzminister.3 Ich habe, um nicht auseinanderzufallen, eine neue Technik gelernt und mich auf den Holzschnitt geworfen, das half mir mit wütender Arbeit über die letzten Monate hinweg.
Ich bin oft empört über mich selbst, daß man das Alles so hinnimmt, bin ich allein so, oder gehts auch Andern so? Aber, die täglichen Nöte und Familiensorgen sind wichtig wie vorher und die schwere Not der Allgemeinheit kommt eigentlich nur in kurzen Augenblicken wie eine Erscheinung von scheußlicher Gespensterhaftigkeit über mich. Da ich aber zu klein bin, sie so groß, so ists als ob ich unversehrt durch sie dringe und weder von ihr verschlungen noch überhaupt bemerkt bin.
Mein Bruder hat sich in einem Brief vom 4. Dez. angemeldet. Er hofft zu Weihnachten Charkow verlassen zu können. Ich bin aber aus seinem Brief nicht ganz klug geworden, ob er hofft, oder fürchtet zu müssen. Jedenfalls wenn er kommt, bringt er die Olga4 mit und so hat meine Mutter die nette Aussicht auf Besuch einer Schwiegertochter, die dick, dumm, faul und gefräßig ist. Ich ahne Schrecken, aber meine Mutter ist darin gesünder als ich, sie sieht angenehmes Zusammenleben voraus. Luise Schenck ist gestorben, ich war zu ihrer Einäscherung in Hamburg und Lotte Lucht und ich waren die nächsten Angehörigen. Einen Grabstein soll ich ihr setzen.5 Da habe ich denn auch Garbers gesehen, einen zufriedenen Ehemann, Vater von 2 Kindern an der Seite einer, man kann sagen, schönen Frau, die nicht nur schön ist. Ein Atelier hat er nicht, unterrichtet, sie, Lehrerin, trägt die Hauptlast, aber die Kinder sind gesund und das Ganze macht einen Harmonie-übersättigten Eindruck. Wers nicht glaubt zahlt einen Taler,6 ich hätte den Taler gezahlt, wenn ich damals in Dresden und Paris vor Glauben oder Unglauben gestellt wäre. Einen sonnigen Sonntagvormittag lang spazierte ich die Elbe entlang, die stille Elbe, wie lebensmüde. Am Nachmittag sah ich ein Stück von Stavenhagen7 und dachte, wenn sie mich auch so aufführen, dann sollen sies lieber ganz bleiben lassen.
Luise Schenck mußte eine himmelschreiende Leichenrede über sich ergehen lassen, wir mußten sie anhören. Was soll es heißen, wenn von einem gut und gern 80jährigen Fräulein gesagt wird, daß sie leider keinen Mann bekommen hat! Das geht mir zu weit!
Dem Klaus hat die Grippe arg zugesetzt, Folgen ihrer Falschheit trägt er noch mit sich herum, Husten, Eßunlust und sonst noch was Fatales, was keinem Kind und Menschen Vorteil bringt. Meine Mutter hat sich durchgeschlagen, daß es erstaunlich ist, sie wirkt als stünde sie erst am Anfang des Krieges. Solange sie nur ihre Gemütsruhe erhält, ist alles gut.
Wie mags Euch in Berlin gehen! Ich wünsche Euch alles Gute. Unser Blättchen redet schon verheißungsvoll von der Diktatur Liebknechts.8 Übrigens hinterher: meine bei Cassirer vermißten 40 Zeichnungen sind wiedergefunden.9 Das Himmelreich ist gleich einem Bildhauer …10
Also wir danken herzlich für die Bücher, aber wir wünschten ihnen einen Namenszug des Gebers.
Grüße … die herzlichsten und für alle von uns dreien. In alter Liebe
Dein – Euer Ernst.
Brief; Standort unbekannt (Maschinenabschrift in Materialsammlung Friedrich Droß); Barlach 1968/69; [398]
1Auf das Ende des Ersten Weltkriegs und der Monarchie folgten teils gewaltsame Auseinandersetzungen um das zukünftige Staatssystem in Deutschland: als parlamentarische Demokratie oder als Rätesystem. Nach dem Matrosenaufstand vom 3./4. 11. 1918 bildeten sich von Kiel ausgehend auf dem Gebiet des Kaiserreichs Arbeiter- und Soldatenräte, die Regierungsaufgaben übernahmen. In Mecklenburg-Schwerin setzte der Großherzog am 9. 11. mit Zustimmung der Arbeiter- und Soldatenräte eine neue Regierung ein und verzichtete am 14. 11. auf den Thron. Am 6. 12. fiel auf dem Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin die Entscheidung für Wahlen zu einer verfassunggebenden Nationalversammlung und damit für eine parlamentarische Demokratie und gegen die Räterepublik. Die Räte bestanden in der Folgezeit zunächst weiter, verloren aber an Bedeutung (Winkler 2018, 27-52).
2Leo Kestenberg war von 1918 bis 1932 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Preußischen Kultusministeriums und mit Berufungen an Berliner Theater und Orchester sowie der Reform der Musikerziehung betraut.
3Hugo Simon war von November 1918 bis Januar 1919 Finanzminister im preußischen Revolutionskabinett. Als Kunstsammler interessierte er sich auch für EBs Werke. Vgl. hierzu Caspers 2003, 116-120.
4Olga Barlach.
5EB entwarf für die Schwestern Luise und Bertha Schenck einen Grabstein in Form eines aufgeschlagenen Buchs, als Anspielung auf Luise Schencks schriftstellerische Tätigkeit. Der Grabstein wurde 1919 von fremder Hand ausgeführt und befindet sich auf dem Friedhof am Diebsteich in Hamburg-Altona (Laur II 284).
6Zitat des letzten Satzes aus dem Märchen Vom klugen Schneiderlein, der auf die Eigenschaft des Schneiders verweist, Unglaubliches als wirklich erscheinen zu lassen (Grimm 2004, 146).
7Fritz Stavenhagen verfasste vor allem plattdeutsche Theaterstücke. Welches Stück EB sah, konnte nicht ermittelt werden.
8Karl Liebknecht befürwortete zusammen mit Rosa Luxemburg und den Anhängern des Spartakusbunds eine Räterepublik nach russischem Vorbild.
9Nicht ermittelt.
10Anspielung auf die vom Evangelisten Matthäus wiederholt aufgegriffene Einleitungsformel für die Gleichnisse Jesu: »Das Himmelreich ist gleich einem Könige« (Mt 13,24 u. ö.).
1919
495 an August Gaul, Güstrow, 15. Februar 1919
Güstrow
Schwerinerstr. 22
15. 2. 19
Lieber Gaul
Familiengeschichten haben Alles in den Hintergrund gedrängt, ich wollte Ihnen auf Ihren Brief fast täglich antworten, aber dabei blieb es auch. Mein Junge war krank und mit der Krankheit vor Weihnachten erstreckt sichs nun schon über den ganzen Winter, dann kam mein Bruder mit Frau aus der Ukraine, fluchtartig und knapp mit dem Leben aus bolschewikischer Gefangenschaft, in die sie auf der Reise gerieten, entronnen.1 Dazu der sonstige Zeittrödel, kurz, ich lebte (und lebe noch) wie ein Schachbauer, den ein Dutzend närrische Spieler von einem Feld aufs andre jagen. Meine Prophezeiung trifft ein: nach dem Krieg wirds erst ungemütlich.2 Ich komme nur zwischendurch wie ein Dieb zur Arbeit. Gräulich. Das soll mich alles nicht abhalten, in Ruhe hinzusitzen und | ersteinmal für Ihre Neuigkeit, die allerdings eine solche war und natürlich vollkommen als Überraschung kam, zu danken.3 Eine Würde, oder wie soll ichs nennen?, einerlei, ich kann mich darüber nur freuen. Soll ich es als Zeichen der Zeit ansehen? Oder ist es ein natürlicher Ablauf der Dinge, auch darüber will ich mir den Kopf nicht zerbrechen. Daß Sie auch Lehmbruck »durchgebracht« haben,4 muß man wohl als Wunder schlechthin ansehen. Mehr als erfreut bin ich durch Ihre frühere Mitteilung über den Christus II,5 ein Fall, an den ich gar keine Hoffnung mehr knüpfte, eine Angelegenheit, die ich gleich vom Verwendungszweck glaubte im Abgrund der veränderten Weltlage zugleich mit so vielen Angelegenheiten als versunken ansehen zu müssen. Also Ihr Brief war keineswegs verloren, ich trage ihn in der linken Tasche meiner häuslichen Jacke mit andern unbeantworteten, aber nicht vergessenen Briefen mit mir herum. Daß Sie meinen Christus verwenden werden, ist mir eine Art Befriedigung, wie sie mir selten gegönnt ist. Ich nehme an, daß meine Begleitvorschläge bezügl. Kreuzhöhe- und -Breite, Sockel usw. von Ihnen als eine Norm erkannt werden, die aus der Situation meines Ateliers | hervorgegangen ist und die gegenüber andern Verhältnissen hinfällig wird und eigentlich nur formuliert wurde, weil sie von Trendelenburg6 gewünscht ist. Ich kann mir denken, daß je nach Umgebung und Hintergrund eine ganz andere Verwendungsart notwendig wird und kann nur wünschen, daß Sie ganz nach Ihrem Ermessen verfahren.
Ja, nach Berlin soll ich immer noch kommen, weil irgendwann einmal meine Lithographien zum »armen Vetter« gedruckt vorliegen werden und ich dann zum signieren Niemanden ermächtigen kann.7 Vorher wird es schwerlich werden, denn – was für Reisen sind das! Ich war unlängst zu einer Beerdigung nach Hamburg,8 ach Gott, wie sind wir heruntergekommen. Wenn man die Strecke ohne Übernachten in Lübeck machen kann, darf man vom Andern schon nicht reden.
Hoffentlich sind Sie wohlauf und können arbeiten, das ist der einzige Trost, den man hat. Keine Spartakusse am Roseneck?9 Wenn Sie Cassirer sehen, grüßen Sie bitte. Und sonst – auf vielleicht baldiges Wiedersehen!
Ihr ergebener
EBarlach
Brief, 1 DBl. mit 3 beschriebenen Seiten, schwarze Tinte, 28,7 × 22,7 cm; Ernst Barlach Haus Hamburg; Barlach 1968/69; [399]
1↘ 473; ↘ 393.
2Auch nach der Ausrufung der Republik am 9. 11. 1918 kam es in Deutschland wie in anderen Staaten zu revolutionären Bestrebungen, u. a. von linker Seite nach dem Vorbild der russischen Oktoberrevolution. Mit Novemberrevolution, Spartakusaufstand und Märzkämpfen dauerten die Machtkämpfe in Deutschland bis ins Frühjahr 1919 an (Winkler 2018, 54-59).
3Nach der Novemberrevolution kam es zu einer Neuausrichtung der Preußischen Akademie der Künste und einer Öffnung gegenüber moderner Kunst. So wurde am 21. 1. 1919 auch EB Mitglied und blieb es bis zu seinem erzwungenen Austritt durch die Nationalsozialisten 1937.
4Wilhelm Lehmbruck. Der Hintergrund von EBs Anspielung auf die Besonderheit der Wahl Lehmbrucks konnte nicht ermittelt werden. Weitere neue Mitglieder wurden Lovis Corinth, Käthe Kollwitz, Georg Kolbe und Franz Metzner.
5Vermutlich sah Gaul einen neuen Verwendungszweck für EBs Kruzifix II vor. Zu EBs Auftrag, ein Kruzifix für Soldatengräber zu gestalten, ↘ 474, Anm. 1.
6Friedrich Trendelenburg war von 1912 bis 1933 im Preußischen Kultusministerium tätig.
7EB druckte seine Lithografien nicht selbst, sondern bediente sich des verbreiteten Umdruckverfahrens, d. h. er zeichnete in seinem Atelier in Güstrow mit lithografischer Kreide auf einem speziell beschichteten Umdruckpapier. Diese Zeichnungen wurden anschließend in der lithografischen Werkstatt M. W. Lassally in Berlin auf den Druckträger, in der Regel Solnhofener Kalkstein, übertragen und gedruckt (Koschatzky 2003, 172f.). Deshalb war eine Reise nach Berlin eigens zum Signieren der Drucke notwendig (Laur I, 10). Die Vorzugsausgabe von Der arme Vetter erschien in 300 Exemplaren, in drei Varianten, die sich vor allem in der Papiersorte unterschieden. EB hatte dafür insgesamt 4340 Unterschriften zu leisten. Bei den Vorzugsausgaben A1 und A2 (110 Exemplare) wurde jede der 34 Lithografien, 3740 Blatt, signiert. Zudem wurden die Druckvermerke der 300 Textbände und der 300 Mappen eigenhändig mit dem Namenszug bezeichnet (Barlach/Piper 1997, 539).
8Trauerfeier für EBs Verwandte Luise Schenck, für die er den Grabstein schuf (↘ 494, Anm. 5).
9Bereits 1917 hatte sich die SPD in MSPD, USPD und Spartakusbund um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gespalten. Die politischen Gegensätze zwischen diesen Parteien führten in Berlin im Januar 1919 zum Spartakusaufstand. Die Kämpfe fanden im Zeitungsviertel statt. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen, Luxemburg und Liebknecht am 15. 1. 1919 erschossen. Aus dem Spartakusbund ging die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) hervor (Winkler 2018, 59f.). In der Hundekehlestraße 27, nahe dem Roseneck in Berlin-Grunewald, wohnte und arbeitete August Gaul.
496 an Reinhard Piper, Güstrow, 24. Februar 1919
Güstrow 24. 2. 19
Lieber Herr Piper,
ich wollte Ihnen schon so lange einige Zeichnungen schicken, nun geben mir ein paar Krankentage eine ganz erwünschte Muße, eine kleine Sammlung aus verschiedenen Jahren zusammenzusuchen.1 In meinem Gefühl schließt sehr oft die eine Art die Andre aus, man ist also nicht ohne Zweifel, ob man dem Empfänger einen Gefallen erweist, das Durcheinander auf einen Haufen zu legen. | Sie wissen ja aber, daß viel Verschiedenartiges in Einem erklingen kann, hoffentlich giebts zusammen keinen Misklang.
Ihr Mecklenburger Büchlein ist mir sehr willkommen, der Zusammensteller und Sammler ist, soviel ich von ihm weiß, an sein Gebiet völlig hingegeben und würde Ihnen, wenn Sie ihn auf Ihrer Reise heimsuchen wollten, wahrscheinlich in gewisser Hinsicht nützlicher sein, als ichs vermöchte, der ich ja nur als Eindringling gelten kann.2 Ob Sie das hier im Buch lebende Mecklenburg noch anders als in Schwund- u. Kümmerformen vorfinden werden, bezweifle ich, die | Zeit hat hier arg genug gehaust. Der Deutsche weiß Schatz und Schund so himmelschreiend schlecht zu scheiden, daß er sich für Affenmoden die beste Eigenheit abschwindeln läßt.
Ein hiesiger junger Herr Schult ist aus alter Bauernzucht und hat den Inbegriff seines Geschlechts aus Jahrhunderten filtriert in sich bewahrt – er weiß, wie es hergegangen ist und hats als Kind mit eigenen Augen mitangesehen. Vielleicht würde es Sie wenn Sie herkommen, als ebenfalls Mecklenburger intressieren diesen letzten Mohikaner,3 an dem kein falscher Ton ist, in neuzeitlicher Gestalt kennenzulernen.