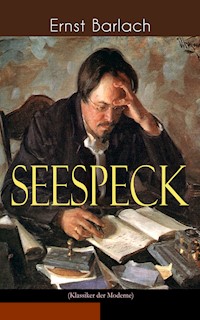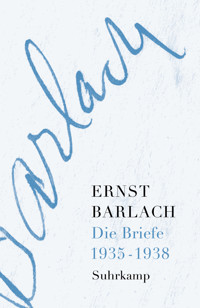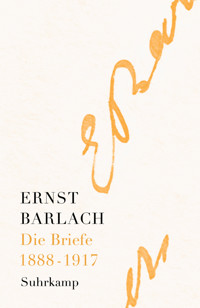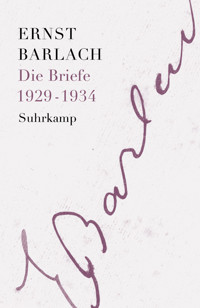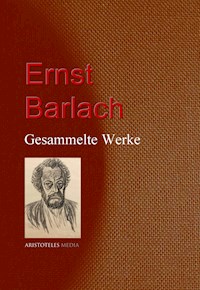Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: marixklassiker
- Sprache: Deutsch
Zehn Jahre vor seinem Tod legt der deutsche Bildhauer, Grafiker und Dichter Ernst Barlach seine Autobiografie unter dem Titel Ein selbsterzähltes Leben vor. Barlach, den man zu den wohl bedeutendsten deutschen Expressionisten zählen darf, schuf literarische Werke, die seinem bildnerischen Schaffen ebenbürtig, aber weit weniger bekannt sind. Seine eigenwillige, expressive Sprache ist ihm ein "Spiegeln des Unendlichen", die bildhafte Ausdruckskraft, sein Humor und die scharfe Beobachtungsgabe machen diese Autobiografie zu einem Klassiker, die zu lesen auch heute noch große Freude bereitet. Ergänzt wird Barlachs eigene Lebensbeschreibung in diesem Band durch seine autobiografischen Güstrower Fragmente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Barlach
Ein selbsterzähltes Leben
—
Güstrower Fragmente
INHALT
EIN SELBSTERZÄHLTES LEBEN
GÜSTROWER FRAGMENTE
Titelblatt der Erstausgabe von „Ein selbsterzähltes Leben“,Federzeichnung, 1928Verlag Paul Cassirer, Berlin 1928
ERNST BARLACH
EIN SELBSTERZÄHLTES LEBEN
1927
Der sich hier freimütig äußernde Bildhauer und gelegentliche Dramenschreiber wird nicht von krummen Wegen, immerhin von Irrfahrten und vom Heimischgewesensein auf verworrenen Pfaden sprechen, er rühmt sich dessen weder noch schämt er sich, lässt sich aber die Feststellung entfahren, es derart bis zu einem guten Grüppchen von Jahren über die Sechzig gebracht zu haben. Wenn er also vom Segen spricht, der ihm nicht allein aus gewissen inneren Begebenheiten, geschweige denn aus der Summierung von Beobachtungen und Nötigungen zur Kenntnisnahme sowohl bitterster wie wohltätigster Art geworden ist, so darf er wohl hoffen, nicht als leichtfertiger Daherredner beiläufiger oder einstweiliger Spruchweisheit angesehen zu werden.
Barlach: Künstler zur Zeit, 1933
Wandernde Puppenspieler, Holzschnitt, 1922Aus der Folge zum Drama „Der Findling“, Blatt 8Verlag Paul Cassirer, Berlin 1922
MEIN VATER ZEICHNET
Großvater Barlach hatte Liebeskummer, und seine Söhne wachten mit ihm und halfen seufzen. Dann wurde es sehr spät, bis das erlösende Wort fiel: „So gebt die Bibel“; denn nur, wenn der Bibelabschnitt gelesen war, durfte nach der Ordnung des Pfarrhauses in Bargteheide zu Bett gegangen werden. Und mein Vater zeichnete, selbst in dieselbe Person schmerzlich verliebt, zeichnete Großvater Barlach mit seinen Söhnen von der einen Seite auftretend, Bertha Korneels aber, einen großen Geldbeutel herweisend, von der andern.
Ein bisschen Zeichnen oder Malen oder Schreiben mehr oder weniger fiel in der Familie nicht auf. Tante Friede schöpfte aus dem Vollen der Farbe und schonte auch die Leinwand nicht – und mit der gerahmten Leinwand nicht Wohnungen, Wände, Stuben, Dielen und alles Gelass derer, die keine Wahl hatten zwischen Nehmen und Ablehnen. Auch ihre Rede quoll aus dem Überfluss; ihre schäumende Suada, hervorbrechend aus unausschöpfbaren Lungen, verglich mein Vater mit der der Königin Margarete in Richard dem Dritten. Tante Erne, zufrieden mit dem von ihrem Gott nur kümmerlich bemessenen Vermögen, strich im Glauben an den Wert alles aus Liebe Gegebenen ihre grundehrlichen Zaghaftigkeiten aufs gutwillige Papier. Und wenn es sich bei den Brüdern einigermaßen verhielt, so geriet es bei den Söhnen umso hemmungsloser; Vetter Friedrich wurde Maler, Vetter Ernst zog das zeichnerische und schreibende Bekennen und Beteuern mit einer seltsamen, draufgängerischen Unbedenklichkeit in den Dienst einer begeisterten Menschenfischerei, aus dem ihn noch als Student der Theologie der unbedenklichere Menschenfischer Tod verjagte – und sein Bruder Karl, obgleich Jurist, gestaltet mit reiner Treue, was Herz und Auge ihm in Lust und Qual zu verwinden geben und bildend aus dem Bereich des Erlebens in den des Betrachtens zu retten auffordern.
Aber mein Großvater starb nicht als Witwer. Als er an seinem ersten Enkel das Werk der Taufe übte, stand er, frisch verlobt, mit seinem Sohn auf dem Balkon des Ratzeburger Hauses, legte reuig die Hände auf das Gitter und seufzte aus tiefster Seele: „Wo ward ick se wedder los?“
Zusammen habe ich fünf Großmütter gehabt, meines Vaters rechte Mutter starb früh, und man hat mir von ihr Züge eines melancholischen Wesens überliefert, einer Neigung zum Trostfinden in Trauer und Tränen – – „Was tu ich mit einer Frau, die am liebsten weint?“ klagte „Vater Barlach“. Auch die Mutter meiner Mutter starb früh, und von ihr schenkte man mir die Vorstellung eines Regenbogenschimmers der heitersten Jugend. Zollkontrolleur Vollert stand als Holsteiner noch in dänischen Diensten, als meine Mutter geboren wurde.
Satrup, das Dorf in Angeln, erfuhr des jungen Dr. Georg Barlach Anfänge in ärztlicher Praxis, Luise Vollert lernte ebenda den Hausstand im Pastorat, ein Dorfidyll kam unversehens in schönsten Flor, und gleich hinter seinen letzten Rosenbüschen stießen sie auf den gepflasterten Weg der Ehe. Meine Mutter malte weder, noch zeichnete, noch schrieb sie, aber sie war herrlich empfänglich für alle Wirklichkeit und wusste aus einem gesegneten Gedächtnis heraus von allen bitteren und heiteren Stücken zu erzählen, in denen die, die vor mir waren, sich bewährten oder versagten. Das Buch, das ich ihr als Aufgabe gegeben, die Familienchronik, hat sie nicht geschrieben, ihr einziges, ein Kochbuch, blieb Manuskript und sein einziger Leser ihr jüngster Zwillingssohn auf seiner texanischen Hungerfarm – so hatte sie es in mütterlichem Sorgenleid als das Wichtigere bedacht.
ICH BLICKE UM MICH
Der Roland auf dem Markt in Wedel an der Unterelbe, wo meine Eltern ihren Haushalt angehen ließen, sieht sich nicht nach kleinen Buben um, seine Hintenübergebogenheit erlaubt ihm das nicht, und nackenlos sitzt der steinerne Stolz eines Übergewichts von Kopf zwischen seinen Schultern. Wenn das Bübchen, ich, aber über den Markt ging, hat es ihn wohl gesehen, aber das Bild war zu schwer für sein Bewusstsein, es ist ihm weggesunken, er hat’s vergessen.
Mein Vater ritt nach Hetlingen und Holm auf Praxis und schrieb den Marschbauern Rechnungen. Solch einer kam einst und mäkelte, während er die Taler aufzählte, über die Höhe der Leistung, und dem Doktor entfuhr im Zorn die Aufforderung, den „ganzen Schiet wedder mittonähmen“, was dem Bauern wohlgefiel zu hören. Er strich ein und meinte nur, das könne man ja beinahe nicht verlangen – oft wird sich mein Vater solche Ausübung ärztlicher Praxis nicht gestattet haben, denn es steht geschrieben, dass es im ersten Jahr des jungen Haushalts knapp herging. War Bruder Karl als Student zu Besuch, so half er wohl gutmütig aus und fuhr mit silbernen Hochzeitslöffeln ins Versatzamt nach Hamburg.
Ich wurde am 2. Januar 1870 geboren. Die Welt, die ich anzuschauen bekam, ließ es sich von meinem guten Platze aus gefallen, dem Eckhaus am Markt, wo ich vom Balkon herab einen Leichenzug mit herzlichem Hurra begrüßte, da ich den Unterschied von einem Schützenausmarsch noch nicht wahrnahm. Knöpfe, die man mir zum Spielen reichte, fraß ich auf, desgleichen Zigarrenstummel, die mein Vater wegwarf, und vom Mistberg musste man mich gelegentlich wegbesorgen, weil ich mir da etwas an Üblem zugute tat; ich nahm eben die Welt in der Weise in mich auf, die ich am schnellsten begriff.
Mein Bruder Hans half mir bei dieser Aufgabe, so gut er konnte, wir schmarotzten am Frischen so gut wie am Faulen, spürten aber um uns herum manches Bedenkliche, auf das achtzugeben nötig wurde, Dinge, die man nicht sehen und nicht hören konnte und die doch gewiss wirklich waren. „Es“ kann kommen oder auch nicht, machten wir aus, wenn wir am taghellen Sommerabend im Bett lagen – „sieh du nach der Stubenseite, ich will die Wand bewachen“, denn wir wussten bald, dass „Es“ auch durch die Wände kam.
ICH WERDE HÖRIG
Nach ein paar glücklichen Jahren verzogen meine Eltern mit uns nach Schönberg, des Fürstentums Ratzeburg Hauptstadt. Die Zwillinge trafen ein, Joseph und Nikolaus – und ich entdeckte die Welt außerhalb des Hauses.
Mein Vater musste sich mit seinem Kollegen, dem älteren Dr. Marung, schießen, meine Mutter empfing von ihren Kindern so viele Pflichten, dass sie mit aller erdenklichen Vorsicht wohl die Frage tat, ob denn die Welt für sie bloß noch Kinderklein, Geschrei, Darmtücken, Kleidernässen und Krankenwartung übrig habe – ich warf mich ins Mäntelchen und erklärte: „Nu geit’ Juhlen all wedder los“ – und ging auf die Straße. Hier nahm mich Edmund Steffan in Empfang und ließ sich meine Unterweisung in seiner Art von Lebenskunst viel Mühe kosten, und ich war gelehrig und ward hörig.
Einmal sollte ein gefundenes Hufeisen zu Geld gemacht werden, und ich wurde damit in die Schmiede geschickt, wo es der Geselle nahm und zu andern warf. So war es aber nicht gemeint, und Edmund Steffan ließ mein Kommen mit leeren Händen nicht gelten. Er scheuchte mich zurück, und ich verlangte Bezahlung. „Kumm“, sagte ermunternd derselbe Geselle, ließ seine rußigen Hände vom Blasbalg los und gab mir eine Maulschelle. – Aber Geld wurde doch beschafft, wenn auch auf andern Wegen.
Der Milchmann ließ in der Küche Wechselgeld zurück, und das lag auf der Tischplatte wie für uns bestimmt da. Was wir nicht sogleich für Lakritzen aufbrauchten, verbargen wir unter Blättern in den Kübeln der Oleanderbäume vor des Krämers Laden. Dann aber holte ich aus eigener Eingebung zu einem Hauptstreich aus. Ich ließ mir von meinem Vater, der mit Pastor Ohl aus Seimsdorf bei dickem Zigarrenrauch Gespräche über „hohe heilige Dinge“ führte, einen „Taler für Bier“ geben, eine Besorgung, die mir schon öfter aufgegeben war, wenn der Mann mit den dreißig Flaschen Aktienbier im Korbe kam. Vater entäußerte sich seines arglosen Talers, und ich damit flott zum Kaufmann Ott und für den Taler dreist Lakritzen verlangt. Als ich aus der Tür trat, hatte das Schicksal, das seine Rache nicht hastig genug betreiben konnte, Pastor Ohl zur Stelle gebracht. Pastor Ohls Hand langte nach meiner mit dem geliebten Naschkram und überlieferte mich der meines Vaters, eines heftig erzürnten Vaters. Das Gelump flog zum Fenster hinaus, und mir kam zu, was meine Tat wert war.
Es gab noch andere Gelegenheiten, schuldig zu werden. Hinterm Hause der Teich war eine Welt voll Wunder, und überm Wundern fand man sich unversehens als aus dem Wasser gezogenes Kind geborgen, aber nicht bedauert, denn es war streng verboten, ins Wasser zu fallen; wer es dennoch nicht ließ, bekam Schläge. Einst war Edmund Steffan vom Steg geglitten, und wir zwei Retter, Hans und ich, hielten uns verzweifelt an seinen Beinen fest, unbehilflicher als er, der mit dem Kopf unter Wasser lag und sich ohne uns wohl leichter herausgeholfen hätte. Mich hatte es ein anderes Mal erwischt, und bald lag ich trocken im Bett und wartete. Vater kam heim, und ich hörte ihn mit forschen Schritten, wie es seine unverkennbare Art war, herantreten. Ob er den Stock mitbrachte, weiß ich nicht, denn gewillt, dem Verhängnis auf einem gangbaren Wege auszuweichen, tat ich die Augen zu und stellte mich, zwar nicht tot, aber schlafend, und tat es so lauter, dass alles eine freundliche Wendung nahm. Vaters Schritt wurde sanft, er hielt inne und bog vom Wege des Rechts ab. Leise ging die Tür, und ich fand es gut so.
Aber im Winter bekam der Teich seinen kalten Meister, und das Eis bot uns erlaubte Bahn. Mich, mit dem väterlichen Verbot des Ertrinkens im Kopfe, überkam die Vorstellung, dass wohl auch der Vater einmal schuldig werden könne, als er mit andern Herren in der Dunkelheit auf dem Eise geblieben war, und ich rannte in der Gitterbettstelle auf und ab und schrie meiner Mutter in die Ohren: „Barlach ist tot, Barlach ist tot!“
Übrigens fasste ich ganz ohne Anleitung eines Edmund Steffan in Schönberg die Idee des Selbstmords. Wenn es mit mir, wie nicht ausgeschlossen war, zum Soldatwerden kommen würde, da sollte man schon sehen: „Ich gehe ins Zarnewenzer Gehölz und finde eine alles schnell ordnende Giftpflanze.“ Oder: „Da kommt ein Wagen die Straße herunter, was nötigt mich auszuweichen, ich kann mich ja beliebig totfahren lassen.“
Und noch andere Spiele eines flügellüftenden Nesthäkchens von Seele. Beim Gang ins Zarnewenzer Gehölz beobachtete meine Mutter, wie ich mit einer Gerte die Klettenpflanzen des Grabens peitschte und murmelnd immer dasselbe versicherte: „Sag’ die Wahrheit, sagt meine Mutter zu mir – sag’ die Wahrheit …“ Was sie danach als Erklärung aus mir herauslockte, war dieses: Ich hatte einem andern Jungen Kletten ans Zeug gesetzt, weswegen seine Mutter gewiss fragen würde, wo er denn gewesen sei, und er, leugnend, im Wald oder Feld herumgetrieben zu sein, bei offenbarem Lügen erwischt, angefahren werden würde: „Sag’ die Wahrheit!“, was er mir als dem schadenfrohen Anstifter mit den Worten hinterbringen würde: „Sag’ die Wahrheit, sagt meine Mutter zu mir.“
Edmund Steffan wurde von Zeit zu Zeit unsere Treppe heraufgeboten. Dann gab ihm meine Mutter ein gutes Butterbrot und fügte eine Pauke hinzu, die er mit scheelen Blicken ausdauerte, solange das Kauwerk arbeitete. Sie änderte nichts an ihm, aber ich wurde anderweitig hörig.
Wollte ich die stärkere Gewalt, der ich verfiel, selbst nicht weitläufiger schildern als Edmund mit seiner Großmäuligkeit und seiner holpernden Rede, mit der, soviel davon er auch vertat, sein Hals verstopft zu bleiben schien, so dürfte ich für immer am Schreiben bleiben. Des Wetters Däumling war ich wohl längst, den es, in welche Falte seiner Farbigkeit, in welche Tasche seiner Räumlichkeit es wollte, zu seinem unaussprechlichen Genügen stecken konnte. Die Sattheit und Schwere der Wedeler Marschen, die Elbfernen, sind mir fortgeschwemmt, aber die Schönberger Tage und Nächte sind schon auf festen Erinnerungsboden gekommen.
Um die Zeit, wo seine Söhne einen Podex nachweisen konnten, der den Strapazen gewachsen war, ließ mein Vater sie zur Teilnahme an der Praxis zu, natürlich zur Landpraxis, die jetzt mit Fuhrwerk besorgt wurde – und da bin ich denn wirklich einmal bis ans Ende der Welt gekommen. Ich wusste bestimmt, dass das Hinschweifen durchs raumlose Dunkel am Rande der Wirklichkeit stattfand, und hatte viel, viel Zeit, über solche Selbstverständlichkeit des Unwahrscheinlichen ohne Ablenkung nachzudenken, denn gesprochen wurde auf all diesen Landfuhren fast nie.
Ich kam zu großen und kleinen Leuten, zu Bauern und Herren, sah Menschen und Dinge unter niedrigen und stattlichen Dächern und lernte – Geduld und Warten, denn der Dr. Barlach betrieb nach seiner eigenen Formulierung keine Dampfdoktorei und vergaß an Krankenbetten frierende Pferde, Kutscher und Kind. Ich meine, die beste Erziehung liegt im Beispiel wertvollen Tuns, und Kinder haben außer Augen und Ohren noch mancherlei empfangende Organe. Es braucht nicht beim Verschlucken von Knöpfen, Zigarrenstummeln und Auflesen der Leckereien vom Mistberg zu bleiben.
Einmal sah ich nach räderndem Verlauf mancher Stunde von einem Steg in einen grünlich-unvergesslichen Wasserabgrund, sah von sicherer Sandigkeit eines Ufers jähes Hinabgleiten der Welt in Bodenverlorenheit, und als später mein vergnügter und befreiter, von Zuversicht gleichsam angeheiterter Vater zu mir sagte: „Wir ziehen nun bald nach Ratzeburg“, da fragte ich hellhörig zurück: „Ist das da, wo das schöne Wasser war?“ – Das war es.
ICH LERNE SCHREIBEN UND LESEN
In Ratzeburg taten sie mich und Hans in Tante Lomeyers Spielschule am Dom, gehalten in einer mittelalterlichen Backsteinkluft, in die man sich von der Turmseite des alten Baues hinabschachtete, wenn man nicht lieber vom Palmberg aus durch einen Stufengang hinaufstolperte. War es auf dem Schulwege kalt, so erstarrte meinem Bruder wohl der Mut, und da er beim Weinen nicht auch noch gehen konnte, so musste er stehenbleiben – das war seine Art, unsere Lage klarzulegen. Ich verstand seine Meinung prompt und widerlegte sie mit Faustschlägen.
Bei Tante Lomeyer hatte ich nichts anderes zu tun, als mein Lesen zu vergessen; denn ich hatte doch schon auf der Schönberger Schule die Nase ins Buch stecken müssen, in der Septima des Gymnasiums wurde ich auf dem Buchstabenweltmeer dann endgültig flott. Auch Schreiben durfte man mir zumuten, zunächst auf Schiefer, und so habe ich damals auf der Schiefertafel meine erste erzählerische Spielerei gestümpert. Als im nächsten Jahre diese Übungen in blauen Heften mit Tinte und Blei vor sich gingen und ich mit unserem Mädchen zum Einkauf in einen Laden kam, da lief mir beim Anblick dieser für mich erhandelten Werkzeuge warmes Wohlgefühl übers Herz – ich merkte was von gutem Umgehen mit so herrlichen Sachen.