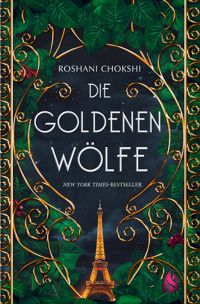15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arctis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die goldenen Wölfe
- Sprache: Deutsch
Band 3 des ›New York Times‹-Bestsellers voller Magie, Action, Diversität und Romantik. Nach Séverins scheinbarem Verrat ist sein Team enttäuscht und gespalten. Mit nur einer Handvoll Hinweisen gelangen Enrique, Laila, Hypnos und Zofia auf unterschiedlichen Wegen nach Venedig, um ihren Anführer zwischen Prachtbauten und Kanälen zu suchen. In einem nahe gelegenen Tempel sieht sich das vereinte Team mit überirdischen Liedern, bronzenen Bestien und magischen Stufen konfrontiert, deren Kräfte Göttlichkeit selbst offenbaren könnten. Aber zu einem Preis, den sie vermutlich nicht zu zahlen bereit sind ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Roshani Chokshi
Die bronzenen Bestien
Aus dem amerikanischen Englisch von Hanna Christine Fliedner und Jennifer Michalski
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel The Bronzed Beasts bei Wednesday Books/St. Martin’s Press, New York.
Deutsche Erstausgabe
© Atrium Verlag AG, Imprint Arctis, Zürich-Hamburg
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2021 Roshani Chokshi
First published by Wednesday Books/St. Martin’s Press
Translation rights arranged by The Sandra Dijkstra Literary Agency
All rights reserved
Übersetzung: Hanna Christine Fliedner und Jennifer Michalski
Lektorat: Katrin Segerer
Covergestaltung: Kerri Resnick
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03880-128-6
www.arctis-verlag.com
Folgt uns auf Instagram unter www.instagram.com/arctis_verlag
Für meine Freundinnen und Freunde, die mich nicht von dem Vorhaben abgebracht haben, eine Mischung aus Das Vermächtnis der Tempelritter und Faust zu schreiben, gewürzt mit einem Schuss existenzieller Krisen … aber in sexy.
Ihr schuldet mir Drinks. Und eine Therapie.
Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte?
– Buch Hiob –
Prolog
Kahina sang dem schlafenden Jungen etwas vor.
Sie saß auf der Bettkante und strich die Albträume fort, die seine Stirn kräuselten. Séverin seufzte, schmiegte sich an ihre Hand, und Kahina wurde das Herz schwer. Nur hier, in diesen verstohlenen Momenten, wenn die Nacht allmählich in den Tag überging und die Welt noch in tiefem Schlummer lag, konnte sie ihn ihren Sohn nennen.
»Ya omri«, murmelte sie.
Mein Leben.
»Habib albi«, ein wenig lauter diesmal.
Liebe meines Herzens.
Séverin blinzelte und sah zu ihr hoch. Schlaftrunken lächelte er und streckte die Ärmchen aus. »Ummi.«
Kahina drückte ihn an sich, während er wieder eindämmerte.
Sie berührte sein Haar, dunkel wie Krähenschwingen und leicht gelockt. Seine Haut duftete schwach nach Eukalyptus, wegen der Zweige, die sie ihm abends ins Badewasser legte. Manchmal ärgerte es sie, dass sie so wenig von sich selbst in seinen Zügen wiedererkannte. Mit geschlossenen Augen war er eine Miniaturausgabe seines Vaters, und Kahina ahnte schon jetzt, wie das seine Zukunft prägen würde. Der Mund ihres Sohnes würde lernen, sich zu einem spöttischen Lächeln zu verziehen, und die rosigen Pausbäckchen würden sich klingengleich schärfen. Sogar sein Benehmen würde sich wandeln. Noch war er schüchtern, ein stiller Beobachter, doch sie hatte ihn schon gelegentlich die elegante Grausamkeit seines Vaters nachahmen sehen. Bisweilen erschreckte sie das, aber möglicherweise zeugte es lediglich von Séverins Überlebenswillen. Es verhieß Macht, nicht nur zu wissen, in welchen Kreisen man sich auf dieser Erde bewegen musste, sondern auch, wie man erreichte, dass die Erde um einen selbst kreiste.
Sanft fuhr Kahina über Séverins Wimpern. Sie überlegte, ob sie ihn wecken sollte. Das war selbstsüchtig, so viel war ihr klar, doch in den Augen ihres Sohnes fand sie den einzigen Teil ihrer selbst, den man nicht hatte auslöschen können. Séverins Augen hatten die Farbe von Geheimnissen. Von silberdurchwirkter Abenddämmerung. Genau wie ihre eigenen und die ihrer Großeltern vor ihr.
Es waren die Augen aller Auserwählten, derjenigen, denen die Gnade der Unverehrten Schwestern zuteilgeworden war: al-Lāt, al-’Uzzā und Manāt. Archaische Göttinnen mit Tempeln, deren Steine inzwischen Industrie- und Handelsstraßen pflasterten. Ihre Mythen waren getilgt worden, ihre Gesichter in Vergessenheit geraten. Nur ein Gebot hatte unbeschadet die Zeit überdauert, streng befolgt von den Nachfahren derer, die die Göttinnen gesegnet hatten.
Das Tor zum Göttlichen liegt in deinen Händen – lass niemanden ein.
Als Kahina klein war, hatte ihre Mutter ihr eingebläut, es sei auch ihre heilige Pflicht, dieses Gebot in Ehren zu halten. Kahina hatte ihr nicht geglaubt. Sie hatte gelacht, das Ganze als Produkt ihrer blühenden Fantasie abgetan. Doch an ihrem dreizehnten Geburtstag nahm ihre Mutter sie mit in die Wüste, zu Ruinen, die außer Ziegen und Vagabunden niemand mehr aufsuchte. In der Mitte eines von baufälligen Säulen umgebenen Hofs befanden sich die Überreste eines ausgedienten Brunnens. Allerdings enthielt er kein Wasser. Stattdessen sammelten sich darin Sand und staubbedeckte Palmwedel.
»Gib ihm etwas von deinem Blut«, forderte ihre Mutter sie auf.
Kahina weigerte sich. Dieser Unfug ging entschieden zu weit. Aber ihre Mutter ließ sich nicht beirren. Sie packte Kahinas Arm und zog einen scharfkantigen Stein über ihre Ellenbeuge. Ein heiß aufflammender Schmerz. Kahina schrie auf. Ihr Blut tropfte auf die alte Brunnenmauer.
Die Welt erzitterte. Ein blauer Lichtstrahl schoss empor, als hätte man den Himmel zu einem Seil geflochten. Er fächerte sich auf, bis ein leuchtender Käfig die Ruinen umschloss.
»Sieh in den Brunnen«, befahl ihre Mutter und klang dabei wie eine Fremde.
Erschüttert beugte Kahina sich über den Rand. Verschwunden waren Sand und Palmwedel. Stattdessen fluteten die Bilder einer Geschichte auf sie ein. Ihre Lider schlossen sich. Ihr Mund füllte sich mit tausend Sprachen, die Zunge zuckte, die Zähne schmerzten. Für den Bruchteil einer Sekunde – nicht länger als ein Wimpernschlag – breitete sich ein fremdes Bewusstsein in ihr aus. Ein Bewusstsein, das flüsternd Wurzeln treiben und Vögel flügge werden ließ, so scharf, dass es aus Chaos Kalkül und aus Willkür Vernunft schneiden konnte und Sterne in den Himmel schnitzte.
Kahina fiel auf die Knie.
Sie hatte das Gefühl, sich in die Luft zu erheben und auf die Welt unter sich hinabzublicken, die ihr nun so klein erschien, als würde sie in ihre Hand passen. Kahina beobachtete, wie ein Fragment des beunruhigenden Bewusstseins hell aufglühte und sich über diese noch junge Welt verteilte. Sie sah es Kerben ins Land schlagen, sah Menschenmengen, die sich, wie von einem Feuerwerk neuer Farben geblendet, die Augen abschirmten, sah, wie die Splitter der Macht sich in den Boden gruben und dort Schnörkel aus Licht erblühen ließen, als hätte man den Erdball mit Schriftzeichen voller Poesie überzogen, die nur Engel aussprechen konnten. Über diesem leuchtenden Netz gedieh das Leben. Pflanzen sprossen, Tiere weideten. Siedlungen entstanden – zunächst klein, dann immer größer –, und die Bewohner begannen, Dinge zu erschaffen. Mit einem Schlenker seines Handgelenks ließ ein Mann aus Grashalmen eine Flöte entstehen. Eine mit Perlen behängte Frau legte Kindern den Finger an die Schläfe, und die Menschen um sie herum sanken vor Ehrfurcht auf die Knie. Später sollte Kahina lernen, dass man diese Kunst in der westlichen Welt als die Schmiedegaben des Geistes und der Materie bezeichnete, sie jedoch viele Namen hatte.
Dann eröffnete das unheimliche Bewusstsein Kahina einen neuen Anblick.
In einem Tempel mit hohen Decken schwebten kurze Fäden des seltsamen Lichts in der Luft, greifbaren Sonnenstrahlen gleich. Eine Gruppe von Frauen sammelte sie ein. Ihre Augen hatten das Licht aufgesogen und glänzten silbrig. Einen nach dem anderen zogen die Frauen die schimmernden Fäden auf den Rahmen eines Instruments auf, das kaum größer war als der Kopf eines Kindes. Neugierig schlug eine von ihnen eine Saite an. Die Zeit schien stillzustehen, und einen schrecklichen Moment lang ächzten die Splitter der Macht in der Erde, die leuchtenden Schriftzeichen blinkten warnend. Sofort presste die Frau die Finger auf die Saite und brachte sie zum Verstummen.
Doch der Schaden ließ sich nicht mehr abwenden.
Überall auf der Welt flammten Brände auf, stürzten neu erbaute Städte in sich zusammen und begruben Menschen unter den Trümmern. Kahina konnte ihren Körper nicht sehen, aber ihre Seele erzitterte vor Angst. Dieses Instrument durfte nicht gespielt werden.
Auf einmal jagte eine Vision die andere.
Kahina beobachtete, wie die Nachkommen der Frauen die Erde bevölkerten. Zu erkennen waren sie am übernatürlichen Glanz ihrer Augen, gerade so außergewöhnlich, dass sie Aufmerksamkeit, aber keinen Verdacht erregten. Das seltsame Instrument wurde unter ihnen weitergereicht und durch Portale geschleust, die Zeit und Raum bezwangen. Es überdauerte Epochen. Königreiche fochten Kriege aus, gierige Gottheiten verlangten nach Blut und noch gierigere Priester nach Opfergaben. Sonne und Mond gingen im Wechsel auf und unter, und während all dieser Zeit blieb das Instrument wundersam still.
Jäh entließen die Visionen Kahina aus ihrem Griff.
Sie fiel erneut, und es schien ein Sturz durch ganze Zeitalter zu sein. Sie spürte die rauen Steine alter Zikkurats an ihren Wangen, schmeckte kühle Münzen auf der Zunge, streifte die Felle ausgestorbener Tiere mit den Füßen. Plötzlich fand sie sich auf dem Boden wieder und starrte hinauf in die Augen ihrer Mutter. Die unermessliche Präsenz, die eben noch ihre Seele ausgedehnt hatte, war fort. Nie zuvor war ihr so kalt gewesen, hatte sie sich so klein gefühlt.
»Ich weiß«, flüsterte ihre Mutter sanft.
Kaum hatte Kahina ihre Stimme wiedergefunden – was länger dauerte als erwartet, denn das Arabische schien ihr nicht über die Lippen zu wollen –, krächzte sie: »Was war das?«
»Eine Vision, die den Auserwählten zuteilwird, damit wir unsere heilige Pflicht besser begreifen«, antwortete ihre Mutter. »Wir haben noch andere Namen, zumindest erzählt man sich das. Unsere Familie hat sich vor ewigen Zeiten in alle Winde zerstreut. Wir sind die Verlorenen Musen, die Nornen, Töchter des Bathala, die Stillen Apsaras. Auch das Instrument hat viele Namen in unzähligen Sprachen, aber seine Wirkung bleibt bis heute gleich: Wird es gespielt, so bringt es das Göttliche aus dem Takt.«
»Das Göttliche …«, wiederholte Kahina.
Ein Wort, das nicht ausreichte, um zu beschreiben, was sie gesehen hatte.
»Deine Großmutter hat mir damals von einem Ort erzählt, einem Heiligtum, erbaut aus den Ruinen eines Landes, dessen heilige Elite ihre Macht missbraucht hatte. Spielt man das Instrument außerhalb dieses besudelten Tempels, entfesselt man eine Zerstörungskraft, die die Welt in ihren Grundfesten erschüttert«, fuhr Kahinas Mutter fort. »Innerhalb des Tempels jedoch vermag es, Gerüchten zufolge, alle Fragmente des Göttlichen zusammenzufügen. Manche sagen, sie würden einen Turm formen, den man erklimmen könne, um göttliche Macht für sich zu beanspruchen. Doch die Wahrheit herauszufinden, ist uns nicht bestimmt. Unser Auftrag besteht allein in der Erfüllung unserer Pflicht …«
Sie half Kahina auf die Füße.
Das Tor zum Göttlichen liegt in deinen Händen – lass niemanden ein.
KAHINABEUGTESICH über ihren Sohn. Sie nahm seine rosige kleine Hand in ihre, zeichnete die blau schimmernden Venen am Gelenk nach, küsste die Knöchel und Kuppen und schloss die Fingerchen dann sanft zur Faust. Sie wünschte, sie könnte für immer in diesem Moment verweilen, in diesem Winkel der Zeit, eingehüllt vom Geräusch ihrer beider Atem, ihr schlafendes, warmes Kind neben sich, während der Mond über sie wachte und die Sonne an anderen Orten brannte.
Doch so funktionierte die Welt nicht.
Kahina hatte ihre Reißzähne gesehen und war vor ihren Schatten geflohen.
Sie versuchte, sich vorzustellen, wie sie Séverin zum heiligen Brunnen brachte, aber das Bild blieb verschwommen. Das ängstigte sie. Und diese Angst hatte sie dazu getrieben, Delphine Desrosiers, der Matriarchin von Haus Kore, die Wahrheit anzuvertrauen. Sie würde auf ihren Sohn achtgeben. Sie würde wissen, was auf dem Spiel stand und wohin er zu gehen hatte, sollte das Schlimmste eintreten.
Selbst nach all den Jahren erinnerte Kahina sich noch genau, was sie an jenem Tag in den Ruinen erlebt hatte. An die Welt zu ihren Füßen und die Schriftzeichen der Macht, die sich unentzifferbar in zerklüftete Gebirge und kristallklare Seen, in ausgedehnte Wüsten und neblige Urwälder eingeschrieben hatten.
Nur ein Ton dieses Instruments … und all das würde verschwinden.
»Das Tor zum Göttlichen liegt in deinen Händen«, flüsterte sie ihrem Sohn zu. »Lass niemanden ein.«
Teil I
Séverin
Venedig, Januar 1890
Séverin Montagnet-Alarie starrte mit stumpfem Blick auf den Mann hinab, der vor ihm kniete.
Hinter ihm wirbelte ein kalter Wind die dunkle, lackglänzende Wasseroberfläche der Lagune auf. Der Bug einer Gondel schlug anklagend gegen den schattigen Kai. Etwa dreißig Meter vor Séverin ragte eine schlichte, helle Holztür auf, flankiert von einem Dutzend Mitgliedern des Gefallenen Hauses. Schweigend beobachteten sie ihn, die Hände vor dem Körper verschränkt, die Gesichter unter weißen Volto-Masken verborgen. Auf Höhe der Lippen prangten goldene Mnemospione in Form von Honigbienen. Ihre Flügel surrten, während sie jede seiner Bewegungen aufzeichneten.
Ruslan, Patriarch des Gefallenen Hauses, stand neben dem knienden Mann und tätschelte ihm den Kopf, als wäre er ein Hund. Spielerisch zupfte er an dem Knebel in dessen Mund.
»Sie …«, sagte er an den Mann gewandt und klopfte ihm mit dem goldenen Messer des Midas gegen die Schläfe, »… sind der Schlüssel zu meiner Apotheose. Nicht der wichtigste, aber dennoch unverzichtbar. Sie müssen verstehen, ohne Sie öffnet sich die Eingangstür nicht.« Ruslan strich dem Mann übers Haar. Seine goldene Hand schimmerte im Schein der Fackeln. »Sie sollten sich geschmeichelt fühlen. Wie viele können schon von sich behaupten, jemandem den Weg zur Göttlichkeit geebnet zu haben?«
Der Mann wimmerte. Ruslans Grinsen wurde breiter. Noch vor ein paar Tagen hätte Séverin das Messer des Midas als das faszinierendste Artefakt bezeichnet, das ihm je untergekommen war. Es modifizierte menschliche Materie mithilfe einer scheinbar göttergleichen Alchemie. Doch das ging, wie Ruslan bewies, auf Kosten der geistigen Gesundheit. Man munkelte, die Klinge sei aus dem höchsten Stein des Turms zu Babel gefertigt worden, aus dessen weltweit verstreuten Überresten sich die Kunst des Schmiedens speiste.
Verglichen mit der Göttlichen Lyra in Séverins Hand jedoch war das Messer des Midas kaum der Rede wert.
»Was meinst du, Séverin?«, fragte Ruslan. »Bist du nicht auch der Ansicht, der gnädige Herr sollte sich geschmeichelt fühlen? Wenn nicht sogar geehrt?«
Die Blut- und Eisschmiedekünstlerin Ewa Jefremowna, die bei den Mitgliedern des Gefallenen Hauses stand, versteifte sich merklich. Ihre großen grünen Augen glänzten fiebrig, seit sie vor zwölf Stunden den Schlafenden Palast auf dem gefrorenen Baikalsee hinter sich gelassen hatten.
Wäge jeden deiner Schritte gut ab.
Séverin musste an das letzte Gespräch mit Delphine, der Matriarchin von Haus Kore, im Bauch des mechanischen Leviathans zurückdenken. Auf einer Mnemoscheibe hatte er mit ansehen müssen, wie Ruslan seinen Freunden zugesetzt, Laila brutal gegen die Wand gestoßen und Enrique das Ohr abgeschnitten hatte. Ruslan war hinter etwas her, das nur Séverin ihm geben konnte: Kontrolle über die Lyra. Wurde sie außerhalb des geweihten Tempels gespielt, brachte sie Zerstörung. Innerhalb jedoch konnte sie die göttliche Macht anzapfen.
Inzwischen wusste Séverin genau, wo sich dieser Tempel befand: auf Poveglia, der Pestinsel.
Er hatte schon früher von der Insel bei Venedig gehört. Im achtzehnten Jahrhundert war dort ein Lazarett für Pestkranke errichtet worden, und man erzählte sich, der Boden bestünde mehr aus Knochen denn aus Erde. Einmal hätte ihn und seine Freunde beinahe eine Akquisitionsmission dorthin verschlagen, hätte Enrique nicht vehement protestiert.
»Der Haupteingang zum Tempel liegt unter der Insel Poveglia versteckt«, hatte die Matriarchin ihm anvertraut. »Weitere Zugänge gibt es überall auf der Welt, allerdings wurden die Karten vernichtet. Es existiert nur noch eine, und Ruslan wird wissen, wo er suchen muss.«
»Aber die anderen …«, hatte Séverin eingeworfen, unfähig, die Bilder auf der Mnemoscheibe aus seinem Kopf zu verbannen.
»Ich schicke sie hinter dir her«, sagte die Matriarchin und packte ihn bei den Schultern. »Ich habe mich hierauf vorbereitet, seit deine Mutter mich gebeten hat, dich zu beschützen. Deine Freunde werden alles Nötige haben, um der Karte auf die Spur zu kommen.«
Es dauerte einen Moment, bis Séverin begriff, was das bedeutete.
»Du weißt es«, entgegnete er wütend. »Du weißt, wo die Karte ist, die zum Eingang des Tempels führt. Du sagst es mir bloß nicht.«
»Das kann ich nicht. Es laut auszusprechen, wäre zu gefährlich. Selbst in meinem Refugium findet sich nur ein versteckter Hinweis darauf. Wenn die anderen scheitern, musst du Ruslan die Information entlocken und ihn dann loswerden. Er wird nichts unversucht lassen, um sich an deine Fersen zu heften.«
»Ich …«
Die Matriarchin folgte seinem Blick zu der ausgeschalteten Mnemoscheibe. Séverin konnte das Bild seiner Freunde einfach nicht verscheuchen: Laila auf Knien, der die Haare wirr ins Gesicht fielen. Enrique, blutend auf dem Eis. Zofia, die Hände so fest in den Stoff ihrer Kleider gekrallt, dass die Knöchel weiß hervortraten. Nicht einmal Hypnos, der noch immer hinter Séverin auf dem Boden lag und schlief, wäre sicher, wenn Ruslan seinen Plan in die Tat umsetzte. Ein kalter, grausamer Klumpen bildete sich in Séverins Magen.
»Wie willst du sie beschützen?«, fragte die Matriarchin.
Séverin dachte an seine kleine Familie, besonders an Laila. Laila mit ihrem warmen Lächeln, ihrem nach Zucker und Rosenwasser duftenden Haar und ihrem Körper … der ihrer Seele in elf Tagen schon kein Zuhause mehr sein würde. Sie hatte ihm nie erzählt, wie wenig Zeit ihr noch blieb, und jetzt …
Die Matriarchin fragte ihn erneut, diesmal mit mehr Nachdruck: »Was willst du tun, um sie zu beschützen?«
Damit hatte sie ihn aus seiner Schockstarre gerissen.
»Alles«, hatte er geantwortet.
Nun, auf dem Marmor vor Ruslans Domizil, trug Séverin eine möglichst unbewegte Miene zur Schau. Er hatte keinen blassen Schimmer, was der kniende Mann mit dem Gebäude zu tun haben oder inwiefern er ihnen Zutritt gewähren könnte. Daher wählte er seine Worte mit Bedacht.
»Stimmt. Er sollte sich geschmeichelt fühlen.«
Der Mann schluchzte auf, sodass Séverin ihn schließlich genauer betrachtete. Eigentlich handelte es sich nicht um einen Mann, sondern vielmehr um einen Knaben unter zwanzig, wahrscheinlich jünger als Séverin. Er war bleich, hatte blaue Augen und aschblonde Haare. Seine Beine waren dünn wie die eines Fohlens, und aus dem obersten Knopf seines Hemds ragte eine Blüte. Séverin spürte einen Kloß im Hals. Diese Augen, die Haare, die Blume … All das war zwar nur eine schwache Kopie, trotzdem kam es ihm kurz so vor, als würde Tristan vor ihm knien.
»Mein Vater verstand diese Welt wie kaum ein Zweiter«, sagte Ruslan.
Je länger Séverin den Jungen musterte, umso drängender beschlich ihn der Verdacht, dass die unheimliche Ähnlichkeit mit Tristan kein Zufall sein konnte. Es juckte ihm in den Fingern, den Jungen loszubinden und ihn in das übel riechende Wasser zu stoßen, damit er Ruslan entkam – was auch immer der mit ihm vorhatte.
Ruslan sprach weiter: »Vor allem verstand er, dass man für alles Opfer bringen muss.«
Seine Hand schoss vor, ehe Séverin reagieren konnte. Er biss sich auf die Zunge und schmeckte Blut. Nur das hielt ihn davon ab, loszustürzen und den Jungen aufzufangen, als seine Augen sich weiteten und er zusammensackte. Blut ergoss sich aus seiner aufgeschlitzten Kehle über den Marmor. Ruslan blickte auf ihn hinunter. Das Messer in seiner Hand glänzte dunkelrot. Wortlos reichte er es einem seiner Gefolgsmänner.
»Daher sind Opfergaben ein wesentlicher Baustein unseres Familiensitzes«, erklärte Ruslan ungerührt. »Vater wusste seit jeher, dass wir dazu bestimmt sind, Götter zu werden … und Götter verlangen Opfer. Deswegen nannte er dieses Gebäude auch Casa D’Oro Rosso.«
Haus des roten Goldes.
Kaum versickerte der Lebenssaft im Boden, veränderte sich das bescheidene, unscheinbare Heim. Das blasse, durchscheinende Mosaik vor dem Eingang überzog sich mit einem rötlichen Schimmer. Tupfer aus sattem Rubinrot und kirschdunklem Granat sprenkelten die Steine und hoben sich von dem nun leuchtend hellrosa Quarz ab. Ein dekoratives geometrisches Muster entstand. Träge breitete sich die Farbe weiter aus, bis schließlich auch die helle Tür errötete. Schnörkel aus Eisen und dunklem Gold krochen empor, fraßen sich durch das geschmiedete Holz und offenbarten ein riesiges Portal. Mit einem Schwung öffnete es sich.
Ruslan deutete auf den Mosaikboden. »Wenn ich mich recht entsinne, sind die Einlegearbeiten im kosmatesken Stil gehalten. Wunderschön, nicht wahr?«
Doch Séverin konnte den Blick nicht von dem Leichnam lösen, dessen warmes Blut in der kalten Luft dampfte. Bei der Erinnerung an Tristans Blut, das ihm damals über die Haut geströmt war, wurden seine Hände feucht. Die Stimme der Matriarchin hallte durch seinen Kopf: Er wird dich auf die Probe stellen, bevor er dir sein Vertrauen schenkt.
Séverin schluckte und lenkte seine Gedanken zu Hypnos und Laila, Enrique und Zofia. Sie bauten darauf, dass er sie zum Tempel unter der Insel Poveglia führte. Seine Anweisungen auf dem Mnemospion, den er neben der bewusstlosen Laila zurückgelassen hatte, waren unmissverständlich: In fünf Tagen würde er am vereinbarten Treffpunkt in Venedig auf sie warten. Bis dahin sollten sie die Hinweise der Matriarchin entschlüsseln und herausfinden, wo die Karte versteckt war. Schafften sie es nicht, musste er Ruslan dieses Wissen entlocken und ihn loswerden.
»Wunderschön, in der Tat«, bestätigte Séverin. Er hob die Augenbrauen und rümpfte die Nase. »Aber der Blutgeruch verträgt sich nicht besonders gut mit dem fauligen Gestank aus den Kanälen. Gehen wir, bevor es uns den Appetit verdirbt. Schon bald werden uns erlesenere Opfergaben vergönnt sein.«
Ruslan lächelte und bedeutete ihm einzutreten.
Séverins Finger zuckten. Er drückte den Daumen in die unnachgiebigen schimmernden Saiten der Göttlichen Lyra. Prompt fiel ihm wieder ein, wie es war, wenn sein Blut damit in Berührung kam. Es fühlte sich an, als pulsierte das Universum in ihm. Seine Hände waren imstande, die Tore zu göttlichen Gefilden aufzustoßen.
Jetzt war es nur noch eine Frage von Tagen, bis aus Séverin Montagnet-Alarie ein Gott wurde.
Laila
Laila hatte sich nie einsamer gefühlt.
Die Grotte verströmte eine brennende Kälte. Eiszapfen lagen zersplittert auf dem Boden, und der unheimliche bläuliche Schimmer der frostigen Wände wurde nur durchbrochen von den regenbogenfarbenen Schwaden, die aus den kaputten Flügeln der Mnemomotte aufstiegen. Ihr schnürte sich die Kehle zu. Sie umklammerte den Diamantanhänger fester und zuckte zusammen, als sich die spitzen Kanten in ihre Haut bohrten.
Seit sie den Mnemospion zertrümmert hatte, hatte sie sich nicht gerührt. Nicht ein einziges Mal.
Stattdessen starrte sie auf die leblosen Körper von Enrique und Zofia, die kaum drei Meter vor ihr auf dem Eis ruhten. Sie wollte sich nicht von ihnen entfernen, traute sich aber auch nicht näher heran. Sobald sie sie anfasste … sobald sie ihnen die Augen schloss, um den Tod nach tiefem Schlaf aussehen zu lassen, würde sie die dünne Hülle des Traums durchbrechen. Eine Berührung, und dieses Grauen würde bittere Realität werden. Das durfte nicht passieren. Die Wahrheit durfte ihr Herz nicht erreichen: Séverin hatte sie alle umgebracht.
Er hatte Enrique und Zofia erstochen. Und Hypnos womöglich auch. Armer Hypnos, dachte Laila. Hoffentlich hatte Séverin ihn von hinten erwischt. Hoffentlich hatte er nicht mitbekommen, wie ihn ausgerechnet der Mensch verriet, nach dessen Zuneigung er sich am meisten gesehnt hatte.
Séverin wusste nur zu gut, dass er Laila dieses Schicksal nicht aufzuerlegen brauchte. Er hätte ihr nichts antun können, was die Zeit nicht ohnehin regeln würde. Als sie blinzelte, hatte sie ihn sofort wieder vor sich, wie er mit kalten violetten Augen auf sie herabschaute, während er das Messer an seinem Mantel abwischte. Sie stirbt so oder so bald.
Ihr Granatring blitzte auf. Die Zahl, die auf dem Juwel prangte, war nicht zu übersehen: 11. Mehr blieb ihr nicht. Elf Tage, bis die Schmiedekunst, die sie am Leben hielt, aus ihrem Körper schwinden und ihre Seele mitnehmen würde.
Wahrscheinlich hatte sie es nicht anders verdient.
Sie war zu schwach gewesen, hatte zu leicht verziehen. Nach allem, was geschehen war, hatte sie geduldet – nein, sogar gewollt –, dass er sie an sich zog und die Pausen zwischen ihren Herzschlägen mit Küssen füllte. Vielleicht war es ein Segen, dass er die Göttliche Lyra nicht gespielt hatte. Denn wie sollte sie ihr Dasein in dem Wissen fristen, ein Monster genährt zu haben?
Monster statt Majnun.
Dennoch verzweifelte der selbstsüchtige Teil in ihr beim Gedanken daran, wie greifbar das Leben gewesen war. Sie hatte die rettenden Saiten schon unter ihren Fingern gespürt, doch es war ihr nicht gelungen, sie zum Klingen zu bringen.
Séverin war grausam genug, ihr das alles noch einmal vor Augen zu führen. Warum sonst hätte er ihr den Mnemospion hinlegen sollen, zusammen mit einem der Diamanten, mit denen er sie vorher zu sich zitiert hatte? Laila schlug die Mnemomotte erneut aufs Eis und sah zu, wie die Erinnerungen in den Flügeln – welche es auch sein mochten – mit einem Seufzen erloschen. Wieder und wieder drosch sie damit auf den Boden ein, vom heftigen Verlangen gepackt, jedes Andenken an Séverin zu zerstören. Ein seltsam ersticktes Lachen befreite sich aus ihrer Kehle. Weitere bunte Rauchschwaden stiegen auf und verdichteten sich zu einem Nebel, der die Grotte um sie herum verschwimmen ließ.
Während sie durch den Schleier starrte, regte sich etwas auf dem Eis.
Entsetzt wich Laila zurück. Das war bestimmt Einbildung. Es musste Einbildung sein!
Offenbar hatte Séverin sie in den Wahnsinn getrieben, denn vor ihren Augen erwachten Enrique und Zofia plötzlich wieder zum Leben.
Zofia
Zofias Ohren klingelten schrill. Ihr Mund war ganz trocken, und ihre Augen tränten. Zu allem Überfluss war ihre Bluse mit klebriger Himbeer-Kirsch-Marmelade beschmiert – und die mochte sie gar nicht. Langsam nahm sie ihre Umgebung wahr. Sie war noch immer in der Grotte. Um sie herum lagen Splitter von Eiszapfen. In dem ovalen Becken war keine Spur mehr von David, dem mechanischen Leviathan, die Wasseroberfläche war spiegelglatt. An der Stelle, wo sie Laila zuletzt gesehen hatte, stiegen bunte Rauchschwaden auf …
Laila.
Panik übermannte Zofia.
Was war mit Laila geschehen?
Allmählich fiel ihr alles wieder ein. Ruslan hatte sie belogen und bloß so getan, als wäre er ihr Freund. Er hatte Laila brutal gestoßen und von ihr verlangt, die Göttliche Lyra zu spielen. Bis sich herausstellte, dass nicht sie diejenige war, die das vermochte, sondern Séverin. Séverin, der mit dem Messer in der Hand auf Zofia zugekommen war. Er hatte sie gepackt und geflüstert: »Vertrau mir, Phönix. Goliaths Gift wird dich nur für ein paar Stunden lähmen. Ich bringe alles in Ordnung.« Sie hatte nicht einmal Zeit gehabt zu nicken, bevor alles dunkel geworden war.
Durch den bunten Nebel stürzte jemand auf sie zu. Das Licht in der Grotte schmerzte ihr in den Augen, was ihr die Sicht auf die Gestalt erschwerte. Sie wollte schützend die Hände hochreißen, doch die waren gefesselt. Ging es Enrique gut? Wo war Séverin? Hatte irgendjemand in Paris daran gedacht, Goliath zu füttern?
»Du lebst!«, rief die Gestalt aus und ließ sich vor ihr auf die Knie fallen. Laila schlang die Arme um Zofia. Ihr Körper wurde von Schluchzern geschüttelt, und dann, unerklärlicherweise, von Gelächter. Normalerweise mochte Zofia Umarmungen nicht besonders, aber ihre Freundin schien diese hier zu brauchen, also hielt sie still.
»Du lebst«, wiederholte Laila. Sie lächelte unter Tränen und entfernte den unangenehmen Knebel aus Zofias Mund.
Zofia brachte kaum ein Krächzen zustande. »Natürlich. Warum?«
Schließlich sollte sie ja nur für einige Stunden gelähmt sein. Davon starb man doch nicht gleich.
»Ich dachte, Séverin hätte dich umgebracht.«
»Weshalb sollte er so etwas tun?«
Zofia betrachtete Lailas Gesicht. Die salzigen Spuren auf den Wangen zeugten von Kummer. Ihr Blick fiel auf den Granatring, und sie erstarrte. Séverin hatte sich geweigert, die Lyra zu spielen, die Lailas Leben hätte retten sollen. Und der einzige logische Grund dafür war, dass die Lyra Lailas Leben nicht retten konnte. Aber was würde dann aus ihr werden? Es waren nur noch elf Tage, bis ihr Körper sie im Stich lassen würde.
»Die Lähmung war Teil seines Plans«, fuhr sie fort.
Über Lailas Miene huschten mehrere Gefühlsregungen: Erleichterung, Schmerz und schließlich … Verwirrung. Plötzlich erregte ein gedämpftes, aber unüberhörbares Stöhnen Zofias Aufmerksamkeit. Den Kopf zu drehen, kostete sie einige Anstrengung – sie hatte schreckliche Nackenschmerzen. Neben ihr rappelte sich Enrique langsam hoch. Rasch löste Laila auch seinen Knebel und die Fesseln um seine Handgelenke. Bei seinem Anblick, quicklebendig und mit gerunzelten Brauen, wurde es Zofia warm ums Herz. Sie musterte ihn. An seinem Hals klebte getrocknetes Blut, und ihm fehlte ein Ohr. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wie er es verloren hatte. Nur Schreie waren ihr im Gedächtnis geblieben. Zu jenem Zeitpunkt war sie in Gedanken fieberhaft verschiedene Optionen für eine Flucht durchgegangen.
»Was ist mit deinem Ohr passiert?«, fragte sie deshalb.
Enriques Hand schoss zur Wunde. Dann zuckte er zusammen und starrte sie an. »Ich wäre fast gestorben, und deine erste Frage gilt meinem Ohr?«
Laila fiel ihm um den Hals, ehe sie einen Schritt zurücktrat.
»Ich verstehe das alles nicht. Ich dachte …«
Aus dem ovalen Becken drang ein Gluckern. Wie auf Kommando fuhren die drei herum. Das Wasser schäumte. Eine metallene Kapsel durchbrach schwungvoll die Oberfläche und schlitterte über den Eisboden. Zofia erkannte die Rettungskapsel aus Davids Bauch wieder. Das Gefährt hatte die Form eines Fischs und war mit ein paar Bullaugen versehen. Dort, wo man eine Schwanzflosse vermuten würde, befand sich eine Art Schiffsschraube. Es dampfte und zischte, als ein Teil der Wand aufklappte.
Heraus trat Hypnos, noch immer in dem Brokatanzug von der vorabendlichen Mitternachtsauktion, und winkte fröhlich grinsend. »Hallöchen, mes chers!«
Dann stutzte er. Sein Blick glitt über Lailas verwirrte Miene, Enriques blutverkrusteten Hals und Zofias gefesselte Hände zu den farbigen Nebelschwaden über dem Eis. Erst jetzt bemerkte Zofia dort die Überreste eines zerschmetterten Mnemospions.
Hypnos’ Grinsen erlosch.
SIEBENUNDACHTZIGSEKUNDENSPÄTER hatte Hypnos die Sprache immer noch nicht wiedergefunden. Enrique beendete gerade seinen Bericht darüber, wie Séverin Zofias und seinen Tod vorgetäuscht hatte, und Laila ergänzte knapp, dass er daraufhin mit Ruslan und der Lyra verschwunden war. Hypnos schlang sich die Arme um den Oberkörper und starrte weitere sieben Sekunden zu Boden, bevor er schließlich den Kopf hob. Er schaute Laila an.
»Du stirbst?« Seine Stimme brach.
»Sie stirbt nicht«, erwiderte Zofia scharf. »Ihr Tod hängt von bestimmten Variablen ab, die wir ändern werden.«
Laila schenkte ihr ein Lächeln und nickte leicht. Seit Hypnos’ Ankunft hatte sie wenig gesagt, ihn kaum angesehen. Ihr Blick war zwischen ihrem Ring und dem zerstörten Mnemospion auf dem Eis hin- und hergehuscht.
»Die Lyra funktioniert nicht so, wie wir angenommen haben«, erläuterte Enrique. »Erinnert ihr euch an die Inschrift? Das Spiel mit dem göttlichen Instrument wird das Geschehene ungeschehen machen. ›Ungeschehen machen‹ bezieht sich auf alles Geschmiedete – es sei denn, man spielt die Lyra an einem besonderen Ort. Nur wissen wir nicht genau, wo –«
»Irgendwo unterhalb von Poveglia, einer der Inseln in der Nähe von Venedig«, unterbrach ihn Hypnos.
»Poveglia?« Enrique erbleichte.
Zofia runzelte die Stirn. Diesen Namen hatte sie schon einmal gehört. Es war lange her, aber Séverin hatte von Poveglia gesprochen. Die Pestinsel, so hatte er sie genannt. Beinahe hätten sie eine Akquisitionsmission angenommen, die sie dorthin geführt hätte. Doch schlussendlich hatten sie sich dagegen entschieden. Enrique war damals sehr erleichtert gewesen. Ihm behagten Grabstätten gar nicht. Zofia erinnerte sich gut an den Streich, den Tristan ihm gespielt hatte, während sie das Für und Wider abwogen: Schlingpflanzen, die sich um Enriques Knöchel gewunden hatten. Enrique hatte das überhaupt nicht witzig gefunden.
»Die Matriarchin hat es mir verraten«, fuhr Hypnos hastig fort. »Sie meinte, dort liege der einzige noch bekannte Eingang zu einem Tempel – dem Ort, den wir suchen. Die Karten zu den übrigen Eingängen seien verloren gegangen. Ich kenne die Tezcat-Routen nach Italien. Wir könnten schon heute Abend in Venedig sein, wo ein geheimer Unterschlupf der Matriarchin auf uns wartet. Angeblich inklusive aller Antworten, die wir brauchen, und Informationen über die letzte verbleibende Karte zum Tempel. Allerdings müssen wir dieses Refugium erst finden.«
»Und wie?«, fragte Enrique.
»Sie hat mir einen Hinweis gegeben, der uns zum Schlüssel und der zugehörigen Adresse führt. Sobald wir uns eingerichtet haben, können wir uns auf die Suche nach der Karte machen. Auf der Mnemomotte hat Séverin uns Anweisungen hinterlassen, wo wir …«
Hypnos’ Blick huschte zu dem lädierten Mnemospion.
»… ihn treffen sollen«, schloss er lahm. Mit großen Augen schaute er Laila an. »Ich verstehe einfach nicht, wieso du das Ding gleich zerschmettern musstest.«
Lailas Miene verdüsterte sich, und ihre Wangen färbten sich dunkler. »Er hat Zofia erstochen, und danach Enrique, und ich dachte, er … er …«
Hypnos’ Augenbrauen schossen in die Höhe. »Wie konntest du nur glauben, Séverin würde uns ernstlich nach dem Leben trachten?«
»Ähm, weil er den Verstand verloren hat und sein aktueller Plan darin besteht, uns alle zu Göttern zu machen?«, warf Enrique ein.
Er fasste sich an das verstümmelte Ohr und verzog das Gesicht. Laila hatte inzwischen Streifen ihres Kleids abgerissen und ihm damit fast den gesamten Kopf einbandagiert. Zwar blutete Enrique nicht mehr, doch Zofia fiel auf, dass er blasser wirkte. Offenbar hatte er Schmerzen. Sie wusste nicht, wie sie ihm helfen sollte, und das frustrierte sie.
»Aber wenn Madame Desrosiers dir von dieser Karte erzählt hat, kann sie uns doch auch einfach erklären, wo sie zu finden ist«, bemerkte Enrique.
Hypnos’ Mundwinkel und Schultern sackten nach unten.
»Sie … sie ist mit dem Leviathan untergegangen.«
Laila schnappte nach Luft und schlug sich die Hand vor den Mund. Enrique verstummte. Zofia senkte den Kopf. Sie wusste, dass ihre Gedanken jetzt eigentlich bei der Matriarchin sein sollten – und ihr Tod betrübte sie auch aufrichtig –, dennoch schweiften sie ab, zu Hela. Zaghaft berührte sie die Stelle über ihrem Herzen, wo die spitze Ecke von Helas letztem, ungeöffnetem Brief ihr in die Haut pikte. Sie besaß das Kuvert nun schon seit einer Weile, aber die Handschrift darauf war nicht die ihrer Schwester. Und wenn Hela ihr nicht selbst hatte schreiben können, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie nicht länger lebte. Allein die Vorstellung von Helas möglichem Tod schmerzte unendlich viel mehr als der tatsächliche Tod der Matriarchin. Zofia spürte die vertraute Panik in ihrer Brust aufsteigen. Sie tastete nach ihrer Streichholzschachtel, doch die war nicht da. Also ließ sie den Blick durch die Grotte huschen, auf der Suche nach Dingen, die sie zählen konnte, um ihr Gleichgewicht wiederzuerlangen – zwölf Eiszapfen, sechs zerklüftete Risse im Eis, drei Schilde, vier Blutlachen auf dem Boden –, aber Hypnos und Enrique sprachen lautstark weiter.
»Was machen wir denn jetzt?«, fragte Hypnos. »Ohne den Mnemospion haben wir keinen blassen Schimmer, wie wir Séverin finden sollen, ganz zu schweigen von der Karte.«
»Wir brauchen Séverin nicht«, entgegnete Enrique frostig.
Hypnos hob ruckartig den Kopf. »Pardon?«
»Du hast es selbst gesagt: Der Unterschlupf der Matriarchin hält alle Antworten für uns bereit.«
»Aber … die Lyra …« Hypnos schielte zu Laila.
»Séverin trachtet nach Göttlichkeit.« Um Enriques Mundwinkel lag ein bitterer Zug. »Er wird in jedem Fall zur Pestinsel aufbrechen, ob wir nun dabei sind oder nicht. Spätestens dort werden wir also auf ihn stoßen. Und er kann die Lyra spielen und Laila retten. Für mehr brauchen wir ihn nicht. Danach müssen wir ihn nie wiedersehen.«
»Aber was soll er denken?«, wandte Hypnos leise ein. »Bevor wir uns getrennt haben, hat er mir gesagt, dass er uns um jeden Preis beschützen will …«
Enrique mahlte mit den Zähnen. Sein Blick wanderte übers Eis, dann zurück zu Hypnos. Er hatte die Brauen zusammengezogen, was auf Wut hindeutete.
»Das Einzige, wovor wir beschützt werden müssen, ist er selbst.«
Beschützen. Das hieß, jemanden vor übler Einwirkung bewahren, Gefahren ausschließen oder abwehren, und war wohl verwandt mit dem Wort »schütten«, wie Enrique einmal erklärt hatte. Wie wenn man Erde zu einem Schutzwall aufschüttete. Erneut legte Zofia sich die rechte Hand aufs Herz, dorthin, wo der Brief versteckt war. Wenn sie alle Möglichkeiten realistisch abwog, warum Hela ihn nicht selbst geschrieben hatte, kam im Grunde nur eine infrage: Es musste die offizielle Nachricht von ihrem Tod sein. Hela war monatelang krank gewesen. Schon einmal war sie fast gestorben. Zofia hatte ihre Schwester nicht beschützen können … aber für Laila war es noch nicht zu spät.
Zofia zwang sich, dem Gespräch der anderen wieder zu folgen. Sie redeten über Tezcat-Routen, die sie nach Venedig bringen würden, und darüber, dass die Mitglieder des Ordens noch immer durch Ewas Blutschmiedekunst gelähmt waren, die Wirkung allerdings nicht mehr allzu lange andauern würde. Demnach hatten sie nur wenig Zeit, wenn sie nicht riskieren wollten, festgehalten zu werden. Zofia musste sich also beeilen, ihre Kette wiederzufinden, bevor sie aufbrachen. Sie brachte es kaum fertig, weiter zuzuhören.
Stattdessen starrte sie auf den Granatring an Lailas Hand: 11.
Ihr blieben noch elf Tage, um Laila zu beschützen. Wenn ihr das gelang, fiel es ihr möglicherweise leichter, den Brief zu öffnen und Helas Schicksal zu erfahren. Bis dahin würde sie den Umschlag geschlossen lassen. Was sie nicht sah, wusste sie nicht, und solange sie es nicht wusste, bestand noch eine Chance – eine statistisch betrachtet sehr geringe, aber doch relevante –, dass Hela nicht gestorben war. Zofia klammerte sich an die Sicherheit der Zahlen: elf Tage, um Laila zu helfen, elf Tage, in denen sie hoffen konnte, dass Hela am Leben war.
Hoffnung, so stellte Zofia fest, war der einzige Schutz, den sie noch hatte.
Laila
Laila duckte sich in den Schatten einer engen, von beiden Seiten durch Backsteinmauern begrenzten Gasse und zog das Tuch zurecht, das Haare und Gesicht bedeckte. Aus den Müllhaufen um sie herum drang das Miauen und Fauchen von Straßenkatzen. Nach dem siebten Tezcat-Portal hatte sie die Orientierung verloren. Doch wo auch immer sie gerade waren, es war früher Nachmittag, und vom Meer wehte der Gestank nach Fischkadavern herüber. Vor ihr stand Hypnos, eine Hand auf die schmutzige Mauer gelegt, daneben Zofia, die einen Tezcat-Anhänger in die Höhe hielt. Zofias Kette war das einzig Nützliche, was sie dabeihatten. Zum Glück hatten sie sie vor ihrem hastigen Aufbruch wiedergefunden. Ihre Laborausrüstung, Enriques Aufzeichnungen und Lailas Kleider hingegen hatten sie im Schlafenden Palast zurücklassen müssen.
Der Anhänger leuchtete hell, was auf ein verstecktes Portal hindeutete.
»Das hier dürfte das letzte sein.« Hypnos lächelte angestrengt. »Laut der Matriarchin führt es geradewegs zur Rialtobrücke. Ist das nicht fantastisch?«
»Unter ›fantastisch‹ verstehe ich etwas anderes«, entgegnete Zofia.
Ihr blauer Rock war angesengt, ihre Frisur hatte sich aufgelöst, und die blonden Haare umgaben ihren Kopf wie ein Heiligenschein. Neben ihr betastete Enrique vorsichtig die blutbefleckte Bandage an seinem Ohr. Plötzlich flitzte eine fette Kakerlake über Lailas dreckverkrustete Schuhe. Angeekelt zuckte sie zurück.
»Fantastisch wäre es, wenn auf der anderen Seite ein heißes Bad und ein narrensicherer Plan auf uns warten würden«, sagte Enrique. »Aber wir wissen ja nicht mal, wo sich das Refugium befindet.«
»Immerhin haben wir den Hinweis«, meinte Hypnos und wiederholte die Worte der Matriarchin: »Auf einer Insel, der Toten Statt, ruht ein Gott, der nicht ein Haupt hat. Welche Summe seht ihr hier? Die Antwort führt euch flugs zu mir.«
»Aber wir haben nicht die geringste Ahnung, was das bedeutet«, gab Enrique zu bedenken.
Hypnos kniff die Lippen zusammen. »Mit mehr kann ich nicht dienen, mon cher. Damit müssen wir uns wohl begnügen. Ich werde jetzt überprüfen, ob das hier die richtige Route ist. Zofia, kommst du mit? Möglicherweise benötige ich deine originelle Kette.«
Zofia nickte, und Hypnos presste die Hand auf einen Stein in der Mauer. Sein Babelring – ein grinsender Halbmond, der sich über drei Finger erstreckte – glühte schwach. Einen Augenblick später traten die beiden durch die Wand und verschwanden.
Laila starrte auf das Tezcat-Portal. Ein verzweifeltes Lachen stieg in ihr auf. Bei ihrem Aufbruch aus dem Schlafenden Palast hatte sie sich noch der Illusion hingegeben, sie könnten das Blatt zum Guten wenden. Als Hypnos ihnen aber zum ersten Mal den »Hinweis« der Matriarchin verraten hatte, war Laila klar geworden, wie verloren sie waren. Selbst wenn sie es bis Poveglia schafften, was dann? Sie hatten keine Ausrüstung, keine Informationen, keine Waffen, keine Wegbeschreibung … und keinen Treffpunkt mit Séverin.
Sie schloss die Augen, als könnte sie so heraufbeschwören, was der Mnemospion ihr hätte zeigen sollen. Sie sah Séverin, wie er sich mit kühlem, düsterem Blick von ihr abwandte. Ein schwacher Abdruck ihres Lippenrots – eine Spur ihrer nächtlichen Küsse – lugte unter dem Hemdkragen hervor. Laila riss die Augen wieder auf und verdrängte die Bilder.
Sie hasste Séverin. Er hatte zu sehr darauf gesetzt, dass sie ihm bedingungslos vertraute. Hatte angenommen, sie könnte sich eine Welt, in der er Enrique oder Zofia Leid zufügte, nicht vorstellen. Dabei hatte er jedoch unterschätzt, wie überzeugend er seine Gleichgültigkeit zur Schau getragen hatte. Laila hörte ihn fast sagen: Du kennst mich doch. Aber das stimmte nicht. Sie kannte ihn kein bisschen. Das schlechte Gewissen nagte an ihr. Bei jedem Wimpernschlag tauchten die zersprungenen Flügel der Mnemomotte wieder vor ihr auf, und sie fragte sich, wie weit ihr Wutausbruch sie alle in ihrer Suche wohl zurückgeworfen hatte.
Laila schob die Gedanken an Séverin beiseite und konzentrierte sich auf die Gasse und Enrique. Der schaute mit verschränkten Armen wütend in die Ferne.
»Bist du böse auf mich?«
Sein Kopf ruckte hoch. Entsetzt sah er sie an. »Nein, natürlich nicht.« Er trat näher. »Wie kommst du darauf?«
»Wenn ich den Mnemospion nicht kaputt gemacht hätte …«
»Ich hätte dasselbe getan«, presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Laila, ich verstehe sehr gut, was du in dem Moment gefühlt hast … wie es ausgesehen haben muss …«
»Selbst wenn –«
»Selbst wenn!«, unterbrach er sie entschieden. »Uns bleiben noch andere Möglichkeiten. Was ich vorhin gesagt habe, war ernst gemeint: Wir brauchen Séverin nicht. Wir finden auch ohne ihn einen Weg.«
Er ergriff ihre Hand. Sie schauten hinauf in den Himmel, und für einen Augenblick vergaß Laila die bleierne Schwere des Todes in ihren Knochen. Sie betrachtete die hohen Backsteinmauern. Offenbar trennte ein Wall die Stadt vom Meer. Sie hörte die lärmende Betriebsamkeit eines Marktes und das Gewirr fremder Sprachen. Der Duft frisch gebackenen Brotes, vermischt mit Honig und Gewürzen, schwängerte die Luft und vertrieb den fauligen Gestank der See.
»Die Pestinsel«, sagte Enrique auf einmal leise. »Erinnerst du dich an den Streich, den Tristan mir gespielt hat? Wir haben darüber diskutiert, ob wir die Akquisitionsmission dort annehmen sollen oder nicht. Er wusste, dass mir nicht ganz wohl dabei war – bei all dem Gerede von menschlichen Überresten im Boden.«
»Nicht ganz wohl?«, neckte Laila, und ein leichtes Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht. »Du hast geschrien wie am Spieß, als Tristans Ranken deine Knöchel gepackt haben. Die Hälfte der Gäste dachte, im Salon des L’Éden wäre jemand ermordet worden.«
»Er hat mir aber auch einen Riesenschrecken eingejagt.« Enrique schauderte.
Laila konnte nicht anders, als zu grinsen. Die Erinnerung hätte einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen müssen, stattdessen versüßte sie ihr die Stimmung. Tristans Tod fühlte sich inzwischen nicht mehr an wie eine frische Wunde, eher wie ein verblassender blauer Fleck. Mit jedem Tag tat die Berührung weniger weh.
»Das kann ich mir vorstellen«, erwiderte sie sanft.
»Ich finde Grabstätten verstörend«, sagte Enrique und bekreuzigte sich hektisch. »Und eigentlich …«
Jäh brach er ab, seine Augen weiteten sich. Beinahe im selben Moment traten Hypnos und Zofia wieder durch das Tezcat-Portal. Hinter ihnen führte ein langer steinerner Gang zu einem Marktplatz. Über den Fischständen kreisten Möwen, und weiter entfernt konnte man eine weiße Brücke erkennen.
»Enrique? Was ist los?«, fragte Laila.
»Ich … ich glaube, ich weiß, wo wir nach dem Schlüssel für das Refugium suchen müssen«, antwortete er. »Auf einer Insel, der Toten Statt … Damit ist bestimmt die Isola di San Michele gemeint. Vor knapp einem Jahrhundert verfügte Napoleon, dass Venedigs Friedhof aus Hygienegründen auf die Insel ausgelagert wird. Das habe ich an der Universität gelernt. Dort gibt es auch eine einzigartige Renaissancekirche und ein Kloster, das …«
Hypnos klatschte in die Hände. »Na dann, auf, auf, zum Friedhof!«
Enrique runzelte die Stirn.
»Was ist mit dem Rest des Rätsels?«, fragte Zofia.
Laila ging die Worte im Stillen noch einmal durch: Auf einer Insel, der Toten Statt … ruht ein Gott, der nicht ein Haupt hat … Welche Summe seht ihr hier? … Die Antwort führt euch flugs zu mir …
»Ich … Das weiß ich nicht«, gestand Enrique. »Es gibt zahllose Gottheiten mit mehreren Köpfen, vor allem in den asiatischen Glaubenslehren. Und ›Welche Summe seht ihr hier?‹ klingt, als würden wir erst vor Ort mehr erfahren.«
Hypnos’ Lächeln war wie weggeblasen. »Du bist dir also nicht sicher, wonach wir auf dem Friedhof suchen müssen?«
»Na ja. Nein. Nicht so ganz«, erwiderte Enrique.
»Aber du bist dir sicher, was die Isola di San Michele betrifft?«
Pause. »Nein.«
Es wurde still. Für gewöhnlich verliefen ihre Reisen immer im gleichen Takt. Zofia stellte Berechnungen an, Enrique trug sein historisches Wissen bei, Laila las Gegenstände, und Séverin … Séverin ordnete die Erkenntnisse in einen Kontext ein. Wie eine Linse, die etwas in den Fokus rückt.
Wir brauchen ihn nicht, hatte Enrique gesagt.
Glaubte er das wirklich?
Laila musterte ihren Freund: die tiefe Röte auf seinen Wangen, die großen Augen, die gekrümmte Haltung. Er hatte die Schultern hochgezogen, als wollte er sich unsichtbar machen. »Also, ich finde, dieser Ansatz ist besser als keiner.«
Enrique schien verblüfft. Er schenkte ihr ein Lächeln. Doch nach einem Blick auf ihren Granatring, der ihnen vorwurfsvoll entgegenfunkelte, erlosch es prompt wieder. Ohne hinzugucken, wusste Laila, was darauf zu sehen war.
11.
Dennoch baute sie auf ihre Freunde, die sich um ihr Vertrauen verdient gemacht hatten. Sie ergriff Enriques Hand und schaute Zofia und Hypnos an.
»Wollen wir?«
DIEAUSSICHTRAUBTE Laila den Atem, und obwohl ihr nur noch so wenig von der kostbaren Lebensluft blieb, störte es sie nicht. Venedig war wie ein Ort aus einem Kindertraum. Eine auf dem Wasser treibende Stadt in zwei Hälften, an der Naht von Marmorbrücken zusammengehalten, voller halb versunkener Türen, die von Gesichtern grinsender Götter geziert wurden. Wo sie auch hinsah, erlag sie dem Zauber der Lebendigkeit: Entlang des Canal Grande hatten Kaufleute ihre Tische aufgestellt. Über einem davon faltete sich geschmiedete Spitze zu einem Halbmond und brachte ein Kind mit dem Guck-guck-Spiel zum Lachen. Eine Kette aus Buntglasperlen erhob sich von einem Samtkissen und legte sich neckisch um den Hals einer gut gelaunten Aristokratin. Masken, reich verziert mit Blattgold und Perlen, schwebten majestätisch an ihnen vorüber, nachdem die Mascareri ihr Werk vollbracht und sie in die Luft entlassen hatten.
»Wenn wir zur Isola di San Michele wollen, brauchen wir ein Boot«, sagte Enrique.
Hypnos kehrte seine Taschen bedauernd auf links. »Und womit bezahlen wir?«
»Überlasst das mir«, erwiderte Laila.
Raschen Schrittes ging sie am Kai entlang. Sie raffte eine schwarze Stola an sich, die unbeaufsichtigt über einem Hocker hing. Eine Erinnerung an die warmen braunen Hände, die sie gestrickt hatten, schoss ihr durch den Kopf. Tut mir leid, dachte sie und warf sich die Stola über ihr schmutziges, zerschlissenes Kleid. An einem grünen Seidenband um ihren Hals baumelte ein kleiner bernsteinfarbener Anhänger, der ihre L’Énigme-Tarnung in sich barg. Sie tippte ihn an, und sofort bedeckten Maske und Pfauenkopfschmuck ihr Gesicht. Falls den ebenso Maske tragenden Mascareri-Händlern, an denen sie vorbeilief, etwas auffiel, so sagten sie nichts.
Laila behielt den Kanal im Auge. Der Gang aus hellem istrischen Stein hatte sie direkt neben der Ponte di Rialto ausgespuckt. Die große Brücke sah aus wie eine Mondsichel, die den Himmel verlassen hatte, um die Stadt mit ihrem Antlitz zu schmücken. Gondeln glitten durch das jadegrüne Wasser.
Die Gondolieri, die gerade keine Kundschaft hatten, saßen rauchend auf einer Steintreppe, spielten Schach und schenkten ihr keinerlei Beachtung. Und so betastete Laila ein Boot nach dem anderen und stöberte in deren Erinnerungen …
Beim ersten: ein Mädchen mit einer Blume im Haar, das sanft die Augenlider schließt und sich für einen Kuss vorbeugt.
Beim zweiten: das frustrierte »Mi dispiace …« eines Mannes.
Beim dritten: ein Kind an der Hand seines Großvaters, eingehüllt in Zigarrenrauch.
Und so weiter und so fort, bis …
Laila hielt inne, als sich Stille in ihrem Kopf ausbreitete. Es war die Art von Stille, die nur Schmiedekunst hervorrief.
Sie lächelte.
EINESTUNDESPÄTER betrachtete Laila vom Bug der sich selbst steuernden Gondel aus den perlweißen Mond, der sich schwach über einer Insel in der Ferne abzeichnete. Der kalte Wind im Gesicht wirkte belebend. Wenigstens war ihr ein solches Gefühl noch vergönnt, trotz der stetigen Todesmahnung an ihrer Hand.
Ihr gegenüber waren Enrique und Zofia vollkommen in Gedanken versunken. Enrique starrte hinaus aufs Wasser, während Zofia in Ermangelung von Streichhölzern die angesengten Fransen von ihrem Rocksaum zupfte. Neben Laila auf der gepolsterten Bank saß Hypnos. Er lehnte sich an sie und ließ seinen Kopf auf ihre Schulter sinken. »Ich fürchte, ich werde krank, ma chère.«
»Wie kommst du darauf?«
»Ich sehne mich nach Langeweile, als wäre sie der seltenste Jahrgang eines erlesenen Weins«, antwortete er. »Ist das nicht unerhört?«
Fast hätte Laila gelacht. In der vergangenen Woche hatte sie Reichtümer gesehen, die einem König alle Ehre gemacht hätten, war Zeugin einer berauschenden Macht geworden, die mit nur einem Lied an den Grundfesten der Welt zu rütteln vermochte. Doch das alles war längst nicht so verlockend wie der Luxus, sorglos einen gesamten Tag verschwenden zu können. Wenn sie eine Truhe mit den unvorstellbarsten Schätzen füllen dürfte, befänden sich darin herrliche, sonnendurchflutete Tage und kühle, sternengesprenkelte Nächte, die sie in Gesellschaft ihrer Liebsten vergeuden konnte.
»Ich muss mich bei dir entschuldigen«, fuhr Hypnos fort.
Laila legte die Stirn in Falten. »Wofür?«
»Ich habe mich furchtbar benommen wegen des zerbrochenen Mnemospions.« Er starrte in seinen Schoß. »Obwohl Séverin mein vollstes Vertrauen genießt, hat er das deine offenbar verspielt. Ich weiß nicht, was er Schlimmes zu dir gesagt hat, aber ich versichere dir, es war bloß eine Farce, um dich zu beschützen.«
Erneut machte sich die nunmehr vertraute Taubheit in Laila bemerkbar. »Das ist mir inzwischen auch klar geworden.«
»Und du solltest eins nicht vergessen: Er hat uns zwar alle gern, aber dich –«
»Nicht«, unterbrach sie ihn eisig, bevor sie hinzufügte: »Bitte.«
Ergeben hob Hypnos die Hände und überließ Laila sich selbst. Ihr Blick fiel auf den Ring: 11. Elf Tage, um diese Luft und den Anblick des Himmels in sich aufzusaugen. Egal ob helle Kuppeln von Kathedralen oder ein Flickenteppich aus Gewitterwolken – ihr Verstand labte sich an jedem Bild wie an frisch geschlagener Sahne. Doch das Grübeln über Séverin besudelte all diese Eindrücke mit dunkler Tinte. Er hinterließ düstere Kleckse in ihren Gedanken, hinter denen kaum noch etwas zu erkennen war. Aber er war nicht hier. Und so gab sie sich alle Mühe, nicht an ihn zu denken.
STILL UND VERLASSEN lag die Friedhofsinsel Isola di San Michele da, umgeben von rot-weißen Mauern. Eine Kirche mit einer Kuppel aus hellem istrischen Stein schien direkt auf dem dunklen Wasser der Lagune zu schwimmen. Als die Gondel den Kai erreichte, spreizte eine drei Meter große Schmiedekunststatue des Erzengels Michael die Flügel und hob zur Begrüßung eine Waage in die Höhe. Das bronzene Messgerät schwankte im schneidenden Januarwind, und der Engel durchbohrte sie mit seinen blinden Augen, als würde er schon einmal das Gute und Schlechte in ihnen abwägen. Am Ende eines weißen Kieswegs wiegten sich stattliche Zypressen und wachten über den Eingang ins Reich der Toten.
Als Laila einen Fuß an Land setzte, fegte ein seltsames Gefühl durch ihren Bauch. Eine eigenartige Leere. Einen Moment lang nahm sie weder den Schneegeruch in der Luft wahr noch die Kälte an ihrem Hals. Ihr Körper war wie von ihr abgeschnitten. Wie etwas Lebloses, das sie hinter sich herschleifte …
»Laila!«
Hypnos fing sie auf.
Zofia stürzte zu ihnen. »Was ist passiert?«
»Ich … ich weiß nicht«, sagte Laila.
Ihr Körper fühlte sich so starr an, so still. Ihr Herz schlug träge, als pumpte es sirupartiges Blut.
»Du bist verletzt«, bemerkte Zofia.
»Nein, das ist es nicht. Ich …«
Hypnos hob ihre beringte Hand. Ein Schnitt zog sich quer über die Handfläche. Wahrscheinlich hatte sie sich zu fest an den Holzpfahl der Anlegestelle geklammert.
»Hier.« Zofia riss einen Streifen von ihrem angesengten Saum ab.
Teilnahmslos griff Laila nach der Bandage.
»Du hast eine Menge durchgemacht«, sagte Hypnos sanft. »Wieso wartest du nicht hier in der Gondel? Wir brauchen bestimmt nicht lange. Was meint ihr?«
Enrique stammelte: »I… ich bin mir nicht sicher, aber …« Hypnos musste ihm einen scharfen Blick zugeworfen haben, denn auf einmal nickte er. »Bleib hier und ruh dich aus. Wir kommen zurecht.«
»Hast du Schmerzen?«, fragte Zofia.
»Nein.« Laila starrte abwesend auf die Wunde. Dann scheuchte sie die anderen fort, während ihr Verstand schrie, was sie sich nicht laut auszusprechen traute. Sie hatte Zofia nicht angelogen. Sie spürte keine Schmerzen.
Sie spürte rein gar nichts.
Enrique
Enrique Mercado López wusste viel.
Er kannte sich aus mit Geschichte, Mythen und Legenden und beherrschte mehrere Sprachen. Er verstand sich aufs Küssen, Essen und Tanzen. Und obwohl so manches im Moment ungewiss war, so wusste er doch ohne den Hauch eines Zweifels: In dieser Rolle war er eine Fehlbesetzung.
Und er war nicht der Einzige, dem das klar war.
Ein Stück hinter ihm folgten Zofia und Hypnos, in vielsagendes Schweigen gehüllt. Sie erwarteten von ihm, dass er eine exakte Vorstellung davon hatte, was als Nächstes zu tun war. Dass er sie anführen, Anweisungen erteilen und die weiteren Schritte planen würde … aber das entsprach nicht seinem Wesen.
Dieser Platz steht dir nicht zu, flüsterte eine Stimme in seinem Kopf. Zurück dahin, wo du hingehörst.
Wo er hingehörte.
Doch wo genau das war, konnte er nicht sagen. Als Kind hatte Enrique einmal fürs Schultheater vorgesprochen. Die ganze Nacht hatte er den Text der männlichen Hauptrolle auswendig gelernt. Hatte Spielzeugfiguren als Publikum aufgebaut und seine Mutter so lange angebettelt, bis sie sich erbarmte und die Zeilen des weiblichen Gegenparts übernahm. Aber am Tag des Vorsprechens unterbrach ihn die Nonne, die Regie führen würde, bereits nach zwei Sätzen.
»Anak.« Sie lachte. »Du willst doch nicht den Helden spielen! Viel zu viel Arbeit und so ein Berg Text. Mutterseelenallein im Mittelpunkt zu stehen, in diesem grellen Rampenlicht, ist schrecklich. Vertrau mir. Das ist nichts für dich. Aber sei nicht traurig, ich habe eine ganz besondere Rolle für dich.«
Die »besondere Rolle« hatte sich als Baum entpuppt.
Trotzdem war seine Mutter sehr stolz auf ihn gewesen, und Enrique hatte sich damit getröstet, dass Bäume von großer symbolischer Wichtigkeit waren. Vielleicht konnte er ja beim nächsten Mal die Hauptrolle spielen.
Doch weitere Versuche endeten ähnlich: Enrique nahm an Schreibwettbewerben teil, nur um zu erfahren, dass seine Meinung niemanden interessierte. Wollte er für seinen Debattierklub antreten, taten die anderen seine Ideen meist direkt ab. Wenn nicht, warfen sie einen Blick auf sein Gesicht, in dem sich sowohl Züge der Spanier als auch der Visaya fanden, und letztendlich lief es immer auf das Gleiche hinaus:
Du gehörst nicht dazu.
Als Enrique begonnen hatte, für Séverin als Historiker zu arbeiten, hatte er zum ersten Mal gewagt, etwas anderes zu denken. Es sah aus, als hätte er seinen Platz gefunden. Séverin war der Erste gewesen, der wirklich an ihn geglaubt, ihn ermutigt, ihm Freundschaft angeboten hatte. Bei Séverin schlugen seine Ideen Wurzeln. Mit seiner Karriere als Wissenschaftler ging es steil bergauf. Sogar die Ilustrados, die Gruppe philippinischer Intellektueller, deren Bemühungen eines Tages sein Land verändern könnten, zeigten sich ihm gegenüber aufgeschlossener. Auch wenn er bisher nur am Rande mitwirkte und historische Artikel schrieb, war es mehr, als ihm zuvor je gewährt worden war … und es hatte ihn auf noch mehr hoffen lassen.
Was für ein Narr er doch gewesen war!
Séverin hatte seine Träume gegen ihn verwendet. Er hatte versprochen, dass man Enrique zuhören würde, und ihn dann mundtot gemacht. Er hatte ihre Freundschaft nach seinen Wünschen zurechtgebogen, bis sie zerbrochen war, und Ruslan hatte die Scherben aufgesammelt und zu einer Waffe geformt.
All dies ließ Enrique nun völlig verloren zurück, und zwar ziemlich sicher nicht dort, wo er hingehörte.
Vorsichtig berührte er den Verband über seinem verstümmelten Ohr und zuckte zusammen. Seit sie aus dem Schlafenden Palast aufgebrochen waren, hatte er es vermieden, sich selbst zu betrachten. Doch seinem Spiegelbild in der Lagune vor Venedig hatte er nicht entkommen können. Es wirkte ungleichmäßig, ja regelrecht gebrandmarkt. Zuvor hatte er seine mangelnde Zugehörigkeit wenigstens verschleiern können. Das fehlende Ohr hingegen war nun ein deutliches Zeichen: Seht her, ich bin anders.
Enrique schob diese Gedanken beiseite. Gerade konnte er es sich nicht leisten, sich in Selbstmitleid zu suhlen.
Komm schon … konzentrier dich!
Mit gerunzelter Stirn schaute er sich auf dem Friedhof um. Er maß in der Länge kaum fünfhundert Meter, und inzwischen hatten sie das Areal bereits zweimal vollständig abgeschritten. Nun wanderten sie zum dritten Mal über denselben zypressengesäumten Pfad. Gleich da vorn würde er eine Biegung machen und an einer Reihe Statuen vorbeiführen: Erzengeln, die ihre Schmiedeköpfe drehten, um ihnen nachzusehen. Auf den Gräbern ragten große, kunstvoll gemeißelte Grabsteine aus Granit empor. Viele waren von hohen Kreuzen gekrönt und von geschmiedeten Rosen umrankt, die weder Farbe noch Duft verloren. Die Mausoleen dagegen waren zumindest von außen sehr schlicht, und nichts an ihnen wies auf einen kopflosen oder mehrköpfigen Gott hin.
»Auf einer Insel, der Toten Statt, ruht ein Gott, der nicht ein Haupt hat«, rezitierte Enrique aus dem Gedächtnis. Er zermarterte sich das Hirn. »Welche Summe seht ihr hier? Die Antwort führt euch flugs zu mir.«
»Hast du was gesagt?«, fragte Hypnos.
»Ich? Nein, ich … äh … gehe nur das Rätsel der Matriarchin noch mal auf Hinweise durch.«
»Trotzdem hast du was gesagt«, stellte Zofia fest.
»Na gut, stimmt.« Enrique spürte, wie ihm die Röte in die Wangen stieg. »Was wir suchen, hängt davon ab, wie wir das Rätsel interpretieren. Es ist so vieldeutig.«
Zofia hob eine Augenbraue. »Ich dachte, wir suchen nach einem Gott mit ›nicht einem Haupt‹. Das hört sich recht spezifisch an.«
»Und lässt dennoch Spielraum für eine ganze Palette an Darstellungen«, widersprach Enrique. »Einerseits gäbe es da den chinesischen Gott Xingtian, der weiterkämpfte, nachdem man ihn enthauptet hatte. Oder Ketu, einen personifizierten Planeten im Hinduismus – er entstand aus dem Körper von Rahu, dem man den Kopf abschlug. Andererseits kennt man natürlich auch Götter mit mehreren Häuptern. Was ist wohl wahrscheinlicher? Hm, Gottheiten des Ostens, die venezianische Grabsteine zieren … Das wäre doch eher ungewöhnlich. Es muss also etwas anderes dahinterstecken, etwas nicht so Offensichtliches, wenn nicht gar –«
Hypnos räusperte sich. »Lassen wir unseren hübschen Historiker zaubern, Phönix. Ich bin überzeugt, er wird uns in Kürze mit der Brillanz seiner Schlussfolgerungen blenden.«
Der Patriarch des Hauses Nyx strahlte ihn an. Einen Moment lang war Enrique versucht, das Lächeln zu erwidern. Hypnos’ Schönheit und Esprit hatten noch immer etwas Verführerisches, Märchenhaftes. Sie verleiteten einen dazu, Unmögliches und Unerreichbares in greifbarer Nähe zu wähnen. Doch mittlerweile kam Enrique diese Aura vor wie ein Traum, der ihm schon zwischen den Fingern zerronnen war.
»Danke«, erwiderte er steif und wandte sich ab.
Er bemühte sich wirklich, sich auf das Rätsel zu konzentrieren, aber Hypnos’ Lächeln hatte ihn aus dem Konzept gebracht. Erst gestern hatte Enrique ihn auf das Ungleichgewicht ihrer Gefühle angesprochen, und seine Antwort hatte gelautet: »Ich glaube, dass ich mit der Zeit lernen könnte, dich zu lieben.« Die Erinnerung war noch so frisch, dass sie ihm einen Stich versetzte.
Enrique wollte keine erzwungene Liebe. Er wollte eine Liebe wie ein helles Licht, eine Kraft, die die Schatten vertrieb und die Welt in einen warmen Ort verwandelte. Irgendwo tief in sich hatte er immer geahnt, dass ihm eine solche Liebe mit dem umwerfenden Patriarchen nicht beschieden war, und vielleicht war es im Grunde das, was am meisten schmerzte. Nicht der Verlust der Beziehung selbst, sondern dessen Vorhersehbarkeit.
Natürlich fühlte Hypnos nicht dasselbe wie Enrique. Die Tatsache, dass Enrique das trotz allem überrascht hatte, war entweder ein Zeichen für seinen grenzenlosen Optimismus oder für seine grenzenlose Dummheit. Er tippte stark auf Letzteres.
NACHDEMSIEEINE weitere halbe Stunde über den Friedhof gelaufen waren, kamen sie wieder am Eingang an.