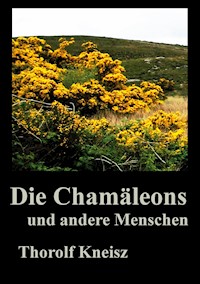
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Lebenslauf kann nur rückwirkend geschrieben werden, doch eine Lebensplanung, muß zwangsläufig dem Begriff Hoffnung untergeordnet werden, denn ab dem Moment, an dem ein Baby die ersten Atemzüge macht, schwebt der Begriff Zufall über ihm. Ein winziger Krankheitskeim oder ein Mißgeschick kann ungeahnte Folgen nach sich ziehen. Das gesamte weitere Leben, das gilt für jeden Menschen, vollzieht sich unter dem Deckmantel von Zufällen, andere sagen Schicksal, wiederum andere glauben an Göttliche Fügung. Unser Leben wird gelebt in ständiger Abhängigkeit von eben diesen Zufällen in Verbindung mit dem eigenen sich entwickelnden Willen. Dieser Wille kann noch so ausgeklügelt und zielsicher erscheinen, doch ein winziger Schlag dieses Schicksals kann zur Korrektur oder auch Aufgabe des gesteckten Willens zwingen. Alle Hoffnungen und Planungen sind zerstört. Aktion und Reaktion zwingen uns Menschen ständig zu Korrekturen unserer Planungen, Hoffnungen, Meinungen, Überzeugungen. Unser Wohlbefinden hängt von diesen Korrekturen ab, Argumente anderer sind zu berücksichtigen. Lebensplanungen können oder müssen in andere Richtungen gelenkt werden. Unser gesamtes Leben wird ständig unter dem Einfluß von äußeren, aber auch inneren Faktoren, gelebt. Je bewußter wir leben, desto besser können wir mit diesen Einflüssen umgehen. Diese und viele andere Überlegungen und Erkenntnisse bilden die Grundidee zu dem Roman Die Chamäleons mit dem Untertitel und andere Menschen. Das Spektrum der Farben, in dem diese Chamäleons ihre momentane Gefühlssituation ihren Artgenossen mitteilen, ist begrenzt. Der Mensch kann in ähnlich begrenztem Maße mit seinem Gesichtsausdruck seine seelische Verfassung zeigen, aber was seine Reaktionen, sein Denken, seinen Intellekt betrifft, ist seine Reserve an Reaktions- und Ausdrucksmöglichkeiten unendlich. Das ist wunderbar an unserem Leben und eine der Grundlagen unserer Evolution. In diesem Roman sind viele Personen in die Handlung eingebunden, von denen einige diesen Chamäleons vergleichbar sind, während andere ihr Leben geradlinig ohne extreme Kurven in die eine oder andere Richtung leben. Beide Gruppen leben zusammen, begegnen sich, trennen sich, beeinflussen sich gegenseitig. Zufällige Begegnungen verändern ihre Lebensauffassungen. Andere begegnen sich, berühren sich - aber es bleibt ein Aneinander vorbeigehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1093
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Chamäleon
Der Vater
Die Kindheit
Die Jugend
Die Flucht
Student
Katholische Junge Gemeinde
Das Noviziat
Die Agentur
Die Silvesterpartie 1966
Die Lösung
Die Erblindung
Der Notartermin
Das Gelübde
Der erste Klosterurlaub
Der zweite Klosterurlaub
Im Allgäu I
Pater Sebastian I
Familie Kirchheim
Sebastians Geburtstag
Die Verlobung
Die Hochzeit
Winter im Allgäu
Zukünfte
Die Schwangerschaft
Zwillinge
Die Jahre 1970 - 1975
Judith
Hoffnungen
Die große Enttäuschung
Sinah und Ingmar
Die Jahre 1984 - 1989
Die Wende
Mama
Licht und Farben
Schottland
Pater Sebastian II
Eva und Yvonne
Evas Tod
Das Begräbnis
Nachwort
Das Chamäleon
Mit ihren Körperteilen imitieren die Chamäleons verschiedene Teile von Pflanzen. Die echten Chamäleons erinnern mit ihren Körpern an ein Blatt, die Erdchamäleons an altes Holz oder Laub. Außerdem haben sich die Füße zu Zangen umgeformt, mit denen sich jeder Ast umschließen läßt. Manche Arten besitzen zusätzlich Krallen, die den Griff noch sicherer machen. Zusätzlich zu den Füßen unterstützt der Greifschwanz das Klettern. Die Wichtigkeit dieses Schwanzes wird durch die fehlende Fähigkeit, den Schwanz abzuwerfen und zu regenerieren, verdeutlicht. Als Besonderheit ist die Fähigkeit zu nennen, bei einem Fall vom Baum die Lungen aufzublähen, so daß sie den Sturz abfangen.
Das Chamäleon hat ein sehr scharfes Sehvermögen, so daß es mögliche Feinde bis zu einem Kilometer scharf sieht. Eine weitere Fähigkeit, die ausschließlich dem Chamäleon vorbehalten ist: es kann seine Augen unabhängig voneinander bewegen, wobei sich die Sehfelder beider Augen nicht überschneiden, sondern einzeln im Gehirn verarbeitet werden. Bei der Beutesuche wird die Umgebung mit einem Sichtfeld von 342° abgesucht. Ist ein Beutetier gefunden, wird dieses mit beiden Augen fokussiert.
Die gummibandartige Zunge schießt auf das Beutetier, ergreift es und zieht es in das Maul. Anschließend wird die Beute als Ganzes verschluckt. Gehör- und Geruchsinn sind gegenüber dem Sehsinn vernachlässigt.
Chamäleons sind dafür berühmt, daß sie in der Lage sind, ihre Hautfarbe zu ändern. Jede Art hat eine bestimmte Anzahl von Farben. Innerhalb dieses Spektrums können verschiedene Farbschläge und Muster angenommen werden. Dieser Vorgang geschieht allerdings langsam. Die Annahme, daß Chamäleons die Verfärbung ausschließlich zum Tarnen entwickelt haben, ist nur zum Teil richtig. Mit ihren Farben kommunizieren sie untereinander und signalisieren damit ihren Artgenossen, in welcher Stimmung, in welchen Gefühlen sie sich gerade befinden. Haben sie Angst, werden sie schwarz, stehen sie unter Streß, schillern sie in hellen Farben, sind sie paarungsbereit, werden sie bunt.
Chamäleons ernähren sich von Insekten und kleinen Wirbeltieren, fressen aber auch kleinere Artgenossen.
Der Vater
Die Kindheitserinnerungen der Yvonne Neufeld beginnen mit einem schicksalsschweren Ereignis, das sie ihr Leben lang belasten sollte. Ob sie das Produkt einer Vergewaltigung war oder ob sich ihre Mutter damals im Frühjahr 1943 freiwillig einem russischen Offizier ergab, hat sie nie erfahren. Die längste Zeit ihres Lebens fehlte ihr die Möglichkeit, mit ihrer Mutter zu reden und später, als ihr Verhältnis wieder gut wurde, wollte sie ihre Mutter nicht mit dieser Frage belästigen.
Der Mann, der ihr Vater hätte werden sollen, wurde bereits zu Beginn des Krieges eingezogen und hatte alle Entsetzlichkeiten des Frontlebens und anschließender Gefangenschaft in sibirischen Lagern erlebt. Wie ihre Mutter damals erzählte, durfte er sie in den langen Kriegsjahren zweimal besuchen. Fronturlaub nannte man das. Was für ein Ausdruck! Makaber! Yvonne dachte ungern an die Versuche ihrer Mama zurück, ihr von diesen Begegnungen zu erzählen. Jedes Mal mußte sie abbrechen, weil ihr die aufkommenden Tränen das Sprechen versagten. Sie las später in ihrer Jugend das Buch von Remarque „Im Westen nichts Neues“ und konnte sich vorstellen, was es bedeutet, nach einem sogenannten Urlaub wieder an die „Arbeit“, an das Töten und das Getötet werden, in das erniedrigende Dahinvegetieren in Schützengräben zurück fahren zu müssen. Wie soll sich das ein normal denkender Mensch vorstellen? Die Briefe, die ihre Mutter von der Front erhielt, waren zensiert und wären auch ohne diese Zensur nie so verfaßt, daß sie einen realen Bericht hätten abgeben können. Wozu auch? Allein schon die Rücksicht auf die in der Heimat Gebliebenen verbot eine Beschreibung von Details. Ein Gang durch die Hölle war es für alle.
Es war an einem Tag im Herbst des Jahres 1948. Yvonne war kurz zuvor fünf Jahre alt geworden, als dieser Mann, der leider nicht ihr leiblicher Vater war, zu dieser ersten Kindheitserinnerung wurde. Den leiblichen Vater hatte ihre Mama auch nur im „Vorrübergehen“ kennengelernt. Mit Sicherheit konnte Yvonne behaupten, daß sie nicht in Liebe gezeugt wurde. Später einmal bemerkte sie, daß ihr daraus keine Defizite entstanden sind.
An diesem Tag mußte die kleine Yvonne vor Sonnenaufgang zur Toilette. In der Diele der kleinen Wohnung hingen fremde Sachen - Lumpen, die einen merkwürdigen unangenehmen Geruch ausströmten. In der Küche, deren Tür sie, neugierig geworden, leise öffnete, entdeckte sie ebenfalls mehrere Veränderungen. Die kleine Zinkbadewanne, in der sie jeden Freitag badeten, erst sie, dann ihre Mama, stand auf dem Boden. Handtücher hingen über den Stuhllehnen und auf dem kleinen Bord vor dem Spiegel stand ein winziger eigentümlicher Pinsel. Sie sah zum ersten Mal einen Rasierpinsel. Der unangenehme Geruch der Kleidungsstücke und die Tatsache, daß in ihrer Wohnung etwas anders war als gewohnt, machten dem Mädchen Angst und sie kroch nach ihrem Toilettengeschäft zurück in ihr Bett, das in einer winzigen Bodenkammer seinen Platz unter einem kleinen Fenster hatte. Sie zog ihre Decke über den Kopf und hatte Furcht vor einem drohenden Unbestimmten.
Sie lag kaum, als sie lautes Reden hinter der Wand hörte. Nun wußte sie, daß dort ein Fremder war. Ein Mann war bei ihrer Mama. Ihre Angst steigerte sich und sie verkroch sich tiefer unter die Decke ihres Bettes. Aber auch unter der Bettdecke war sie nicht sicher vor den immer lauter werdenden Worten. Diese Worte steigerten sich, wurden zum lauten Schimpfen und Toben. Sie hörte ihre Mama schreien. Furchtbar laut und voller Zittern war ihre Stimme. Sie hörte die Worte: „Lass das Kind! Es ist doch unschuldig!“ Die männliche Stimme brüllte zurück: „Ich schlag das Balg tot!“ Dann wieder vernahm sie ein Wort, das sie erst viel später deuten konnte: „Russenbastard“ Stühle fielen um, Glas zerbrach, Türen schlugen zu. Die Wohnungstür krachte laut in das Schloß und plötzlich war Ruhe - gespenstische Ruhe. Unheimlich war diese Stille nach dem vorangegangenen Toben. Dieses Schweigen war ebenso furchterregend wie das Schreien zuvor. Yvonne lauschte, gespannt, atemlos, die Hände auf die klopfende Brust gepreßt, zur Tür, das leise Knarren der Klinke erwartend, ob sie sich öffnet, um jemanden einzulassen, der sie schlagen oder gar töten würde. Die Zeit blieb stehen und sie flüchtete sich in stilles Weinen. Wie lange sie leise schluchzend unter der Decke lag? Die Zeit stand still für das kleine Mädchen.
Durch die Wand hörte sie, daß ihre Mama ebenfalls weinte. Nicht nur das, sie wurde von Weinanfällen und wahren Krämpfen geschüttelt. Sie lauschte - unterdrückte Schreie, Schluchzen, tiefes Einatmen, erneutes Schluchzen. Der Mann war nicht mehr da. Was sollte sie tun? Sie wartete und als das Weinen hinter der Wand leiser wurde, schlich sie hinüber. Vorsichtig öffnete sie die Schlafzimmertür und stand neben dem Bett ihrer Mama. Erst als Yvonne ihre Bettdecke anhob, um sich neben sie zu legen, drehte sie sich um und zog Yvonne zu sich. Yvonne dachte, sie müßte ersticken, so sehr drückte sie ihre Mama an ihren Körper, küßte sie an jede freie Stelle, die ihr gerade unter die Lippen kam und begann wieder, herzzerreißend zu weinen. Aber das Weinen war anders als das, welches Yvonne durch die Wand gehört hatte. Nicht mehr Angst und Verzweiflung floß aus ihren Augen, sondern Glück und Mutterliebe. Als sie sich beruhigt hatte, flüsterte sie der Tochter zu: „Du brauchst keine Angst zu haben. Dir wird nichts passieren“. Yvonne hatte auch keine Angst mehr, denn sie war ja im warmen Bett ihrer Mama, lag in ihren Armen und wurde getröstetet Wie sollte ein kleines Mädchen in dieser Geborgenheit Angst haben?
Wenige Tage danach klingelte es an der Wohnungstür. Yvonne wurde von ihrer Mama in ihre Kammer geschickt und hörte nur bruchstückhafte Satzfetzen. Ihre Mama berichtete anschließend, daß man im Wald jemanden gefunden hat, den sie, Mama, vermutlich kennen müßte. Sie nahm Yvonne daraufhin wieder in den Arm und weinte still vor sich hin. Danach ließ sie die Tochter für eine lange Zeit allein. Es wird eine Stunde gewesen sein, aber dem Mädchen kam diese Zeit wie eine Ewigkeit vor.
Im Jahre 1958 Jahre durfte die inzwischen fünfzehnjährige Yvonne die ganze Tragweite der entsetzlichen Geschehnisse vor zehn Jahren begreifen. Es kam zu einer indirekten „Begegnung“ mit dem Mann, der ihr Vater hätte sein sollen. Eines Tages erhielt Frau Neufeld Post von einem Unbekannten, der schrieb, daß er mit einem Mann namens Neufeld in russischer Kriegsgefangenschaft bis zur Entlassung zusammen war. Er hatte nach Kontakten mit dem Roten Kreuz ihre Adresse erfahren und es würde ihn freuen, wenn er seinen damaligen Kameraden und dessen Familie besuchen dürfe. Nach Zögern antwortete Frau Neufeld und schrieb dem Unbekannten vom Tod ihres Mannes. Sie stellte ihm frei, sie und ihre fünfzehnjährige Tochter zu besuchen. Nach einigen Wochen stand er eines Abends vor der Tür. Zu dritt saßen sie lange am Eßtisch der kleinen Wohnung. Mama und Tochter ließen sich von den Kriegserlebnissen der beiden Kameraden erzählen.
Frau Neufeld war aufgewühlt an diesem Abend und Yvonne hatte den Eindruck, sie bereute es, dem Fremden zugehört zu haben. Alles war wieder zurück. Alle Entbehrungen, alle Sehnsüchte, alle Schande, alle Hilflosigkeit. Yvonne spürte etwas anderes. An diesem Tag erkannte sie den Mann ihrer Mutter postum als Vater an. Sie begann, diesen Mann zu lieben und zu verehren. Bestimmt machte sie ihn in ihrer Fantasie edler und großmütiger als er es je gewesen war, aber sein Leidensweg stellte sich ihr stellvertretend dar für alle, die ähnliche Schicksale in Kriegen durchleben mußten, so daß sie begann, einen Heiligenschein um seinen Kopf zu weben. Außer einem Hochzeitsbild hatte sie keine bildliche Vorstellung von ihm. Sie wob sich ein eigenes Bild um diesen „Vater“. Ein junger Mann wird gezwungen, in einen Krieg zu ziehen. Er wird von seiner Familie fortgerissen. Ein Jüngling, fast noch Kind, verblendet von kriegsverherrlichenden Parolen, von Begriffen wie Ruhm und Ehre, Vaterland, Volk und Herrenrasse. Wie alle seine Kameraden schrie auch er Hurra für Führer und Vaterland. Voller Stolz rollten sie in Richtung Ostfront. Nieder mit dem Feind hieß die Parole. Was Krieg bedeutet, erfuhren sie in aller Bitternis bereits nach wenigen Wochen. Keiner der Parolenschreier hatte ihnen gesagt, was es heißt, für ein Vaterland zu sterben, was es heißt, Schmerzen zu erleiden und zu sehen, zerfetzte Menschenleiber zu begraben. Zu erdulden war auch die Sehnsucht nach dem Zuhause, nach der Liebe zu der Frau, die noch schnell nach dem Frontbefehl geheiratet wurde. Der Patriotismus lag nach wenigen Wochen Krieg neben den Toten in ihren Gräbern. Was wird in Kriegen von Menschenseelen verlangt? Die Ziele aller konzentrierten sich nur noch auf eines - Überleben. Täglich wurde gestorben, täglich wurden die schreienden Verwundeten in überfüllten Waggons in die Lazarette abtransportiert. Und er? Er war noch immer unter den Lebenden, unter den Nichtverletzten. Was blieb ihm? Sich zu fügen und zu hoffen, daß er auch morgen oder übermorgen nicht zu denen gehört, für die der Krieg beendet ist. Kämpfen und töten - oder getötet werden. Desertieren war dem Tod gleich zu setzen. Also paßte er sich der Situation an und lebte. Seine Gedanken gingen die stupidesten Wege, hart an der Grenze zum Wahnsinn, einer Logik kaum noch fähig.
Ob seine Gedanken nach acht Jahren Psychoterror noch steuerbar waren, ist anzuzweifeln. Nach dreitausend Tagen des Leidens kann man nicht mehr denken wie am ersten Tag. Als das sinnlose Morden endlich beendet war, befand sich dieser Mann auf einem ewigen Fußmarsch in ein russisches Kriegsgefangenenlager. Hier ging das Sterben weiter. Zwangsarbeit, Hunger, Krankheiten, Kälte, Willkür. Zu all dem kam noch die permanente Demütigung, denn man machte ihn und seine Kameraden für das Blutvergießen, das sinnlose Morden in den Kriegsjahren verantwortlich. Wen hätte man auch sonst zur Rechenschaft ziehen sollen. Die paar Kriegsverbrecher, die in Nürnberg in einem Schauprozeß verurteilt wurden, konnten nur symbolisch gewertet werden - als höchste Spitze eines Eisberges.
Vier Jahre Krieg, vier Jahre Gefangenschaft - und das Herz schlug noch immer. Aber der Mensch war am Ende seiner Kräfte. Es war Nachkriegszeit und auch in der Sowjetunion fühlte man sich, wenn auch zaghaft, internationalen Konventionen des Völkerrechts verpflichtet. Kriegsgefangene, die noch am Leben waren, wurden entlassen. Auf einmal war es so weit, daß die Hoffnung, an die man sich die langen Jahre geklammert hatte, die am Leben erhielt, Erfüllung finden sollte. Je näher er der Heimat kam, verminderte sich die permanente seelische Anspannung, um so mehr schwanden die körperlichen Kräfte, denn der eiserne Wille zum Überleben war nicht mehr in dem Maße gefordert wie in den Jahren und Monaten zuvor. Er sah an sich herab, sah sich im Spiegel und war entsetzt. Die Erinnerungen an die Zeit vor dem Krieg krochen hervor aus dem stupide gewordenen Gedächtnis. Hoffnungen, vermischt mit Ängsten, keimten in ihm wie in jedem seiner übriggebliebenen Kameraden.
Daß die Zeit der Kriegswirren auch für die Daheimgebliebenen nicht stehengeblieben sein konnte, war für einen Heimkehrer wie ihn kaum vorstellbar. Herr Neufeld muß die Vorstellung gehabt haben, seine Frau hätte die ganzen Jahre hindurch ihre Zeit damit verbracht, sich auf ihn zu freuen. Die Zeit des Leidens und der Entbehrungen hatte auch die Menschen verändert, die vor Bombenhagel in Schutzkeller fliehen mußten, die um Nahrung für das tägliche Überleben zu kämpfen hatten. Natürlich hat Frau Lindberg auf seine Heimkehr gehofft. Schließlich hörte auch sie ständig im Radio die Meldungen des Roten Kreuzes, wer seine Hoffnungen auf Rückkehr des Ehemannes, Bruders, Verwandten begraben konnte - und wer noch hoffen durfte.
Yvonne hatte schon seit Jahren eine enge Freundin, Eva, die Tochter eines Pfarrers in Wernigerode. Von Evas Eltern wurde Yvonne wie ihre eigene Tochter angesehen und Yvonne vertraute diesen Eltern oft mehr als ihrer Mama. Das Thema „Krieg, Vater …“ belastete Yvonne sehr und es kam zu langen Gesprächen mit Evas Eltern. Yvonne konnte nach den Gesprächen klarer einschätzen, daß jeder bewußt oder unbewußt während seines Lebens Veränderungen seiner Person erlebt. Man entwickelt sich, abhängig von äußeren Umständen, abhängig von lieben oder weniger lieben Mitmenschen, abhängig von beruflichen und persönlichen Lebensstationen. Jeder ist selbst für die Entscheidungen verantwortlich - aber diese sind nie objektiv, können also „falsch“ sein.
Auf wen hat Frau Lindberg gewartet? Doch stets auf den Menschen, den sie vor vielen Jahren das letzte Mal sah und erlebte. Und schon damals während des ersten Fronturlaubes war er nicht mehr der, den sie geheiratet hatte. Wie unrealistisch wäre es gewesen, einen heimkehrenden Kriegsgefangenen nach acht Jahren Höllenerlebnis unverändert wiedersehen zu wollen, so, als käme er von einer Dienstreise zurück. Ein Fremder kam zu ihr, ein bemitleidenswerter, zerlumpter Greis von dreißig Jahren. Sein Körper funktionierte, aber seine Seele war zum Krüppel geworden. Als er an die Tür klopfte und seine Frau öffnete, erkannte sie ihn nicht. Wie oft mag diese Frau versucht haben, sich ein Wiedersehen vorzustellen. Fantasien dieser Art können nichts Realistisches an sich haben. Yvonnes Mama, die seit fünf Jahren ein Kind von einem russischen Offizier hatte, eine Halbwaise schon wenige Tage nach seiner Zeugung, war psychisch völlig überfordert. Die zerquetschte Seele des Mannes konnte es nicht verarbeiten, daß seine einzige und letzte Hoffnung im Keim erstickt wurde. Er war am Ziel angekommen und als er die Zielgerade überschritten hatte, tat sich ein unerwarteter Abgrund auf, der ihn in einen Strudel riß und vernichtete. Er konnte es nicht ertragen, Vater eines Kindes sein zu sollen, dessen leiblicher Vater einer derer ist, die zu seinem absoluten Feindbild geworden waren. Yvonne war dieses Kind und sie wußte nichts von allen diesen Problemen. Aber wer war denn schuld, daß dieser Mann viele Jahre um sein Leben kämpfte, um mit noch immer schlagendem Herzen in den Schoß der Familie zurückzukommen. Seine ganze übriggebliebene Stärke, sein ganzer unbeugsam geglaubter Wille zerbrach innerhalb der wenigen Minuten, in denen ihm klar wurde, wer, bzw. was da hinter der Kammertür seiner Frau liegt.
Er zog nach der Auseinandersetzung seinen stinkenden Militärmantel über und lief davon. Er lief in den nahegelegenen Wald und schaute suchend nach oben, fand einen Ast, an dem er seinen Hosengürtel befestigen konnte und erhängte sich. Damit war sein Leben ebenso ausgelöscht wie das derer, die bereits in den ersten Kriegswochen gefallen waren.
Dieser Mann, den Yvonne so gern zum Vater gehabt hätte, auf dessen Schoß sie so gern gesessen hätte, den sie so gern am Arm ihrer Mama gesehen hätte, an dessen Hand sie so gern in ihr eigenes Leben geführt worden wäre, hat sein Schicksal bis zum letzten Atemzug unter schrecklichsten Entbehrungen und Leiden auskosten dürfen. Warum??? Wozu???
Die Kindheit
Yvonne erlebte ihre Kindheit in Wernigerode am Nordrand des Harzes so, wie ein völlig „normales“ Kind aufwächst. Sie hatte Freundinnen, besuchte Kindergarten und Schule. Die Kinder hatten alle Freiräume, hatten Wälder und Felder, um ihre Spiellust zu befriedigen. Sie bauten Hütten aus Ästen, Sträuchern und Laub, spielten mit den Jungen der Nachbarschaft Indianer und, das einzige anormale - sie spielte niemals mit Puppen. Die Spiele der Jungen waren ihr lieber. In der Schule war ebenfalls nichts Auffälliges an ihr. Sie zeigte normale Intelligenz, war nicht weniger frech und aufsässig als die anderen - von einem Mehr hat niemand berichtet. Ihre erste Menstruation hatte sie im dreizehnten Lebensjahr und war entsetzt, denn ihre Mutter war nicht aufgeklärt über den Umgang mit Sexualfragen und hatte ihrer Tochter mangels einfühlsamer Worte verschwiegen, was auf sie zukommen wird. Alles diesbezügliche Wissen durfte sie sich von den älteren Schulfreundinnen holen, die sich oftmals über Yvonnes rückständiges Wissen amüsierten. Aber das waren alles Probleme, die eigentlich keine sind.
Sie war zehn, als sie eine Freundin bekam, Eva Lindberg, Tochter eines evangelischen Pfarrers. Sie fühlten eine besondere Affinität zueinander und wurden unzertrennliche Freundinnen - nicht nur für die Kindheit, sondern für das gesamte Leben. Durch sie und ihre Familie wurden ihr die Augen für die Wahrnehmung dieser Welt geöffnet. Hier durfte sie erfahren, was Allgemeinbildung bedeutet. Hier kam sie das erste Mal mit dem Begriff Religion und Kirche zusammen. Jede Stadt, jedes Dorf hatte seine Kirche. Für Yvonne war das ein Bauwerk mit einem spitzen Turm. Die Glocken darin schlugen die volle, manchmal auch die halbe oder Viertelstunde. Ihre Mutter ist niemals mit der Tochter in einer Kirche gewesen. In Schlössern, Museen oder Parks allerdings ebenfalls nicht. Plötzlich ging sie in einer solchen ein und aus, hörte den dröhnenden Klang der Orgel, durfte sogar selbst ihre Kinderhände auf die Tasten legen und mit den Füßen die Manuale treten. Das waren Erlebnisse, die unvergeßlich sind. Aber es gab auch andere Erlebnisse, die nachhaltige Eindrücke in dem Mädchen hinterließen wie zum Beispiel das folgende: In den großen Schulferien des Jahres 1958 wurde Eva wie in früheren Jahren von ihren Großeltern in ein winziges Dorf im Harz ganz in der Nähe der Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten eingeladen. Frau Lindberg hatte dort ihr Elternhaus und ihre Eltern hatten auf diesem Anwesen einen Hühnerhof, zwei Schweine, drei Kühe und mehrere Schafe. Dazu bestellten sie ihren großen Garten mit Kartoffeln, Unmengen von Gemüse, und ernteten auf der Obstplantage wunderbare Kirschen, Äpfel und Birnen. Eva fragte ihre Freundin, ob sie nicht Lust hätte, mitzukommen. Yvonne war Feuer und Flamme. Ihre Mutter konnte nichts dagegen sagen und so fuhren sie in den ersten Julitagen per Bahn los. Am Bahnhof wartete bereits Evas Opa mit einem alten klapprigen Traktor auf die Kinder. Eine unvergeßliche Fahrt über Wald- und Feldwege bis zu dem einsam auf einem großen Gehöft stehenden Haus der Großeltern. Auf dem Gelände gab es etliche leerstehende Stallungen, denn früher war es ein gut bewirtschafteter Bauernhof. Die Oma empfing die beiden Mädchen am Gartentor und bewirtete sie mit selbstgekeltertem Apfelsaft und Kuchen. Waren das Genüsse! Yvonne schwebte vor Wonne. Aber das Schönste sollte noch kommen. Beide durften sich aussuchen, ob sie in einer großen Kammer im Dachgeschoß oder in einem Zelt, das sie sich irgendwo im Gelände aufschlagen konnten, schlafen möchten. Gab es da eine Frage? Sie suchten einen Platz am Rande der Obstplantage aus und begannen mit Hilfe des Opas das Zelt aufzubauen. Aus dem Haus wurden zwei Matratzen geholt und es blieb immer noch ausreichend Platz, um sich an einem winzigen Tisch auf einen Berg von Kissen zu setzen. Das war ihr Reich für die nächsten sechs Wochen. Yvonne konnte sich an keine Ferien erinnern, die aufregender und schöner waren als diese. Es gab derart viel zu erkunden, daß ihr der Mund ständig offen stehenblieb. Sie halfen, ohne daß sie darum gebeten wurden, bei vielen Arbeiten. Sie drängelten sich danach, die Schweineställe trotz des fürchterlichen Geruches, der einem den Atem nahm, auszumisten. Sie durften die kleinen Ferkel betreuen, die eine der beiden Säue kurz vor ihrer Ankunft geworfen hatte. Sie jagten sich mit den Schafen, die leider so scheu waren, daß es selten gelang, eines zu berühren. Sie erinnert sich, daß sie mit Eva in den Kuhstall kamen, als die Oma eine der Kühe molk. Daß beide einen Becher noch warmer Milch trinken durften, war das eine, aber daß sie unter Omas Anleitung versuchen durften, ein Kuheuter in die Hände zu nehmen, um diesem Milch zu entlocken, war eine Faszination der ganz besonderen Art. Mit dem großen Schäferhund Nero schlossen sie eine Freundschaft, die sich als unzertrennlich entwickelte. Dieser Hund folgte den Mädchen auf Schritt und Tritt. Yvonne hatte bei der ersten Begegnung einen höllischen Respekt vor diesem Ungeheuer. Schließlich war er so groß, daß er mehr Kilos auf die Waage brachte wie sie selbst. Nach zwei Tagen sprang dieser Respekt in eine wahre Liebe um. Er leckte ihr über das Gesicht, sie kraulte ihn, er wedelte mit dem Schwanz, wenn er sie entdeckte, und sie liefen um die Wette, das heißt, er rannte voraus und wartete, bis Eva und Yvonne ihn einholten.
Die Abende verbrachten sie bei den Großeltern. Sie erzählten oder hörten Musik, die aus einem alten Grammophon kam. Evas Oma war früher einmal Lehrerin gewesen und berichtete gern von ihren Schulerlebnissen. Es ergab sich am zweiten Tag, daß Yvonne in einem der Bücherregale stöberte und ein Buch herausnahm, das in Englisch geschrieben war. Erst die Oma mußte ihr erklären, daß es diese Sprache ist und begann plötzlich, englisch zu ihr zu reden. Yvonne war völlig verdattert und fragte, was sie da gerade gesagt hat. Für die Kinder gab es nur eine Fremdsprache und die hieß Russisch. Die Oma fragte die Kinder, ob sie nicht Lust hätten, während der Ferien ein wenig Englisch zu lernen. Schaden könne es doch nie, wenn man wenigstens ein paar Brocken einer anderen Sprache kann. Beide waren begeistert und verbrachten ab sofort die langen Abende mit Englischbüchern. Yvonne wurde um die Erfahrung reicher, daß ihr das Erlernen von Sprachen buchstäblich zufiel. Sie brauchte nur eine Vokabel zu hören und hatte sie im Gedächtnis. Eva fiel das nicht so leicht. Sie mußte immer wieder im Wörterbuch nachschauen und konnte nicht begreifen, wieso das go - went - gone und nicht go - gin - gonnen oder so ähnlich gehen sollte. Es vergingen ein paar Tage und Yvonne machte sich daran, Geschichten aus dem Lehrbuch zu übersetzen. Es ging immer besser. Sie nahm sich vor, als kleine Engländerin zurück zu ihrer Mutter zu kommen. Wenn sie ihre Russischkenntnisse mit den so schnell erworbenen Englischkenntnissen verglich, so fand sie beide gleich gut. Es kam in der letzten Woche der Ferien sogar dazu, daß Yvonne ihr Englisch konkret anwenden mußte.
Das Gehöft der Großeltern Evas lag im sogenannten Grenzgebiet und die Kinder hätten es nicht ohne Sondererlaubnis betreten dürfen. Für diese Formalitäten hatten die Lindbergs gesorgt. Diese Passierscheine mußten sie ständig bei sich tragen, um zu verhindern, daß man sie mit viel Ärger auf einer der Grenzwachen abholen mußte. Der Zufall wollte es, daß die Kinder eine Entdeckung machten, die viel später für Yvonne lebensrettend werden sollte. An einem steilen Hang an der Grenze des Anwesens, in Felsen eingebettet, entdeckten sie einen Schuppen, dessen Tür nicht verriegelt war. Was tun in einem solchen Fall halbwüchsige Kinder? Sie stillen ihre Neugier und untersuchen das Versteck. Sie betraten eine Abstellkammer mit Kisten und altem Werkzeug, alles schmutzig, verrostet und mit Spinnennetzen umwoben. Sie entdeckten, daß ein Bretterverschlag an der Rückseite des Schuppens zu öffnen war. Eva muß etwas Unheimliches gespürt haben, als sie hörte, daß es eigentümlich hohl hinter den Brettern klang, wenn man dagegen klopfte. Die Bretter waren nur lose befestigt und nachdem sie die ersten abgenommen hatten, schauten sie in eine tiefe Höhle. Ein Ende dieser Höhle konnten sie nicht sehen. Es war stockfinster. Jetzt wurde es richtig spannend. Eva rannte in das Haus und kam außer Atem mit einer riesigen Taschenlampe zurück. Sie hatten tatsächlich einen unterirdischen Gang entdeckt, der mit leichtem Gefälle in westlicher Richtung verlief. Sie betraten herzklopfend die Finsternis. Der schmale Weg war steinig und feucht. Es war wie in einem Märchenfilm. Hier war in den letzten Jahrzehnten kein Mensch gewesen. Sie liefen, krochen, stolperten und sprangen immer weiter. Bizarre Wurzeln, die sich durch die Gesteinsritzen gezwängt hatten, hingen herab. Nach etwa hundert Metern machte der Gang eine leichte Biegung und sie sahen in der Ferne einen Lichtschein. Das mußte das Ende des Ganges sein. Ihre Neugier wuchs und wenig später kletterten sie ins Freie auf einen Felsvorsprung, nur wenige Quadratmeter groß. Sie hatten ein wunderschönes Fleckchen Erde entdeckt. Unter ihnen plätscherte ein Gebirgsbach. Hinter ihnen die steilen Felsen, aus denen sie gerade heraus gekrochen waren. Links und rechts neben ihnen steile Hänge, an denen sich Kiefern und anderes Unterholz mühsam festklammerte. Der Bach, das wußten sie von den Erzählungen der Erwachsenen, war der eigentliche Grenzverlauf zwischen den beiden Deutschlands. Sie waren in einer absolut verbotenen Zone gelandet. Eine wilde Einsamkeit umgab sie hier. Es hätte viel Geschick erfordert, an den steilen Hängen hinunter zum Bach zu klettern. Sie beschlossen, am nächsten Tag wieder hierher zu kommen und wollten ein Seil mitbringen, an dem sie sich herablassen konnten. Sie schätzten die notwendige Seillänge auf höchstens fünf Meter. Sie freuten sich wie Rumpelstilzchen über diesen Geheimplatz und wußten, wo sie sich in den nächsten Tagen am liebsten aufhalten würden - auf einem Privatbalkon mit Sicht auf das andere Deutschland.
Daß sie sich in einem besonders gefährlichen Gebiet aufhielten und riesigen Ärger bekommen hätten, wenn sie dort die Grenzsoldaten aufgespürt hätten, bedachten sie mit keiner Silbe. Warum sollten sie auch? Sie waren Kinder und hatten keine Lust, sich um die sinnlosen Verbote der Politiker zu kümmern. Damals war die Grenze politisch gesehen nur eine Linie auf der Landkarte. Es gab keine Befestigungen mit Kontrollposten. Irgendwelche Soldaten liefen die Grenze in weiten Zeitabständen ab, wären aber zu ihrem idyllischen Flecken nie gekommen, da das Gelände viel zu unwegsam war. Am nächsten Tag kamen sie mit einem Seil. Nero war mit von der Partie. Schon in der Höhle war er furchtbar aufgeregt. Sie befestigten das Seil sicher an einer Fichte und Eva war die erste, die sich daran herunterließ. Drei Meter Seil hätten auch gereicht. Eva hatte bereits ihre Füße im Bach, als Yvonne zu ihr kam. Oben winselte ihr Beschützer und wußte nicht, wie er zu seinen Herrinnen kommen sollte. Er lief aufgeregt hin und her und rutschte mindestens zweihundert Meter entfernt eine steile Böschung herab. Wie sollte er aber wieder nach oben kommen? Die Mädchen konnten ihn doch nicht am Seil hochziehen. Die Frage beschäftigte beide lange Zeit und verdarb ihnen einen Teil des ersten Bachbesuches. Wie sich ergeben sollte, war das Tier gar nicht so dumm. Nero lief, nachdem sie in der Höhle verschwunden waren, so lange am Bach entlang, bis er eine Stelle gefunden hatte, an der sein Aufstieg möglich wurde. Wild bellend rannte er vor dem Schuppen hin und her, sprang auf Yvonne zu, so daß sich Hund und Mädchen auf dem Gras wälzten.
Oft waren sie am Bach und machten dieses kleine Paradies zu ihrem Privateigentum. Das Seil versteckten sie im Inneren des Ganges hinter einem großen Stein, so daß es von keinem anderen entdeckt werden konnte. Aber wer außer ihnen sollte sich in dieses verlassene Versteck verirren? An den nächsten Tagen nahmen sie Bücher mit und lasen, während ihre Beine im Wasser hingen. Sie hatten ein Reich für sich, ein winziges Fleckchen Erde, auf dem sie niemand entdecken konnte. Auf dem winzigen Rasenstück fühlten sie sich einsam wie Robinson Crusoe auf seiner Insel. Sie zogen sich nackt aus und zeigten sich gegenseitig, wie groß ihre Brüste schon waren. Sie wagten verbotene Berührungen und genossen das Zusammensein auf besondere Weise. Wenn das die Mutter Yvonnes gesehen hätte, wäre sie bestimmt in Ohnmacht gefallen vor Entsetzen. Yvonne war überzeugt, daß Eva ihrer Mutter von allem, auch von diesen scheuen Berührungen erzählen durfte, ohne deshalb auch nur einen roten Kopf zu bekommen. Im Hause der Lindbergs sah man alles mit anderen Augen.
Yvonne fühlte sich nach diesen Ferien wie ein Baum, der seine Äste plötzlich in eine andere Richtung wachsen lassen darf, weil sich der Lichteinfall geändert hat. Sie spürte, wie sich dieser Drang zu wachsen, Äste, Blüten und Früchte zu treiben, in Dimensionen entwickelte, die ihr zuvor völlig unbekannt waren. Ihr Leben hatte ein anderes Gesicht, eine andere Zukunft bekommen und diese Ahnung sollte sich erfüllen.
Es gab wie schon angedeutet, eine hübsche Episode, die sich in der letzten Ferienwoche ereignete und zur ersten praktischen Anwendung ihrer Englischkenntnisse wurde. Sie waren wieder am Bach und wollten endlich dessen andere Seite erkunden. Sie sprangen hinüber und landeten im sogenannten „Westen“. Ein Stück liefen sie durch das dichte Unterholz auf den Wald zu und sahen durch die Bäume, daß sie auf einen schmalen Weg zusteuerten. Nero sprang wie gewöhnlich herum. Auf einmal raste er los, als hätte ihn eine Schlange gebissen und begann mörderisch zu bellen. Die Mädchen beeilten sich, Nero zu folgen, zu diesem Weg zu kommen. Zwei Soldaten standen wie zu Salzsäulen erstarrt nebeneinander und Nero breitbeinig einen halben Meter vor ihnen. Er fletschte sie an, ließ sie keine Sekunde aus den Augen. Eva und Yvonne erschraken fürchterlich. Die beiden Soldaten sahen die Kinder und riefen: „Help me! Please, help me”! Yvonne rief: „Nero, come back to me! “ Im gleichen Moment sagte sie sich, was der Unsinn soll, Nero versteht doch nur deutsch. Aber er gehorchte trotzdem und bewegte sich einen Meter rückwärts, aber ohne die beiden aus den Augen zu lassen. Inzwischen waren die beiden Mädchen so weit herangekommen, daß sich Eva zu Nero bücken konnte, ihn beruhigte und die Gefahr für die beiden Soldaten beendete. Yvonne quasselte welter: „Excuse me. The dog is a lovely dog. He will plays with you“. Jetzt begannen die beiden Soldaten aufzutauen und der eine sagte zu seinem Kameraden: „The girl speaks english! It`s verry nice.“ Dann wandte er sich Yvonne zu und es entspann sich ein Gespräch, das sie nicht für möglich gehalten hätte. Eva natürlich auch, die höchstens die Hälfte mitbekam. Die beiden Soldaten waren Amerikaner und schienen beim Sprechen einen riesigen Kloß im Mund zu haben. Sie waren auf Patrouille wie jeden Tag und freuten sich, endlich einmal etwas zu erleben. Lange redeten sie miteinander, so gut es eben ging. Yvonne merkte schnell, daß sie noch viel lernen muß, um sich fließend unterhalten zu können. Aber sie war stolz, daß es schon so gut ging. Sie saßen zu viert im Gras und Nero ließ sich von den beiden Soldaten kraulen und war sehr zutraulich. Zum Abschied kramten beide in ihren Tornistern und holten mehrere Packungen Kaugummi - dobble gum - wie sie sagten - und zwei Tafeln Schokolade heraus. Obendrauf legten sie noch eine Schachtel Zigaretten mit der Bemerkung: „For your father!“ Mit mehreren „Thank you very much“ und „Goodbye“ verabschiedeten sich die Freundinnen. Auf dem Rückweg fragten sie sich besorgt, ob sie das zu Hause erzählen dürften. Bestimmt würden die Großeltern sofort verbieten, daß sie jemals wieder an diese Stelle gehen dürfen. Yvonne hätte es ihrer Mutter sicherlich nicht erzählt, aber Eva sah das anders. Zu Hause angekommen, legte Eva die Schokoladentafeln auf den Tisch, die Zigaretten dazu und berichtete, was geschehen war. Es gab weder Gezeters noch Schimpfen. Die Oma meinte, daß das auch böse hätte enden können, wenn nicht Nero dabeigewesen wäre. Fazit der Erwachsenen: bei solchen Touren immer den Hund mitnehmen. Das war alles. Der Opa kassierte die Zigaretten dankend. Er rauchte schon lange nicht mehr, aber bei einer Westzigarette kann man schon mal schwach werden. Die Schokolade wurde gerecht verteilt und die Dobble gums kamen mit in das Zelt. Der Großvater wußte von der begehbaren Höhle zur Schlucht und staunte, daß sie noch immer passierbar ist. Er riet seinen Schutzbefohlenen lediglich, ja aufzupassen, daß sie nicht im Morast ausrutschen und sich womöglich ein Bein brechen. Die restlichen Tage vergingen leider wie im Fluge. Am Ende gab es noch ein Festessen. Ein Huhn war geschlachtet und als Nachspeise gab es Schokoladenpudding, für den die Oma ihren Anteil der Westschokolade verwendet hatte. Opa brachte seine Gäste, die wesentlich mehr Gepäck als bei der Herfahrt hatten, wieder mit dem Traktor zum Bahnhof. Jeder von ihnen bekam zum Abschied ein Freßpaket mit Eiern, Wurst und Schinken, dazu die Reste des Kuchens. Die Oma hatte Yvonne zum Abschied zwei Englischlehrbücher, ein Wörterbuch Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch und einen Erzählungsband in englischer Sprache geschenkt. Yvonne war selig und der Meinung, daß sie mit diesen Büchern in einem Jahr fließend englisch sprechen werde. Die Bahnfahrt dauerte nicht sehr lange, höchstens eine Stunde. Am Bahnhof wartete Frau Lindberg. Es ging zum Pfarrhaus und eine lange Erzählstunde wurde abgehalten. Erst als Yvonne annehmen konnte, daß ihre Mutter von der Arbeit zurück sei, verabschiedete sie sich mit vielen Dankeschöns für die herrlichen Ferien. Eva begleitete sie nach Hause.
Frau Neufeld freute sich sehr über die eßbaren Mitbringsel, auch wenn ihr das sichtlich peinlich war, sie in Gegenwart Evas entgegenzunehmen. Eva verabschiedete sich schnell und Yvonne wollte ihrer Mutter von den Ferien erzählen. Hatten sie bei Frau Lindberg aus Zeitmangel vieles nicht erzählen und anderes nur andeuten können, so wurde Yvonnes Erzähleifer schon nach einer Viertelstunde gedämpft, weil ihre Mutter noch abzuwaschen hatte und vor allem am Abend zu einer Versammlung in ihre Arbeitsstelle mußte. Sie sagte etwas von wichtigen Veränderungen in ihrer Arbeit, zog sich um und ließ ihre Tochter allein. Die packte ihre neuen Bücher aus und freute sich, in Ruhe lesen zu können.
Frau Neufeld zählte zu den eher armen Leuten. Sie lebte mit ihrer Tochter von dem wenigen Geld, das sie als Näherin in Heimarbeit eines kleinen Konfektionsbetriebes verdiente. Das Geld reichte für die Miete der kleinen Wohnung in einem Sozialwohnungsbau aus der Vorkriegszeit, ausgestattet mit dem Notdürftigsten, und für das tägliche Essen. Außergewöhnliches durfte nicht hinzukommen. Bekleidet wurde die Tochter vorzugsweise mit abgelegten Sachen aus dem Kollegenkreis ihrer Mutter oder von Spendenaktionen, die damals die Schule veranstaltete. Am Wochenende gab es eine kleine Fleischration, ansonsten mußte sich Frau Neufeld mit Kartoffeln, Brot oder Gemüse (zwei Kohlsorten und Möhren) beschränken. Irgendwann hatte sie drei Hühner geschenkt bekommen, die in einem kleinen Stall ihr Dasein fristeten. Das bedeutete ab und an mal ein Ei auf dem Frühstückstisch.
Diese Umstände erklärten Yvonnes Begeisterung, wenn ihr bei der Pfarrerfamilie mitunter auch ein Stück Schokolade zugesteckt wurde. Auch Kuchen lernte sie erst in diesem Hause kennen. Die Pfarrer bekamen damals eine gewisse Unterstützung von ihren Amtskollegen aus dem Westen, der sogenannten Brüderhilfe - vor allem in Form von Westpaketen.
Die Mutter Evas wagte es kurz vor dem Weihnachtsfest 1958, ein kleines Päckchen für Yvonnes Mutter mitzugeben. Als Frau Neufeld es unter dem kleinen Tannenbäumchen in ihrem Wohnzimmer aufmachte, kullerten ihr ein paar Tränen auf das „corpus delicti“ - ein Paar Nylonstrümpfe. Dazu eine Tafel Schokolade, so schöne mit vielen Nüssen darin und ein Paket Haferflocken. Das waren aber nicht solche, die Kreise von säuberlich auf dem Tellerrand angeordneten Spelzen hinterließen. Es war ein Genuß. Unvergeßlich für ein Kind, das oftmals trockene Brotkanten mit den Zähnen zerbrechen mußte, um etwas in den Magen zu bekommen. Dieser Unterschied zwischen dem Leben der Familie Lindberg, deren Eltern, und dem der kleinen Familie Neufeld war Yvonne nie so bewußt geworden, wie in den Ferientagen des Jahres 1958 und dem Weihnachtsfest. Es machte sie unsagbar traurig, daß ihre Mama hart arbeiten mußte, um die Tochter und sich selbst ernähren zu können. Andere dagegen hatten es so viel leichter. In der Schule predigte man ständig, daß es im Sozialismus keine Klassenunterschiede mehr geben wird, aber das, was sie am eigenen Leibe spürte, deutete auf ganz andere Tatsachen hin. Die Nachkriegszeit währte in Wernigerode und dem ganzen so stolzen Land, das sich Deutsche Demokratische Republik nannte, viel länger als im bösen Westen, wo es doch nur Ausbeutung, Kriegstreiber und Revanchisten gab. Das waren Vokabeln, die das Kind Yvonne ebenfalls kennenlernte, die in der Schule zum tagtäglichen Sprachgebrauch gehörten. Unbewußt spürten die Kinder die Richtung, in die ihre Erziehung gelenkt wurden. Um so bewußter wurden Zweifel gesät, ob denn das, was man in der Schule predigte, das allein Seligmachende sei. Frau Neufeld interessierte sich nicht für Politik, wie sie selbst häufig sagte, aber wie man in der Schule lehrte, kommt keiner um eine eigene Meinung herum. Allerdings hieß das, und das erkannte Yvonne spätestens dann, als sie mit Eva über derartige Themen sprach, eine eigene Meinung ist wichtig, aber nur die Richtige, nein die einzige Richtige muß es sein.
Yvonnes Selbststudium der englischen Sprache ging seinen Lauf. Frau Lindberg wurde darauf aufmerksam und bot sich an, zu helfen. In ihrer Jugend war sie viel in London und mußte auch in Deutschland sehr oft mit Engländern reden. So kam es, daß Eva und sie eine Art Privatunterricht bekamen und nach einem Jahr konnte Yvonne zwar nicht fließend sprechen aber das Gespräch in den Ferien mit den beiden Soldaten war ein einziges Gestammel gegen das, was sie nach diesem Jahr gelernt hatte. Etwas anderes kam noch dazu. Im Pfarrhaus ging eine pensionierte Sopranistin ein und aus. Die wurde auf ihre Sprachbegabung aufmerksam und bot an, ihr die Grundbegriffe der italienischen Sprache beizubringen. Yvonne war wie versessen auf Bildung und nahm auch das mit Freuden an. So hatte sie auf einmal vier Sprachen: Deutsch, Russisch, Englisch und Italienisch im Kopf. Sie fühlte sich begnadet und ihre Mutter schüttelte nur den Kopf und verstand die Welt nicht mehr. Yvonne hatte mehr und mehr Zugang zur Bibliothek der Lindbergs und stöberte in den Regalen herum, wann immer die Möglichkeit sich ergab. Der Herr Pfarrer half ihr mehrfach, die geeignete Lektüre auszusuchen. Anfänglich verschlang sie Abenteuerromane aller Art wie Dickens, Yule Verne usw. Aber bald kamen auch schwerere Brocken, schließlich ging sie in das fünfzehnte Lebensjahr und sie war verdammt aufnahmefähig. Sie konsumierte Sachen wie Feuchtwangers „Josephus-Trilogie“, die Werke von Tolstoi und Dostojewski folgten und bald darauf vergrub sie sich in die Fantasien Hermann Hesses. Sie las alles, was ihr unter die Finger kam, schwelgte in Jungmädchenträumen und fühlte sich als Baronesse, die in den Ballsälen russischer Fürsten ihrem Glück entgegenschwebt, als verführerische Kurtisane bei Stendhal, vergoß Tränen mit der unglücklichen Nonne von Diderot oder tanzte als Hermine in Hesses Höllenszenarium aus dem „Steppenwolf“ und wollte zeitgleich den Einsamen, ewig suchenden Wolf als Maria trösten. Sie spielte mit den Glasperlen aus Hesses gleichnamigen Superroman und lernte Gedichte von ihm auswendig. Das Gedicht „Stufen“ wollte sie zum Lebensprinzip erheben - und letztendlich hat sie dieses Prinzip Wirklichkeit werden lassen. Eva war manches Mal sauer, daß ihre Freundin das Lesen anderen Gemeinsamkeiten vorzog. Ebenfalls durch die enge Freundschaft zu Evas Familie lernte sie Musik kennen und lieben. Es gab dort eine umfangreiche Schallplattensammlung und sie wünschte sich nichts mehr als einen Plattenspieler. Ihre Mutter hatte kein Geld für derart Überflüssiges und so mußte sie wieder auf die freundliche Gnade der Lindbergs zurückgreifen. Dort saß sie manches Mal am Klavier und klimperte selbsterdachte Melodien vor sich hin. Mehrmals durfte sie zusammen mit Eva in der Kirche an der Orgel spielen. Spielen ist zuviel gesagt. Eva setzte sich irgendwo in das Kirchenschiff und Yvonne drückte erst vorsichtig eine Taste, untersuchte die Wirkungen der Register und entwarf Tonfolgen, die ihre Herzen und Zwerchfelle erbeben ließen. Eva war ebenfalls beeindruckt von dem Dröhnen. Da sie immer wieder an diesen Veranstaltungen teilnahm, kann es so miserabel nicht geklungen haben.
Yvonnes pubertierendes Kinderleben war das Schönste, das man sich vorstellen kann und es hätte getrost so weitergehen können, wenn nicht das reale Leben draußen vor und hinter der Orgel, den Büchern und den Träumereien auf sie wie auch auf ihre Freundin Eva gewartet hätte. Yvonne war trotz der vielen Ablenkungen die Beste der Schulklasse geblieben. Ihr Klassenlehrer und die über ihm angeordnete Schulhierarchie erwarteten mehr von ihr als nur gute Zensuren. Man wollte sie zwingen, Position zu ergreifen, das hieß politische Position. Sie war natürlich Mitglied der Jungen Pioniere, der großen Kinderorganisation der DDR. Hier wurde außerhalb der Schule das ergänzt, was im Unterricht nicht geschafft wurde - die Erziehung zum sogenannten „Sozialistischen Menschen“, der frei zu entscheiden lernt. Das bedeutete jedoch nichts anderes, als sich die vom Staat vorgeschriebene Meinung und Überzeugung zur eigenen machen, das wiederum hieß, zu bekennen, wie sehr man sein Vaterland zu lieben bereit ist, seine ganze Kraft einsetzen wird, einen Staat nach sowjetischem Vorbild aufzubauen, in dem jeder Mensch frei nach seinen Bedürfnissen leben kann. Alle diese Phrasen wurden im Hause des Pfarrers widerlegt, der Falschheit und Lüge überführt und durch glaubwürdigere Argumente ersetzt. Vor einem Jahr noch hatte Yvonne sich gewundert, daß ein Mädchen wie ihre Freundin Eva nicht an den Pioniernachmittagen teilnahm, daß sie nicht zur im nächsten Jahr anstehenden Jugendweihe angemeldet wurde. Für Yvonne und ihre Mutter waren es Selbstverständlichkeiten, an allen diesen obligatorischen Staatsbürgerpflichten teilzunehmen. Bei diesen Veranstaltungen und deren Vorbereitungen wurde den Kindern viel geboten - Vergnügung, Bildung, Erlebnisse. Das war nicht abzustreiten. Bei Gesprächen mit ihrer Mutter stellte Yvonne fest, daß sich ihre Auffassungen mehr und mehr voneinander entfernten. Die Mutter ließ sich von dem beeinflussen, was sie in ihrer Arbeitsstelle hörte oder in der offiziellen Presse las. Die Tochter dagegen hielt sich ausschließlich an die Gespräche und Argumente der Familie Lindberg. Alles, was sie dort hörte, erschien ihr glaubwürdiger, logischer und vor allem ehrlicher. Sie wog ständig ab, was wohl der Wahrheit am Ehesten nahekommt. Schule - Presse - Radio - oder Lindberg.
Lange behielt sie die Worte im Ohr, die ihre Mutter vorwurfsvoll zu ihr sagte: „Der Staat für dich, Du für den Staat“. Yvonne wollte aber nicht diese Floskel annehmen. Der Staat hatte für sie seine Ehrlichkeit verspielt. Das Wort Opportunismus fiel in diesen Jahren ständig. Es war etwas, das böse und zu verurteilen war. Ein sozialistischer Staatsbürger ist nicht opportunistisch. Er ist ehrlich zu sich und dem Staat. Aber alles, was sie in diesem Alter erfuhr, war, daß man ohne diese Fähigkeit, opportunistisch zu sein, ausgeschlossen wurde aus der sogenannten Gesellschaft. Wenn sie nicht zur Jugendweihe geht, wird sie nicht auf die Oberschule gehen dürfen. Und wenn sie nicht das Abitur machen kann, wird sie nicht studieren können. Also welches Fazit schließt ein Kind von dreizehn Jahren daraus. Es meldet sich zu dieser Jugendweihe an, um keinen Ärger zu bekommen. Alles, was in dem Schulfach Staatsbürgerkunde gelehrt wurde, war damit widerlegt. Yvonne wie auch viele andere kamen in Gewissenskonflikte. Sie wahrscheinlich mehr als manche anderen, denn sie ging zu ihrer Mutter und sagte ihr, daß sie sich weigere, die Jugendweihe zu feiern. Sie möchte zusammen mit ihrer Freundin Eva am Konfirmandenunterricht teilnehmen. Ihre Mutter scheuerte ihr eine links und noch eine rechts. Das war bisher einmalig in ihrem gemeinsamen Leben. Sie verbot ihr den Umgang mit Eva und ihren Eltern. Yvonne heulte, weigerte sich zu gehorchen, lief schluchzend aus der Wohnung und flennte noch immer, als sie bei Lindbergs klingelte. Frau Lindberg tröstete und versprach, das mit der Mutter zu regeln. Yvonne konnte sich nicht vorstellen, daß mit ihrer starrköpfigen Mutter zu reden sei. Aber sie wußte auch noch nicht, daß man Kompromisse machen kann. Jedenfalls klingelte am nächsten Abend Frau Lindberg bei Frau Neufeld und bat, mit ihr reden zu dürfen. Frau Neufeld konnte so stur nicht sein, die fremde Frau vor der Tür stehen zu lassen und bat sie herein und fühlte sich schnell der Gesprächspartnerin bei allen Argumenten unterlegen, konnte nichts erwidern und als ihr nahegelegt wurde, doch in erster Linie die Entwicklung ihrer Tochter im Auge zu haben und ihren Trotz nicht zu schüren durch unüberlegte Verbote, gab Frau Neufeld klein bei, gestattete ihrer Tochter weiterhin den Umgang mit Eva und ihren Eltern und war mit dem Kompromiß, dieses Wort mußte ihr erst erklärt werden, daß man neben der Jugendweihe problemlos auch die Konfirmation feiern könne, einverstanden. Yvonnes Mama antwortete, und das schien ihr bei diesen Entscheidungen das Wichtigste zu sein, daß sie kein Geld hätte für zwei Feiern. Die eine ist schon teuer genug. Frau Lindberg war hoch erfreut. Was Yvonne nach dieser Entscheidung nicht begriff: wenn das das einzige Problem war, braucht Mama sich doch überhaupt keine Sorgen zu machen. Konfirmation heißt doch nicht, Geld für eine Feier ausgeben müssen, sondern, daß das Kind in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen wird und auf dem Wege in die Selbständigkeit ist. Mehr vom Wesen dieser Konfirmation erklärte Frau Lindberg gar nicht, weil das Frau Neufeld doch nicht verstanden hätte.
Yvonne hatte wieder freien Zugang zum Hause der Lindbergs und Eva konnte ihre Freundin bleiben für immer. An einem der nächsten Tage bat Herr Lindberg Yvonne, in sein Arbeitszimmer zu kommen und fragte sie nach ihren Absichten und ob sie wirklich an den Konfirmandenstunden teilnehmen und sich im nächsten Jahr zusammen mit seiner Tochter konfirmieren lassen möchte. Yvonne antwortete: „Wenn Sie mir vorher genau erklären, was das bedeutet, konfirmiert zu werden, wenn ich es verstehe und danach immer noch möchte, bin ich einverstanden.“ Er sagte daraufhin, daß er das natürlich liebend gern tun würde, von ganzem Herzen. Und er wies sie auch darauf hin, daß sie völlig frei in ihren Entscheidungen sei, daß das keinerlei Vorbedingung für etwas Späteres sei. Er spielte vorsichtig auf das Thema Jugendweihe an. Viel später erzählte ihr Eva, daß er ihre Antwort als sehr intelligent und regelrecht weise empfand. Er fragte Yvonne, ob sie denn getauft ist und sie konnte nur sagen, daß sie das glaube. Als ihre Mutter mehrere Stunden außer Haus war, machte sie sich auf die Suche nach einem Taufschein und wurde sogar fündig. Als sie damit zu Herrn Lindberg kam, wußte der schon Bescheid, denn er hatte im Kirchenbuch des Jahres 1943 die gesuchte Eintragung gefunden. Andernfalls hätte er die Taufe bei einem der Gottesdienste nachholen müssen. Er sagte noch, daß das so besser für sie wäre. Man sollte in der heutigen Zeit möglichst wenig Staub aufwirbeln. Ab diesem Zeitpunkt war Yvonne Mitglied der Evangelischen Gemeinde der Stadt Wernigerode. In der Schule erzählte sie nichts darüber, aber es kam immer wieder vor, daß sie einige Lehrer nicht direkt, aber mit spitzen Bemerkungen darauf aufmerksam machten, daß sie eine sei, die auf zwei Hochzeiten tanzt und der man wohl nicht allzuviel Vertrauen schenken dürfe, wenn es um die große Sache gehe. Es waren nicht nur Lehrer, die derartige Meinungen vertraten. Es waren die Menschen, die glaubten, ihren Opportunismus überwunden zu haben und sich voll und ganz der Dummheit der Staatsdoktrin ergeben hatten - in dem einfältigen Glauben, zu dem zu stehen, was sie von sich gaben. Natürlich hatten sie Recht mit der Erkenntnis, daß Yvonnes Interesse an der Konfirmation - nicht das an Familie Lindberg - aus einer Trotzreaktion heraus entstanden war. Sie war nicht mit den Lügen einverstanden, die sie tagtäglich hören mußte. Und das Schlimmste dabei war, daß diese Lügen von den Menschen verbreitet wurden, die Vorbild sein wollten und die, so schien es, nicht einmal merkten, wie sehr sie sich in Unwahrheiten verstrickten. Alle die „überzeugten“ Genossen der Partei haben am Abend heimlich die Nachrichten aus dem Westradio gehört, um auf dem Laufenden zu sein, aber am nächsten Tag predigten sie das, was die Staatspresse ihnen vorschrieb und das war meist das Gegenteil von dem am Vorabend Gehörten. So gewöhnten sich alle mehr und mehr an diese Lügenpropaganda. Alle lebten damit - die, die Unwahrheiten und Lügen gewissenlos verbreiteten und die, die sie hörten und als solche abtaten. Sehr wenige wagten es, offen etwas dagegen zu sagen, denn alle hatten noch den 17. Juni 1953 in Erinnerung, als sowjetische Panzer die Wahrheit brutal überrollten und ihr ein jähes Ende setzten. Im Pfarrhaus konnte man freier reden als draußen, auch wenn Herr Lindberg stets darauf achtete, daß nichts gesagt wurde, aus dem man ihm oder einem der Anwesenden einen Strick hätte drehen können. Von Eva, ihrer engsten Vertrauten, erfuhr Yvonne allerdings manches, was nicht für ihre Ohren bestimmt war. Oft war sie entsetzt, wenn Eva heimlich erzählte, daß jemand im Gefängnis gelandet war, weil er den Mund zu weit aufgemacht hatte. Sie erzählte von Kinderheimen, in denen die Kinder der langjährig Inhaftierten zu „ordentlichen“ Menschen erzogen wurden. Yvonne trauerte um die Betroffenen, die der Willkürherrschaft zum Opfer gefallen waren und sie lebte in der Angst, daß auch ihr ähnliches widerfahren könnte. Ein kleiner Anstoß hätte dafür ausgereicht. Mit ihrer Mutter kam Yvonne überein, daß die bescheidene Feier zur Konfirmation und nicht zur nachfolgenden Jugendweihe stattfinden sollte. Der Mama war das egal. Von Eva durfte sie sich ein Kleid für beide Anlässe borgen. Familie Lindberg hatte es vorbereitet, daß Yvonne zusammen mit Eva im Pfarrhaus einen wunderschönen Nachmittag und Abend haben sollten. Yvonnes Mutter war eingeladen und hatte die Einladung erstaunlicherweise angenommen. Sie betrachtete ihre schöne erwachsen werdende Tochter voller Stolz. Yvonne sah schick aus und konnte sich mit den anderen bestens unterhalten. Ihre Mutter saß sehr zurückhaltend auf ihrem Stuhl und antwortete nur auf Fragen - und auch das nur sparsam. Sie fühlte sich nicht sehr wohl in ihrer Haut zwischen den anderen. Die Gesellschaft war groß und Yvonne glaubte, daß Mutter noch nie vorher in einer solchen Gesellschaft war. Als sie die „Einsamkeit“ ihrer Mutter spürte, kümmerte sie sich intensiver um sie, nahm sie vor allen anderen in den Arm. Danach taute sie etwas mehr auf und Yvonne beobachtete daß sie sich mit Frau Lindberg längere Zeit angeregt unterhielt. Am nächsten Tag stellte Frau Lindberg mehrere gezielte Fragen nach Yvonnes Vater und bekundete damit, daß sie mehr wußte, als Yvonne ihr und auch Eva je erzählt hatte. Die offizielle Feier der Jugendweihe rückte immer näher. Alle Teilnehmer, das waren alle Schüler der Altersklassen aus sämtlichen Schulen der Stadt, probten die Feierstunde in der „Halle des Friedens“. Yvonne kam alles albern vor. Als sie den Text des Gelöbnisses mitsprechen sollte, glaubte sie, einen Kloß im Hals zu haben und sagte „Nein“ zu sich und schwieg. Das wiederum fiel dem FDJ-Funktionär auf und sie wurde vor versammelter Mannschaft zur Ordnung gerufen: „In deiner Kirche kriegst Du den Mund nicht zu und hier zierst Du Dich! Am Sonntag will ich Dich aus allen heraushören, verstanden!“ Diese Art Tonfall war üblich bei Schülern, die nicht ganz so wollten wie es gewünscht war. Sie las zu Hause den Text der zehn Gebote des Gelöbnisses noch einmal genau durch und entschied, diese Worte, diese Befehle, nicht zu sprechen. Wie oft fiel im Staatsbürgerkundeunterricht das Wort Lippenbekenntnis und wie sehr wurde ein solches verachtet. Sie entschied sich genau dafür und bewegte nur die Lippen und hielt ihr Gewissen sauber - ohne „Bekenntnis“.
Am besagten Sonntag interessierte sich keiner dafür, wie laut Yvonne mitsprach. Die Feierstunde selbst war bestens organisiert. Eine Musikkapelle sorgte für den kulturellen Rahmen. Der Schulchor sang kämpferische Lieder und ein Redner hielt eine lange Rede - eine Aneinanderreihung der gewohnten Klischees. Es gab mehrere Mitschüler, von denen Yvonne wußte, daß sie einer Meinung mit ihr waren, aber nicht wagten, was sie tat. Stolz war Yvonne deshalb nicht, aber es tat gut, ehrlich gewesen zu sein. Ihre Mutter saß unten im Saal in der dritten Reihe und Yvonne sah, daß sie Tränen in den Augen hatte. Dieses Ritual ging ihr mehr nahe als die Konfirmationsfeier. Sie mußte sich nicht konzentrieren. Hier war ihr die Thematik vertraut, denn sie war inzwischen in ihrem Industriebetrieb zur Sekretärin eines der Chefs emporgestiegen und hatte mit diesen Klischees tagtäglich zu tun. Die Bindung ihrer Tochter zur Kirche war ihr unheimlich. Das hatte Yvonne mehr und mehr am Küchentisch oder wo auch immer zu spüren. Yvonne war sich der ärmlichen Verhältnisse ihres Elternhauses bewußt, hatte aber das beste Zeugnis der Klasse und wurde wider Erwarten zum Besuch der Oberschule zugelassen. Das mit ihrer Konfirmation wußten alle, vom Schulkameraden bis zum Schuldirektor. Später wurde im Pfarrhaus erzählt, daß man Schüler wie sie braucht, um den Zensuren durchschnitt hochzuhalten. Ab 1. September 1959 ging sie in eine andere Schule. Neue Umgebung, neue Anforderungen, neue Schulkameraden. Eva und sie blieben zusammen - das war die Hauptsache für beide. Sie waren unzertrennlich und ihr Verhältnis festigte sich weiter. Ihnen machte das Lernen Spaß und sie hatten weiterhin stets beste Zensuren. Etwas anderes kam auf Yvonne zu, daß ihr ganzes Leben maßgeblich beeinflussen sollte - eine Krankheit - unheilbar, selten und folgenschwer.
Die Jugend
Es war im Sommer des Jahres 1960, als sich im Leben der jungen Yvonne Neufeld eine Wende einstellte. Sie hatte in den letzten Monaten ab und zu Kopfschmerzen, die sich mit gängigen Schmerztabletten in den Hintergrund schieben ließen, aber als sie mit der Schulklasse in einem Ferienlagen an der Ostsee war, nahmen die Schmerzen an Häufigkeit zu und wurden Migräneanfälle, die ihr den Urlaub zur Qual werden ließen. Yvonne wollte das Abitur machen. Sie wählte den sprachlichen Zweig, weil neben der ersten Fremdsprache Russisch noch fakultativ Französisch gelehrt wurde. Sie schrieb Kartengrüße an ihre Mama, auch an Evas Eltern, aber jeder konnte sie nur bedauern. Sie lag im Zelt und heulte vor Schmerzen, hatte das Gefühl, daß ihr der Schädel zerplatzt, während die anderen im Sand und in den Wellen tobten. Sie erfuhr die ersten Liebesabenteuer, aber alle Freuden vielen in sich zusammen, da sie im Bett lag und heulte.
Wieder im Alltag konsultierte sie Ärzte, die sich bemühten, sie von einem zum nächsten Spezialisten schickten. Sie berichtete von ihren Schmerzanfällen, die aus heiterem Himmel ihren Kopf dröhnen ließen, sie in das Bett zwangen, Übelkeit und Erbrechen begleiteten die Anfälle. Die Ärzte diagnostizierte einstimmig Migräne, die sich, so wäre zu hoffen, im Laufe der nachpubertären Entwicklung, spätestens nach der ersten Schwangerschaft in Luft auflösen. Das war zwar ein kleiner Trost, half ihr aber vorerst nicht weiter. Sie bekam schmerzstillende und beruhigende Medikamente, die auch ihre Wirkung nicht verfehlten, aber an eine Heilung war nicht zu denken. Es gab Zeiten, an denen sie sich fast normal fühlte, aber Aufregungen oder körperliche Anstrengungen machten ihr zu schaffen. Insbesondere die Sommermonate waren nervenaufreibend, so daß sie sich nicht aus dem Haus wagte. Ihr Trost war das Lernen mit dem Ergebnis, stets beste Zensuren zu haben.
Eva blieb nicht nur ihre engste Freundin. Sie drückten die gleiche Schulbank. Wie es ihre Eltern, schließlich eine Pastorenfamilie, in dem totalitären DDR-System, geschafft hatten, Eva den Besuch der Oberschule zu ermöglichen, wußte Eva selbst nicht. Beide freuten sich riesig drüber, gemeinsam büffeln zu können und Eva half ihr liebevoll, wenn die Freundin mehrere Tage mit Migräne im Bett bleiben mußte.
Yvonnes Mutter begann, die Stufen ihrer beruflichen Karriereleiter Schritt für Schritt emporzusteigen. Ihr Betriebsdirektor bot ihr an, Mitglied der Partei SED zu werden. Yvonne fand es abscheulich, daß ihre Mutter dazu ja sagte, konnte aber nichts dagegen unternehmen. Sie sagte nur: „Muß das denn sein?“ und bekam eine der bekannten Floskeln zur Antwort: „Der Staat für mich - ich für den Staat!“ Yvonne mußte feststellen, daß ihre Mama es auf ihre Art ehrlich meinte, denn sie glaubte an den sogenannten Sieg des Sozialismus und all diesen Humbug. Als ihre Tochter es wagte, zu erwähnen, daß man schon einmal an einen „Endsieg“ glaubte, hob ihre Mutter ihren rechten Arm, um Yvonne eine zu scheuern, doch die war schneller und der Schlag ging ins Leere. Yvonne registrierte, daß dies die zweite körperliche Züchtigung im gemeinsamen Leben mit ihrer Mama gewesen wäre. Sie mußte feststellen, daß sich die Herzlichkeit in ihren Beziehungen stetig mehr abkühlte. Die Tochter stand zu sehr auf der anderen Seite. Die Kehrseite war, daß das Gehalt Frau Neufelds aufgestockt wurde und die Ärmlichkeit ihrer Verhältnisse nicht mehr so vordergründig war. Das wiederum gönnte ihr auch Yvonne, denn daß sie es in den ganzen Jahren verdammt schwer hatte, tat ihr stets sehr leid und sie liebte sie um so mehr - trotz der Meinungsverschiedenheiten. Sie zog von der Nähmaschine in ihrem Wohnzimmer in die Chefetage, wurde Sekretärin des Kaderleiters und war stolz auf diese Position, noch stolzer darauf, daß sie ab jetzt mit den sogenannten „vertraulichen und geheimen“ Sachen des Betriebes zu tun hatte. Sie mußte unterschreiben, daß sie keine Beziehungen zu Personen hat und haben wird, die in Westdeutschland leben. Man konnte zusehen, wie sie begann, aufzublühen. Sie kleidete sich sorgfältiger, versuchte, ihre Art zu reden der Ausdrucksweise der Kollegen anzupassen. Sie wurde zusehends zu einer attraktiven Frau und genoß die Blicke und Bemerkungen der männlichen Kollegen. Bei betrieblichen Veranstaltungen durfte sie am Tisch der Direktoren sitzen und ihr Selbstwertgefühlt steigerte sich um die nächste Größenordnung. Sie machte es sich endgültig zum Lebensprinzip, keine eigene Meinung zu haben. Die vorgeschriebene Parteimeinung war für sie bindend und sie nahm alles für bare Münze, was in den Zeitungen stand und ihr Direktor erzählte. Erstmals ab 1. Januar 1960 kam jeden Morgen die Tageszeitung „Neues Deutschland“ ins Haus. Früher konnte sie sich eine Tageszeitung nicht leisten. Sie gehorchte ihrer Parteigruppe aufs Wort und verbat ihrer Tochter, im Radio westdeutsche Sender zu hören. An der Stelle wurde es Yvonne zu bunt und sie weigerte sich, zu gehorchen. Mama gestand: „Ich komme in Teufels Küche, wenn es herauskommt, daß in meiner Wohnung Westradio gehört wird.“ Wie war das mit dem Opportunismus? Yvonne fragte ihre Mutter, ob sie nicht damals in den letzten Wochen des Krieges auch heimlich vor der Göbbelsschnauze gesessen und Radio London gehört hat. „Das kannst Du doch damit nicht vergleichen!“, war ihre Reaktion. Yvonne wollte und konnte sich nicht verbieten lassen, eine eigene Meinung zu bilden. Derartige Auseinandersetzungen gab es häufig und es entwickelte sich zunehmende Distanz zwischen Mutter und Tochter.
Es war im Herbst 1960, als es eines Tages in der Schule zu großer Unruhe kam. Zwei Mitschüler wurden zum Direktor befohlen. Eine Woche später kam es zu einer sogenannten Verhandlung, zu der auch die FDJ-Sekretäre zu kommen hatten. Yvonne war es peinlich, daß sie gezwungenermaßen auch in diesen Verein eintreten mußte, sich aber weitestgehend von allem, was dort gemacht wurde, fernhielt. Das Ergebnis dieser Verhandlung wurde durch den Schuldirektor persönlich während der gerade anstehenden Unterrichtsstunde im Fach Staatsbürgerkunde bekanntgegeben und hatte zum Inhalt, daß diese beiden Schüler für ein Vierteljahr vom Unterricht suspendiert wurden und sich in der Industrie zu bewähren hatten. Das bedeutete im Klartext, sie durften die Höfe kehren, Kohlen schaufeln und andere Drecksarbeit verrichten. Wenn sie sich gut führen, dürfen sie ab Januar wieder die Schule besuchen. Yvonne empfand das als einzige Schande und derart erniedrigend, daß ihr die Worte fehlten. Besonders entsetzt war sie darüber, daß ausgerechnet ihre Mutter in diese Geschichte verstrickt war. Alles war nur konstruiert, um ein Exempel zu statuieren. Wer sich gegen die Staatsmacht aussprach, hatte mit derartigen Folgen zu rechnen. Das war im Mittelalter schon die gängige Praxis. Als Yvonne ihre Mutter zur Rede stellte, war der darüber nichts bekannt, allerdings rötete sich ihr Kopf bei ihrer verneinenden Antwort. So weit war es also gekommen mit der sozialistischen Schleimerei. Yvonne ekelte das derart an, daß sie für eine Woche im Bett verschwand.
Nach den drei Monaten kamen die beiden Verurteilten wieder zurück und die Lehrer taten so, als wäre nichts geschehen. Sie halfen ihnen, den versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen und alle bekundeten möglichst unter vier Augen ihr Bedauern. Yvonne war es verständlicherweise besonders unangenehm, ihnen unter die Augen zu treten, aber andere hatten bereits von dem angespannten Mutter-Tochter-Verhältnis berichtet und sie hatte eher das Gefühl, daß sie bemitleidet wurde - auch von den beiden Jungen.





























