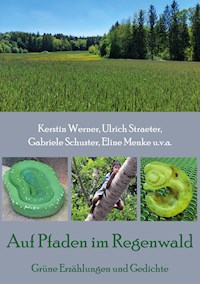Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Bei einem Sturm landen Schiffbrüchige in einem Boot an der Ostseeküste. Eine sonderbare Münze aus Sowjetzeiten gibt Rätsel auf. Aus einem tauenden Gletscher wird eine Leiche geborgen. Was ist damals geschehen und wird sich das Geheimnis der dritten Patrone enthüllen? Auf sehr speziellen Baupfusch und mysteriöse Netzwerke stößt eine Kriminalerzählung aus der arabischen Welt. Eine junge Frau sprüht Symbole für die Klimarettung auf eine Hauswand. Sie wird von Blaulicht überrascht, kann sie den Polizisten entkommen? Die Herero und die Schlacht am Waterberg rücken in den Blick, die Verbrechen der deutschen Schutztruppen in Namibia. Von einem Schuljungen und seinem Schicksal berichten Fragmente aus seinem Leben, nichts schützt ihn vor der drohenden Gefahr. Einem Flugzeugabsturz folgt ein strapaziöser Trip durch den Urwald, kriminelle Gestalten waren mit an Bord. Ein Baby, ausgesetzt auf einer Parkbank, wird von der Mutter wieder zurückgeholt. Die Kette ihrer Missgeschicke und Fehlentscheidungen legt die Autorin offen. Der Band enthält auch einige Kriminalgedichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 781
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Kerstin Werner
Das Geständnis
Susanne Schwertfeger
Die dritte Patrone
Gisela Seekamp
Blut ist nicht gleich Blut
Gennadi Ratson
Eine nasse Polyglottin
Janne Köder
Für eine bessere Welt
Jutta Schöps-Körber
Das Unglück hält sich nicht an Besuchstage
Marko Ferst
Der Freund und das Fensterkreuz
Kai Schwarz
In und unter den Wolken
Klaus J. Rothbarth
Weiße Farben. Kriminelle Spuren in einer arabischen Welt
Manfred Ach
Kriminelle Farbenlehre
Carsten Rathgeber
Rosenmord – Aus heiterem Himmel
Welten-Prozess
Poröse Seele
Alexander Walther
Epilog für Jean Paul
Marko Ferst
Erosion
Kinder
Ann-Helena Schlüter
Betrug
Hängend
Volker Teodorczyk
Ehezwist
Tätersuche
Didi Costaire
Worte
Kopfschütteln
Michael Matzke
Blutspur
Cold Case
Neffentrick
Darknet
Dallas 1963
Waltraut Lühe
Das Grab
Sonja Guldi
Die Katze
Heidi Axel
Ein böser Zwilling kommt selten allein
Marion Otto und Steffi Beyersdorf
Gefährliche Heilkunde
Sina Brooren
Fahrrad
Ursula Strätling
Wolfs Hunger
Bernharda May
Kupferne Hochzeit
Svenja Kaiser-Heykes
Die Kaffeemühle
Karsten Beuchert
Schlaflos
Ein Vorfall bei Wendler
Sanatorio del Gottardo
Auflösung
Stefan Wetterau
Der Oma-Trick
Julia Raba
Das Dorf
Grete Ruile
Das Geheimnis der Toten von Falein
Vergangenes enthüllt sich in der Gegenwart
Eisgekühlt
Esther Wäcken
Der Tod der Spinnenfrau
Tod am Strand
Marita Wilma Lasch
Der Reinfall
Simone Schmitt
Ausgleich
Anette Felber
Mörderjob
Marcel Zischg
Noel gehört nicht dazu
Carsten Rathgeber
Spesenabrechnungen
Zwillingsschwestern
Metallkugeln
Peggy Christianus
Die Leiche im Tierpark
Ein Glas Rotwein zu viel?
Regina Holzkämper
Bretonisches Finale
Cleo A. Wiertz
Nachbarschaft
Ingo Anspach
Spuren vom Tatort
Gabriele Guratzsch
Kleiner Krimi
Alexander Henning Smolian
ein experte
jemand
ein fahrradkeller
eine kriminalkomödie gesehen
Kathrin Ganz
Blumen am Tatort
Autorinnen und Autoren stellen vor
Kerstin Werner
Das Geständnis
Dreieinhalb Jahre muss ich hier im Frauengefängnis absitzen. Man hat mich in einer Einzelzelle untergebracht, worüber ich sehr froh bin. Ich habe alles, was ich brauche: eine Pritsche, einen Tisch mit Stuhl, einen Schrank mit meinen Sachen, ein kleines Regal mit Büchern, die ich mir hier in der Bibliothek ausgeliehen habe, ein Waschbecken und ein WC. Ich will allein sein, mit niemandem sprechen. Mich interessieren die Geschichten der anderen Frauen nicht, oder besser gesagt – nur wenig. Ich muss mit meiner eigenen Geschichte fertig werden. Sie verfolgt mich bis in meine Träume. Es sind immer wiederkehrende Alpträume, die mir Angst machen. Anfangs fand ich nachts gar keinen Schlaf, die Gedanken und furchtbaren Bilder kreisten in meinem Kopf umher, doch seitdem ich in der Wäscherei arbeiten darf, bin ich so erschöpft, dass ich wieder schlafen kann. Nur die Alpträume werde ich nicht mehr los. Man hat mir erlaubt, einen Stift und ein Notizbuch bei mir zu haben. Meine Gefängnispsychologin riet mir, alles aufzuschreiben, was passiert ist, auch wenn der Prozess bereits beendet ist. Es sei für meine weitere Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig, denn nur so könnte ich das Geschehene besser verarbeiten und wieder zu mir selbst finden. Ich habe alles gestanden, der Druck war zu groß, ich hielt es nicht mehr aus. Dennoch habe ich nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Hat mein Leben überhaupt noch einen Sinn?
Ich sitze an meinem kleinen Tisch und schlage mein Notizbuch auf, welches mir Susan auf meine Bitte hin kürzlich mitgebracht hat. Ein schlichtes Buch mit festem Einband, ohne Zeilen, jede Seite schneeweiß. Und leer. Wo soll ich anfangen?
Ich habe Ralf in einer Bar kennengelernt. Als ich mit meinem Praktikum in einem Pflegeheim begonnen hatte, ging ich abends oft dorthin, um einfach nur abzuhängen, auf andere Gedanken zu kommen und neue Leute kennen zu lernen – und vor allem um Abstand zu gewinnen vom zermürbenden Alltag im Pflegeheim. Susan, die schon länger im Heim arbeitete, nahm mich einmal mit ins Lokal, und seitdem fand ich Gefallen daran und konnte nicht mehr davon lassen, es war wie eine Sucht und schon am Morgen freute ich mich auf den Abend. Das schien für mich das eigentliche Leben zu sein, dort fühlte ich mich frei und sorglos. Ich zweifelte immer mehr an meinem Berufswunsch, denn so anstrengend und furchtbar hatte ich mir die Arbeit im Pflegeheim nicht vorgestellt. Die alten Menschen krallten sich an mir fest, sie wollten reden, mich anfassen, aber ich hatte keine Zeit, ihnen länger zuzuhören. Mir fiel es schwer, sie zu berühren, mir war schlecht vom Geruch, der von ihnen ausging. Aber da musste ich durch. Ich musste sie waschen, füttern und trösten. Das Schlimmste aber war das Wechseln der Windeln. Für mich eine Katastrophe, aber ich schaffte es. Stolz war ich darauf nicht, mich bedrückte die Arbeit, und ich war froh, wenn ich nachmittags das Heim verlassen konnte. So hatte ich mir mein Praktikum nicht vorgestellt. Wenn ich wieder zu Hause war, wurde ich den Geruch in der Nase nicht los, ich sah die Bilder vor mir, wie die Alten in ihren Rollstühlen saßen und vor sich hindösten. Es war ein Jammer. Ein Elend. Ich konnte zu Hause nicht abschalten.
Dennoch war es mein eigener fester Entschluss, als Altenpflegerin zu arbeiten. Im zwölften Schuljahr zog ich in eine Einraumwohnung, da meine Eltern sich schon seit einigen Jahren getrennt hatten und ich nur noch raus wollte. Kaum war ich eingezogen, lernte ich meine Nachbarin kennen, eine kleine rundliche Frau, zweiundachtzig Jahre alt, deren Mann bereits vor neun Jahren verstorben war und die nun ganz allein in ihrer Wohnung lebte; leider hatten sie keine Kinder. Frau Jahnke war sehr lieb zu mir und verwöhnte mich wie eine Großmutter. Hin und wieder ging ich für sie einkaufen oder holte ihr Medikamente aus der Apotheke, und dafür war sie mir dankbar. Manchmal lud sie mich zu einer Tasse Kaffee ein, dann saßen wir gemütlich in ihrem Wohnzimmer und plauderten. Eigentlich hatte ich gar keine Zeit, denn ich musste für das Abitur lernen, meine Noten sahen nicht sehr rosig aus. Eines Tages sagte mir Frau Jahnke, dass sie sich in einem christlichen Seniorenheim angemeldet habe, denn sie wüsste nicht, wie lange sie noch allein zurechtkäme. Sie hatte Geld dafür gespart und hoffte nun auf einen Platz, auch wenn sie wusste, dass es Jahre dauern könnte, solange sie noch kein Pflegefall sei. Das beeindruckte mich und seitdem reifte in mir der Entschluss, Altenpflegerin zu werden. Und da ich vorhatte, ein Freiwilliges Soziales Jahr nach dem Abitur zu absolvieren, bewarb ich mich zunächst für ein einjähriges Praktikum in dem christlichen Seniorenheim, das sich meine Nachbarin ausgesucht hatte. Doch leider war dort kein Praktikumsplatz frei, sodass ich es in einem anderen Pflegeheim probieren musste und dort angenommen wurde.
Meine anfängliche Euphorie hatte sich aber schnell gelegt, und ich zweifelte immer mehr, ob ich überhaupt mein Praktikumsjahr durchhalten würde. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass die tägliche Arbeit im Pflegeheim so anstrengend sein kann, dass ich nicht einmal zu Hause abschalten konnte. Auch für meine Nachbarin fand ich kaum noch Zeit, ich war so erschöpft, dass ich mich erst hinlegen musste, um abends wieder fit zu sein.
Denn nur in der Bar, so schien es mir, fand ich genügend Ablenkung; ich trank mit Susan und einigen Männern ein Bier, sie schienen sich zu freuen, uns zu sehen, denn Frauen waren hier eindeutig in der Minderheit, und es ging oft sehr lustig zu. Tom konnte Witze erzählen wie kein anderer. Er war noch Lehrling, wurde aber von seinen Kollegen akzeptiert. Sie mochten ihn, er strotzte so vor Optimismus, dass es für alle ansteckend war. Ich weiß nicht, woher ich den Mut nahm, auch allein dorthin zu gehen, immerhin war ich erst neunzehn, aber die Männer, die um vieles älter waren als ich, taten mir nichts Böses. Ihre Ausgelassenheit gefiel mir. Wenn Susan keine Spät- oder Nachtschicht hatte, setzte sie sich aber sofort zu mir, und manchmal redeten wir von Frau zu Frau, leise, damit die Männer es nicht hören konnten. Das Lokal lebte von seinen Stammkunden, aber immer wieder begegneten mir auch fremde Gesichter. Oft beobachtete ich sie und fragte mich, ob sie zufrieden mit ihrem Leben waren. Und da saß Ralf, etwas abseits von der Bar, an einem kleinen Tisch neben einem Fenster. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Er wirkte traurig. Immer wieder schaute ich zu ihm herüber, bis unsere Blicke sich trafen.
Am nächsten Abend sah ich ihn wieder. Er kam mir so verloren vor, irgendetwas schien ihn zu bedrücken. Auf einmal verspürte ich das Bedürfnis, zu ihm zu gehen, aber ich traute mich nicht. Erst als ich begriff, dass auch er mich beobachtete, wurde mir ganz heiß. Ich saß wie angewurzelt auf meinem Stuhl und umklammerte mein Glas Bier. Den Männern hatte ich mich an diesem Abend nicht angeschlossen, mir war nicht zum Lachen zumute. Im Heim war ein Mann qualvoll an einer Lungenentzündung verstorben, obwohl er mit Morphiumspritzen versorgt wurde. Ich hatte noch nie einen Toten gesehen. Ich weigerte mich, ihn zu waschen, und das brachte mir großen Ärger ein. Aber ich war doch nur Praktikantin! Wie sollte ich einen Toten waschen? Ich hatte einfach Angst. Ich wollte mit jemandem darüber reden, aber Susan fehlte mir schon seit einigen Tagen, sie hatte die ganze Woche Nachtdienst. Als ich mein Bier ausgetrunken hatte, nahm ich all meinen Mut zusammen und ging zu ihm hinüber. Er schaute mich verdutzt an, sagte aber nichts.
„Hi. Ist hier noch frei?“
Er nickte.
„Ich bin Grit“, sagte ich und setzte mich.
Er schwieg.
„Was machen Sie so? Sind Sie oft hier?“
Er zuckte mit den Schultern und schien zu überlegen, was er mir antworten sollte.
„Ich gehe fast jeden Tag hierher, um abzuschalten“, sagte ich und wartete auf eine Reaktion. „Ich mache gerade ein Praktikum in der Altenpflege. Ist nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe.“
Er schaute mir lange in die Augen, bis ich seinem Blick nicht mehr standhielt. Am liebsten wäre ich aufgestanden, ich kam mir verdammt blöd vor. Warum erzählte ich ihm das?
„Du kannst ruhig du zu mir sagen“, sagte er plötzlich. „Ich bin Ralf. Ich arbeite als Mikrobiologe.“
„Wow.“
„Willst du einen Whisky?“
„Weiß nicht. Hab so etwas noch nie getrunken.“
Ralf bestellte uns jedem einen Whisky und das Zeug schmeckte mir erstaunlicherweise gut, auch wenn es mir im Hals brannte. Nach dem zweiten Glas war ich betrunken. Ich verspürte auf einmal keine Hemmungen mehr. Ich erzählte ihm vom Altenheim und er hörte mir aufmerksam zu. Es stellte sich heraus, dass sein Großvater im selben Heim untergebracht war, allerdings auf der Demenzstation. Gegen halb elf wollte ich nach Hause. Ralf hatte nichts von sich erzählt, aber ich wollte ihn auch nicht bedrängen. Nur eine Frage schoss mir unentwegt durch den Kopf: War er verheiratet oder solo?
Seit diesem Tag traf ich ihn oft in der Bar, aber nie kam er auf mich zu. Das verunsicherte mich, doch sobald ich mich zu ihm gesetzt hatte, spürte ich eine gewisse Vertrautheit zwischen uns. Und endlich begann er von sich zu erzählen. Er war sechsunddreißig Jahre alt, verheiratet und hatte ein körperlich behindertes Kind aus erster Ehe. Seine jetzige Frau war Ärztin und für beide stand von Anfang an fest, dass sie keine Kinder haben wollten. Doch da seine Frau sich als Ärztin selbstständig gemacht und eine eigene Praxis eröffnet hatte, blieb ihnen kaum noch Zeit füreinander. Manchmal hasste er sie dafür, für ihren Ehrgeiz, für ihre Karriere. Immer wieder bedrängte sie ihn, ebenfalls eine Doktorarbeit zu schreiben, aber das wollte er nicht. Doch jetzt hatte sich erneut eine Gelegenheit ergeben, und nun überlegte er, das ihm angebotene Forschungsprojekt anzunehmen. Eigentlich könnte er mit seinem Leben zufrieden sein, aber er war es nicht. Es passierte nichts Aufregendes mehr in seiner Ehe, und er hatte schon seit zwei Jahren nicht mehr mit seiner Frau geschlafen.
Und dann geschah das Unvermeidliche. An jenem Abend im Dezember, als Ralf mich nach Hause brachte, nahm er mich plötzlich in seine Arme und küsste mich zum Abschied. Ich ließ es geschehen, aber diese körperliche Nähe brachte mich völlig aus der Bahn, denn bisher achtete er sehr auf Distanz. So sehr ich ihn auch mochte, wollte ich doch keine Affäre mit einem verheirateten Mann. Ich fühlte mich ihm geistig unterlegen und hatte Angst, ihn als Freund zu verlieren. Trotzdem kam es, dass er mich Tage später überredete, ihn mit in meine Wohnung zu nehmen, und kaum hatte ich die Tür hinter mir geschlossen, fiel er über mich her. Ich versuchte, innerlich stark zu bleiben, aber meine Gefühle für ihn waren so intensiv, dass ich ihm nicht widerstehen konnte. Wir liebten uns auf dem Bett in meinem einzigen Zimmer, wir waren ganz wild aufeinander und ich vergaß alle meine Vorsätze, ich wollte ihn nicht mehr loslassen.
Doch am nächsten Abend kam er nicht mehr in die Bar, und auch in den darauffolgenden Tagen und Wochen sah ich ihn nicht wieder. Ich fühlte mich sofort schuldig. Warum hatte ich mich nur mit ihm eingelassen? Genau wie ich es befürchtet hatte, würde ich ihn vermutlich für immer verloren haben. Was hatte ich mir erhofft? Ich wusste es nicht. Plötzlich begriff ich, dass ich ihn auch nicht erreichen konnte, denn wir hatten keine Handynummern ausgetauscht.
Einen Monat später spürte ich eine Veränderung in meinem Körper und ich ahnte, dass ich schwanger war, denn auch meine Regelblutung war ausgeblieben. Noch am selben Tag kaufte ich mir in der Apotheke einen Schwangerschaftstest und zu Hause bestätigte sich meine Vermutung. Ich begann, am ganzen Körper zu zittern.
„Das darf nicht sein“, schoss es mir durch den Kopf, das ist völlig unmöglich. Was soll ich jetzt mit einem Kind? Ich war verzweifelt und machte mir unentwegt Vorwürfe. Wie konnte ich nur so unvorsichtig gewesen sein? An diesem Abend blieb ich zu Hause und fühlte mich schrecklich einsam.
Am darauffolgenden Tag sagte ich niemandem etwas, auch nicht Susan. Sie fragte mich nur, warum ich mich nicht mehr mit „Herrn Doktor“ treffe. „Keine Ahnung“, sagte ich, „er kommt einfach nicht mehr.“ Damit war das Thema beendet, Susan fragte nicht wieder nach. Tatsächlich hatte ich Ralf in der Bar nicht wiedergesehen, seit er die Nacht bei mir gewesen war. Hatte er es bereut? Oder gab es Probleme mit seiner Frau? Ich wusste es nicht und wartete jeden Abend auf ihn. Ich gab die Hoffnung nicht auf, dass er eines Tages wieder auftauchen würde.
Doch mit meiner Schwangerschaft änderte sich komplett mein Leben. Jetzt wartete ich so sehnsüchtig auf Ralf, dass ich an nichts anderes mehr denken konnte. Warum ließ er mich plötzlich allein zurück, nachdem was geschehen war? Bedeutete ich ihm nichts? Tagelang blieb ich im Ungewissen, ich grübelte, was geschehen sein konnte, bis ich auch dafür keine Kraft mehr fand. Inzwischen war mir so übel, dass die Arbeit im Pflegeheim mich enorm anstrengte, immer wieder musste ich zur Toilette rennen, um mich zu übergeben. Abends ging ich nicht mehr in die Bar, ich konnte keinen Alkohol mehr riechen, und ich war auf einmal so müde, dass ich schon gegen neun ins Bett fiel. Aber ich verdrängte meine Schwangerschaft, ich wollte nichts mit ihr zu tun haben und hoffte, dass ich eine Fehlgeburt haben würde. Aber nichts dergleichen geschah und für eine Abtreibung fühlte ich mich nicht stark genug, ich wollte mich auf keinen Fall einer Frauenärztin vorstellen. Auch fürchtete ich die vielen Fragen, die auf mich zukommen würden. Es gab keinen Vater, den ich erwähnen konnte. Dabei hätte ich Ralf gern wiedergesehen und ihm von der Schwangerschaft erzählt, aber dann überkam mich einfach nur Wut und Mitleid mit mir selbst. Er hatte mir ein Kind gemacht und war plötzlich spurlos aus meinem Gesichtsfeld verschwunden. Ich verstand auf einmal die Welt nicht mehr; abends streifte ich ziellos durch die leeren Straßen, um meiner Wut und meiner Verzweiflung freien Lauf zu lassen. Dann dachte ich an Susan und überlegte, mich ihr anzuvertrauen, aber irgendetwas hielt mich zurück. Ich wollte bei meinen Kollegen im Pflegeheim nicht als Nutte abgestempelt werden.
Als der Zeitpunkt einer Abtreibung überschritten war, erlebte ich meine erste Panikattacke. Ich wollte mich gerade aufmachen, um ins Pflegeheim zu fahren, da überkam mich eine solche Angst, dass ich begann, am ganzen Körper zu zittern. Krampfhaft hielt ich mich am Tisch fest, mir wurde schwindlig und schwarz vor Augen, Schweiß lief mir über den Rücken, meine Brust schnürte sich zu und mein Herz raste wie wild. Ich dachte, ich müsste sterben. Als es vorbei war, atmete ich tief durch, zog mich an und verließ meine Wohnung. Meine Bahn hatte ich verpasst, ich würde also zu spät kommen, was mir erneut negative Punkte für meine Praktikumsbewertung einbringen würde. Ich entschuldigte mich und sagte, ich hätte verschlafen.
Mein Leben engte sich immer mehr ein, ich fühlte mich gefangen in meinem eigenen Zuhause, nichts bereitete mir mehr Freude und manchmal weinte ich mich in den Schlaf. Ich sehnte mich nach Geborgenheit und Liebe. Auf einmal sah ich mich wieder als Kind, das von seinen Eltern ausgestoßen wurde, und ich fragte mich, ob ich jemals erwachsen werden würde.
Doch meine Tätigkeit als Praktikantin gab mir auf einmal neuen Halt. Sobald ich frühmorgens das Pflegeheim betrat, fühlte ich mich ein Stück selbstbewusster, und als meine Übelkeit allmählich nachließ, ging mir die Arbeit wieder leichter von der Hand und es gelang mir, von meinen Sorgen abzuschalten. Susan fragte mich, ob alles in Ordnung mit mir sei, ich hätte abgenommen und sehe sehr schlecht aus. Und warum ich nicht mehr in die Bar käme? Ich sagte, es sei nichts, ich hätte einfach keine Lust mehr, dorthin zu gehen. Sie glaubte, ich hätte Liebeskummer und fragte nicht weiter nach. „Das vergeht wieder“, sagte sie.
Hier im Gefängnis frage ich mich oft, ob es besser gewesen wäre, wenn ich mich Susan anvertraut hätte, aber irgendetwas schien mich innerlich anzutreiben, meine Schwangerschaft geheim zu halten. Ich entwickelte einen Verdrängungsmechanismus, den ich heute kaum noch nachvollziehen kann. Ich aß weniger, weil ich nicht zunehmen wollte, zog weite Pullover an, damit niemand meinen angeschwollenen Bauch sehen konnte, und ich begann abends zu joggen, in der Hoffnung, das Baby endlich zu verlieren. Aber nichts dergleichen geschah. Es saß fest in meinem Bauch.
Die Panikattacken am Morgen hielten mich weiterhin gefangen, dennoch schaffte ich es pünktlich zur Arbeit, da ich inzwischen eine Stunde früher aufstand als sonst. Doch dann kam jener Tag, als ich Ralf im Pflegeheim wiedersah. Plötzlich trafen wir uns im Treppenhaus, als er gerade seinen Großvater besuchen wollte. Beide waren wir auf diese Begegnung nicht vorbereitet.
„Hi“, sagte ich nur.
Ralf lächelte gequält. „Es tut mir leid, Grit, aber … bitte versteh mich … es ist vorbei mit uns.“
Sprachlos schaute ich ihn an und war kurz davor, in Tränen auszubrechen. In diesem Moment hatte ich mir gewünscht, er würde mich in seine Arme schließen, und alles wäre wieder gut. Ich würde ihm von unserem Baby erzählen, er würde sich scheiden lassen und wir würden ein neues Leben beginnen.
Er wich meinem Blick aus, schaute nervös auf seine Uhr, klopfte mir kurz auf die Schulter, wünschte mir alles Gute und stieg die Treppen hinauf, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Heute bedaure ich, dass ich diese Chance nicht genutzt hatte, um ihm die Wahrheit zu sagen, aber ich wollte sein Leben nicht zerstören. Offenbar hatte er seinen Seitensprung bereut und wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich fühlte mich allein gelassen, so wie damals, als meine Eltern sich hatten scheiden lassen, ich wurde von Mutter zu Vater geschubst und umgekehrt. Niemand wollte mich wirklich haben, und jeder redete schlecht über den anderen. Als ich achtzehn war, suchte ich mir eine eigene Wohnung, bekam Sozialhilfe und brach jeglichen Kontakt zu meinen Eltern ab. Erst zum Gerichtsprozess habe ich sie wiedergesehen. Sie waren fassungslos, konnten nicht begreifen, was ich getan hatte und distanzierten sich, soweit es ihnen möglich war. Dennoch versuchten sie, nur Gutes über mich auszusagen, was mich tatsächlich erstaunte. Ob mich einer von beiden im Gefängnis besuchen wird?
Die Begegnung mit Ralf im Pflegeheim löste eine Kehrtwende in meinen Gefühlen aus. Während ich mich anfangs noch bemitleidet hatte, schlug dieses Mitleid nun vollständig in Wut um. Ich begann Ralf zu hassen, und als ich die ersten Bewegungen des Babys in meinem Bauch spürte, hasste ich auch dieses. Ich wollte mit dem Kind nichts zu tun haben, es sollte nicht in meinem Bauch wachsen, um dann auf die Welt zu kommen. Es sollte sterben und mich endlich in Ruhe lassen. Stärker denn je verdrängte ich meine Schwangerschaft und lebte nur mit meiner inneren Wut. Und als mein Bauch sich wölbte, trommelte ich wie eine Wahnsinnige auf ihn ein, als würde er dadurch wieder kleiner werden, aber nichts geschah. Er wurde schwer, und die Bewegungen des Babys brachten mich zur Weißglut. Mein Leben war zerstört und ich wusste nicht mehr weiter. Ich weinte mich in den Schlaf und wachte morgens mit einer Panikattacke auf.
Doch eines Tages kamen keine Tränen mehr und ich begann, in zwei verschiedenen Welten zu leben. Heute denke ich, dass ich einen deutlichen Hang zur Schizophrenie hatte. Als Pflegerin schien ich eine andere Frau zu sein, eine Frau, die freundlich zu den Alten war, sich sogar Zeit nahm, ihnen einfach zuzuhören, und die an manchen Tagen sogar eine Stunde länger im Pflegeheim blieb, weil sie sich vor dem Alleinsein zu Hause fürchtete. Ich hatte noch nie meine Arbeit so gut abgeleistet wie in dieser Zeit, als wollte ich mir beweisen, was für eine kompetente und starke Frau ich war.
Susan arbeitete jetzt auf der Demenzstation, sodass wir uns im Pflegeheim nicht mehr sehen konnten. Doch bevor sie ging, umarmte sie mich und sagte: „Grit, lass uns die Handynummern austauschen, und wenn was ist oder du Hilfe brauchst, dann schreibe mir einfach eine Nachricht. Wir können uns auch woanders treffen oder ich komme auch gern zu dir. Alles klar? Du schaffst das schon, aller Anfang ist schwer. Der Pflegeberuf ist kein Zuckerlecken.“
Heute tut es mir in der Seele weh, dass ich von ihrem Angebot keinen Gebrauch gemacht und sie seitdem auch nicht mehr gesehen habe, denn gewiss hätte sie irgendwann meinen Zustand bemerkt, da bin ich mir sicher, und vielleicht hätte ich ihr dann alles erzählt und das ganze Unglück wäre niemals geschehen. Aber ich tat es nicht, ich schrieb ihr keine Nachricht und ließ auch sonst niemanden an mich heran.
Das Wesen in mir wuchs und wuchs, während ich jeden Morgen versuchte, mich in meine Jeanshose zu zwängen, bis ich sie nicht mehr zuknöpfen konnte. Ich nähte vorn einen Gummi ein, zog weite lange Blusen und Poloshirts über, um meinen Bauch zu kaschieren, und kaufte mir einen neuen Tunikakittel in der Größe L. Die Arbeitskleidung war somit perfekt für mich. Zu Beginn der Schwangerschaft hatte ich extrem abgenommen, sodass ich insgesamt nur drei Kilo zunahm, was kaum auffiel. Obwohl ich inzwischen mehr Hunger verspürte als sonst, nahm ich nur morgens und abends eine volle Mahlzeit ein, im Pflegeheim trank ich meine Flasche Kakaomilch und aß eine Banane, die mich stärkte und mir half, den anstrengenden Tag zu überstehen. Dennoch merkte ich, wie meine Kräfte allmählich nachließen und ich oft froh war, wenn ich mich zu jemandem ans Bett setzen konnte, um mit ihm zu reden oder ihm etwas vorzulesen.
Normalerweise las ich keine Zeitung, doch im Pflegeheim lagen jeden Tag die regionalen Zeitungen aus. Als ich einer alten Dame daraus vorlesen sollte, stieß ich plötzlich auf einen Artikel, der mir fast den Atem raubte. „Mikrobiologe Ralf Thielman (Siehe Foto) forscht auf dem Gebiet der Infektionsimmunologie, um neue Therapieansätze zu erschließen, die gerade bei der Behandlung und Vorbeugung von Infektionserkrankungen bei älteren, an Mehrfacherkrankungen leidenden Patienten hilfreich sein können …“ – Ich begann am ganzen Körper zu zittern und hatte große Mühe, mir nichts anmerken zu lassen, doch die Frau neben mir lächelte nur und sagte: „Schön, dass für uns alte Menschen etwas getan wird. Lesen Sie weiter, Schwester Grit!“
Ich nickte, aber ich konnte es nicht, meine Kehle war wie zugeschnürt. Wieder stieg Wut in mir auf, und ich hasste mich selber, dass ich Ralf nichts von der Schwangerschaft gesagt hatte. Er durfte weiterhin forschen, an seiner Doktorarbeit schreiben und sein gewohntes sicheres Leben fortsetzen, während mein Leben zerstört war. Und ich war fest davon überzeugt, dass ich ganz allein selbst die Schuld daran trug. An jenem Abend nähmlich, als ich ihn in meine Wohnung gelassen hatte, fragte er mich sofort, ob ich verhütete, und weil ich in diesem Moment glaubte, mir würde schon nichts passieren, versicherte ich ihm, dass ich die Pille nähme.
„Was ist mit Ihnen?“, fragte mich die alte Dame, als sie vergeblich darauf wartete, dass ich die Nachrichten weiter vorlesen würde.
„Ich komme später noch einmal zu Ihnen“, sagte ich und verließ ihr Zimmer. An diesem Tag ging es mir so schlecht, dass mich die Pflegeleiterin nach Hause schickte. Das war das einzige und letzte Mal, dass ich im Heim in solch eine schwierige Notlage geriet.
Bis zum Schluss konnte ich meine Schwangerschaft verbergen, obwohl ich zu Hause fast jeden Morgen mit einer Panikattacke zu kämpfen hatte, aber im Pflegeheim hatte niemand etwas bemerkt. Doch eines Tages spürte ich, dass es dem Ende zuging, und das bereitete mir erneut Angst.
An einem Dienstagmorgen Ende August setzten die Wehen ein, ich glaubte es zumindest, denn es waren Schmerzen, die ich bisher noch nicht kannte. Ich rief im Pflegeheim an und sagte, dass es mir nicht gut gehe und ich nicht zur Arbeit kommen könnte. Aber ich hatte keinen Plan, was jetzt zu tun sei. Ich wusste nur eins, ich wollte das Kind nicht haben. Doch als gegen Mittag die Fruchtblase platzte und die Schmerzen stärker wurden, begann ich am ganzen Körper zu zittern, und ich hatte auf einmal Angst, dass ich die Geburt nicht überstehen würde. Ich lief durch meine kleine Wohnung und geriet in Panik, wie ich es bisher noch nicht gekannt hatte. Gefühlt mehrere Stunden lag ich auf meinem Bett und zitterte wie Espenlaub, ich hatte meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. Die Angst und der Schmerz hielten mich gefangen, dennoch war mir bewusst, dass ich handeln musste. Als es draußen dunkel wurde und ich mich endlich ein wenig beruhigt hatte, schaltete ich meine Nachttischlampe an, stand langsam auf, ging ins Bad und ließ warmes Wasser in die Wanne laufen. Auf einen Hocker legte ich mein Badehandtuch und die große Küchenschere. Dann zog ich mich aus und setzte mich hinein. Die Wärme tat anfangs gut, doch dann wurden die Wehen stärker, die Schmerzen waren kaum noch auszuhalten. Irgendwann begann ich zu pressen, mein Unterleib schien zu zerreißen, und ich dachte, jetzt würde ich sterben. Und dann glitt das Baby heraus, aber ich sah nur Blut. Ich hob das zappelnde Wesen aus dem Wasser und es begann zu schreien. Und in diesem Augenblick schoss mir nur ein Gedanke durch den Kopf: Drücke ich es erneut ins Wasser oder lasse ich es am Leben? Erschöpft hielt ich inne und blickte auf das blutige Wasser, in dem ich saß. Ich begann zu frieren und hielt das Wesen fest in meinen Händen. Meine Wut war verflogen, und ich war nicht gestorben – und auch das Baby lebte. Ich drückte es an mich, fühlte den kleinen warmen Körper an meinem Bauch und begann zu weinen. Erst jetzt begriff ich, was für ein zartes, hilfloses Wesen ich neun Monate in mir getragen und vor der Außenwelt versteckt hatte. Dann sah ich, dass es ein Mädchen war.
Ich wartete auf die Nachgeburt, begann erneut zu pressen und zog die Plazenta aus mir heraus, durchtrennte die Nabelschnur mit der großen Schere und stieg mit wackligen Beinen, das Baby in den Armen haltend, aus der Wanne. Dann wusch ich das Baby unter fließendem Wasser, wickelte es in mein Badehandtuch und legte es in mein Bett. Ich ließ das blutige Wasser aus der Wanne laufen, duschte mich rasch, legte mir mehrere Einlagen in meinen Schlüpfer und zog mich an. Anschließend putzte ich das Bad, denn das viele Blut machte mir Angst und ich wollte keine Spuren hinterlassen. Vor Anstrengung wurde mir so schwindlig, dass ich nur noch in mein Bett fiel. Doch das Baby neben mir ließ mich nicht in Ruhe, es schrie so laut, dass ich es kaum ertragen konnte. Ich gab ihm meine Brust, es trank gierig und schlief bald ein. So einfach geht das, dachte ich. Ich wollte nur noch schlafen.
Am nächsten Morgen weckte mich das schreiende Baby, es lag halb nackt neben mir, denn es hatte sich aus dem Handtuch freigestrampelt. Ich wickelte den ausgekühlten Körper wieder ein und gab dem Baby erneut meine Brust, damit es endlich wieder Ruhe gab. Und während ich es stillte, zog sich meine Gebärmutter so stark zusammen, dass ich noch lange im Bett liegen bleiben musste, bis die Krämpfe endlich nachließen. Offenbar war auch mein Damm gerissen, der höllisch brannte, aber ich fürchtete mich, nach der Wunde zu schauen. Irgendwann stand ich auf, zog mich an und als ich mir in der Küche Cornflakes in eine Schüssel schüttete, begann ich am ganzen Körper zu zittern, mir brach der Schweiß aus und ich glaubte, mein Herz springe mir aus der Brust. Ich hielt mich am Tisch fest und setzte mich, mir wurde schwarz vor Augen. Das Baby fing wieder an zu schreien. Ich hielt mir die Ohren zu, aber dann bekam ich Angst, dass es jemand im Haus hören könnte. Doch ich konnte mich nicht rühren, ich saß am Tisch und wartete, bis das Herzklopfen nachließ, erst dann stand ich auf. Jetzt sah ich, dass das Baby eingekackt hatte, aber ich besaß keine Windeln. Auf ein Baby war ich nicht vorbereitet, ich hatte es all die Monate verdrängt, so absurd das auch klingen mag. Ich holte ein neues Handtuch aus dem Schrank und wickelte es fest darin ein. Das vollgekackte Handtuch warf ich in die Badewanne. Auf einmal fühlte ich mich vollkommen überfordert und meine innere Wut kehrte zurück.
„Ich muss das Kind loswerden“, war der einzige Gedanke, der mich nun beherrschte. An nichts anderes konnte ich an diesem Tag denken.
Am späten Abend verließ ich das Haus, ich hatte das Baby zusätzlich in eine Wolldecke gewickelt und in meine Reisetasche gepackt. Als es schlief, verließ ich die Wohnung. Erst jetzt merkte ich, wie wacklig ich noch auf den Beinen war, mein Unterleib schmerzte und mir wurde so schwindlig, dass ich plötzlich Angst bekam, ohnmächtig zu werden.
Die Straße war leer. Ich brauchte zehn Minuten bis zum Stadtpark, dann schaute ich mich noch einmal um, aber niemand war zu sehen. Ich holte das Bündel aus meiner Reisetasche und legte es auf eine Bank. „Hier würde man es schnell finden“, dachte ich, „sobald die ersten Hundespaziergänger unterwegs sind.“ Dann verließ ich den Park – ohne Gefühl, ohne Schmerz. Mein Herz war erstarrt.
Zu Hause trank ich ein Glas Milch und legte mich erschöpft ins Bett, aber ich konnte nicht einschlafen. Immer wieder musste ich an das Baby denken, dass ich draußen in der Nacht allein zurückgelassen hatte. Was, wenn es niemand rechtzeitig fände? Ich wälzte mich hin und her, meine Brust fing an zu schmerzen, und als ich sie mit meiner Hand berührte, schoss in dünnen Strahlen Muttermilch heraus. Mein Bett wurde nass und plötzlich fing ich an zu weinen. Auch wenn das Kind nicht mehr da war, hatte sich für mich nicht viel verändert, die tiefe Angst, die in mir saß, ließ sich nicht verscheuchen. Ich schaute auf die Uhr, es war inzwischen kurz nach vier. Plötzlich war ich wie von Sinnen. Hastig sprang ich aus meinem Bett, zog mich an und rannte zum Park. Ich suchte vergeblich nach der Bank, konnte sie aber nicht finden, sodass ich erneut in Panik verfiel. Dann wurde mir schwarz vor Augen und ich brach zusammen.
Als ich wieder zur Besinnung kam, hörte ich ganz aus der Nähe ein Schreien, und da entdeckte ich endlich die Bank. Das Baby lag noch immer an derselben Stelle, wo ich es am Abend zuvor abgelegt hatte, nur die Decke und das Handtuch hatte es sich abgestrampelt, und ich erschauderte beim Anblick des nackten kleinen Körpers. Warum hatte ich die Decke nicht zugeschnürt? Rasch wickelte ich das ausgekühlte Baby ein und trug es nach Hause. Um es zu beruhigen, legte ich es erneut an meine schmerzende Brust, und für einen kurzen Moment fühlte ich mich erleichtert. Dann rief ich im Altenheim an und sagte, dass ich krank sei.
Doch schon am Nachmittag bekam das Baby Fieber und ich merkte, dass es schwer atmete. Wenn es schrie, legte ich es an meine Brust, aber wie es nun weitergehen sollte, das wusste ich nicht. Noch immer besaß ich keine Babysachen, keine Windeln. Ich überlegte, ob ich welche kaufen sollte, aber ich hatte Angst, entdeckt zu werden – Angst, dass alles auffliegen könnte, was bisher geschehen war. Auch hatte ich mir bei meinem Sturz eine Platzwunde an der Stirn zugezogen, die mich verunsicherte. Dennoch verließ ich erneut die Wohnung, kaufte in einem Sekondhandshop zwei Hemdchen, zwei Oberteile und zwei Strampler. Bei Aldi nebenan kaufte ich ein kleines Paket Wegwerfwindeln und zwei Packungen Monatsbinden und verstaute alles zu den Babysachen in meiner Reisetasche, ich wollte damit nicht gesehen werden.
Zuhause badete ich das Baby, band ihm eine Windel um und streifte ihm Hemdchen, Pullover und Strampler über. Obwohl es nun gut ausgestattet war, zitterte es am ganzen Körper. Sein Köpfchen fühlte sich heiß an, die Händchen eiskalt. Ich stillte es und legte es in mein Bett. Dann spülte ich die schmutzigen Handtücher aus und steckte sie in die Waschmaschine. Als ich damit fertig war, duschte ich mich gründlich und legte mich neben das Baby ins Bett. Mein Unterleib schmerzte, und da ich die Krämpfe kaum aushielt, stand ich noch einmal auf und machte mir eine Wärmflasche. Kurze Zeit später musste ich eingeschlafen sein.
Am Abend fing das Baby an zu husten und wollte nur wenig trinken. Als ich es anschließend in meinen Armen hielt, begann es erneut zu husten und erbrach sich. Sein Gesicht war ganz blass. Es schrie und ich konnte es einfach nicht beruhigen. Ich trug es durch die Wohnung, und erst gegen Mitternacht, nachdem ich es im Bett noch einmal gestillt hatte, schlief es in meinen Armen ein. Bald darauf schloss auch ich vor Erschöpfung die Augen.
Doch am nächsten Morgen war das Baby so apathisch, dass es nicht mehr trinken wollte. Es hatte glasige Augen, hustete kraftlos und atmete schnell und flach. Ein seltsames Rasseln in seiner Brust machte mir Angst. Ich wusste nicht mehr weiter. Mein bisschen Verstand, der noch in mir war, sagte mir, ich sollte zum Kinderarzt gehen, aber meine Angst, in eine für mich belastende Situation zu geraten, in der man sofort erkannte, dass ich allein schuld daran war, hielt mich davon ab. Ich hatte mein Kind schutzlos in der kalten Nacht zurückgelassen, und jetzt war es sterbenskrank.
Den ganzen Vormittag verließ ich nicht meine Wohnung. Ich versuchte, das Baby zu stillen, aber es erbrach sich kurze Zeit später während eines Hustenanfalls. Ich legte das Baby auf die Seite, aus Angst, dass es ersticken könnte. Dann schaltete ich mein Laptop ein und schaute mir einen Film an. Das lenkte mich ab, und für kurze Zeit vergaß ich meine beunruhigende Situation. Doch dann bekam ich Hunger, ich ging in die Küche und suchte nach etwas Essbarem. Mein Kühlschrank war leer, ich hatte auch keine Milch mehr. Ich schüttete mir Cornflakes in eine Schüssel und aß sie trocken. Dann kochte ich mir einen starken Kaffee, denn erst jetzt merkte ich, wie müde ich war.
„Ich muss hier raus“, dachte ich, „sonst werde ich wahnsinnig.“ Also zog ich mich an, lief durch die Straßen, bis ich den Stadtpark erreichte. Vor allem Hundespaziergänger waren hier unterwegs. Ich lief an der Bank vorbei, wo ich das Baby abgelegt hatte, keine Spur war zu sehen, nichts, das darauf hindeutete, was ich getan hatte. Dennoch fühlte ich mich die ganze Zeit beobachtet und verfolgt, deshalb schaute ich immerzu auf die Erde. Als ich den Park verließ, kam ich an einer Apotheke vorbei. Da wusste ich auf einmal, was zu tun sei. Ich ging hinein und verlangte Fiebersaft. Als die Apothekerin mir erklärte, worauf ich achten müsse, bekam ich einen Schweißausbruch. Ich fing an zu zittern, während ich das Geld auf den Tresen legte. Sie fragte mich, ob ich mich kurz setzen wolle und bot mir einen Stuhl an, der hinter einer Trennwand stand. Ich schüttelte den Kopf, aus Angst ertappt zu werden. Mit der Flasche in der Hand verließ ich die Apotheke, ging hinunter zum Fluss und setzte mich auf eine Bank. Die Flasche verstaute ich in meiner Jackentasche, dann atmete ich tief durch. Ich blieb lange dort sitzen und beobachtete eine Entenmutter mit ihren Kindern im Schlepptau, die auf dem Wasser umherschwammen. Hier ist die Welt in Ordnung, dachte ich, und ich verspürte auf einmal den Wunsch, endlich aus meinem bösen Traum zu erwachen.
Als es anfing zu dämmern, lief ich nach Hause. Was mich dann erwartete, war nicht ein böser Traum, sondern die erschreckende Wirklichkeit. Das Baby lag reglos auf dem Rücken und schien nicht mehr zu atmen. Ich rüttelte an dem kleinen Körper, hoffte, dass das Baby wieder schreien würde, aber nichts geschah. Da begriff ich, dass es tot war. Ich saß wie gelähmt auf dem Bett und starrte auf das Baby. Erstaunlicherweise blieb ich ganz ruhig, als hätte ich es nicht anders erwartet. Meine Gedanken wirbelten durch den Kopf, als wären sie vom Teufel besessen. Jetzt musste ich handeln. Ich könnte es im Wald vergraben und niemand würde es merken.
Aber ich konnte es nicht. Meine Grausamkeit machte mir Angst und drückte so schwer auf mein Gemüt, dass ich am nächsten Morgen Susan eine Nachricht auf WhatsApp schrieb, mit der Bitte, zu mir zu kommen. Sie antwortete mir eine Stunde später und versprach, am Abend vorbeizukommen.
Als ich Susan die Wohnungstür öffnete, muss sie an meinem verstörten Blick und meiner Platzwunde an der Stirn sofort geahnt haben, dass etwas nicht stimmte. Dann sah sie das reglose Baby auf meinem Bett liegen. Fassungslos starrte sie mich an. „O mein Gott, Grit, was ist hier passiert?“, schrie sie. „Sag, was ist los!“
Ich begann am ganzen Körper zu zittern und brachte keinen Ton heraus, doch als Susan mich rüttelte und mich immer mehr bedrängte, brach ich mein Schweigen.
„Ich habe es hier zur Welt gebracht“, stammelte ich, „aber ich glaube, es lebt nicht mehr.“
„O nein, das darf nicht wahr sein. Verdammt, warum hast du mir nie erzählt, dass du schwanger bist? Was nur ist in dich gefahren? Du hattest doch mein volles Vertrauen! Das kann einfach nicht wahr sein.“
Haltlos sank ich in mich zusammen und fing an zu weinen.
„Ist schon gut, Grit“, versuchte Susan mich zu beruhigen und nahm mich in ihre Arme. „Bist du auch gar nicht beim Frauenarzt gewesen?“
„Nein, ich wollte das Kind nicht.“
„Ist es von ihm?“
Ich nickte.
Dann setzten wir uns auf das Bett und Susan betrachtete das Baby. Tränen stiegen ihr in die Augen.
„Grit, wir müssen sofort den Notarzt rufen“, sagte sie und tippte, ohne auf meine Antwort zu warten, die Notrufnummer in ihr Handy.
Kurze Zeit später kam der Notarzt und erkannte sofort, dass das Baby bereits tot war. Er zog es vorsichtig aus und untersuchte es gründlich. Als er sah, dass der Nabel noch nicht abgeheilt war, fragte er: „Wie alt war das Baby?“
Ich überlegte kurz, dann antwortete ich: „Drei Tage.“
„Haben Sie es hier entbunden?“
Ich nickte.
„Und Sie sind die Hebamme?“, fragte er Susan.
„Nein“, erwiderte sie, „ich bin ihre Freundin.“
Dann wandte der Arzt sich wieder an mich. „Wann ist Ihr Baby gestorben?“
Unsicher blickte ich zu Susan, aber auch sie schaute mich nur fragend an. „Ich weiß nicht genau“, sagte ich schließlich.
„Es tut mir leid, aber ich muss die Polizei rufen, das Baby ist schon seit mindestens vierundzwanzig Stunden tot, vermutlich sogar länger.“ Dann holte er einen Totenschein aus seiner Aktentasche und fragte nach dem Namen des Kindes. Ich erschrak. Es gab keinen Namen für das Baby. Der Arzt schüttelte ungläubig den Kopf und griff nach seinem Handy.
Eine halbe Stunde später klingelte es an meiner Wohnungstür und zwei Polizisten traten ein. Sie stellten dem Arzt, Susan und mir viele Fragen, aber ich war unfähig, klare Gedanken zu fassen. Auf ihren Befehl hin gab ich ihnen meinen Ausweis und sagte, dass ich allein lebe. Der Arzt empfahl eine Obduktion des Babys, um die genaue Todesursache festzustellen. Ich geriet in Panik, redete wirres Zeug, betonte immer wieder, dass ich hilflos gewesen sei, weil das Baby Fieber hatte und zeigte ihnen den Fiebersaft, den ich in der Apotheke gekauft hatte. Doch immer wieder fragten sie mich, warum ich nicht zum Arzt gegangen sei. Verzweifelt schüttelte ich den Kopf und wusste keine Antwort. Anschließend ordneten sie eine Hausdurchsuchung an und erklärten mir, dass die Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Babys veranlassen werde. Dann wurde ich festgenommen und kam einen Tag darauf in Untersuchungshaft. Bei den Vernehmungen durch die Polizei verschwieg ich anfangs viele Einzelheiten, mein Herz schien nur noch ein Eisklumpen zu sein, doch als ich erfuhr, dass das Baby laut Obduktionsbericht an einer Lungenentzündung gestorben sei, brach ich in Tränen aus. Dann ließ man mich allein und kurze Zeit später kam nur noch einer der beiden Polizisten zu mir in den Raum. Er fragte mich, wie ich mir die Bestattung des Kindes vorstelle. Ich sah ihn fassungslos an, denn diese Frage warf mich restlos aus der Bahn. Auf einmal begriff ich, dass dieses verstorbene Baby mein Baby war.
Als ich mich einigermaßen beruhigt hatte, legte ich mein Geständnis ab. Ich berichtete dem Polizeibeamten, was geschehen war. Wie ich die Schwangerschaft die ganze Zeit verdrängt hatte und das Kind nicht haben wollte, weil ich damit allein war und den Vater nicht wiedergesehen hatte; wie ich es allein zur Welt gebracht und es gleich nach der Geburt versorgt hatte; wie ich es in der darauffolgenden Nacht im Park ausgesetzt und es Stunden später wieder zurückgeholt hatte und dann nicht mehr weiterwusste. Der Polizist stellte mir zwischendurch Fragen, denn es war ihm unverständlich, warum ich das Baby nicht hatte abtreiben lassen. Ich wusste keine Antwort, und auch heute weiß ich nicht, warum ich diesen Schritt nicht gegangen war. Vermutlich war es meine Angst, so früh eine Entscheidung zu treffen, denn damals hatte ich noch gehofft, dass Ralf zu mir zurückkommen würde. Dennoch versuchte ich, dem Polizisten wahrheitsgemäß zu antworten, denn ich wollte mich von der Last meiner Schuld befreien. Nur eins verschwieg ich: Ich nannte den Namen des Vaters nicht.
Der Gerichtsprozess, der im Januar stattfand, dauerte einen Tag und fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, nur meine Eltern und Susan waren als Zeugen geladen. Da ich meine Tat ehrlich gestanden hatte und bereit gewesen war, unmittelbar nach der Geburt das Baby zeitweise zu versorgen, bekam ich eine Strafmilderung. Auch wenn eine Persönlichkeitsstörung bei mir festgestellt wurde, wäre ich nicht außerstande gewesen, das Baby in ärztliche Obhut zu geben. Ich wurde beschuldigt, bewusst jegliche Hilfe unterlassen zu haben. Mein Urteil lautete: Dreieinhalb Jahre Freiheitsentzug wegen Totschlag durch unterlassene Hilfeleistung.
Ich lege meinen Stift aus der Hand und werfe einen sehnsüchtigen Blick aus dem vergitterten Fenster meiner Einzelzelle und sehe, dass draußen die Sonne scheint. Bald ist Frühling, denke ich, aber ich werde kaum etwas davon spüren. Ich bin froh, dass die Verhandlung hinter mir liegt und ich endlich nach vorn blicken kann.
Susan durfte mir bei der Organisation der Beerdigung helfen, und dafür bin ich ihr dankbar. Allein hätte ich es nicht geschafft, aber der Gedanke, mein Baby auf einer grünen Wiese zu bestatten, war für mich tröstend. Susan durfte mich in der Untersuchungshaft besuchen, wenn auch nur für eine halbe Stunde. Sie versprach mir, sich mit einem Bestattungsinstitut in Verbindung zu setzen und alles zu regeln, nur die Kosten müsste ich selbst übernehmen.
Und dann erzählte sie mir, dass sie Ralf auf der Demenzstation begegnet war. Er hatte Susan erkannt, sie freundlich gegrüßt, bevor er das Zimmer seines Großvaters betrat. Diese Begegnung sei nicht spurlos an ihr vorbeigegangen, sie hätte auf einmal begriffen, dass es unfair sei, ihn aus allem herauszuhalten. Sie bot mir an, mit Ralf zu sprechen, denn sie war fest davon überzeugt, dass er wissen sollte, was geschehen war. Ich trüge nicht allein die Schuld, ich sei noch so jung, er hätte begreifen müssen, dass er mit mir zu weit gegangen war, schließlich sei er ein verheirateter Mann. Er trüge eine große Verantwortung mir gegenüber. – Erschrocken schaute ich Susan an, spürte, wie Panik in mir aufstieg und schüttelte heftig mit dem Kopf. Ich wollte nicht, dass sie mit ihm sprach, ich wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben, ich wollte ihn aus meinem Leben streichen und für immer vergessen. Ich hatte Angst, dass er beim Gerichtsprozess auftauchen würde. – Susan verstand mich, auch wenn es ihr innerlich sehr leidtat. Meine Gefangenschaft bedrückte sie, aber sie würde nichts unternehmen, wenn ich damit nicht einverstanden sei. Das versprach sie mir.
Ich blieb zwei Wochen in Untersuchungshaft, dann wurde ich vorläufig bis zum Prozessbeginn wieder frei gelassen. So war es mir möglich, bei der Bestattung Ende September dabei zu sein, und ich war erleichtert, dass Susan mich begleitete. Es war ein trüber nasskalter Tag, ich fror, da ich mich nicht warm genug angezogen hatte. Schweigend wurde die kleine Urne vom Bestatter tief in die Erde gelassen, dann faltete er seine Hände, sprach ein paar tröstende Worte und ließ uns allein zurück. Wir blieben noch eine Weile dort stehen, bis ein Gärtner kam und das Loch mit Erde zuschüttete und Grassamen darüber streute. Ich hockte mich nieder und legte einen weißen Rosenstrauß auf das Grab. Susan umarmte mich und ich begann zu weinen. Ich hatte meine Tochter Sophia genannt, als wir die Geburts- und Sterbeurkunde beantragt hatten. Drei Tage nur hatte sie gelebt. Wie grausam, wenn ich daran zurückdenke. Dafür will ich büßen und meine Tochter um Verzeihung bitten. Dank Susans Hilfe und Unterstützung begreife ich, dass ich trotz allem es wert bin, nach der Haftstrafe ein neues Leben zu beginnen. Auch wenn eine lange Strafzeit vor mir liegt, werde ich versuchen, sie sinnvoll zu nutzen. Ich bin froh, dass ich jeden Tag in der Wäscherei arbeiten darf, das lenkt mich ab und strengt mich körperlich so an, dass ich abends erschöpft ins Bett falle. Von dem Geld, das ich verdiene, kann ich die Wiesenbestattung in Raten abbezahlen. Das beruhigt mich.
Doch wann immer ich Zeit finde, nehme ich mir ein Buch zur Hand, setze mich auf meine Pritsche und vergesse alles um mich herum. Hier im Frauengefängnis gibt es eine Bibliothek, die ich oft besuche, um mir Bücher auszuleihen. Das Lesen hilft mir, ganz zu mir selbst zu finden. Ich darf in das Leben der Romanfiguren eintauchen, mich mit ihren Gedanken, Träumen und Zweifeln auseinandersetzen und dabei mein eigenes Leben reflektieren. Einige Passagen im Buch, die mir besonders wichtig erscheinen, schreibe ich in mein Notizbuch. Schon jetzt spüre ich, dass ich mich verändert habe. Meine Naivität habe ich abgelegt, ich bin nachdenklicher geworden und betrachte mein jetziges Umfeld mit kritischen und wachsamen Augen. Hier in der Bibliothek habe ich eine Frau kennengelernt, die vom Alter her meine Mutter sein könnte. Babette ist sehr freundlich zu mir und hat mir schon einige Bücher empfohlen, die ich unbedingt lesen sollte. Sie erkundigt sich nicht nach meiner Geschichte und auch ich frage nicht, weshalb sie hier ist. Ich mag sie und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie treffe.
Manchmal denke ich auch an meine Mutter und frage mich, ob sie glücklich ist. Als ich sie im Gerichtssaal sah, schmerzte mich ihr Anblick und mir wurde bewusst, dass ich sie ein Jahr lang nicht mehr gesehen hatte. Mir schien, als schaute sie mir abschätzig in die Augen, aber erstaunlicherweise gab sie sich große Mühe, mich in ein positives Licht zu rücken. Vermutlich wollte sie selbst als gute Mutter dastehen. Ich weiß so wenig über ihr Leben und bedaure, dass wir nie ein inniges Verhältnis zueinander hatten. Ich habe nie erlebt, wie es sich anfühlt, eine Mutter zu haben, die einem Liebe und Geborgenheit schenkt. Ich frage mich, warum ich überhaupt auf dieser Welt bin.
Meinen Vater erkannte ich fast nicht wieder, aber da er neben meiner Mutter saß, wusste ich, dass er es sein musste. Er hatte sich einen Bart wachsen lassen und sah auf einmal viel älter aus. Auch von ihm weiß ich nichts. Ob er mich jemals vermisst hat? Dennoch war mir mein Vater als Kind ein Stück näher als meine Mutter. Manchmal las er mir abends am Bett eine Gute-Nacht-Geschichte vor, doch als ich die Schule besuchte und selbst lesen konnte, nahm er sich keine Zeit mehr für mich. Meine Eltern lagen immerzu im Streit, der mich traurig und wütend zugleich machte. Ich bekam Angst, mich meinen Eltern zu nähern und zog mich immer mehr zurück. Als ich acht Jahre alt war, meldete ich mich in der Stadtbibliothek an und flüchtete in die Welt der Bücher. Keiner von meinen Schulkameraden war so versessen auf Bücher wie ich. In der vierten Klasse durfte ich im Deutschunterricht mein Lieblingsbuch vorstellen, und ich erinnere mich noch daran, wie ich meine Mitschüler mit dem Märchenroman „Momo“ von Michael Ende begeistern konnte. Auch die Lehrerin war sehr angetan. Ich hatte dieses Buch von meiner Oma geschenkt bekommen, und daher konnte ich es einigen Mädchen ausborgen. Jetzt steht es in meinem kleinen Regal, ich durfte es von zu Hause mitbringen. Leider lebt meine Oma nicht mehr.
Hier im Gefängnis habe ich meine Leidenschaft zum Lesen wiederentdeckt. Ich liebe Bücher und überlege, ob ich mich nach meiner Haft als Buchhändlerin ausbilden lasse. Ich möchte gern einmal in einer Buchhandlung arbeiten und die Menschen, die zu mir kommen, ausführlich beraten und ihnen anspruchsvolle Bücher empfehlen, die in den Regalen zu finden sind. Das ist mein großer Traum, der noch weit in der Ferne liegt, aber ich will an ihm festhalten, denn ich spüre, dass er mir innerlich neue Hoffnung schenkt. Es fühlt sich gut an, ein klares Ziel vor Augen zu haben.
Susanne Schwertfeger
Die dritte Patrone
Johann sah sich um. Das Bergdorf, in dem er seine Kindheit und Jugend verbracht hatte, kam ihm nach seiner Rückkehr auf einmal so seltsam klein vor. Die tiefverschneiten Häuser und die Straßen wirkten fast wie in einem Winter-Wunder-Spielzeugland. Aber die gigantischen Berge und der Gletscher ringherum hatten nichts von ihrer majestätischen Erscheinung verloren. Auch wenn Johann mit gemischten Gefühlen zurückgekehrt war, war es doch auch ein schönes Gefühl, wieder zu Hause zu sein. Die kalte Bergluft umfing ihn. Während in den tieferen Regionen um München herum der Schnee schon lange wieder weggetaut war, herrschte hier oben immer noch tiefer Winter.
„Ich werde mich an diese Kälte und den ewigen Schnee erst wieder gewöhnen müssen“, dachte Johann und schlug den Kragen seiner Jacke hoch. Er war der erste Tag in seinem neuen Job als neuer Polizeichef von Obermoos. Er würde damit den Posten seines Vaters übernehmen, der nun in Rente gegangen war. Johann freute sich, endlich wieder zu arbeiten und darauf, seine neuen Kollegen zu begrüßen. So machte er sich zu Fuß auf den Weg zu seiner neuen Wirkungsstätte, der kleinen Polizeistation in Obermoos. Aber als er durch die verschneiten Straßen und Gassen ging, spürte er, dass die Kälte die Schmerzen in seiner Schulter verstärkte. Aber damit konnte und musste er nun leben. Den dringenden Rat seines alten Chefs, sich noch eine Weile krankschreiben zu lassen und sich psychologische Hilfe zu holen, hatte Johann strikt abgelehnt. „Arbeit ist für mich die beste Medizin und ich habe mich ja in mein kleines und ruhiges Bergdörfchen versetzten lassen. Da kann ich mich gut auskurieren und mein Trauma bearbeiten“, hatte er argumentiert. Es war nun fast ein Jahr her, seit Johann im Dienst von einem fliehenden Einbrecher angeschossen worden war. Fast hätte er diesen Einsatz mit seinem Leben bezahlt. Aber inzwischen fühlte er sich wieder fit und einsatzbereit und auch die Alpträume waren fast verschwunden. So ging Johann die alten und vertrauten Wege von Obermoos entlang.
Als er an seiner alten Schule vorbeikam, musste er zum ersten Male seit langen Jahren wieder an Lena denken. Als sie ihn damals wie aus dem Nichts heraus plötzlich nicht mehr sehen wollte, hatte es ihm fast das Herz gebrochen. Er hatte auch nie verstanden, warum sie sich in jenem Winter auf einmal nicht mehr mit ihm treffen wollte. Das war kurz nach dem Verschwinden ihres Vaters gewesen… Als sie beide im folgenden Sommer das Abitur endlich in der Tasche hatten, hatte Johann noch ein letztes Mal versucht, Lena dazu zu bringen, mit ihm fortzugehen und in der Stadt eine Ausbildung oder ein Studium zu machen. Aber sie hatte nur wortlos den Kopf geschüttelt. Er konnte sie einfach nicht mehr erreichen. Es war, als hätte sie sich vollkommen eingeigelt und in ihre Welt zurückgezogen. Damals hatte er vermutet, dass sie ihre Mutter nicht alleine lassen wollte, jetzt, da der Vater verschwunden war. Aber es verletzte ihn tief, dass sie ihn so vollkommen aus ihrem Leben ausgeschlossen hatte. So war er am Ende alleine aufgebrochen, hatte in München seine Ausbildung als Polizist gemacht, sich dort hochgearbeitet und nun nach seiner Versetzung war er wieder zurück. All die Jahre hatte er es vermieden, seine Eltern oder Freunde nach Lena zu fragen, aber nun würde er sicher bald zwangsläufig erfahren, wie es ihr ergangen war.
Reinhold Müller überprüfte ein letztes Mal seine Ausrüstung. Aber so wie es aussah, hatten er und sein Team alles Erforderliche für die anstehende Expedition zum Gletscher zusammengepackt. Reinhold war ein wenig aufgeregt. Es war die erste Expedition unter seiner Leitung und die Forschung erwartete aufschlussreiche Erkenntnisse von ihm, warum die Gletscherschmelze immer schneller voranschritt. „Also, dann mal los“, rief er seinem Team zu und gemeinsam machten sie sich in der kalten Morgendämmerung auf. Ihr Plan war es, Sonden in einige Gletscherspalten herabzulassen um die Temperatur, aber auch die Beschaffenheit des Eises zu messen und Proben auch aus den tieferen Eisschichten zu entnehmen. Eine kleine Spezialkamera sollte das Team zudem mit Aufnahmen der Eisschichten versorgen.
Der Weg zum Gletscher war steil und mühsam. Der frisch gefallene, schwere Schnee klebte an den Schneeschuhen der Wanderer. Aber Reinhold liebte diese Aufstiege am Morgen, bei denen ihre Schritte durch den knarzenden Schnee die einzigen Geräusche waren, die die morgendliche Stille durchbrachen. Als sie endlich an ihrem Ziel angekommen waren, wies Reinhold sein Team an, die Sonden abzulassen, um die Aufzeichnungen zu starten. Er genehmigte sich einen Schluck aus seiner Teekanne und hoffte auf aufschlussreiche Ergebnisse. Nach circa einer Stunde piepte sein Funkgerät. Die junge Praktikantin Melanie sprach aufgeregt in das Gerät: „Herr Müller, kommen Sie schnell. Ich glaube, ich habe etwas gefunden, was Sie sich unbedingt ansehen sollten.“
Johann trug eine große und prall gefüllte Tüte der Bäckerei Eberspächer in der Hand, als er seine neue Wirkungsstätte betrat. „Guten Morgen zusammen“, rief er in die Runde. „Ich bin schon da und deshalb können wir uns ja auch gleich zusammensetzen um uns kennenzulernen. Also: Treffen zur ersten inoffiziellen Dienstbesprechung um 9.00 und bringt Appetit mit. Es gibt belegte Brötchen und Kuchen!“ Sein neues Team, bestehend aus dem Wachmeister Jeschke und der Sekretärin Rita Oberstein, ließ sich nicht lange bitten, denn Brötchen und Kuchen klangen verlockend. Natürlich war es nie leicht, in die Fußstapfen des Vaters zu treten, aber in Johanns Fall war es sicher besonders schwer, weil sein Vater Roland die Polizeistation mehr als dreißig Jahren geleitet hatte. In all dieser Zeit war Roland sowohl für seine Mitarbeiter als auch für das ganze Dorf eine Art moralische Instanz gewesen war. Zu ihm hatten die Leute automatisch Vertrauen und Roland hatte sich nie hinter dem Gesetz verschanzt, sondern immer versucht, für die Bewohner von Obermoos, aber auch für die Touristen, eine friedliche und einvernehmliche Lösung zu finden. Johann hatte nicht vor, mit den Gewohnheiten seines Vaters zu brechen. Schließlich waren sie hier auf dem Dorf und nicht in der Großstadt. Das schwerste Verbrechen, an das sich die Einwohner von Obermoos erinnern konnten, war ein versuchter Einbruch in den Dorfsupermarkt, als ein Tourist versucht hatte, sich nach Ladenschluss noch eine Flasche Schnaps zu besorgen.
Johann reichte die Tüte mit den dick belegten Brötchen herum, als das Telefon plötzlich klingelte. Rita schaute etwas ungehalten darauf und verdrehte die Augen. Johann war sich sicher, dass sie normalerweise den Hörer erst nach der Frühstückspause wieder abgenommen hätte, aber sie wollte offensichtlich bei ihrem neuen Chef keinen schlechten Eindruck machen. Also hob sie ab. Ihre zunächst etwas gelangweilte Haltung veränderte sich und sie richtete sich kerzengerade auf. „Eine Leiche, sagen Sie“, wiederholte sie gerade. „Hier bei uns in Obermoos? Ja, ich schicke sofort jemanden.“ Johann und Jeschke hatten sie mit wachsendem Interesse beobachtet. „Was gibt es? Eine Leiche?“, fragte Johann schließlich, als Rita den Hörer endlich zurück auf die Gabel gelegt hatte. „Das Forschungsteam, das oben am Gletscher ist, hat eine Leiche in einer Gletscherspalte entdeckt“, berichtete Rita mit runden Augen. „Na, das fängt ja gut an!“ stellte Johann fest. „Wir sind schon unterwegs!“, rief er dann, schnappte sich noch eines der Brötchen und streifte seine Jacke über. Jeschke folgte etwas widerwillig. Gerne hätte er seinen Kaffee noch ausgetrunken, aber er sah ein, dass dazu jetzt keine Zeit war. Auch wenn sein neuer Chef offiziell noch gar nicht im Dienst war, nahm er seinen Job offensichtlich ernst. Aber in Obermoos wurde auch nicht jeden Tag eine Leiche gefunden.
Oben am Gletscher wehte ein eisiger und schneidender Wind, der den frisch gefallenen Schnee zu bizarren Verwehungen auftürmte. Aber Johann hatte in diesem Moment kein Auge für dieses Naturschauspiel, sondern wünschte, er hätte seine Schneeschuhe angezogen. Aber er hatte ja nicht ahnen können, dass ihn sein erster Arbeitseinsatz direkt hierher zum Gletscher führen sollte. Ein Mann in einer roten Daunenjacke, der offensichtlich der Einsatzleiter war, winkte die beiden Polizisten heran. „Kommen Sie schnell, hier liegt die Leiche“, rief er und es war ihm anzumerken, dass die Entdeckung, die seine Praktikantin gemacht hatte, ihn sichtlich aufregte. Johann folgte dem Mann zu einer der vielen Gletscherspalten des Bergmassivs. Davor lag vollkommen steifgefroren eine offensichtlich männliche Leiche. Der Tote lag auf dem Rücken und starrte sie aus toten Augen an. Sein Blick wirkte verwirrt und zornig zugleich. So, als könne er nicht glauben, dass der Tod ihn ereilt hatte. Die grauen langen Haare klebten am Kopf des Toten, der durch die Kälte vollkommen konserviert wirkte. Auch die Kleidung hatte die Zeit im Eis offensichtlich gut überstanden. Johann betrachtete den Toten genauer und er war sich sofort sicher: „Das ist Lenas Vater Xaver.“ Auch im Tode war ihm immer noch anzusehen, dass er kein angenehmer Zeitgenosse gewesen war. Da fiel Johann ein, dass Xaver immer einen großen protzigen Siegelring getragen hatte, der so gar nicht zum Leben eines Bauern zu passen schien. Er hatte den Mann nie ohne diesen Ring gesehen. Lena hatte ihm einmal erzählt, dass Xaver diesen Ring als Andenken an seinen Vater trug, der immer davon geträumt hatte, das Dorfleben hinter sich zu lassen und als Geschäftsmann in der Stadt erfolgreich zu sein. Vielleicht hatte Xaver ja auch von einem anderen Leben geträumt? Jedenfalls war von diesem Ring nichts zu sehen. „Sonderbar“, konstatierte Johann. „Aber vielleicht ist er ihm vom Finger gerutscht?“ Der Ehering des Mannes dagegen steckte noch an seinem Ringfinger. Johann erinnerte sich weiter, dass die Polizei und die Bergwacht damals nach dem Vermissten gesucht hatten, aber außer dem Schneemobil hier oben in der Nähe des Fundortes war nichts gefunden worden. „Der ist bestimmt beim Wildern abgestützt“, hatte sein Vater damals gemutmaßt und mit dieser Annahme schien er seiner Zeit ja auch recht gehabt zu haben.