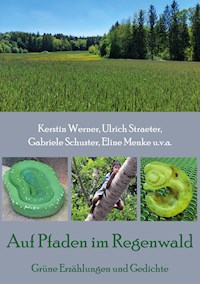Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Winterstimmungen aus der Kindheit werden wachgerufen. Immer wieder wird der spannende Weihnachtsabend erwartet. An besondere Geschenke erinnert man sich viele Jahre später. Eine Exkursion um den Stechlinsee zurück zum Quartier zieht sich ungeahnt in die Länge. Folgen Sie den exotischen Regeln, wie man in der Sowjetunion reisen durfte oder eben aufgehalten wurde. Plötzlich saß man mitten in Sibirien fest in den Fängen der Miliz. Räucherkerzen von besonderer Mixtur entstehen aus einer Strafarbeit heraus, der Sohn hatte sich ungefragt das Auto des Vaters für eine Spritztour geliehen. Nach Kriegsende eine Wohnung zu bekommen war schwer, ein geschenkter Anzug führt zu überraschenden Folgen. Vom dunklen Schattenreich der Weihnachtsgeschenke berichtet eine surreale Geschichte, die Klimagefahr öffnet einen anderen Blick auf unseren Konsum. Einen Protagonisten verschlägt es gar auf die Antarktisstation Neumayer III. Die Nebelgespenster eines Schneesturms dringen in unseren Blick. Der Band enthält neben Erzählungen zahlreiche Gedichte über Winterlandschaften, die Adventszeit und den Heiligen Abend. Hören Sie, der Weihnachtsmann klopft an die Tür!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Kerstin Werner
Bilder meiner Kindheit
Roland Jähnichen
Verschollen vor Kysyl. In einem Land kurz vor dem Ende der Geschichte
Jutta Schöps-Körber
Der Anzug
Zoe Ingraden
Es raucht
Frank Joussen
Weihnachten und das Loch in der Welt
Karsten Beuchert
Die russische Fellmütze
Turmzeit
Polarwinter
Das Glücksrezept – eine Weihnachtsgeschichte
Tilman Kressel
Uns ist ein Kind geboren – und nun?
Bettina Engel-Wehner
Wintermorgen
Weih-nach-denk-lich
Weihnachtsstunden
Haiku
Volker Teodorczyk
Wunschgeschenk
Beweise
Wunderwelt
Weihnachtlicher Dialog
Vorbereitungen
Regina Jarisch
wintertal
es weihnachtet
winterzweifel
wintertief
Carsten Rathgeber
Lebensspuren
Schneefall
Weiße Landschaft
Existenz in Räumen
Laternenschein
Eisige Hülle
Angelika Lotfey
Am Morgen nach dem Schneefall
Michael Matzke
Weihnacht in Heidelberg
Christtagsmorgen
Winterweihnacht
Winterwunder
Winterwind
Innsbrucker Weihnacht
Corona-Weihnacht 2020
Weihnachten in Graz
Weihnachten auf Lampedusa
Schlaf des Gekreuzigten
Wiener Weihnachten
Karin Unkrig
Januar
Schneeleopard
Willi Volka
Der Rubel rollt
Dröhnen Drohnen fern
St. Martin
Ingrid Ostermann
Winterwind
Christrose
Ingeborg Henrichs
Adventhimmel
Sehnen
Flüstern
Dezemberland
Miki Goldberg
Ofen
Schneeglocken klingen
Winteratem
Frank Findeiß
„Weinnachten“
Weihnachtsextase
Schein heiliger Abend!
Fritz Haselbeck
Schneesturm
Kalte Tage
Weihnachtsabend
Geboren
Stille Nacht
Abendstille
Andrzej Kikał
Tirreno Adriatico
durch den Januarpark streifen
Tirreno Adriatico (polnisch)
styczniowe szwendania w parku
Marko Ferst
Von dort kippt alles
Im Ural
Schloßpark Charlottenburg
Väterchen Frost
Weißbärtiger
Schneefrühling
In der Tundra
Heike Streithoff
Sich dehnen
Dyrk-Olaf Schreiber
en passant
Ich bin ein Gebäck
Reinhard Lehmitz
Winter Tanka
Winter Haiku
Winterblau
Seelenfrieden
Bettina Melzer
das jahr ist alt
einerlei welches jahr anbricht
Robert Minkel
Januarnachmittag
Der Winter dauert
Frühlingsheiß
Januarmorgen
Februarwind
Frühlingstod
Falsches Versprechen
Frost
Winterling
Dezember
Tristesse im Dezember
Fluss führt Hochwasser
Niemandsleer
Gesang im Vorfrühling
Erich Pfefferlen
Erster Wintertag
Gestern ist der Winter
Schneereste
grün im januar
René Oberholzer
Die von Gurs
Im Schwarzwald
Vom Weg abgekommen
Verschätzt
Möhrenland
Spiessig
Zoe Fornoff
In mir schneit es
Gerwin Haybäck
Winterweh
Knecht Ruprechts Maske
Nikolaus Luttenfeldner
Advent-Problem
Sylvia Hofmann
Stille Nacht – schlimme Nacht. Weihnachten im Staat New York
Verschollen in der Felswüste Afghanistans. Olinas Traum und die raue Wirklichkeit
Weihnachtszeit auf Teneriffa
Winterurlaub in Kenia
Möchten Sie ein Winter-Traumland erleben?
Welcher Weihnachtsmann kommt zu uns?
Winterurlaub mit dem Freund und der guten Freundin
Bernhard Valta
Josef denkt nach
Wolf-Ulrich Cropp
Erfüllte Weihnachten
Begegnung auf dem Weihnachtsmarkt
Marita Wessels
Weihnachtsmarkt im Wald
Ulrike Teepe
Pfauenauge
Grete Ruile
Der Talisman
Durch Inspiration geboren
Meine Puppe
Verlockendes Weihnachtsgebäck
Die Enthüllung
Weihnacht im Hotel Maritim in Würzburg
Der Weihnachtswunderstern
Margit Stein
Maria mit dem Kind – eine Weihnachtsgeschichte
Vanessa Boecking
Winterurlaub auf Teneriffa
Eine verrückte Weihnachtsparodie
Nikolaus Luttenfeldner
Das Geheimnis des Großonkels
Utta Kaiser-Plessow
Schneewalzer
Beatrix Jacob
Wintergedanken in Naumburg an der Saale
Im Schneetreiben bei Querfurt gefangen
Marko Ferst
Im Schlaubetal
Heike Streithoff
Im Winkel
Nadine Messerschmidt
Familie
Michael Langemann
Heiligabend
Marita Wilma Lasch
Loblied auf einen Newsletter
Saskia Wolter
Unerfüllte Hoffnung
Thea Marie Egger Riedmüller
Wie Schneeflocken
Thomas Steiner
ich war mal den ganzen dezember
weil ich nicht wusste
der schnee
Erich Spöhrer
Sterndeuter
Andrea Therese Berntal
Rückblick
Genesung
Kathrin Ganz
Eisiger Januar
Freier und offen
Dezemberabend
Kaltes Lied
Abend im Dezember
Vergnügen mit Mond und Sterne
Denitza Petrova
Wiederentdecken
Bernhard Valta
Weihnachten damals
Thomas Stein
Dezembertag
Eisblumen
Wintersonnentag
Umeå
Lesley Wieland
Kunststück
Legendenbuch
Schmuck wilder Möhre
Der Zettelwunsch
Stefan Reschke
Winterglück
Am Nordpol
Hans-Georg Karl
Weihnachten ist da
Jens Gottschall
Winterzauber mit Frosti
Besinnlichkeit und Hoffnung
Ein neues Jahr
Was ist Glück?
Die kleine Weihnachtstanne
Weihnachts-(B)rauch
Erwin der Schneemann
Wünsche zum Fest
Schneemann - Träume
Nur für dich
Winter-Weihnacht, so wie einst
Annedore Hirblinger
Weihnachtspotpourri 1
Weihnachtspotpourri 2
Saskia Wolter
Winterbeginn
Waldspaziergang
Bodo, der Weihnachtshund
Schneeflockenreise
Grete Ruile
Winterzauber
Das Weihnachtsglöckchen
Winternacht bei Vollmondschein
Weihnachtsbotschaften
Ein Tannenbaum
Wundersterne der Natur
Ein Gruß aus der Unendlichkeit
Anita Hollauf
Februar
Wintervorrat
Vergehender Herbst
Nebel im Advent
Weihnacht
Sven W. Dahlke
Der Südwind
Ines Marx
Weihnachten
Haiku zur Heiligen Nacht
Ilona Gruber Drivdal
Segel im Winter
Safari baridi: Eine Winterreise und eine stille Nacht auf Suaheli
Olga Goldberg
Weihnachtszauber
Anja Apostel
Nadalia
Alexander Weiz
Die Verbindung eines Volkes
Beatrix Jacob
Hoffnung im Advent
Weihnachtswald
Winterliche Erholungspause für die Natur
Winterkleid
Josef Glückski
Berlin, 25.11.23
Berlin, 27.11.23
Berlin, 4.12.21
Berlin, 13.12.21
Berlin, 27./28.12.15
Berlin, 25.12.16
Berlin, 28.12.23
Berlin, 5.1.13
Berlin, 11.1.15
Berlin, 20.1.22
Berlin, 28./29.1.12
Berlin, 17.2.09
Berlin, 21.1.24
Berlin, 3.2.16
Berlin, 16.2.17
Michael Huschens
durchs Holz
Gespräch mit einer Bahnhofstaube
Winterbetrachtung
Ansichten eines Stadtstreichers
kalendarischer Frühling
Autorinnen und Autoren
Kerstin Werner
Bilder meiner Kindheit
Für meine Eltern
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, erinnere ich mich immer wieder gern an meine Kindheit. Erst heute begreife ich, wie wohlbehütet ich aufgewachsen war, mit wie viel Liebe, Geduld und Konsequenz meine Eltern unser Familienleben gestaltet und ihre vier Kinder großgezogen haben. Meine Eltern gaben uns stets die Gewissheit, dass das Leben gut ist, und ich spüre noch heute dieses Urvertrauen, dass alles im Leben einen Sinn hat. Auch in schweren Krisen habe ich fortwährend mit der Zuversicht gelebt: Alles wird gut! Diese Lebenshaltung hat mich stark geprägt. Alles was ich tue, geschieht mit meinem inneren Glauben an das Gute im Menschen. Meine Eltern konnten uns vier Kindern ein sicheres Heim schenken, was für mich Geborgenheit und Wärme bedeutete. Auf sie konnte ich mich stets verlassen. Ich glaube, dass mir diese Wurzeln einen sicheren Halt in meinem weiteren Leben gegeben haben. Sowohl meine Mutter als auch mein Vater ließen sich bei der Erziehung ihrer vier Sprösslinge von ihrem Gefühl und gesunden Menschenverstand leiten.
Da wir vier Geschwister kurz hintereinander auf die Welt gekommen waren, fühlten wir uns von Anfang an eng miteinander verbunden. Ich wurde als drittes Kind geboren, orientierte mich oft an meiner älteren Schwester und meinem älteren Bruder, die mich beide beschützten und mir vieles beibrachten. Meine jüngere Schwester wurde bald meine engste Spielkameradin in unserer Familie.
Bis zu meinem siebten Lebensjahr wohnten wir in Landsberg, einem Ort unweit von Halle an der Saale. Ich liebte diese Kleinstadt; sie war so überschaubar, dass wir schon im Vorschulalter allein durch die Stadt laufen durften, ob zum Kindergarten, zum Einkaufen, ins Kino, zum Rodeln oder ins Felsenbad – unsere Eltern wussten, was sie uns bereits zutrauen konnten. Sie schenkten uns ein Stück Freiheit, das wir schon als Kinder zu schätzen wussten und deshalb unsere Eltern nur selten enttäuschten. Auf diese Weise lernten wir schon recht früh, Selbstverantwortung zu übernehmen. Da wir Geschwister häufig gemeinsam loszogen, kamen wir auch zur rechten Zeit wieder nach Hause.
Einen besonderen Platz in unserem Familienleben nahmen die jahreszeitlichen Feste ein – wie Ostern, Nikolaus und Weihnachten. Doch das Weihnachtsfest war mir von allen traditionellen Festen das Liebste. Nie habe ich mich als Kind so glücklich gefühlt wie zu Heiligabend. Wenn ich all die vielen Erinnerungsbilder wieder vor mir aufleben lasse, wird mir innerlich ganz warm ums Herz, und noch heute spüre ich diese geheimnisvolle und feierliche Atmosphäre, die ich als Kind an Heiligabend empfunden habe.
Schon Tage vorher schmückten wir unseren Weihnachtsbaum, der auf mich eine magische Anziehungskraft ausübte. Sein strahlender Glanz mit all den bunt glänzenden Weihnachtskugeln, den Lichterkerzen und dem silbernen Lametta beglückte mich so sehr, dass ich diesen wundersamen Anblick noch immer vor mir sehe. Für mich war es jedes Jahr aufs Neue der schönste Weihnachtsbaum, den ich je gesehen hatte, und ich hielt mich gern in seiner Nähe auf.
Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest begann für mich in all den Jahren bereits Mitte November, am Geburtstag meines Bruders. Meine Eltern nahmen diesen Tag zum Anlass, jedem von uns Kindern einen Adventskalender zu schenken. Dies war für uns ein ganz besonderer Augenblick. Aufgeregt hielten wir die Kalender in den Händen und betrachteten die stimmungsvollen Bilder und rätselten, was sich wohl hinter jedem der vierundzwanzig Türchen verbergen könnte. Diese Bilder regten so stark meine Phantasie an, dass meine kindliche Seele bald selbst in die Geschichte meines Adventskalenders hineinschlüpfte. Doch nie öffneten wir ein Türchen schon vorher, sondern wir warteten geduldig jeden Tag ab und freuten uns, gleich am Morgen nach dem Aufstehen unser Kalendertürchen zu öffnen.
Als wir älter wurden und schon gut zeichnen konnten, begannen wir selbst solche Kalender zu malen. Wir fertigten kleine Papierlose an, die darüber entschieden, wer für wen einen Adventskalender gestalten würde, aber niemand durfte etwas verraten. Jeder von uns malte und bastelte seinen Kalender heimlich, und erst als der 1. Dezember näher rückte und wir mit unseren Arbeiten fertig waren, überreichten wir uns gegenseitig die selbstgestalteten Adventskalender. Von Jahr zu Jahr wuchsen unsere Ansprüche und wir entwickelten eine Kreativität, die mich noch heute zum Erstaunen bringt. Wir malten Bilder, die meist eine Schneelandschaft darstellten. Einmal gestaltete meine ältere Schwester mit Pinsel und Farbe einen Winterwald, und für den Schnee klebte sie weiße Watte auf das Papier. Überall auf ihrem Bild lugten Waldtiere hervor, hinter oder auf einem Baum, unter einer Wurzel oder in einer Erdhöhle – alles wirkte sehr geheimnisvoll.
Mit Leidenschaft und Ausdauer entstanden in all den Jahren die schönsten Kunstwerke. Als ich etwa zwölf Jahre alt war, bastelte mein Bruder für mich einen räumlichen Adventskalender und zauberte aus einem Schuhkarton und mehreren Streichholzschachteln ein winterliches Stillleben hervor. Wir alle, auch unsere Eltern, waren beeindruckt, denn so etwas Schönes hatten wir noch nicht gesehen. Ich selbst malte auf meinen Bilderkalendern am liebsten Kinder, die draußen im Schnee spielten, umgeben von Häusern und Bäumen, wo ich recht schnell und geschickt ein Türchen hineinzeichnen konnte. Die verborgenen Bilder, die wir hinter die Türchen auf ein zweites Blatt malten, mussten sich gut in das vordere Gesamtbild einfügen, das war unser Anspruch. Beim Zeichnen der Figuren orientierten wir uns gern an den Illustrationen unserer Kinderbücher, die wir so manches Mal auch abgepaust haben; ein kleiner Trick, den uns unser Vater beigebracht hatte.
An ein Weihnachten, das sehr weit zurückliegt, kann ich mich besonders gut erinnern; es muss 1968 gewesen sein, ich war gerade viereinhalb Jahre alt. Zur damaligen Zeit lebten wir noch in Landsberg in einem Mehrfamilienhaus, und unsere Großmutter Rosalie väterlicherseits wohnte eine Etage über uns. Das war für uns Kinder sehr schön. Da wir am Nachmittag des Heiligabends unser Wohnzimmer nicht mehr betreten durften, brachte uns mein Vater zu meiner Oma und erlaubte uns, die Fernsehsendung „Zu Besuch im Märchenland“ anzuschauen. Wir liebten diese Sendung, und an jenem Nachmittag stimmte sie uns besonders auf das Weihnachtsfest ein, denn auch Pittiplatsch und Schnatterinchen, Herr Fuchs und Frau Elster, Onkel Uhu und all die anderen Waldtiere und Kobolde bereiteten sich auf das Weihnachtsfest vor. Auch hier war der Winter eingezogen, die verschneiten Tannen und Hütten verzauberten den Märchenwald und alle Puppenfiguren trugen eine Pudelmütze auf dem Kopf und einen Schal um den Hals. Alles war so schön und gemütlich, wir saßen eng beieinander auf Omas Sofa, mit einem Kribbeln im Bauch, und folgten gebannt der Geschichte im Fernsehen. Wir wussten, bald würde die Bescherung sein. Als die Kindersendung zu Ende war, bat mich meine Oma, nach unten zu gehen und meine Eltern zu fragen, wie lange die Vorbereitungen noch dauern würden. Doch meine Eltern konnte ich nirgends erblicken, ich stand vor der verschlossenen Wohnstubentür und schaute durch die geriffelte Glasscheibe. Auf einmal sah ich bewegte Schatten im gedämpften Licht und vernahm leise Stimmen. Hier darf ich jetzt nicht rein, dachte ich, bestimmt ist gerade der Weihnachtsmann da und bespricht sich mit meinen Eltern. Mein Herz klopfte. Ich hatte ein wenig Angst vor dem Weihnachtsmann und wollte ihm deshalb nicht begegnen. Leise schlich ich mich hinaus, stieg die Treppen wieder hoch und erklärte meiner Oma, dass gerade der Weihnachtsmann da sei und ich niemanden fragen konnte. Meine Oma lächelte und erlaubte uns, noch einen Märchentrickfilm anzuschauen.
Dann endlich kam mein Vater zu uns nach oben, und gemeinsam mit meiner Oma verließen wir ihre Wohnung und stiegen die Treppen hinab. Aufgeregt standen wir nun vor der Wohnstubentür und warteten, bis meine Mutter sie öffnete und uns hineinließ. Wir huschten in das Zimmer und stießen Freudenschreie aus. Wohin ich auch blickte, überall brannten Lichter und Kerzen, der große Weihnachtsbaum leuchtete festlich und unsere Geschenke waren wie von Zauberhand auf den niedrigen Schränken aufgebaut. Da entdeckte ich ein großes Puppenhaus – und als ich begriff, dass es für mich sein sollte, blieb ich staunend davor stehen. Das weiße Haus mit rotem Ziegeldach, einem Balkon und einer Wiese ringsherum sah wunderschön aus. Jedes Zimmerchen war mit Puppenmöbeln eingerichtet und an den Wänden entdeckte ich kleine hellblaue Lichtschalter, mit denen ich die Deckenlampen an- und ausschalten konnte. Im Puppenwohnzimmer schmückten verschiedene Grünpflanzen das große Erkerfenster und mittendrin stand sogar ein kleiner Weihnachtsbaum. In der Küche darüber gab es ebenfalls ein Fenster und rechterhand eine Tür mit rotem Vorhang, die ich für meine Puppen benutzen konnte, um auf den großen Balkon zu gelangen. Besonders hübsch fand ich die vierteilige durchsichtige Eingangstür, die mit einer weißen Gardine versehen war und in das Schlafzimmer führte. Ich freute mich über die vielen Puppen, die im ganzen Haus verteilt waren. Im Wohnzimmer saßen sie auf einem grünen Sofa oder einem Sessel, oben in der Küche auf rot-weißen Stühlen, oder sie lagen in einem der Betten im Schlafzimmer. Alles sah so echt aus, nur eben ganz klein, und ich konnte es kaum erwarten, damit zu spielen.
Schon bald trug mein Vater das Puppenhaus in unsere Wohnküche und stellte es auf den großen Esstisch, damit ich mit meinen Geschwistern ungestört spielen konnte, denn auch meine ältere Schwester besaß bereits eine Puppenstube, nur etwas kleiner, mit zwei Zimmern und ohne Licht. Doch an diesem Abend freute sie sich vor allem über ihre kleine Puppenschule, die ihr der Weihnachtsmann geschenkt hatte – mit kleinen Schulbänken, in denen die Puppenkinder saßen, mit einer schwarzen Schultafel, auf die man mit winziger Kreide schreiben konnte, und mit einem Lehrertisch, hinter dem die Puppenlehrerin stand.
An jenem Weihnachtsabend spielten wir lange und diese beglückende Stimmung werde ich wohl nie vergessen. Wir schalteten das große Licht im Zimmer aus, damit die kleinen Lampen in meinem Puppenhaus besonders schön leuchteten, schließlich war es draußen schon dunkel. Magisch vom warmen farbigen Licht angezogen, setzten sich meine Geschwister bald zu mir, denn vor meinem neuen Puppenhaus, so schien es uns, war es mit dem kleinen Weihnachtsbaum und dem Licht am gemütlichsten.
Damals ahnte ich noch nicht, wie bedeutsam dieses Puppenhaus für mich werden und wie lange es mich in meiner Kindheit begleiten würde, denn bis zu meinem zwölften Lebensjahr empfand ich große Freude, damit zu spielen. Mein Puppenhaus überlebte mehrere Umzüge.
Dass der Weihnachtsmann und der Nikolaus damals auch eine erzieherische Aufgabe zu erfüllen hatten, erlebte ich ein Jahr später in unserem Kindergarten. Normalerweise kam der Nikolaus in der Nacht, wenn alle Kinder schliefen, so erlebte ich es zu Hause. Wenn wir am Morgen aufwachten, war die Überraschung jedes Mal groß: Unsere geputzten Stiefel waren gefüllt mit einer Apfelsine und allerlei Süßigkeiten. Aber oft fragte ich mich, ob es den Nikolaus wirklich gab. So viel ich darüber auch nachdachte, die Vorstellung, dass er nachts von Haus zu Haus zog und die Stiefel der Kinder mit einer kleinen Gabe füllte, gefiel mir so sehr, dass ich an den Nikolaus glaubte; er war ein guter Mann, der die Kinder liebte und heimlich beschenkte.
Doch als ich fünfeinhalb Jahre alt war, kam der Nikolaus zu uns in den Kindergarten – für mich ein traumatisches Erlebnis. Wir Kinder saßen bereits im Morgenkreis und sangen das Lied „Lasst uns froh und munter sein“. Plötzlich hörten wir ein lautes Klopfen – wieder und immer wieder. Erschrocken und verängstigt hielten wir den Atem an, aber auch unsere Kindergärtnerin schien sich zu wundern. Auf einmal öffnete sich die Tür und der Nikolaus mit seinem roten Mantel und dem Sack auf dem Rücken polterte herein. Seine Kapuze war tief über seine Stirn gezogen und auch sein langer weißer Bart verdeckte sein Gesicht, nur seine dunklen buschigen Augenbrauen und seine Augen waren zu erkennen. Er schaute uns grimmig an – so schien es mir – und begrüßte uns mit seiner lauten, barschen Stimme. Dann setzte er sich zu uns in den Stuhlkreis und holte ein großes Buch aus seinem Sack.
„Ward ihr auch alle artig?“, fragte er.
„Jaaa“, riefen wir wie aus einem Munde.
„Da will ich doch mal schauen, ob das wirklich stimmt“, erwiderte der Nikolaus und öffnete sein Buch.
Ich spürte, dass mir seine ruppige Erscheinung Angst einflößte, und ich glaube, meinen Spielkameraden erging es ähnlich. Er rief nach und nach die ersten Kinder auf und überreichte jedem Einzelnen ein kleines Säckchen mit Lebkuchen, Schokolade und Nüssen. Mein Herz klopfte wie wild, aber ich wurde nicht aufgerufen.
Der Nikolaus schaute nachdenklich in die Runde und sprach: „Doch leider waren nicht alle Kinder artig.“ – Ich erschrak und war den Tränen nahe. Was hatte ich Böses getan? Als er meinen Namen aufrief, behauptete er, ich würde bei den Mahlzeiten zu viel mit meinen Freundinnen schwatzen. Beschämt schaute ich ihn an. War das wirklich so? Es überraschte mich, denn es war mir nicht bewusst gewesen. Doch dann war ich erleichtert, dass ich nicht das einzige Kind war, welches gegen die Regeln verstoßen hatte. Zur Strafe mussten wir mehrere Runden innerhalb des Stuhlkreises über seine Rute springen, sodass uns die anderen Kinder dabei zuschauten. Ich fühlte mich so gedemütigt, dass ich anfing bitterlich zu weinen. Auf einmal brach meine heile Welt zusammen und ich konnte nichts dagegen tun – nur laufen und springen. Erst als wir unsere Runden absolviert hatten und versprachen, uns zu bessern, bekamen auch wir dieses kleine Geschenk. Aber ich freute mich nicht mehr darüber. Ich war zutiefst erschüttert.
Etwa vierzehn Tage später feierten wir im Kindergarten das Weihnachtsfest. An diesem Tag machten wir einen kleinen Ausflug, und ich erlebte das erste Mal ein richtiges Theaterstück in einem großen Saal. O wie war das aufregend! Mit großer Erwartung saßen wir auf unseren Stühlen und blickten auf die schön gestaltete Bühne. Und auf einmal trat der Weihnachtsmann hervor, begrüßte uns Kinder und eröffnete die Theatervorstellung. Unsere Kindergärtnerinnen führten das Märchen „Frau Holle“ auf und ich staunte, wie ausdrucksvoll sie das spielten. So hatte ich meine Erzieherinnen noch nie erlebt. Zum Abschluss trat der Weihnachtsmann noch einmal auf die Bühne und wünschte uns Kindern ein frohes Fest. Da fiel mir ein großer Stein vom Herzen, denn mir schien, dass der Weihnachtsmann lieb und freundlich zu uns war, keine böse Überraschung würde mich diesmal erwarten. Gemeinsam sangen wir noch ein Weihnachtslied, dann standen wir auf und liefen wieder zurück in unseren festlich geschmückten Kindergarten. Am Nachmittag waren die Tische mit Weihnachtsplätzchen und Lebkuchen gedeckt, die mir natürlich viel besser schmeckten als die Vesperschnitte in meiner Brottasche. Dem Weihnachtsmann war ich an diesem Tag unendlich dankbar. Er hatte uns das Märchen „Frau Holle“ geschenkt und war zu allen Kindern so freundlich, dass ich noch heute sein liebes, strahlendes Gesicht vor mir sehe. Der Nikolaus hingegen, so sagte ich mir, konnte nicht der echte gewesen sein, denn der echte Nikolaus kommt nur in der Nacht und hat alle Kinder gleich lieb.
Es war mein letztes Jahr im Kindergarten, und in dieser Zeit vergrößerte sich unsere Familie. Meine Großtante, die wir liebevoll Tante Susi nannten, war aus ihrer Heimatstadt Halle, wo sie bisher mit ihren Eltern gelebt hatte, zu uns nach Landsberg gezogen und wohnte von nun an bei uns. Ihr Vater, den sie bis zu seinem Tod gepflegt hatte, war der Letzte ihrer Familie, ihre Mutter lebte schon lange nicht mehr und ihre drei Brüder waren im Zweiten Weltkrieg gefallen. Daher haben wir unseren Großvater nie kennengelernt. Wir liebten Tante Susi; sie war gutmütig und freundlich und bereicherte unser Familienleben. Sie übernahm viele Hausarbeiten und kümmerte sich um uns Kinder. Ich genoss es, auch mit ihr allein unterwegs zu sein. Ich liebte Landsberg, kannte jeden Winkel, und noch heute verbinde ich meine Kindheit mit dieser schönen Kleinstadt.
Aber auch unsere Großmütter waren nicht aus unserem Familienleben wegzudenken. Nicht nur meine Oma Rosalie väterlicherseits, sondern auch meine Oma Martha mütterlicherseits lebte mit ihrem Vater in Landsberg, etwa zehn Minuten Gehweg von unserem Wohnhaus entfernt. Wenn wir über die beiden sprachen, sagten wir häufig einfach: „die Omi, die oben wohnt“ und „die Omi, die einen Opa hat“.
Wir besuchten unsere Oma Martha oft, und nachdem ihr Vater verstorben war und sie nun allein in ihrer Wohnung lebte, blieb ich mit meiner jüngeren Schwester manchmal auch mehrere Tage bei ihr, ich empfand es immer als etwas Besonderes, bei ihr zu übernachten. Meine Oma Martha war sehr lieb zu uns, aber auch ein wenig streng, doch genau das gab uns eine gewisse Sicherheit. Ich fühlte mich bei ihr wie zu Hause, alles war mir vertraut und ich genoss es, von meiner Oma mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und verwöhnt zu werden, als ich es bei meinen Eltern gewohnt war. Unmittelbar neben ihrer Wohnküche befand sich eine kleine Kochnische, in der ein Kohleherd stand, den sie mit Holz und Kohlen beheizen musste, damit sie darauf kochen konnte. Das fand ich als Kind sehr gemütlich. Meine Oma besaß keinen Kühlschrank. Die Frischmilch, die sie für uns kaufte, kochte sie auf dem Herd ab und brachte sie anschließend in ihren kühlen Keller, damit die Milch nicht sauer wurde. Auch Butter, Wurst und Käse bewahrte sie in ihrem Keller auf. Da sie auch kein Bad besaß, sondern nur eine Toilette, stellte sie uns abends in der Kochnische eine Schüssel mit warmem Wasser auf einen Hocker, sodass wir uns dort mit Seife und Lappen waschen konnten. Nie habe ich mich als Kind so gern gewaschen wie bei meiner Oma. Es wurde mir bei ihr nie langweilig, auch wenn sie für uns Kinder nur einen Holzbaukasten als Spielzeug besaß. Doch dafür befanden sich in ihrem Nähkästchen eine Menge Knöpfe, mit denen wir ebenfalls spielen durften. So saßen meine jüngere Schwester und ich gern in ihrer Wohnküche am großen Esstisch, bauten mit den Holzklötzchen kleine Häuser, Türme und Brücken, und sortierten dazu Omas wunderschöne Knöpfe und legten sie in unsere Bauwerke hinein. Unsere Phantasie kannte keine Grenzen.
Wenn ich allein bei meiner Oma war, begleitete ich sie oft zum Friedhof, der nur wenige Schritte von ihrem Haus entfernt lag, sodass sie auf unserem Weg dorthin immer eine Gießkanne und eine Harke bei sich tragen konnte. Ich mochte die Friedhofsstille, in der sie ihr Familiengrab pflegte und mir von ihren Eltern und ihrem Mann erzählte, die dort in der Erde ruhten. Ich hörte ihr gern dabei zu und wollte alles genau wissen. So erfuhr ich, dass ihre Mutter Emma im selben Jahr verstorben war, als ich das Licht der Welt erblickte. Das berührte mich als Kind. Nicht, dass ich traurig war, aber ich begriff: Tod und Geburt gehören im Leben der Familie zusammen. Ich fühlte mich mit meiner Uroma eng verbunden, da sie mich so kurz vor ihrem Tod noch in ihren Armen halten konnte.
Gelegentlich holte meine Oma Martha ihre Fotoalben aus dem Schrank, die ich mir in Ruhe anschauen durfte. Da sah ich zum ersten Mal ihren Mann – meinen Großvater –, der im Zweiten Weltkrieg gefallen und der Bruder von Tante Susi war. Mich beeindruckten die zahlreichen Familienfotos und ich erkannte, dass ich meiner Oma sehr ähnlich sah, als sie selbst noch ein Kind gewesen war.
Aber nicht nur zum Friedhof begleitete ich sie, sondern auch zu ihrem Schrebergarten, der etwas abseits von Landsberg lag und wir deshalb einen langen Weg zurücklegen mussten, aber das störte mich nicht. Während sie sich um ihre Beete kümmerte, half ich ihr beim Unkrautziehen oder beim Gießen. Doch wann immer ich wollte, durfte ich von den Äpfeln, Birnen und Beeren naschen oder einfach nur spielen.
Meine Oma Martha blieb auch später, als wir 1971 unsere Heimatstadt Landsberg verlassen mussten, eine wichtige Bezugsperson für uns. Das Dorf, in dem wir nun lebten, war nur zwanzig Kilometer von Landsberg entfernt, sodass wir weiterhin regelmäßig meine Oma besuchten oder wir sie zu uns nach Hause einluden. Dennoch bedeutete dieser Umzug für mich ein schmerzvoller Abschied von meiner geliebten Heimatstadt Landsberg, in der ich nicht nur meine Freunde verlor, sondern auch das vertraute Umfeld, in dem ich groß geworden war. Ich ließ ein Stück Kindheit zurück.
Meine Oma Rosalie, die über uns gewohnt hatte, erlitt bald einen schweren Schlaganfall. Sie verlor ihre Sprache, war körperlich stark eingeschränkt und musste viel Zeit im Bett verbringen. Ihre zweitälteste Tochter, die mit ihrer vierköpfigen Familie in der Nähe wohnte, nahm sie zu sich nach Hause und war bereit, sie mit Hilfe ihres Mannes zu pflegen. So war es möglich, dass mein Vater und seine sechs Geschwister meine Oma bis zu ihrem Tod 1974 begleiten konnten. Wenn mein Vater sie besuchte, nahm er Fotos von uns mit, in der Hoffnung, dass sie ihre Enkel wiedererkennen möge. Wir Kinder begriffen, wie schlecht es um unsere Oma stand und hatten sie seit ihrer Krankheit nicht wiedergesehen.
Doch auch in unserem neuen Dorf wurde ich bald heimisch. Schon nach wenigen Monaten hatten meine Eltern mich gefragt, ob ich gern das Klavierspiel erlernen würde, denn nur fünf Minuten von unserem Haus entfernt wohnte eine Klavierlehrerin. Ich war sofort von der Idee begeistert. Wenige Tage später besuchte ich zusammen mit meinem Vater die Klavierlehrerin, um mich bei ihr anzumelden. Frau Biehle war bereits Rentnerin, lebte mit ihrem Mann und ihrer Mutter in einer kleinen Dreiraumwohnung und begrüßte uns sehr herzlich. Sie empfahl mir die Klavierschule „Köhler“: ein dickes Notenheft, das für Klavieranfänger ausgelegt war. Da mein Vater in Halle arbeitete, kaufte er mir dort dieses Notenheft, und so ging ich jeden Montagnachmittag zu Frau Biehle in die Klavierstunde. Ich lernte schnell die Noten, und schon bald konnte ich die ersten kleinen Stücke auf dem Klavier spielen. Doch etwa nach einem halben Jahr begriff ich, dass ich mit dem Klavierspiel nur vorankommen würde, wenn ich regelmäßig jeden Tag eine Stunde übte. Anfangs fiel mir das nicht schwer, aber dann wollte ich lieber mit meiner Freundin draußen spielen, als mich an das Klavier zu setzen. Zum Glück wartete Bettina oftmals geduldig auf mich, bis ich mit dem Üben fertig war. Heute bin ich meinem Vater dankbar, dass er mich damals motivierte, regelmäßig zu üben, denn sonst hätte ich womöglich das Klavierspiel aufgegeben. Da ich mehrmals in der Woche auch noch Kanusport trainierte, war mein Freizeitplan sehr eng. Doch als ich spürte, dass ich wesentliche Fortschritte im Klavierspiel erzielt hatte, empfand ich wieder große Freude beim Üben. Nach gut einem Jahr durfte ich schon Stücke aus dem „Album für die Jugend“ von Robert Schumann spielen. Ich liebte dieses Album, da ich die Klavierstücke, die ich nun einstudierte, viel schöner fand, als die Etüden von Louis Köhler.
Als ich zehn Jahre alt war, hatte ich sogar meinen ersten großen Auftritt. Zur Abschlussfeier der beiden zehnten Klassen unserer Dorfschule sollte ich in einem Festsaal in Halle vor den vielen Schülern, Eltern und Lehrern ein Klavierstück vorspielen. Die Idee kam vermutlich von meiner Musiklehrerin aus der Schule, denn auch sie nahm Klavierunterricht bei Frau Biehle. Noch heute erinnere ich mich an diesen Tag; ich trug einen hellblauen Hosenanzug und spielte von Robert Schumann den „Fröhlichen Landmann“, und obwohl ich sehr aufgeregt war, verspielte ich mich nicht. Kaum hatte ich meinen Vortrag beendet, lief ich rasch zu meinem Platz zurück und hörte, wie das Publikum klatschte. Wenige Minuten später spielte meine Klavierlehrerin ein Stück von Edward Grieg und das erste Mal erlebte ich, dass sie ebenfalls aufgeregt war, denn ein Auftritt vor so vielen Menschen war auch für sie eine Seltenheit. Wie gebannt saß ich auf meinem Stuhl und fieberte mit ihr mit. Ihr Stück, das bedeutend schwerer und länger war als meins, spielte sie sehr ausdrucksstark und ich bewunderte sie dafür. Doch als sie wieder bei mir war, schimpfte sie auf das Klavier, dessen Tasten sich so schwer anschlagen ließen. Ich selbst hingegen war einfach nur froh, dass ich meinen Vortrag hinter mich gebracht hatte, denn vor so vielen Menschen zu spielen und vor Aufregung Herzklopfen und Schweißhände zu bekommen, kannte ich bisher noch nicht. Als Dank für mein Klavierspiel bekam ich von einem Zehntklässler einen kleinen Blumenstrauß geschenkt.
Die schönste Zeit, die ich mit meiner Klavierlehrerin verbrachte, war für mich die Adventszeit, und schon in meinem ersten Übungsjahr kaufte sie mir ein Weihnachtsheft, das mir viel Freude bereitete. Anfang November begannen wir, erste Weihnachtslieder daraus einzuüben. Einige kamen mir bekannt vor; wir sangen sie in der Schule, sodass mir die Melodien bereits vertraut waren. Aber in diesem Notenheft gab es auch Weihnachtslieder, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Es waren vor allem christliche Lieder, die wir weder in der Schule noch zu Hause gesungen hatten, doch ich fand sie wunderschön. Auch wenn meine Klavierlehrerin mir jedes neue Stück vorspielte, wusste ich zu Hause oftmals nicht mehr, wie das mir unbekannte Weihnachtslied eigentlich klingen sollte. Noch nie hatte ich das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ gehört, ich spielte es rhythmisch völlig verkehrt, bis mein Vater sich zu mir setzte und mir das Lied vorsang. Ich war erstaunt, dass mein Vater es kannte und begriff, dass die Welt der Weihnachtslieder unerschöpflich war. Doch warum wir diese alten Lieder in der Schule nicht mehr erlernten, blieb mir ein Rätsel.
Auf dem Klavier die stimmungsvollen Weihnachtslieder zu spielen, motivierte mich sehr; ich übte auch zu Hause mehr als sonst und freute mich auf die nächste Klavierstunde. Und so manches Mal, wenn ich die Wohnung meiner Klavierlehrerin betrat, kam mir ein Weihnachtsduft entgegen. Ihr Mann, der von Beruf Konditor war, hatte Plätzchen, Makronen und Blätterteigröllchen gebacken, und ich durfte zugreifen und von den Leckereien kosten.
Besonders gern spielte ich mit meiner Klavierlehrerin die vierhändigen Stücke, die am Ende des Weihnachtsheftes zu finden waren. Ich mochte den vollen Klang, der sich beim vierhändigen Spiel entfaltete und meine Vorfreude auf Weihnachten erhöhte. Noch heute begleitet mich dieses wunderschöne Weihnachtsheft durch die Adventszeit, und jedes Mal, wenn ich daraus spiele, fühle ich mich eng mit meiner Klavierlehrerin verbunden, auch wenn sie schon lange nicht mehr lebt. Die Notenseiten sind inzwischen vergilbt und fallen immer mehr auseinander, doch genau das liebe ich und mir wird bewusst, wie weit meine Kindheit zurückliegt und wie bedeutend das Klavierspiel für meine Seele geworden ist.
Nicht nur bei meiner Klavierlehrerin wurde in der Vorweihnachtszeit fleißig gebacken, sondern auch bei uns zu Hause. In den ersten Jahren halfen wir meiner Mutter beim Plätzchenausstechen, doch als wir älter wurden, durften wir Kinder schon selbstständig backen. Dann duftete es in der Küche und die vielen Plätzchen nahmen kein Ende; acht Backbleche kamen an einem Tag zusammen, schließlich waren wir eine siebenköpfige Familie. Als wir alle Plätzchen und Honigkuchen fertig gebacken und hin und wieder davon gekostet hatten, legten wir sie in große Steinkrüge und deckten sie mit Butterbrotpapier und einem Gummiband ab. Anschließend trugen wir die Krüge die Treppen hinauf, um sie in einer unserer beiden Dachbodenkammern abzustellen; dort sollten sie in der Kühle ruhen und bis zur Adventszeit ihren würzigen Geschmack entfalten. Aber so manches Mal überkam uns Kinder der Appetit auf ein leckeres Weihnachtsplätzchen, sodass wir heimlich auf den Dachboden stiegen und uns ein Honigkuchen oder ein Plätzchen aus einem der Steinkrüge herausholten, um es gleich zu vernaschen. Ob unsere Eltern davon gewusst haben? Bestimmt. Aber ein bisschen Heimlichkeit in der Weihnachtszeit war wohl erlaubt. Schließlich glaubten wir, es würde nicht weiter auffallen. Erst an den Adventssonntagen holten wir die Steinkrüge tatsächlich herunter und verteilten die Plätzchen und Honigkuchen auf die Teller, ließen es uns bei Kerzenschein schmecken und sangen anschließend unsere vertrauten Weihnachtslieder.
Doch in unseren beiden Dachbodenkammern verstauten wir nicht nur unsere Weihnachtsbäckerei, sondern auch viele Dinge, die wir nicht täglich brauchten oder die in der Wohnung nicht immer Platz fanden. So war es auch mit unseren Puppenhäusern. Meine jüngere Schwester hatte inzwischen ebenfalls ein sehr schönes Puppenhaus geschenkt bekommen, und so kam es, dass wir vor allem in der Vorweihnachtszeit gern damit spielen wollten. Mein Vater half uns dabei, die Puppenhäuser und die Kartons mit den Puppenmöbeln vom Dachboden herunterzuholen. Die beiden Häuser stellten wir Rücken an Rücken auf unseren Kinderzimmertisch, sodass meine Schwester an dem einen und ich an dem anderen Ende des Tisches saß. Dieser Moment war für uns immer etwas Besonderes. Zunächst entfernten wir mit einem feuchten Lappen den Staub von unseren Puppenhäusern, der sich das Jahr über trotz des abdeckenden Tuches darauf gesammelt hatte. Dann öffneten wir die Kartons und waren jedes Mal aufs Neue erstaunt, was für schöne Puppenmöbel wir besaßen. Es gab nie Streit, wir teilten uns die Möbel auf und putzten sie gründlich. Auch einigten wir uns schnell, wer welche Puppen zum Spielen nehmen wollte. Zu unserer Puppenfamilie zählte eine Mutter, mehrere Kinder und ein Baby. Einen Puppenvater gab es nicht, dazu fehlte einfach die entsprechende Puppe. Aber seltsamerweise störte uns das nicht, da wir als Mädchen vermutlich leichter in die Rolle der Mutter schlüpfen konnten und die Vaterrolle nicht vermissten. Für die Puppenbetten hatte uns unsere Oma Martha kleine Kissen genäht, über die wir uns sehr freuten und die wir wunderschön fanden. Meine Oma hatte ein unglaubliches Geschick für Handarbeiten, denn sie nähte nicht nur kleine Kissen, sondern auch neue Anziehsachen für die Puppen. Dafür entfernte sie zunächst die kaputten Kleider und umhäkelte dann mit dünnem Garn die kleine Puppe. Ich schaute ihr dabei zu und war erstaunt, wie schnell sie ein neues Puppenkleid hervorzauberte. Sie spürte meine Dankbarkeit und noch heute bin ich tief gerührt, wenn ich daran denke, mit wie viel Einfühlungsvermögen sich meine Oma in unsere Kinderwelt hineinversetzen konnte; sie wusste, womit sie uns eine Freude bereiten würde.
Stundenlang spielten wir mit unseren Puppen. Wir tauchten ein in eine Welt, die wir mit unserer Phantasie gestalteten; wir konnten selbst bestimmen, welches Leben die Puppen führten. Schon als Kind erfand ich kleine Geschichten, die ich mit meinem Puppenhaus im Spiel auslebte. Wir ließen uns viel Zeit dabei, alles sollte wie im echten Leben passieren. Wenn meine Mutter Kuchen backte, durften wir aus einem Rest Hefeteig kleine Brote und Brötchen formen, die sie dann mit in den Backofen legte. O wie freuten wir uns, als wir sie noch warm auf die kleinen Teller im Puppenhaus verteilen konnten.
Doch nicht immer blieben wir in den Weihnachtsferien zu Hause. In einem Jahr, es muss 1972 gewesen sein, ich war gerade acht Jahre alt, verbrachte unsere Familie Weihnachten und Sylvester in einem FDGB-Ferienheim in Wernigerode. Diese Art von Ferienheimen, die es überall in der DDR gab, wurden vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund stark subventioniert, sodass vor allem Menschen mit schwerer körperlicher Arbeit, Schichtarbeiter und kinderreiche Familien dieses günstige Reiseangebot in Anspruch nehmen konnten; so auch unsere Familie. Wir Kinder fuhren gern in den Urlaub, wir liebten es, mit unseren Eltern etwas Neues zu erleben und lernten auch recht schnell andere Kinder kennen, mit denen wir uns anfreundeten. Für uns war das jedes Mal eine spannende und aufregende Zeit.
Pünktlich zum Winteranfang hatte es in Wernigerode geschneit, und noch heute erinnere ich mich, wie sehr wir uns darüber gefreut hatten. Nun mussten wir auch nicht mehr lange warten, Heiligabend rückte näher heran, und für alle Kinder und Eltern sollte eine Weihnachtsfeier im Speisesaal stattfinden. Die Tische waren festlich mit Tannengrün und Kerzen geschmückt, und es gab für alle Familien Kaffee, Kakao, Lebkuchen und Plätzchen. An diesem Nachmittag war ich sehr aufgeregt, denn wir ahnten, dass auch der Weihnachtsmann kommen würde. Dieser Gedanke bereitete mir Unwohlsein. Ich mochte es nicht, vor so vielen Menschen ein Gedicht aufsagen oder ein Lied vorsingen zu müssen, denn schon manches Mal hatte ich erlebt, dass mir meine Stimme versagte und ich vor Aufregung keinen einzigen Ton herausbekam. Doch was sollte ich tun?
Als der Weihnachtsmann mit seinem großen Sack hereinkam, zitterte ich am ganzen Körper, am liebsten hätte ich mich verkrochen. Aber er war gütig und überaus freundlich. Ich brauchte nicht allein nach vorn zu kommen, sondern er hatte meine beiden Schwestern und mich gemeinsam aufgerufen. Unsere drei Geschenke sahen alle gleich aus. Meine jüngere Schwester, die damals erst sechs Jahre alt war, kannte kein Lampenfieber, und sie begann sogleich das Weihnachtslied „Guten Abend, schön Abend“ vorzusingen. Wir liebten dieses Lied, das uns auf wundersame Weise auf das Weihnachtsfest einstimmte. Doch meine kleine Schwester beließ es nicht bei der ersten Strophe, sondern sang alle drei Strophen hintereinander mit dem immer wiederkehrenden Refrain – und das Lied schien kein Ende zu nehmen. Der Weihnachtsmann wurde ein wenig ungeduldig, wollte ihr nach jeder Strophe danken, aber er schaffte es nicht, meine kleine Schwester aus dem Takt zu bringen. Als das Lied zu Ende war, atmete er auf, lächelte freundlich und bedankte sich für den großartigen Auftritt. Meine ältere Schwester und ich brauchten nun nichts mehr vorzutragen, und da fiel mir ein Stein vom Herzen. Als wir zu unserem Familientisch zurückkehrten, mussten auch meine Eltern schmunzeln und waren wohl ein wenig stolz auf ihre kleine Sängerin.
Doch was für eine Freude empfand ich, als ich mein Weihnachtsgeschenk auspackte! In meinem Karton lag eine Puppe, die ich sofort liebgewann. Ich hielt sie in den Händen und drückte sie an meine Brust. Sie war mittelgroß und trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Latzhose, eine weiße Pudelmütze aus Trikotstoff mit einer roten Bommel, weiße Söckchen und rote Schühchen zum Schnüren. Auch meine beiden Schwestern bekamen eine ähnliche Puppe geschenkt, nur trug jede eine andere Kleidung. Bis in den späten Abend hinein spielten wir mit unseren Puppen und waren glücklich. Mein Bruder bekam vom Weihnachtsmann ein sehr langes Paket, und wie groß war seine Freude, als er es auspackte: Es waren die Skier, die er sich so sehr gewünscht hatte.
Als wir im neuen Jahr meine Oma Martha besuchten und ihr unsere Puppen zeigten, nahm sie sofort ein Bandmaß zur Hand, um den gesamten Körper auszumessen. Einige Tage später begann sie, für unsere Puppen neue Kleider, Pullover, Jacken, Schlüpfer, Hosen, Röcke und Schuhe zu stricken und zu nähen. Damals arbeitete sie noch als Kranführerin, und wenn sie gerade keinen Knopf oder Hebel betätigen musste, nahm sie ihre Handarbeit auf und strickte ein Kleidungsstück nach dem anderen. Als sie im Frühjahr damit fertig war und uns all die schönen Puppensachen schenkte, fielen wir ihr vor Freude um den Hals und konnten es kaum fassen. Solche hübschen Sachen hatten wir noch nie gesehen. Meine Oma war eine richtige Künstlerin. Von da an behandelte ich meine Puppe wie ein eigenes Kind, abends legte ich sie zu mir ins Bett und auch in den darauffolgenden Jahren nahm ich sie mit auf Reisen, wenn unsere Familie in den Urlaub fuhr. Wie eine Mutter packte ich den kleinen Puppenkoffer und legte die vielen Anziehsachen hinein.
Aber auch mein Bruder konnte bald seine neuen Skier ausprobieren, denn in jenem Winter fiel ausreichend Schnee. Gemeinsam mit seinem besten Freund baute er auf dem Damm nahe unseres Dorfes eine kleine Sprungschanze, über die sie immer wieder sprangen, ohne dabei hinzufallen. Mein Bruder erlaubte mir, ebenfalls mit seinen Skiern zu fahren und dafür war ich ihm sehr dankbar. Sowohl Skilanglauf als auch eine kleine Abfahrt bereiteten mir viel Freude, nur über die Sprungschanze traute ich mich nicht. Mein Bruder dagegen liebte kleine Mutproben. Auf unserem Hof baute er eine lange Schlitterbahn, und je öfter wir darauf entlangschlitterten, desto glatter und eisiger wurde sie. Das sah schon sehr gefährlich aus, aber es machte uns Spaß, und erst wenn es richtig dunkel wurde, gingen wir ins Haus.
Wenn ich an all die Weihnachten meiner Kindheit zurückdenke, verbinde ich diese Bilder oftmals mit Eis und Schnee, auch wenn ich weiß, dass uns der Himmel nicht immer ein tolles Winterwetter beschert hatte. Doch sobald die Landschaft draußen vor dem Fenster weiß gepudert war, fühlte sich die Zeit vor und nach Weihnachten sehr geheimnisvoll an. Der Schnee verzauberte das Dorf und die Auenlandschaft, die daran grenzte, und wann immer wir Zeit hatten, spielten wir draußen im Schnee oder gingen rodeln. Und in dieser kalten Jahreszeit mochte ich am liebsten Lebkuchen, egal ob weiß oder braun lasiert. Diesen würzigen Duft und Geschmack liebe ich bis heute. Ein Winter ohne Lebkuchen wäre für mich nur halb so schön, und Weihnachten ohne Schnee ebenfalls.
Meine Eltern verstanden es, jedes Jahr aufs Neue Weihnachten zu einem schönen, unvergesslichen Erlebnis zu machen. In der Adventszeit liebte ich all die besinnlichen Weihnachtslieder, die wir nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause sangen. Besonders gern spielte ich sie auf dem Klavier und begleitete mich beim Singen. Die Texte regten meine Phantasie an und lösten beim Singen und Musizieren wundersame Bilder in mir aus. Die Welt, die mich als Kind umgab, war klein und friedlich, besonders in der Weihnachtszeit. Damals ahnte ich noch nichts von dem großen menschlichen Leid auf der Erde, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen.
All die vielen Kindheitsbilder, die ich mit Heiligabend verbinde und die wie kleine Puzzleteile in meiner Seele aufblitzen – mal klar und deutlich, mal verschwommen –, schmelzen zu einem einzigen, immer wiederkehrenden Bild zusammen: Der festlich geschmückte Weihnachtsbaum in der Mitte unserer Stube. Ringsherum die Geschenke, die so schön aufgebaut sind und uns zum Staunen bringen. Meine Eltern, die mit uns das Glück teilen. Das wunderbare Gefühl, noch Kind sein zu dürfen. Den ganzen Abend mit unseren Puppen spielen. Mit dem großen Nussknacker Nüsse knacken, eine Apfelsine schälen und von unseren Bunten Tellern naschen. Liebe und Geborgenheit spüren und selig sein vor Freude.
Diese feierliche Atmosphäre, die uns jedes Jahr zu Heiligabend umgab, trage ich noch immer in meinem Herzen. Wenn ich heute all die besinnlichen Weihnachtslieder auf dem Klavier spiele, dazu singe und jeden Tag ein Kalendertürchen öffne, fühle ich mich in meine glückliche Kindheit zurückversetzt.
Unvergessen bleibt für mich der Winter 1978/79. Zu dieser Zeit war ich bereits vierzehn Jahre alt und schon ein wenig aus meinen Kinderschuhen herausgewachsen. Meine Eltern, meine drei Geschwister, meine Oma Martha und ich verbrachten die Weihnachtsferien in einem FDGB-Ferienheim in Neuglobsow am Großen Stechlinsee. Das erste Mal erlebte ich einen märchenhaften Winter, wie ich ihn nur aus Büchern oder Filmen kannte. Es hatte so viel geschneit, dass die Tannen im Wald in eine dicke Schneedecke gehüllt waren und eine gedämpfte Stille ausstrahlten, dass mir die Welt wie verzaubert erschien. Es war herrlich, durch den hohen, sauberen Schnee zu laufen, der unter den Stiefeln knirschte, und im Winterwald zu versinken; es war wie ein Sog, dem wir uns nicht entziehen konnten. Und so geschah es, dass meine ältere Schwester und ich bei einem gemeinsamen Waldspaziergang am Vormittag den anderen vorausliefen, bis wir sie aus den Augen verloren hatten. Wir waren offenbar zu schnell, was uns aber nicht davon abhielt, in raschem Tempo weiterzulaufen. Bald würden wir den Wald verlassen, ins Heim zurückkehren und am Familientisch zu Mittag essen. Die frische Luft machte uns hungrig.
Doch alles kam anders. Der Wald schien kein Ende zu nehmen. Wir liefen und liefen, beschleunigten die Schritte, aber der Weg hörte nicht auf, keine Häuser waren in Sicht. Allmählich wurde uns ein wenig kalt, und die Wege wurden schmaler. Mehrmals drehten wir uns um, konnten aber niemanden erblicken. Irgendwann waren auch keine Fußspuren anderer Spaziergänger mehr zu sehen, wir stapften durch den unberührten hohen Schnee und unser Atem dampfte in der Kälte. Dann endlich entdeckten wir den großen See. Jetzt kann es nicht mehr weit sein, so dachten wir. Wir wussten, dass unser Ferienheim nicht weit vom Stechlinsee entfernt lag. Die Wege waren so schmal, dass meine ältere Schwester vorneweg lief. Wir ließen uns nicht beirren und stapften weiter durch den Schnee. Da wir zu zweit waren, verspürten wir auch keine Angst. Doch der Weg nahm einfach kein Ende. Auf einmal verschwanden wir im Nebel, der sich über den See ausgebreitet hatte, und gelangten über eine kleine Holzbrücke. Jetzt erst begriffen wir, dass irgendetwas nicht stimmte. Diese Brücke kannten wir noch nicht und der Nebel war unheimlich. Doch was sollten wir tun? Umkehren? Den ganzen langen Weg zurücklaufen? Nein, das kam für uns nicht in Frage. Sicherlich war es bis zum Ort nicht mehr weit. Also beschlossen wir, einfach weiterzulaufen. Was konnte uns schon passieren? Ich atmete erschöpft die kalte Luft und spürte keinen Hunger mehr. Wie spät mochte es sein? Wir wussten es nicht, denn wir trugen beide keine Uhr. Doch der große See, der neben uns lag, beruhigte uns und schenkte uns die Gewissheit, dass bestimmt hinter der nächsten Bucht der Ort erscheinen würde. Nur noch die eine Bucht umlaufen, so dachten wir, dann werden wir sicherlich da sein. Aber der See nahm ebenfalls kein Ende, wieder tauchte eine neue Bucht vor uns auf. Oh, wie waren wir auf einmal müde und unser letztes Fünkchen Hoffnung verschwand. Plötzlich bekamen wir Angst, nicht mehr zurück ins Heim zu finden. Wo befanden wir uns?
Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden wir unterwegs waren, irgendwann erreichten wir doch noch den kleinen Ort und fanden den Weg zurück in unser Heim. Meine Eltern und meine Oma waren offensichtlich erleichtert, uns endlich wiederzusehen. Das Mittagessen war natürlich längst vorbei, aber das störte uns nicht, wir waren einfach nur froh, endlich wieder im Warmen zu sein. Meine Mutter reichte uns Stolle und einen Eierlikör, der uns von innen wärmen sollte. Vermutlich wäre ein heißer Tee besser gewesen, doch wir hatten keinerlei Möglichkeiten, etwas zu kochen, denn zu den Mahlzeiten gingen wir immer in einen Speisesaal. Vom Eierlikör wurde mir leider nicht warm, ich bekam nur ein mulmiges Gefühl im Magen. Aber das machte nichts, dafür hatten wir eine abenteuerliche Wanderung hinter uns. Ich wickelte mich in eine warme Decke und genoss es, wieder bei meinen Eltern zu sein. Mein Vater nahm unsere Wanderkarte in die Hand und konnte daran ablesen, dass wir rund sechzehn Kilometer um den Großen Stechlinsee gelaufen waren. Trotz der Sorge, die meine Eltern gewiss empfunden hatten, schienen sie ein wenig stolz auf uns zu sein, dass wir diese lange Strecke allein bewältigt und zurückgefunden haben.
Doch das eigentlich beunruhigende Ereignis stand uns noch bevor. Über Neujahr hatte es so viel geschneit, dass sämtliche Straßen und Zugstrecken meterhoch zugeschneit waren. Ein eisiger Schneesturm hatte den gesamten Verkehr und Teile des Stromnetzes lahmgelegt. Es war unmöglich, rechtzeitig nach Hause zu fahren. Meine Geschwister und ich fanden das aufregend; es war ein schöner Gedanke, länger im Urlaub zu bleiben und noch nicht zur Schule zu müssen. Außerdem freuten wir uns über den vielen Schnee, denn so einen schönen Winter hatten wir noch nie erlebt. Nur meine Eltern wurden ein wenig unruhig, weil sie spürten, dass meine Oma voller Sorge war. Sie versuchten immer wieder, sie zu beruhigen, dass alles gut werden würde, aber es half nur wenig.
Leider blieben wir nur zwei Tage länger im Ferienheim, dann waren die Straßen und Zugstrecken wieder frei, und am Sonntagnachmittag fuhren wir mit dem Auto nach Landsberg, um meine Oma nach Hause zu bringen, und kehrten gegen Abend in unser Dorf zurück. Nur meine ältere Schwester und mein Bruder waren mit dem Zug unterwegs gewesen, da wir nicht alle in unser Auto gepasst hätten.
Meine Großtante, die zu Hause auf uns gewartet hatte, war erleichtert, als wir endlich heimkamen, und an ihrem Gesichtsausdruck bemerkte ich, dass sie große Angst um uns gehabt hatte. In der Wohnung war es dunkel, der Strom war ausgefallen, und Tante Susi hatte ein paar Kerzen angezündet. Sie wich nicht von unserer Seite und war noch immer voller Sorge. Im Kinderzimmer betrachtete ich traurig die Fische in unserem Aquarium, die wohl schon mehrere Tage ohne Licht und Sauerstoff waren. Das Wasser war trüb, Tante Susi hatte es mit dem Füttern wohl auch zu gut gemeint. Mir wurde auf einmal ganz schwer ums Herz, und ich verspürte keine Lust, am nächsten Morgen wieder zeitig aufzustehen, um mit dem Bus nach Halle zum Gymnasium zu fahren, doch es blieb mir nichts anderes übrig. Ich erinnere mich noch heute, wie ich am darauffolgenden Tag in meiner Schulbank saß und mich nicht auf den Unterricht konzentrieren konnte: In Gedanken war ich weit fort, der viele Schnee hatte die Welt verzaubert, und ich war darin versunken und wollte sie nicht so schnell wieder verlassen, der Alltag sollte mich noch nicht einholen. Aber ich konnte die Zeit nicht aufhalten. Ich musste Abschied nehmen von unserem letzten gemeinsamen Weihnachtsurlaub, und ich glaube, hier endete auch ein Stück meiner Kindheit.
Diese stimmungsvolle Atmosphäre um die Weihnachtszeit, die ich von Kind auf erleben durfte, konnte ich auch Jahre später noch spüren, aber die raue Wirklichkeit blieb mir nicht mehr verborgen. Ich wurde älter, selbstständiger, begann zu studieren und schon mit zwanzig Jahren heiratete ich und zog mit meinem Mann in eine eigene Wohnung, obwohl er gerade seinen Wehrdienst leistete. Die Realität des Lebens hatte mich eingeholt, nun trug ich die volle Verantwortung für mein Handeln, musste Entscheidungen treffen, neue Herausforderungen bewältigen und Krisen überwinden. Doch jedes Jahr, wenn Weihnachten vor der Tür stand, tauchten die glücklichen Bilder meiner Kindheit wieder in mir auf und Wärme durchströmte meine Seele. Auf einmal spürte ich wieder diesen inneren Frieden und die Heiligkeit, die mich damals umgab, und ich begriff, dass mich dieses Gefühl mein Leben lang begleiten würde. Meine Eltern hatten dafür einen wichtigen Grundstein gelegt.
Später, als ich selbst Mutter von vier Kindern war, konnte ich all die Liebe, Geborgenheit und Wärme, die ich selbst empfangen hatte, an meine eigenen Kinder weitergeben. Ich spürte, dass die Weihnachtszeit durch sie wieder zu etwas Besonderem wurde. Ihnen eine Freude zu bereiten, bedeutete für mich höchstes Glück. Ich sehnte mich selbst nach dem Licht in der dunklen Jahreszeit und diese Sehnsucht war mein innerer Antrieb, alles zu geben, um dieses Licht zum Leuchten zu bringen. Mit meinen Kindern erlebte ich alles um mich herum viel intensiver, ich sah die Welt mit ihren unschuldigen Augen und fühlte mich in meine eigene Kindheit zurückversetzt. Genau wie meine Eltern versuchte ich, die Advents- und Weihnachtszeit schön zu gestalten, und viele Traditionen, die ich aus meinem Elternhaus mitbrachte, setzte ich fort. Wir backten Plätzchen und Honigkuchen, und jeden Morgen wurde ein Kalendertürchen geöffnet. Wir sangen Weihnachtslieder und meine Kinder hatten ebenfalls das Klavierspiel erlernt.
Am Vorabend des 6. Dezembers wurden eifrig die Schuhe geputzt und vor die Tür gestellt, und damit der Nikolaus sich von der weiten, anstrengenden Reise stärken konnte, kam unser ältester Sohn auf die Idee, ihm eine kleine Mahlzeit anzubieten. Seine Geschwister waren sofort begeistert, und gemeinsam stellten sie dem Nikolaus ein Glas Saft auf den Tisch, legten eine Apfelsine und selbstgebackene Plätzchen auf einen Teller und schrieben ihm einen liebevollen Brief. Ich war gerührt, wie emsig sie bei der Sache waren und nicht nur an sich selbst, sondern auch an den Nikolaus dachten. Am nächsten Morgen waren die Schuhe mit kleinen Gaben gefüllt, das Glas war ausgetrunken und auch auf dem Teller lagen nur noch die Apfelsinenschalen. Unsere Kinder waren selig.
Und doch gestaltete ich die Adventszeit ein wenig anders. Inzwischen hatte ich die Geschichte von Maria, Josef und dem Jesuskind kennengelernt, die mir als Kind verborgen geblieben war, und diese Weihnachtsgeschichte hatte mich so berührt, dass ich sie auch meinen Kindern nahebringen wollte. Ich gestaltete einen Jahreszeitentisch und formte aus farbiger Märchenwolle kleine Puppen und Tiere: Maria, Josef, das Jesuskind, Ochs und Esel, die Hirten und die Schafe. Aus einem großen dunkelblauen Filztuch und kleinen Tannenzweigen baute ich eine Landschaft auf und legte einige Edelsteine hinzu. Unsere Kinder liebten diesen Jahreszeitentisch, den wir gemeinsam immer wieder ein bisschen veränderten. Als Weihnachten vorbei war, bekam König Winter, der nun über der Erde herrschen sollte, seinen Platz. Diese kleine Puppe, die ich dafür gestaltete, sah ein bisschen aus wie Großväterchen Frost, mit blauem Mantel, weißem Haar und langem Bart. Auf dem Kopf trug er eine silberne Krone, hielt einen langen Stab in der einen und einen Schneeball in der anderen Hand. Wir hofften, er würde uns reichlich Schnee bringen.
Als unsere Kinder alt genug waren, faltete ich mit ihnen wunderschöne Fenstersterne aus farbigem Transparentpapier. Es entstanden verschiedene Muster, die erst durch das Sonnenlicht im Fenster zur Geltung kamen. Während wir stundenlang falteten, hörten wir nebenbei Märchen und später die ersten Harry Potter Hörbücher. Mit den Faltsternen statteten wir nicht nur unsere eigenen Fenster aus, sondern wir verschenkten sie auch an die Großeltern, die sich jedes Jahr darüber freuten.
Einen Tag vor Heiligabend schmückten wir wie immer den Tannenbaum, und während ich meinen Kindern dabei zusah, überkam mich jedes Mal eine große innere Freude. Erst der geschmückte Weihnachtsbaum verwandelte die Wohnstube in ein festliches Zimmer. Noch einen Tag schlafen, so sagten sich meine Kinder, dann ist es endlich soweit. Als wir am Heiligabend die Stubentür öffneten und unsere Kinder zur Bescherung hineinließen, durchströmte mich ein wundersames Licht, das mir aus meiner eigenen Kindheit vertraut war. Und an den großen staunenden Augen erkannte ich, dass es uns Eltern gelungen war, auch unseren Kindern Weihnachtsfreude zu schenken. Ich spürte eine tiefe Glückseligkeit. Kinder sind für mich das Hoffnungslicht des Lebens.
Roland Jähnichen
Verschollen vor Kysyl. In einem Land kurz vor dem Ende der Geschichte
23.12.1985, der Abend vor Heiligabend.
Nun hatten sie uns. Hier kommen wir nicht mehr raus. Sehr wahrscheinlich hat uns die Heimat bald wieder. Nicht mehr bis Weihnachten, aber dann im neuen Jahr. An den Prüfungen, die immer direkt nach dem Erwachen aus dem Neujahrskoma beginnen, müssen wir vielleicht schon gar nicht mehr teilnehmen.
Wir saßen in einem maximal unbequemen, aber gut geheizten russischen Milizauto und waren auf dem Weg zur Wache, aufgegriffen auf dem irgendwie nicht sehr modernen, fast schon maroden Flughafen Nowokusnezk, wo wir aber eigentlich auch gar nicht sein wollten. Sondern wir sollten im Flugzeug von Nowosibirsk nach Kysyl sitzen, einen Cognac schlürfen und uns freuen, es wieder mal geschafft zu haben. Aber jetzt steckten wir fest im Fastniemandsland der UdSSR, zwischen Taiga und Sperrgebieten, Ural und Mongolei, Weihnachten und neuem Jahr.
Dieses Mal stand die Reise wohl unter keinem guten Stern. Ärger schon vor dem Start in Leningrad, weil unser Alibi nicht funktionierte. Wir hätten eines gebraucht, um unsere mehrtägige Abwesenheit so kurz vor der „Sessija”, der Prüfungsperiode, zu rechtfertigen. Und sowieso war es uns nur erlaubt, uns innerhalb eines Radiusses von 50 Kilometer um Leningrad aufzuhalten. So musste eine Begründung herhalten, die einer genaueren Prüfung nicht standhalten würde. Wir hätten uns zur intensiven und störungsfreien Prüfungsvorbereitung auf die Datsche eines Kommilitonen vor der Stadt und ohne Telefon zurückgezogen.
Die Reise selbst - ein Flickenteppich. Erst eine ungeplante Zwischenlandung auf irgendeinem Provinzflughafen, es war wohl Omsk. Vielleicht mussten sie ja einen vergifteten Dissidenten retten, jedenfalls wurde jemand von Bord getragen und mit Blaulicht zum Krankenhaus gefahren (hoffentlich ins Krankenhaus). Dann war der Flug in Nowosibirsk schon weg, wir sollten stattdessen in Tomsk oder Krasnojarsk umsteigen, wo wir aber nie ankamen, wegen eines Sturms und stattdessen in Nowokusnezk zwischenlanden mussten. Und ausgerechnet hier kam es einem vom Dienst genervten oder gelangweilten oder viel lieber Fußball schauen wollenden Kontrollbeamten in den Sinn, alle unsere Dokumente mal ganz genau zu kontrollieren, wenn er sowieso schon das entscheidende Spiel seiner Mannschaft nicht im Wachraum sehen konnte. Vielleicht war ja eines falsch ausgestellt oder fehlte ganz. Aber es war kein Dokument falsch ausgestellt, und nicht eines fehlte ganz. Uns fehlten drei Dokumente ganz, die auch nie ausgestellt worden waren. Uns fehlte die Erlaubnis, aus unserem Startort Leningrad auszureisen, genauso fehlte uns die Erlaubnis, in unseren Zielort Kysyl einzureisen und schon ganz und gar fehlte uns die Erlaubnis, uns unterwegs im militärischen Sperrgebiet aufzuhalten, aber gerade da waren wir jetzt. Letzteres war zwar die wahrscheinlich schwerwiegendste Übertretung, aber das hatte nichts mit dem im tiefsten Sibirien gelegenen Nowokusnezk zu tun, alle anderen bereits aufgezählten Zwischenlandeflugplätze wie Omsk, Tomsk, Krasnojarsk waren auch geschlossene und somit verbotene Orte für uns.
Wir, das sind zwei bisher immer gut durchgekommene Auslandsstudenten aus Leningrad, ein langer dünner Ostsprachler, der Chinesisch studiert, und ich, ein kürzerer und etwas dickerer Ostsprachler, der sich an Siamesisch versucht. Der Krug geht eben so lange zu Wasser, bis es ihm den Deckel ausschlägt. Wir meinten damals, das wahre Land der unbegrenzten Möglichkeiten wären nicht die USA, sondern eindeutig die Sowjetunion. Unbegrenzte Verbote schafften eben auch grenzenlose Möglichkeiten. Die alles verbietenden Regeln, beispielsweise eben zum Reisen im Land, waren so kompliziert und schlossen sich so häufig gegenseitig aus - die notwendigen Unterschriften unter die Anträge für den Erhalt der Dokumente, die wir nicht hatten, waren in der verlangten Reihenfolge, in den vorgeschriebenen Zeiträumen, mit den gewünschten Nachweisen einfach nicht erbringbar. Weil das jeder wusste, bekam man sie manchmal auch so oder man fuhr ohne, auch die Kontrollbeamten wussten ja um die innewohnenden Dilemmata. Außerdem wollten auch sie sich keinen zusätzlichen Ärger aufbürden, also wählten sie den Weg des geringsten Widerstands. Sie kontrollierten entweder gar nicht oder akzeptierten hanebüchene Ausreden, von denen wir eine ganze Batterie je nach Erfordernis in wild gebrochenem oder nahezu lupenreinem Russisch schussbereit hielten. Oder sie beruhigten sich einfach mit der Tatsache, dass ohne Vorlage der Dokumente, welche uns jetzt fehlten, überhaupt kein Reiseticket verkauft werden dürfte, weder für einen Fernzug noch für einen Fernbus noch für die Krone der Reiseschöpfung, das Flugzeug. Da wir aber Flugtickets vorweisen konnten, mussten wir ja bei ihrem Kauf auch im Besitz aller Genehmigungen gewesen sein. So ging das. Vielleicht sahen wir auch ganz einfach eher wie Genossen und nicht wie Klassenfeinde aus. Also ziehen lassen in Gottes Namen.
Und eigentlich sind diese Ausführungen zum Reisen ohne die entsprechenden dokumentarischen Genehmigungen ziemlich nutzlos, weil sowieso alle Probleme mit einem gewissen Geldbetrag gelöst werden konnten, um den wir, arme Studenten, allerdings auch manchmal herumkamen. Die zu Bestechenden hierzulande hatten durchaus manchmal eine soziale Ader, wenn es nicht gerade die Verkehrspolizei war. Einkommensorientierte Korruption sozusagen.
Und so waren wir, genau wie auch viele Einheimische, oft unter nicht ganz legalen Voraussetzungen im Lande unterwegs und übertraten schon mal ein paar der vielen Verbote. Manchmal auch nur aus Jux und Dallerei oder um uns auch mal gegen irgendetwas aufzulehnen. Klug war das nicht unbedingt, schließlich war die DDR-Delegation die absolut rigoroseste Gruppe unter den ausländischen Studierenden in der UdSSR, was die Einhaltung aber auch wirklich ALLER Vorschriften betraf, inklusive eines ausgefeilten Katalogs von Sanktionen. Andere Gruppen von Auslandsstudenten wie Tschechen, Vietnamesen, Kubaner, Bulgaren - die reinsten Ponyhöfe.
Uns beiden drohte bei einer Meldung an unsere Botschaftsorgane in Moskau oder das Generalkonsulat der DDR in Leningrad mit ziemlicher Sicherheit sogar die endgültige Heimreise, sogar bei wohlmeinenden Richterinnen oder Richtern, denn wir hatten die Vorstufen - Ermahnung - Rüge - Verweis - strenger Verweis - strenger Verweis mit Androhung des Ausschlusses vom Auslandsstudium - bereits erfolgreich durchschritten und standen mit dem Rücken zur Wand.