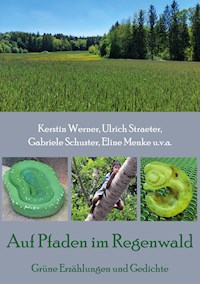Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Erzählungen und Gedichten über die Liebe unterhält dieser Band. Eine Karte ohne Absender gibt Rätsel auf. Ein Taxifahrer in New York fährt ungewöhnliche Routen ab mit einer Frau. Eine Gerichtsakte ist zu bearbeiten, erfordert einen juristischen Kommentar. Das alles wird zur Fußnote in den Armen der sich Liebenden. Ein Aufenthalt in Schweden führt zu den Sámi. Nach diskreter psychologischer Behandlung sucht ein Kanzler, doch welche Folgen hat das? Leben vergeht, und neue Begegnungen entfalten sich fast gleichzeitig in einer Erzählung. Eine junge Heilerin aus einem Stamm pflegt einen fremden Mann, der verunglückt ist. Sie kommen sich näher, doch gibt es eine Chance für ein Zusammenleben? Die mysteriösen Begebenheiten in einem Gothic-Hotel rufen die Staatsanwaltschaft auf den Plan. In den Gedichten entfaltet und versteckt sich die Liebe, rote Linien ziehen ihren Weg. Die Geheimnisse der Mittsommernacht werden aufgerufen. Mirabellenbäume laden zum Träumen ein. Spaziergänger verweilen am Meeresufer. Krimiabende stören das Liebesleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Mesut Bayraktar
Möwen auf der Brücke
Kerstin Werner
Zeit und Raum gibt es nicht mehr
Natascha Tesar-Pelz
Der Kanzler
Marlene Wieland
Schicksalszüge. Eine wahre Liebesgeschichte
Brigitta Rudolf
Hochzeit mit Hindernissen
Claudia Engeler
Die Doppelhochzeit
Zoe Ingarden
Der mitgebrachte Abschied
Ingrid Peter
Die Dermatologin
Der Fluch der Mutter
Angelika Zöllner
Unser Land nennen wir Sapmi und uns selbst Samen – oder:Nie eine Revolution
Thomas Barmé
lassen wir die liebe bleiben
Orpheus
du
ist die liebe entfacht
es säumen die linden
deine liebe war‘s die meine nacht beherzte
die sterne singen
Das hohe Lied
ich sehe dich in allem dunkel
Eurydike
Sylvia Amstadt
dreifache Träne von Einem
Carsten Rathgeber
Lebendiges Sein
Bestandsaufnahme
eingestürzt
Berühren (beim Espresso)
hüllenlos pulsierend
Staubiger Weg
Fremdes der Liebe
Konzerte
Helga Thomas
Niemandsland
Unsere Hände
Ich liebe Dich…
Gute Nacht
In was wird meine Liebe sich wandeln
Auf der Suche nach mir
Ruf mich noch einmal
Wenn neben mir kein Raum mehr ist
Der Baum der Liebe
Ich bekam einst zwölf Gläser geschenkt
Ich bin Ich
Hanne Strack
rote Linie
Liebesgedichtversuch
Norbert Rheindorf
Leb wohl Miss Dickinson
Achim Franz Willems
auf tuchfühlung
bei dir
Hans-Jürgen Gundlach
Morgens zwischen fünf und sieben
Deine Freundin
Das wünsch ich mir…
Du bist schön
Ich möchte
Wenn Du nicht wärst…
Angenommen
Alte Liebe
Elke Tegtmeyer
Oft gegangene Wege
Thomas Schricker
Rom
Marko Ferst
Ich darf nicht denken
Kleine Liebesgeschichte
Sommernacht
Helle Mondnacht: 60. Breitengrad
Atemlos
Versteckspiel
Nachspeise
Hanna Fleiss
Ansichtskartenglück
Johanna Queitsch
Punkt oder Komma
Karin Bolte
Spätes Glück
Liebestraum
Dirk Tilsner
die Rose
ich weiß
mein Eis
Krimiabend
Kalypso
ich bin der ernste mann
hätt‘ ich drei Wünsche frei
Die Ballade vom Schleimpilz
wenn ich nur malen könnte
offen bar
du schöner Mai
Peter Schuhmann
Auftrieb
Drei Worte
Wolkenschättin
Durchgebrannt
Initial
Süßer Tod
Springflutmond
Sturmes Auge
Aura
Diamant
Martina Fornoff
Wundbrand
Henrike Hütter
Feedback
Begegnung mit der Natur
In der Sommerhitze der Picardie
Am Meeresufer
Ralf Hilbert
Weniges
Schläfst du früher ein
Herbst Tag- und Nachtgleiche
Abends ahnt man: Herbst
Jahrhundertsommer
Liebesdiskurs
Herbst
Gertrud Jüde
Was ich bin
Das Ende von etwas
Marlies Kalbhenn
Unter Mirabellenbäumen
Helgard Gebhardt
Die wichtigen Dinge im Leben
Simone Belko
Morgenrot
Die dunkle Seite der Macht
Aurora
Peter Hort
Im Süden
Martin Görg
Tilman
Gabriele
kurz vorher habe ich etwas Zeit
Der Strand
Trompetenspiel im Steinatal
Renée
ein Segeltörn
setze mich auf die Bank
Dornröschen
der Tag, an dem Dornröschen aufwachte
Die Wanderung
Henriette Tomasi
Liebesbrief
Eberhard Schulze
Als wir uns trennten
Deine Blicke
Aprilbeginn
Dein Duft
Mittsommernacht
Gefährlich nah
Dein Bauch
Regen wispert
Wunsch
Sommerfrühstück
Der Betrunken mit der Rose
Erinnerung
heute
Schneereicher Winter
Entdeckung
dammbruch
Bittermandelduft
Gansäugige
nähere dich besser nicht
Zärtlichkeit
Die Silberpappel
ich wollte nicht
In deinem Büro
Was ich will
Im Ginstergold
Arglos
Die Vogelkirsche
Im Regen
es ist was
Sehnen
Schneegewisper
Anita Hollauf
Neubeginn
Edith Meusburger
Du und ich
Wolfgang Jatz
Liebe Leben
Liab‘s Nachbarle
Die Frau
Für Judith H.
Biegsam im Kopf
Wir amüsieren uns
Kopfgeburten
Lieblinge
Schöner Traum
Der Sohn
Begegnung
Mutter
Der Schwärmer ...
Resümee
Girls
War‘s das?
Das war’s
Begegnung im Treppenhaus
Einem Freund
Psycho-Anneliese
Ende einer Beziehung I
Ende einer Beziehung II
Besuch
Reinhard Lehmitz
Liebesspiele
Unsere Flamme
An einem Strande
Abrupt
Haiku
Guido Luft
Es wird eng
Helmut Tews
Mit einem Lächeln
In deinen Augen
Volker Teodorczyk
Vorfreude
Nicole Pfeiffer
Herbstregen
Rita Dorn
was soll mir die liebe
Barbara Gase
Luca in the Yellow Cab
Karen Wright
Verena?
Heidi Axel
Auch mit 60 weint Frau leise
Hannelore Thürstein
„Das Ende!“ und „Der Anfang?“
Mia Lada-Klein
Kugelmensch
Carsten Rathgeber
Fragmentarisches Leben: Ökologie und das Duschen
Ein Kartengruß und ein Gedicht
Bettina v. Minnigerode
Hundespaziergang
Werner Hetzschold
Die vielen Gesichter der Liebe
Rita Dorn
Der lindgrüne Pullover
Josef Helmreich
Hotel
Henryk Bolik
10.000 v. Chr.
Deal auf Sao Thomé
Sarah L. Goehre
Parfum
Kathrin Ganz
Liebe zum April
Zeichen des Herbstes
Besondere Maitage
Die Rosen werden blass
Franka Billen
Mein schönstes Gedicht bist du
Erika Maaßen
Verlassen
Abschied
Mich betrügt man nicht
Ein melancholisches Lied
In Träumen der Nacht
Gitarrenmusik
Glück
Eine vorübergehende Angelegenheit
Festhalten
Feuer
Danke
Lang ist es her
Nur einmal noch
Januarvollmond
Meine Augen streicheln dich
Meine Hand in deiner
Mein Leben ein Kerzenlicht
Habe Geduld
Gerhard Kosuch
Du und ich
Eins sein
Ode an die Liebe
Geheimnis
Morgenlicht
Quelle
Hannah Kaip
Balanceakt
Fernbeziehung
Gabriele Friedrich-Senger
Der Morgen danach …
Klaus Mucha
Bücher und Frauen
Karsten Beuchert
Erdschätze
Im Licht des vollen Mondes
Butterfly
Atmen
L|i|ebensweise
Traumschiff
Lesley Wieland
reservatio mentalis
Treibhaus
Spritzenhaus oder siebzehn Jahr – blondes Haar ...
Godess of Boston country
Felix Gutermuth
Nora & Felix
Das Klima des Mondes
Eine geliebt
Irmgard Woitas-Ern
Die Hand fürs Leben
Drei Worte
Heiratsantrag
Meeresrauschen
Rendezvous mit dem Abend
Wir drehen am Rad
Erika Maaßen
Liebe
Ein Anruf
Marlies Joepen
Herzsplitter
Eberhard Schulze
Die Treppe
Mona Wartenberg
Zeitfenster vom Ich
Edith Meusburger
Sommer-Sonntag
Irmgard Woitas-Ern
Check Troy
Autorinnen und Autoren stellen vor
Mesut Bayraktar
Möwen auf der Brücke
Diese Nächte waren nichts anderes als Zauber. In ihnen drehte sich nicht das Rad der Zeit, auch hielt die Zeit nicht an. Vielmehr fand das Fließen des Jetzt weiterhin statt, aber das Namenlose war, dass das Fließen des Jetzt aus seinem allbekannten Rahmen fiel und sich selbst überschritt. Es wurde zeitlos. Wir fassten gemeinsam die Weltgesamtheit im verdichteten Moment ihrer Flüchtigkeit in ihrem kleinen Zimmer unter einer Dachschräge zusammen. Diese Nächte waren das Suchen nach der Wesentlichkeit der Dinge und die Deutlichmachung der Undeutlichkeit des Selbst. Für einen Augenblick siegten wir, lediglich für einen Augenblick über die Unmöglichkeit der menschlichen Begegnung. Dabei sollte ich ihr nur kurz etwas bringen.
Es war mitten in der Woche. Sie hatte mich kurzfristig darum gebeten, ihr einen juristischen Kommentar zur Bearbeitung einer Akte zu bringen. Da ich noch beim Gericht war und ein Auto besaß, besorgte ich ihr den Kommentar aus der Gerichtsbibliothek und fuhr zum späten Nachmittag zu ihr. Sie wohnte alleine in einem Dachgeschoß eines fünfstöckigen Altbauhauses am Rand der Stadt. Vor dem Gebäude befand sich ein dickes, weißes Metalltor, hinter dem ein kleiner, unregelmäßig gepflegter Garten war, wo die eigentliche Eingangstür zum Haus stand. Der hölzerne Treppenflur, der auf jeder seiner Stufen knarzte, war akkurat mit einem schmalen, gräulichen Teppich verlegt, der den Schall der Schuhsohlen etwas dämpfte. Auf jeder Etage breiteten sich große Fenster aus, die zur Straße guckten und das abnehmende Tageslicht einfingen. Ich war das erste Mal in diesem Haus und es machte in gewisser Weise Eindruck auf mich, vielleicht wegen der Tatsache, dass sie hier wohnte. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ich so etwas wie Anmut spürte, die mit jeder Treppenstufe in mir wuchs. Auf der höchsten Etage angekommen, dehnte sich vor mir eine Wand aus milchigem Glas, das bis zu den hohen Decken reichte, aus. Mittendrin stand eine Tür im Rahmen. Zunächst dachte ich, dass sie hier wohnen würde, sodass ich eine Hand auf die kühle, bronzene Türklinke legte. Sobald ich aber aus dem Augenwinkel sah, dass sich links von mir, schräg neben der Wand aus milchigem Glas, eine weiße Tür, die ich vorher nicht erkannt hatte, öffnete, wandte ich mein Gesicht um und sah sie, wie sie mit ihren perlblauen Augen lächelnd aus dem Türrahmen, der sie wie ein Engel zu einem Gemälde festhielt, guckte. Ich zog meine Hand von der Türklinke und ging ihr entgegen. Sie umarmte mich, dabei roch ich ihre milde Haut am schmalen Nacken, wo sich einige Härchen aufwärts kräuselten. Sie bat mich reinzukommen. Zunächst erwartete ich, dass ich ihr den Kommentar kurz geben und dann wieder verschwinden würde, da sie sicher viel zu tun hätte, hat sie mich doch kurzfristig darum gebeten. Daher war ich überrascht als ich in ihrer Wohnung war, auf einem kleinen, weißen Sofa neben ihrem Bett saß und umgeben war von dem milden, einmaligen Duft ihrer Haut, der ihre überschaubare, kleine Einzimmerwohnung füllte und die glatte Oberfläche meiner dreidimensionalen Wirklichkeitsbilder wie mit einer Messerspitze aufschnitt. Im Zimmer standen eine kleine Kochdiele, daneben ein Kleiderschrank und eine Kommode, ein kleines Bücherregal, darin ein integrierter Schreibtisch, ein Sofa und ein Bett. Ihre Möbel waren größtenteils in weißen oder hellen Farben. Eine gewisse Unantastbarkeit legte sich auf sie wie ein durchsichtiger Schleier. Der Boden war mit einem dunkelblauen Teppich verlegt und die Decke fiel schräg auf die Wand gegenüber jener, wo die Eingangstür war. Zwar hatte die Wand keine Fenster, was einengend wirkte, jedoch – und das fiel mir erst später auf – streckten sich zwei große Fenster auf der Dachschrägen, die geradewegs auf den Himmel gerichtet waren, als wären sie Eingangstüren des Firmaments, mit denen man wie durch Schlüssellöcher hinter die Bilder von Tag und Nacht lauschen könnte.
Sie gab mir einen Tee und wir tauschten uns kurz aus. Sie erzählte mir ihre Schwierigkeiten, die sie mit der Bearbeitung der Akte hatte. Ich spürte Mitgefühl mit ihr, da sie sich sichtlich damit quälte. Ich bot ihr daher meine Hilfe an. Sie lächelte, lehnte jedoch dann ab, da sie es schon selbst schaffen werde. Dann rauchten wir noch eine Zigarette in ihrem ebenso kleinen, überschaubaren Badezimmer, wo neben der Toilette ein geöffnetes Fenster war. Sie stand, ich setzte mich auf die zugeklappte Toilette und krümmte mich rauchend über meine überkreuzten Beine. Es wurde schon dunkel und inzwischen war ich schon seit über einer Stunde bei ihr. Als ich dies bemerkte, bedankte ich mich für den Tee und sobald ich mich verabschieden wollte, schnitt sie mir mit gesenktem Blick mein Wort ab und sprach leise: „Bleib doch noch.“
Das hatte ich sicher nicht erwartet. Ich verstummte, rauchte die Zigarette zu Ende und rätselte über ihren Willen, der mir wie ein Becken voll Sehnsucht schien, wie ich es noch nicht kannte. Nicht, dass wir noch nie was miteinander gehabt hätten, unzählige Male lagen wir auf der Brust des jeweils anderen, aber diese Art Sehnsucht in ihrem Blick, die mir die Tür zu ihrer Wohnung öffnete, wunderte mich, da bis zu diesem Zeitpunkt eine durchsichtige Scheidewand sich zwischen uns schob, die zwar zuließ, dass ich ihren und sie meinen Kosmos sehen durfte, aber ein Stillschweigen uns befahl, dass wir niemals über diese Grenzlinie hinweg die Welt des anderen betreten konnten. Diese Sehnsucht, dieses Verlangen kannte ich nicht an ihr. In diesem Ausmaß war sie mir neu. Nun hatte etwas diese Scheidewand zwischen uns weggeschoben. Ich musste sie nicht mehr durch etwas Unsagbares sehen, ich konnte unmittelbar in ihr Ich fallen, so wie sie in das meine.
Wir gingen wieder in ihr Allzweckzimmer. Ich setzte mich auf das Sofa, sie neben mich. Ich versuchte ihr zu entlocken, was sie bedrängte, doch scheinbar war da nichts, nichts als Sehnsucht im leeren Raum. Sie trug eine hautenge Jeans, eine weiße Bluse und ihre blonden Haare waren am Hinterkopf zu einem Knäuel gebunden. Aus ihrem hellen Gesicht strahlten große, blaue Augen, die wie zwei sattblaue Himmelsfalter unter ihren unscheinbaren Augenbrauen hockten. Plötzlich legte sie eine Hand auf meinen Nacken, mein Puls stieg und meine Lenden pressten mir die Luft in meinen Eingeweiden zusammen und im nächsten Augenblick spürte ich ihre Lippen auf den meinen. Ich legte meine Hände auf ihre Hüften, packte fester zu und ohne jede Überlegung verschwanden sie unter ihrer Bluse. Ihre Haut war warm, wie eine Glühbirne. Wir wälzten uns auf ihr kleines Bett. Ich zog ihr nach und nach ihre Bluse, ihre Jeans und ihre Unterwäsche aus. Sie lag nackt wie das verschollene Blütenblatt einer Seerose vor mir. Dann zog sie mich aus, auch ich lag nun nackt neben ihr. Wir schmiegten unsere Körper aneinander, wie zusammenfallende Wachstropfen, die im selben Punkt ins Wasser fallen, küssten uns und fuhren mit der Zunge über den Hals des anderen. Ich strich mit meinen Fingern über ihre helle, atmende Haut, über ihre Gesichtskonturen, in dem die Wangenknochen ihre Gesichtshälften zaghaft wölbten, über ihren Rücken, ihre Wirbelsäule, ihr Becken, ihren Bauch, in den sich eine kleine Grube schraubte, über ihre Brüste, ihre Murmel gewordenen Brustwarzen, über jeden Zweig ihres Gerippes, unter dem ihr Herz schlug, kurz, über ihre ganze Knochenanatomie, auf der sich ihre Schale aus Haut spannte; womöglich tat ich dies, um mich zu vergewissern, dass sie wirklich bei mir war, dass sie existiert, dass ich existiere, dass wir nicht nur eine flüchtige Verdünstung eines fragilen Ganzen waren, das mit einer Klaviertaste kommt und mit der nächsten vergeht. Irgendwann begannen wir zu schwitzen, doch das kümmerte uns nicht weiter. Wir überquerten die Grenzen der Scham und gelangten in das Gebiet unbedingter Aufrichtigkeit. Es war, als schälten wir uns in den Zustand völliger Öffnung unserer Körper und Seelen und verschmolzen in das tiefste Weltgeheimnis, das hinter den Vorhängen der Dinge gedankenstill und verborgen sein Werk verrichtet.
Ich übernachtete bei ihr, nicht nur eine Nacht, sondern drei, vier Nächte. Das weiß ich nicht mehr so genau. Die Tage und Nächte schwammen ineinander, ohne sie noch trennen zu können. Nachts legten wir die Matratze auf den Teppich und schauten aus den riesigen Fenstern ihrer Dachschräge in den schwarzen Himmel, in dem lebende und tote Sterne wie Laternen der Milchstraße blinzten. Sie hob ihren Arm und ging mit zwei Fingern durch das Universum. Das tat ich ihr nach. Wir waren nackt, unsere Blöße reichte sich die Hände, wir tranken dann und wann ein Glas Wein und rauchten Zigaretten. Ebenso wie ich hatte auch sie die Arbeit vergessen. Wir meldeten uns krank, sorglos, und pfiffen auf die Fesseln des Alltags. Wir waren frei. An einem der Abende überraschte sie mich. Sie stand auf und klappte die längliche Kante eines kleinen, hölzernen Klaviers auf, das ich vorher für einen Schrank oder eine Kommode hielt. Ohne jede Ankündigung begann sie sanfte Rhythmen zu spielen, von denen maßlose Zartheit ausging. Ich war sprachlos und tief beeindruckt. Ich stellte mich hinter sie, schaute an ihrem schmalen Nacken vorbei auf ihre makellosen Hände, die über die Klaviertasten wie Blätter auf der Wasseroberfläche eines Bachs glitten, und legte meine Hände auf ihre Schultern. Sie rührte sich nicht, war konzentriert und spielte ihr Stück zu Ende. Dass sie Klavier spielen konnte, wusste ich nicht. Als ich sie danach fragte, sagte sie, dass sie es als Kind gelernt hatte und nun ab und an sich an ein Klavier wagte, wenn ihr danach wäre. In welchen Augenblicken ihr danach war, blieb ihr Geheimnis.
Schließlich rückte der Tag an, an dem ich fahren sollte. Es war später Abend, vielleicht schon Mitternacht. Wir umarmten uns und als ich mich verabschiedete, sprach sie mit gesenktem Blick: „Schön, dass du geblieben bist.“
Dazu hatte ich nichts zu sagen. Ich nickte und gab ihr einen Kuss. Im Grunde genommen wollte ich nicht gehen und war betrübt, wusste ich doch, dass ich damit die einmalige Seinssphäre, in der ich mich mit ihr in den Nächten befand, unwiderruflich wie eine zerdrückte Luftpolsterfolie zerriss. Dennoch ging ich, in den Gedanken bei ihr, stieg ins Auto und fuhr mit einem gemischten Gefühl aus Glück und Wehmut ab, als hätte ich bei ihr etwas vergessen. Ich fühlte mich trotzdem gut. Ich drehte das Radio aus und zündete mir eine Zigarette an. Mein Fenster kurbelte ich runter. Die Straßen waren leer, nur das fahle, gelbe Licht der Laternen legte sich auf den Asphalt. Ich genoss die nächtliche Fahrt und war umgeben von Stille. Keine Menschen, kaum Verkehr, einige Sterne im Himmel, die Straßenlaternen der Nacht und ich, dessen Gedanken mit Gefühlen zusammenflossen.
Schließlich kam ich an einer Brücke an, die sich über den breitnackigen Rhein spannte. Ich musste auf die andere Seite. Als ich auf sie auffuhr, verließ mich jeder Verdruss. Ich schaute nach rechts über das Gelände des Gehweges und sah einen unruhigen kalten Fluss, der immerfort im Strom gefangen war. Dann wandte ich meinen Blick um zu meiner Linken und entdeckte Ahnungsloses am Geländer der Brücke; Möwen, schlafende, wachende, einander in Schutz nehmende Möwen. Sie zogen sich wie Kerzen von einem Ende der Brücke entlang bis zum anderen und sie alle richteten ihren Blick auf den Fluss, der ihnen einen kühlen Wind ins Gesicht pustete. Einige hatten die Augen geschlossen und schliefen vermutlich, während die Wachen wie Soldaten ihren Nachtposten hielten. Der Abstand der Möwen zueinander war wie mathematisch berechnet exakt derselbe. Keine der Möwen schien Flügel ausspreizen und davon fliegen zu wollen. Sie waren keine einzelnen, unabhängigen Vögel, sondern vielmehr ein weißes, wie mit Kreide über das Brückengeländer gezogenes, unbändiges Kollektiv, in dem sich jede einzelne Möwe in voller Sicherheit, Geborgenheit und Einigkeit fühlte, da sie um ihres gleichen neben sich wusste. Ich war verblüfft. Ich war überrumpelt. Die Möwen auf der Brücke schienen derart unwirklich, dass ich mir dachte, ich hätte sie mir eingebildet oder jemand hätte mit Papier Möwen gefaltet und sie auf das Geländer geklebt. Also überquerte ich noch einmal, nun in umgekehrter Fahrtrichtung, sobald ich die andere Rheinseite erreicht hatte, die Brücke, um mich zu vergewissern. Die Möwen waren echt, sie waren wirklich, sie saßen auf der Brücke, als gehörte sie ihnen, als wäre sie ein großes Nest. Zum einen war ich vom Spektakel der Natur beeindruckt, und zum anderen sehnte ich mich danach, Teil jener fürsorglichen Sicherheit, Geborgenheit und Einigkeit zu sein und mich wie eine Möwe unter den Möwen einzureihen. Mit diesem Gedanken erwachte eine unbeschreibliche, fast ziellose Sehnsucht. Ohne weiter nachzudenken, jedem Willen beraubt, fuhr ich am Ende der Brücke in die Richtung ihrer Wohnung, als hätte man mir einen Befehl gegeben. Ich spürte, dass ich wieder zu ihr musste, und wäre es auch nur noch für diese eine Nacht gewesen, ich musste zu ihr. Ich wollte ihr Einsicht in diesen Moment meines Lebens gewähren. Denn in den vorangegangenen Nächten erschufen wir eine Kreatur von unbedingtem Vertrauen. Wir hörten auf, uns zu schämen, in jeder Hinsicht. Dieses Vertrauen machte ich geltend. Ich dachte nicht darüber, dass ich sie stören würde oder ich unerwünscht sein könnte.
Ich parkte also das Auto, klingelte, sie machte auf, ich lief die Treppen hoch und sah sie, wie sie lächelnd und mich mit glühendem Verlangen anguckte. Ich fiel ihr in die Arme und wir verschlangen einander. Auch diese Nacht war eine Nacht leidenschaftlichem Einklangs und sinnlicher Verschmelzung. Als wir nackt im Bett lagen und aus den großen Fenstern in die Nacht blickten, schilderte ich ihr die Möwen auf der Brücke. Sie war ebenso wie ich beeindruckt von diesem Bild. Ich versprach ihr, dass ich ihr eines Nachts dieses Wunder weißer Vögel zeigen müsste. Sie willigte ein. Wir rauchten noch eine Zigarette im Badezimmer. Als sie fertig war, ging sie schon ins Zimmer und legte sich ins Bett. Ich rauchte meine Zigarette noch allein zu Ende und dachte über das Glück nach, das mir mit ihr widerfahren sein musste. Ich lächelte in mich hinein, dass ich, obwohl ich Hals über Kopf wieder hierher stürmte, wo wir uns doch schon verabschiedet hatten, kein ungebetener Gast zu sein schien. Ich war willkommen. Das vergewisserte mir, dass auch sie noch an mich dachte, nachdem ich gegangen war. Ich bedeutete ihr etwas, dachte ich mir, du bedeutest ihr etwas.
Nachdem ich die Zigarette zerdrückt hatte und den Mund spülte, legte ich mich mit einem zarten Gefühl der Selbstzufriedenheit zu ihr. Ich spürte maßloses Glück, diese Frau in den Armen zu halten. Ich fragte mich, ob ich es überhaupt verdient hätte; vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich konnte jedenfalls nicht schlafen, ehe ich ihr nicht offenbarte, wie unser beider Sehnsucht sich in einer unentdeckten Region gefunden hatte. Das war, fiel mir auf, was ich bei ihr vergessen hatte. Ich strich mit der Hand an ihrer Achsel, sie kicherte und drehte sich mit dem Rücken zu mir. Dann küsste ich ihren Nacken, unter dem sich eine einzige Wirbel wie eine kleine Wurzel hervortat, neigte meinen Mund über ihr Ohr und spürte, wie eine eigenartige Hitze in mir aufstieg, die mich fast lähmte. Doch ich überwand sie, als ich erkannte, dass sie die Vorahnung von Feigheit und Heuchelei war. Ich wollte weder das eine noch das andere sein. Dann fasste ich mich zusammen und tat etwas Unmögliches, was ich weder beabsichtigt noch geahnt hatte. Ich sagte, Ich liebe dich.
Ich wartete. Vergeblich, sie erwiderte nichts. Sie schwieg. Nun verstummte ich und begann mich zu schämen. Dann konnte ich nicht mehr schlafen und dachte bis zum Morgengrauen an die Möwen.
(Auszug aus einem umfangreichen Romanprojekt)
Kerstin Werner
Zeit und Raum gibt es nicht mehr
Nie kam mir der Gedanke, dass Großmutter bald sterben könnte. Sie ist ein Teil von mir und ein Leben ohne sie kann ich mir einfach nicht vorstellen. Seit ich bei ihr wohne, war sie nie ernsthaft krank gewesen. Doch was Großmutter jetzt erleiden muss, kam so plötzlich und unerwartet, dass ich auf ihre Krankheit nicht vorbereitet bin. Ihre Diagnose lautet: Leberkrebs – und es gibt keine Heilungschancen mehr. Aber das weiß Großmutter nicht. Seit Wochen liegt sie mit unerträglichen Schmerzen in einem Pflegeheim, nachdem die Ärzte im Krankenhaus ihr nicht weiterhelfen konnten, und nun wartet sie darauf, dass ich sie endlich wieder mit nach Hause nehme.
„Was soll ich hier?“, sagt sie. „Hol mich hier raus, Elisa, bitte!“
„Ich werde mit Tante Edith sprechen“, sage ich.
Meine Tante leitet das Pflegeheim und konnte Großmutter sofort nach der Entlassung aus der Klinik in ihrem Heim unterbringen. Wir beide haben vereinbart, meinen Großeltern nicht die volle Wahrheit zu sagen, um ihre und auch unsere letzte Hoffnung nicht zu zerschlagen. Großmutter möchte wieder gesund werden – und nur das zählt.
Ich lebe seit meinem fünften Lebensjahr bei meinen Großeltern. Sie haben mich aufgenommen, als meine Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen. Als der Unfall passierte, war ich gerade im Kindergarten. Ich erinnere mich noch, wie sehr ich mich gefreut hatte, weil Großmutter mich abholen kam. Doch dann wunderte ich mich, dass sie ein schwarzes Kleid trug und ihr Gesichtsausdruck so ernst war, wie ich es noch nie bei ihr gesehen hatte. „Oma, was hast du?“, fragte ich sie erschrocken.
„Du wirst ab heute bei uns wohnen, Elisa.“
„Aber warum?“
„Mama und Papa sind mit dem Auto verunglückt.“
„Sind sie verletzt?“
„Ja – sie haben nicht überlebt …“
Großmutter fiel das Sprechen schwer, das spürte ich, aber dass meine Eltern nicht mehr leben sollten, das begriff ich an diesem Tag noch nicht. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich war bereit, bei meinen Großeltern zu wohnen, aber nur so lange, bis meine Eltern wieder zurückkehren würden.
Erst als meine Großeltern mich zur Beerdigung mit auf den Friedhof nahmen, verstand ich, dass meine Eltern gestorben waren. Viele Verwandte und Freunde kamen zu uns, und zum ersten Mal sah ich meine Großmutter weinen. Ich ergriff ihre Hand und wollte sie trösten, aber dann weinte ich so heftig, dass Großmutter mich fest an sich drückte. In der Kapelle erblickte ich die beiden Urnen und wunderte mich, wie meine Eltern darin Platz hatten. Später erzählte mir Großmutter, dass sie vorher verbrannt wurden und die Asche sich nun in den Urnen befände. Ich war entsetzt. Es muss doch wehtun, wenn man einfach verbrannt wird. Doch Großmutter erklärte mir, dass das Feuer dem Verstorbenen nicht wehtut.
Fast jeden Tag ging ich mit ihr zum Friedhof, der nicht weit von unserem Haus entfernt liegt. Ich mochte die Stille, die mich dort umgab. Wir pflückten das wenige Unkraut und Großmutter ließ mich die Blumen einpflanzen, die wir vorher gemeinsam ausgesucht hatten. Im Schuppen fand sie noch eine kleine Gießkanne und Harke für mich, damit auch ich die Pflanzen gießen und das Grab und die schmalen Wege harken konnte. Auf diese Weise war es mir möglich, allmählich über den Tod meiner Eltern hinwegzukommen, und ich gewöhnte mich daran, für immer bei meinen Großeltern zu leben. Bald kam ich zur Schule, und darauf freute ich mich.
Heute, nach fast zwanzig Jahren, kann ich mir kein anderes Zuhause mehr vorstellen. Meine Großeltern haben alles getan, um mir meine Eltern zu ersetzen. Der Gedanke, dass ich sie eines Tages verlieren könnte, lässt mich nachts nicht mehr schlafen. Jetzt, wo Großmutter im Pflegeheim liegt, spüre ich deutlicher denn je, wie sehr ich meine Großeltern liebe. Wenn nur Großvater sich nicht so hilflos und allein fühlen würde, dann wäre alles einfacher für mich. Daher versuche ich, weitgehend unsere Gewohnheiten beizubehalten, so als würde Großmutter nur für kurze Zeit fort sein. Soweit ich es schaffe, übernehme ich all ihre Hausarbeiten, erledige die Einkäufe und kümmere mich um die Malzeiten. Während ich jeden Tag zu Großmutter fahre, besucht Großvater sie nur zwei Mal in der Woche. Mehr schafft er nicht. Die Atmosphäre im Heim kann er kaum aushalten. „Ich habe noch nie so deutlich den Tod gesehen wie in diesem Heim“, sagt er.
Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, versuche ich, viel mit Großvater zu reden. Über seinen Garten, über die Zeitungsnachrichten und über Großmutter. Doch sobald ich allein bin und innerlich zur Ruhe komme, droht alles über mir zusammenzustürzen und ich fürchte, mit dieser Situation niemals fertig zu werden.
Großvater ist sehr mager geworden. Deshalb koche ich nicht nur am Wochenende, sondern auch in der Woche; das geht natürlich nur abends, wenn ich von meiner Arbeit zurück bin. Schon als Kind stand ich oft bei Großmutter in der Küche und schaute ihr beim Kochen zu. Wenn genug Zeit war, durfte ich mit einem scharfen Messer das Gemüse schneiden. Darauf war ich sehr stolz. Zwei Mal im Monat gab es Milchreis; dann schüttete sie die Reiskörner auf den Küchentisch und sagte: „Hilfst du mir, die schwarzen Körner aus dem Reis herauszulesen?“ So standen wir beide um den Tisch und sortierten die schwarzen Körner heraus. Für jede Zutat, die sie beim Kochen verwendete, erklärte sie mir, warum sie es tat, und ich hörte ihr aufmerksam zu. Wenn sie Milchreis kochte, kamen Lorbeerblätter, Zitronenschalen, schwarze Pfefferkörner, eine Prise Salz und Muskatnussstückchen hinzu, und erst wenn der Milchreis fertig war, fischte sie die Gewürze mit einem Holzlöffel wieder aus dem Topf heraus. Oh, wie freute ich mich auf diese Mahlzeit. Doch am liebsten aß ich ihre Gemüsesuppen. An jede Gemüsesuppe, die sie kochte, gab sie zum Schluss ein bisschen Mehlschwitze hinein. „Das verfeinert den Geschmack der Suppe“, sagte sie, und ich beobachtete, wie sich die klare Brühe in eine milchige verwandelte. Ich mochte all ihre Gerichte und war glücklich, dass Großmutter nach der Schule mit dem Essen auf mich wartete. Sie lobte mich, dass ich ein guter Esser sei, und war froh, dass es mir jedes Mal so gut schmeckte. „Da koche ich doch gern“, sagte sie. Auch später, als ich nicht mehr zur Schule ging, genoss ich ihr selbst zubereitetes Essen; von Fertiggerichten hielt sie nichts. – Doch in letzter Zeit musste Großmutter sich beim Kochen oftmals setzen, weil ihr das längere Stehen vor dem Herd schwerfiel. Auch klagte sie häufig über Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit. Dann war sie mir dankbar, wenn ich am Wochenende das Kochen übernahm.
Nun koche ich jeden Abend für Großvater und mich, aber so gut wie Großmutter gelingt es mir nicht. Großvater scheint es zu schmecken, obwohl er selten etwas sagt. Wenn er mit dem Essen fertig ist, starrt er betrübt auf seinen leeren Teller und scheint in Gedanken weit weg zu sein. Dann steht er wortlos auf, geht in den Garten hinaus und lässt sich müde in seinen Lehnstuhl fallen. Er kann sich zu nichts mehr aufraffen, während ich selbst oft nicht weiß, womit ich beginnen soll. Wenn ich früh aus dem Haus gehe, weiß ich nicht, was mich am Abend erwartet. Bisher ging mir meine Arbeit als Kunstpädagogin immer leicht von der Hand, aber jetzt kann ich mich nur schwer konzentrieren und möchte mich am liebsten zurückziehen, doch die Museumsbesucher fordern mich heraus. Und dann wundere ich mich selbst, wie mühelos mir ein Lächeln über die Lippen geht. Ich funktioniere. Erst, wenn ich am späten Nachmittag das Museum verlasse, atme ich erleichtert auf.
So auch heute. Ich steige in den Bus und fahre direkt ins Pflegeheim. Als ich das Zimmer von Großmutter betrete, spüre ich, dass sie mich bereits erwartet. Wie immer hat sie sich von der Pflegerin schön anziehen lassen – doch ihr Anblick ist erschreckend. Mit jeder neuen Begegnung muss ich schlucken. Ihre gelbe Hautfärbung und ihre gelbtrüben Augen verändern ihr Aussehen so stark, dass sie mir im ersten Moment fremd erscheint. Um dieses Gefühl zu verdrängen, beginne ich von unseren gemeinsamen Erlebnissen zu erzählen, als ich noch ein Kind war. „Weißt du noch, wie wir jeden Abend dicht beieinander im großen Bett gelegen haben? Du hast mir Geschichten erzählt und mich dabei gestreichelt, damit ich besser einschlafe. Doch meist bist du zuerst eingeschlafen.“
„Ja“, sagt sie, „ich erinnere mich.“
Sie hört mir weiter zu, nickt leicht mit ihrem Kopf und versucht immer wieder zu lächeln, bis sie erschöpft ins Kissen zurücksinkt und ihre Augen schließen muss. Ich nehme ihre Hand, die sich kalt anfühlt, und schweigend bleibe ich auf ihrem Bett sitzen. Sie stöhnt und ich gebe ihr zu trinken.
Zeit und Raum gibt es nicht mehr. Nur Großmutter und ich. Wir halten uns an den Händen und fühlen uns glücklich.
Irgendwann sagt sie, ich solle doch gehen, Großvater würde bestimmt warten und bald würde sie doch wieder heim kommen. Ich sehe auf die Uhr, es ist schon sieben. Ja, Großvater wartet auf mich, und wenn ich nicht komme, dann gibt es für ihn kein Abendbrot. „Also dann, bis morgen“, sage ich und küsse sie auf die Stirn. An der Tür winke ich ihr noch einmal zu.
Doch am nächsten Tag kommt alles anders.
Als ich Großmutters Zimmer betrete, blickt sie nicht wie sonst zu mir auf. Ihre Augen sind glasig. Wie im Fieberwahn ruft sie nach ihrer Mutter, wälzt dabei ihren Kopf hin und her und stöhnt laut auf. Ihre Hände greifen ins Leere. Niemand hat sie zurechtgemacht. – „Oma“, rufe ich, „ich bin‘s, Elisa.“ Aber Großmutter hört mich nicht. Tränen steigen mir in die Augen. Gern möchte ich sie festhalten, aber ich wage nicht, sie zu berühren. Sie scheint in eine ferne Welt zu schweben. Verzweifelt blicke ich mich um. Auf der anderen Seite des schmalen, viel zu dunklen Zimmers liegt eine noch ältere Frau und döst vor sich hin. Auch sie wird bald sterben, denke ich. – Plötzlich muss ich heftig weinen. Noch nie in meinem Leben habe ich mich so hilflos gefühlt. Ich schaue noch einmal zu Großmutter, dann gehe ich hinaus und ziehe die Tür leise hinter mir zu.
Draußen atme ich die frische Luft, die mir im warmen Abendlicht entgegenströmt. Ich überlege, wieder mit dem Bus zu fahren, doch dann entschließe ich mich, zu laufen; nur so kann ich noch eine Weile für mich allein sein.
Als ich zu Hause ankomme, sitzt Großvater im Garten und wartet auf mich. „Da kommst du ja endlich, Mädchen“, sagt er. „Ein junger Mann wollte dich sprechen, und ich sagte ihm, dass du noch im Pflegeheim bist. Er gab mir seine Handynummer, damit du ihn zurückrufen kannst.“
„Hat er sich mit Namen vorgestellt?“ frage ich, obwohl ich weiß, dass es nur Sebastian sein kann.
„Ja, natürlich, aber ich habe seinen Namen wieder vergessen. Er war sehr freundlich. Aber warte, vielleicht steht sein Name ja auf dem Zettel, den er mir gegeben hat.“ Großvater holt den Zettel aus seiner Jackentasche und reicht ihn mir. – Sebastian hat seinen Namen, seine Adresse und seine Handynummer mit Bleistift darauf geschrieben.
„Ich habe mir übrigens schon selbst Abendbrot gemacht“, sagt Großvater. „Aber warum kommst du heute so spät? Ist etwas im Heim passiert?“
„Nein, alles in Ordnung“, sage ich. „Ich habe den Bus verpasst und bin gelaufen.“
„Den ganzen Weg?“
„Ja“, sage ich und erneut steigen mir Tränen in die Augen. Am liebsten möchte ich Großvater alles erzählen, doch heute kann ich es nicht. Ich bin einfach nicht stark genug, um ihn zu trösten. Ich gehe in mein Zimmer und lasse mich auf das Bett fallen. In meiner Hand halte ich noch immer den Zettel, den Großvater mir gegeben hat. Sebastian. Ich kenne ihn erst seit einer Woche. Er und seine Mitstudenten besuchten unsere neue Kunstausstellung zu den Künstlern des „Blaue Reiters“. Als ich die Studentengruppe durch die verschiedenen Räume geführt hatte, kam Sebastian noch einmal allein auf mich zu und bedankte sich für meine schöne und interessante Führung. Er fragte mich, ob wir uns nicht einmal treffen wollen, aber ich schüttelte den Kopf und sagte ihm, dass ich momentan keine Zeit hätte.
Einen Tag später kam er wieder, kurz vor Museumsschluss. Als ich ihn sah, bekam ich Herzklopfen. An diesem Abend musste ich noch einmal nach Hause, um die frisch gewaschene Wäsche für Großmutter zu holen, die ich am Morgen vergessen hatte mitzunehmen. So ließ ich es geschehen, dass Sebastian mich nach Hause begleitete. Anfangs schwiegen wir und waren beide verlegen, doch dann erzählte er mir aus seinem Leben, und als er merkte, dass ich ihm zuhörte, sprudelte es nur so aus ihm heraus. So erfuhr ich, dass er an der Kunsthochschule studiert und bald das vierte Semester abschließen wird. Und dann sprach er von seinen Freunden, mit denen er in einer Wohngemeinschaft lebe, und ich spürte an seinem Erzählton und an seinen Gesten, wie wichtig ihm seine Freunde waren. Auch seine Eltern besuche er hin und wieder, die noch immer in dem Dorf wohnen, wo er mit seinen drei Geschwistern aufgewachsen ist; seine jüngste Schwester lebe noch dort und besuche die elfte Klasse. Während Sebastian erzählte, vergaß ich für einen Moment all meine Sorgen. Es ging ein Leuchten von ihm aus, das ich sofort lieb gewann. Dennoch war ich an diesem Tag froh, als er sich am Gartentor von mir verabschiedete. Er ist erst einundzwanzig Jahre alt, vier Jahre jünger als ich selbst.
Dass Sebastian vorhin hier war und mit Großvater gesprochen hat, lässt mir keine Ruhe mehr. Er meint es ernst. Doch welches Bild macht er sich von mir? Kann ich all seine Erwartungen erfüllen? Wird er meine Sorgen verstehen, die ich mit mir herumschleppe? Er lebt frei und unabhängig, hat sich schon lange von seinen Eltern losgesagt und verbringt seine freie Zeit viel mit seinen Freunden. Ich dagegen wohne noch immer bei meinen Großeltern und führe inzwischen einen sehr geregelten Tagesablauf. Von meinen Freunden, die ich während meines Studiums kennengelernt habe, lebt niemand mehr hier in der Stadt. Hin und wieder schreiben wir uns, nur zu Jan habe ich keinen Kontakt mehr. Mit ihm war ich fünf Monate zusammen, und er konnte einfach nicht verstehen, warum ich mir nicht eine eigene Wohnung suchte. Es war ihm jedes Mal unangenehm, wenn er zu mir nach Hause kam und sich mit meinen Großeltern unterhalten musste. Eines Tages entschloss er sich, zwei Auslandssemester in Edinburgh zu studieren und fragte mich, ob ich nicht mitkommen wolle; es wäre die Gelegenheit, in eine andere Kultur einzutauchen und seinen Wortschatz in Englisch zu erweitern. Anfangs fand ich die Idee verlockend, doch sobald ich länger darüber nachdachte, wurde mir klar, dass ich noch nicht bereit war, meine Großeltern für längere Zeit zu verlassen. Aber das konnte ich niemandem erzählen, ich verstand mich selbst nicht. Ich war zweiundzwanzig, also in einem Alter, wo man froh ist, auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Viele meiner Mitstudenten suchten das Abenteuer.
Doch bei mir war es anders. Bis heute. Ich leide unter großen Verlustängsten. Die wenigen Erinnerungen, die mir von meinen Eltern geblieben sind, reichen aus, dass ich sie nach wie vor vermisse. Umso stärker halte ich an meinen Großeltern fest. Ich habe Angst, auch sie eines Tages zu verlieren. In meinem Kopf sehe ich immer wieder Großmutter vor mir, wie sie mich an jenem Tag vom Kindergarten abholte, als meine Eltern verunglückt waren. Großmutter war so ernst und traurig, so schwarz gekleidet, dass ich dieses Bild nicht vergessen kann. Mich verbindet ein tiefes, inniges Band zu Großmutter. Und ich weiß, dass dieses Band niemals zerrissen wäre, wenn ich mit Jan nach Edinburgh gegangen wäre. Aber ich konnte nicht. Ich hätte immer das Gefühl gehabt, sie allein zurückzulassen. Auch wusste ich nicht, woher ich das Geld für zwei Auslandssemester nehmen sollte; meine Großeltern bekamen nur eine kleine Rente, und mein Bafög reichte längst nicht aus, um für ein Jahr in Schottland zu leben. Als ich Jan meinen Entschluss mitteilte, doch lieber hier in Deutschland zu bleiben, lachte er kurz auf und sagte: „Dann kannst du dich gleich mit deinen Alten begraben lassen.“ Ich fühlte mich tief verletzt.
Meine Entscheidung habe ich dennoch nie bereut. Jan lernte in Edinburgh bald eine neue Freundin kennen, was er mir in einem Brief kurz mitteilte. Ich fühlte mich abgeschoben, konnte nicht fassen, dass ich so leicht austauschbar war und brauchte lange, bis ich unsere Trennung akzeptiert habe. Vielleicht haben wir uns nie wirklich geliebt. Und vielleicht muss man die Liebe auch erst lernen. Ich weiß es nicht.
Doch eins weiß ich mit Gewissheit: Auch wenn Großmutter bald von uns gehen wird, werde ich nie aufhören, sie zu lieben. Heute hat sie mich nicht erkannt, ihre Seele war weit weg von mir. Wird sie noch einmal in unsere Welt zurückkehren? – Ich darf es Großvater nicht länger verschweigen. Morgen will ich zusammen mit ihm ins Pflegeheim fahren. Er muss sie sehen, er muss die Möglichkeit haben, sich von ihr zu verabschieden, auch wenn sie ihn nicht mehr wahrnehmen kann.
Auch Sebastian werde ich alles erzählen. Seit ich ihn kenne, spüre ich ein anderes Leben in mir aufkeimen. Mir ist, als hätte er eine Tür in mir geöffnet, die ich nicht wieder schließen möchte; und bei dem Gedanken, dass er vielleicht weitere Türen öffnen könnte, fange ich innerlich an zu beben. Ich spüre eine unbekannte Wärme in mir aufsteigen. Alles an ihm scheint mir vertraut: Sein Lächeln, seine Stimme, seine Augen … Als hätten wir schon seit unserer Kindheit darauf gewartet, einander zu begegnen.
Auf einmal wird mir bewusst, dass Sebastian nur auf ein Zeichen von mir wartet. Ich springe aus meinem Bett, schnappe mir Jeans und T-Shirt und ziehe mich um, dann bürste ich mein Haar und stecke es hoch. In der Küche trinke ich noch ein Glas Wasser. In diesem Moment kommt Großvater ins Haus und schaut mich fragend an. „Was hast du vor?“
„Ich gehe noch zu Sebastian“, sage ich.
Großvater nickt. „Das machst du richtig, Mädchen. Um mich brauchst du dich nicht zu kümmern. Ich komme schon allein klar.“
Das hat Großvater noch nie gesagt.
„Danke“, sage ich und eile so überstürzt aus dem Haus, als könnte ich es mir noch anders überlegen.
Natascha Tesar-Pelz
Der Kanzler
Der Saal war bunt geschmückt. Rote Lampions, die chinesische Schriftzeichen trugen, hingen prall von der Decke herab. Zierliche österreichische und chinesische Fähnchen hatten ihren Platz an den festlich dekorierten Tischen, um die sich ebenso feierlich gekleidete Menschen platziert hatten. Die Gäste, die an diesen Tischen saßen, waren angeregt in Gespräche vertieft oder lauschten der ungewohnten chinesischen Musik, die von einem Orchester gespielt wurde. Die Kellner beeilten sich die exotisch riechenden Speisen zu servieren, die dann von den Ballgästen mit Stäbchen verspeist wurden. Es war ein Gemisch aus europäisch und chinesisch aussehenden Leuten, die sich in dem Saal tummelten. Einer dieser Besucher war Hanna, die sich an der Seite ihres Mannes angeregt mit einer Frau aus Shanghai unterhielt. Hanna war in heiterer, beinahe ausgelassener Stimmung, wobei ihr das zweite Glas Sekt gute Dienste erwiesen hatte. Sie unterhielt sich gerne mit der Frau, die für sie eine nette Abwechslung zu den sonst gewohnten Werbemanagern, Politikern und Beamten war. Zu oft gab es diese gesellschaftlichen Verpflichtungen, die sie an der Seite ihres Ehemannes, der die Leitung einer großen Werbeagentur innehatte, besuchte. Innerlich gelockert beteiligte sie sich an den unterschiedlichen Gesprächen, lächelte und lachte sogar, wenn sie von einer Bemerkung des Tischnachbarn angetan war. Ihr Mann stand abseits und diskutierte mit einem Stadtpolitiker, wobei er ein konzentriertes Gesicht machte. Als sie ihn so sah, dachte sie, wie gut er in seinem Job war. Aufträge auftreiben, das konnte er. Wieder ihrer Gesprächspartnerin zugewandt, sah sie den Kanzler auf ihren Tisch zusteuern. Er schüttelte allen die Hände, begrüßte jeden mit ein paar netten Worten. Als er auch ihr die Hand reichte und sie anlächelte, musste sie innehalten, denn seine klaren dunklen Augen zogen sie an.
„Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Abend? Mit Ihrem Mann habe ich ja schon gesprochen. Er hat gute Ideen zu unserem neuen Projekt.“
Völlig erstaunt, dass dieser Mann überhaupt wusste, wer sie war, antwortete sie sich schnell wieder fassend: „Oh, danke, der Abend ist sehr nett und inspirierend. Freut mich, dass Ihnen die Ideen meines Mannes zusagen.“
Mit einem Lächeln und einem ihren Eindruck nach zu intensivem Blick, der sie verwirrte, wandte der Kanzler sich jemandem anderen zu. Immer noch angetan von der Ausstrahlung dieser Augen, beeilte sie sich, die Konzentration wieder auf ihre Gesprächspartnerin zu lenken. Sie merkte allerdings, dass sie sich nun schwerer tat aufmerksam zu sein und war beruhigt, dass die chinesische Musik von westlichen Klängen abgelöst wurde und die Leute zaghaft zu tanzen begannen.
„Ein interessanter Mann dieser Kanzler Rössler? Findest du nicht auch?“
Überrascht über die plötzliche Anwesenheit ihres Mannes antwortete sie kurz: „Schon, ja schon. Hast du einen guten Abend?“
„Kann man wohl sagen, bei dem nächsten Projekt sind wir auch involviert. Das hat eine ganz schöne Dimension.“
Sie war froh darüber, dass er wieder ein gutes Geschäft abschließen konnte, denn seine Gereiztheit und Nervosität der letzten Zeit könnte sich damit vielleicht beruhigen. Sie hörte die rhythmischen Klänge der Musik und hatte Lust zu tanzen. Sie schob ihren Mann förmlich auf die Tanzfläche. Widerwillig ließ er sich dazu überreden. Sie spürte, wie gut es ihr tat, sich zu bewegen und in dem Getümmel der Leute so fröhlich sein zu können. Gerade die vergangenen Monate waren für sie nicht leicht gewesen, zu sehr plagten sie so manche Sorgen. In diesem Moment jedoch war die letzte Zeit vergessen. Wie von selbst ließen sich Hüfte und Beine im Rhythmus bewegen. Sie fühlte sich leicht. Auch als die Musik schon ruhiger wurde, konnte sie die elektrisierende Wirkung in ihrem Körper kaum bändigen. Sogar als ihr Mann schon längst die Tanzfläche verlassen hatte, tanzte sie weiter und ließ sich durch die Klänge über den Boden tragen.
„Darf ich um den Tanz bitten?“
Sie bewegte den Kopf in Richtung des Fragenden und sah den Kanzler vor sich stehen. Gebannt von seinen tiefbraunen Augen sagte sie rasch „ja“. Er reichte ihr seinen Arm, sie hängte sich bei ihm ein und schritt mit ihm in Richtung Tanzfläche. Die Leute wichen zurück, um den beiden Platz zu machen. Dabei fühlte sie sich stark beobachtet, wurde aber aufgrund des Lächelns und Nickens der Leute nicht verunsichert. Schließlich begaben sich der Kanzler und sie in Tanzposition und dabei kam ihr der Satz: „… den ersten Schritt mit ihr gemacht…“ in den Sinn. Sie musste innerlich lächeln, denn sie kam sich nun fast so wie Eliza in dem Musical „My Fair Lady“ vor. Der Kanzler führte sie behutsam. Sie ließ sich leiten und sie verspürte die schwebende Leichtigkeit ihres Körpers. Von ihm gehalten und durch den Saal mühelos bewegt zu werden, genoss sie. Sie merkte auch nicht mehr, wie die Blicke der Umstehenden jeden Schritt verfolgten. Ihr Körper fühlte sich bereits so leicht an, dass sie den Eindruck hatte, sie würde über dem Boden schweben. Dazwischen trafen sich ihre Blicke und sie spürte immer mehr, wie sie sich in diesen Augen und dem Lächeln verlor. Das Rundherum verschwand zunehmend. Erst als die Musik geendet hatte und Applaus zu hören war, kam sie wieder zu sich und klatschte wie die anderen dem Orchester Beifall. Sie traute sich nicht den Kanzler anzusehen, aus Angst, die anderen würden ihre entzückte Verwirrung bemerken. Schon bereit, wieder auf ihren Platz zurückzukehren, nahm der Kanzler sie erneut in seine Arme und bewegte ihren Körper zu den Walzerklängen. Von den Drehungen wurde ihr leicht schwindelig, aber sie erlebte es nicht als unangenehm. Sie glitten über die Tanzfläche, innerlich schwebte sie. Immer dann, wenn der Kanzler sie ansah, lächelte er ihr liebevoll zu. Sie war glücklich in diesen Momenten. Nach dem Ende des Musikstücks brachte er sie zu ihrem Tisch zurück.
„Es war schön mit Ihnen getanzt zu haben.“
„Ich danke Ihnen, Sie haben mich auch wirklich gut geführt.“
Erneut vernahm sie eine wohlige Wärme in der Brustgegend. Es fiel ihr nun noch schwerer sich auf die Tischnachbarn zu konzentrieren, aber sie war Profi genug, das zu überspielen.
Als sie mit ihrem Mann auf der Fahrt nach Hause im Taxi saß, musste sie lächeln, denn erneut fiel ihr der Gesangstext aus „My Fair Lady ein“: „…den ersten Schritt mit ihr gemacht, war ihr so wunderbar, dass sie im Traum sogar, noch immer tanz, tanz, tanz heut Nacht.“
„Was erheitert dich so?“, fragte ihr Mann, der schon müde wirkte.
„Ich habe nur an den heutigen Abend gedacht. War wirklich nett.“
„Ja, das stimmt, und geschäftlich recht erfolgreich. Habe mich gewundert, dass der Kanzler heute getanzt hat. Das tut er normalerweise nicht.“
Als hätte sie etwas Unrechtes getan, wandte sie den Kopf in Richtung Fenster und lächelte verstohlen wie ein junges Mädchen in sich hinein. Erst als beide schon zu Hause waren, und sie sich ins Bett legte, merkte sie, wie müde sie war. In ihrem Inneren nahm sie jedoch eine wohltuende Leichtigkeit wahr, sodass sie schnell einschlafen konnte.
Am nächsten Tag wachte sie zum ersten Mal nach längerer Zeit mit weniger Schmerzen auf. Ihr Mann war schon aufgestanden und klapperte in der Küche mit dem Geschirr. Mit geringerer Schwere als die Tage zuvor, erhob sie sich aus dem Bett und ging ins Badezimmer. Als sie in den Spiegel schaute, musste sie lächeln, die Gedanken an den letzten Abend brachten sie dazu. Sie beeilte sich voranzukommen, denn es lag ein langer Arbeitstag vor ihr, der wohl strukturiert gehörte. Sie ging in die Küche, um ihren Mann einen guten Morgen zu wünschen und sich Frühstück zu machen. Aber er war bereits im Umkleideraum. Das ging schon eine gewisse Zeit so, dass sie in ihrer Wohnung ein Parallelleben führten. Sie litt nicht darunter, denn sie brauchte viel Kraft für sich, um den Alltag gut bewältigen zu können.
„Gut Morgen mein Schatz. Gut geschlafen?“
„Guten Morgen, danke, diesmal habe ich endlich wieder durchschlafen können. War ein netter Abend gestern.“
„Du sagst es, besser als ich dachte.“ Und nach einem Blick auf die Uhr bemerkte er: „Ich muss schauen, dass ich weiterkomme. Habe heute einige Termine. Wann kommst du heute Abend nach Hause?“
„Weiß noch nicht, aber ich denke so um acht Uhr.“
„Gut, dann sehen wir uns abends.“ Er drückte ihr einen Kuss auf die Wange und verließ die Wohnung. Hanna versuchte sich rasch zu strukturieren, gerade diese Woche stand einiges auf dem Spiel. Nachdem sie eine Kleinigkeit gefrühstückt hatte, die morgendlichen Hygiene absolviert und sich angezogen hatte, packte sie ihre Arbeitstasche und die Autoschlüssel und verließ die Wohnung. Wie jeden Tag fuhr sie den gewohnten Weg in die Gemeinschaftspraxis.
Der Tag verging überraschend schnell und sie war froh darüber, mit ihren KollegInnen einige Projekte diesmal sinnvoller angegangen zu haben, als die Wochen zuvor. Deutlich schwungvoller als die letzten Tage, kehrte sie am Abend nach Hause zurück und war auch nicht schlecht gelaunt, dass sie noch einiges aufzuarbeiten hatte. Hans war schon da, als sie die Wohnungstür aufschloss, und auch er schien besser gelaunt zu sein.
„Hallo Hanna, schön, dass du auch schon da bist. Ich bin in der Küche. Ich habe uns eine Kleinigkeit vorbereitet.“
„Das ist total nett. Du hast recht, bevor ich mich wieder zum Arbeiten hinsetze, ist es gut noch etwas zu essen. Was gibt es denn?“
„Huhn auf indonesische Art mit Basmatireis.“
Erfreut auch über die gute Stimmung ihres Mannes, setzte sich Hanna an den Glastisch im Wohnzimmer und Hans beeilte sich, das warme würzig duftende Gericht aufzutragen. In beinahe vertrauter Zweisamkeit saßen sich die beiden gegenüber und prosteten einander mit einem Glas Riesling zu.
„Ich bin Samstagabend zu einem halb offiziellen Empfang im Kanzleramt eingeladen. Vorher besprechen wir noch die Werbestrategien für den kommenden Wahlkampf. Kannst du dann zu dem Empfang nachkommen? Ich würde mich freuen.“
Als ihr Mann zu Ende gesprochen hatte, saß Hanna mit verdutztem Gesicht vor ihm. Es überkam sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Gefühlen. Eine verstohlene Freude ihn wieder zu sehen, aber auch eine verunsicherte Zurückhaltung, die diese Freude eindämmte. Was sollte sie darauf antworten? Ohne viel zu überlegen, kam aus ihr heraus:
„Ja gerne, wann soll ich da sein?“
In einem violetten Kostüm, mit hohen dunkelblauen Stöckelschuhen, auf denen am oberen Teil eine goldene Spange befestigt war, saß sie im Taxi auf dem Weg zum Kanzlerarmt. Erst beim Aussteigen aus dem Auto überkam sie eine innere Anspannung und ein leichtes Druckgefühl in der oberen Magengegend. Sie war es gewohnt zu derartigen Anlässen zu gehen, aber diesmal…
Freundlich empfing sie der Portier und beschrieb ihr genau, wo sich der kleine Festsaal befand. Mit wachsender Unruhe stieg sie die Treppe zu dem Saal hinauf. An der obersten Stufe angelangt, vernahm sie schon die Stimme ihres Mannes und war mit einem Mal froh ihn zu hören. Als Hanna den Saal betrat, suchte sie ihren Mann und gesellte sich zu ihm.
„Darf ich vorstellen, Hanna, meine Frau. Schön, dass du es so früh geschafft hast.“
Hanna wurde den umstehenden Leuten vorgestellt, schüttelte Hände und beantwortete souverän die an sie gestellten Fragen. Bald aber merkte sie, dass ihr Blick umherschweifte. Sie suchte ihn. Der Kanzler stand neben dem Fenster an der Wand und befand sich in einem intensiven Gespräch mit einem kleineren rundlichen Mann. Als er sie sah, tauchte sie ein in seinen Blick und begann auf eine Weise zu lächeln, die sie schon vergessen hatte. „Komm jetzt nur nicht her“, dachte sie. Diesen Gedanken zu Ende gebracht, stand er schon vor ihr.
„Guten Abend, Frau Delargo. Das ist aber nett, dass Sie auch gekommen sind.“
Momentan verwirrt, ohne zu wissen, was sie sagen sollte, antwortete Hanna: „Guten Abend Herr Doktor Rössler. Es freut mich, dass wir als Ehepartner diesmal auch eingeladen sind.“
„So ein Unsinn, versuche doch ein lockeres Gespräch zu führen. Du kannst das ja“, dachte sie. Aber es fiel ihr nichts ein. Wie ein Schulmädchen, das zum Direktor gerufen wurde, stand sie vor dem Mann, der ihre Gefühle in ein ihr nicht bekanntes Durcheinander brachte. Aber schon nach dem zweiten Satz des Kanzlers war die Anspannung aus ihrem Körper und vor allem aus ihrem Kopf entwichen. Sie sprudelte nur so aus sich heraus und der Kanzler gab ihr immer wieder Futter, so dass dieses Sprudeln auch nicht weniger wurde. Als die beiden sich nun doch schon eine Zeitlang miteinander unterhielten, bemerkte Hanna wie sich ihr Mann näherte. Schlagartig fühlte sie sich schuldig. Aber wofür? Dass sie sich nicht um ihn gekümmert hatte und schweigend und nickend neben ihm gestanden war, um seinen Worten zu lauschen? Nein, sie wollte sich nun um sich kümmern und weiterhin in diesem Gespräch mit diesem Mann verweilen und in halb schwebendem Zustand seine Blicke und sein Interesse genießen.
„Habe mich schon gewundert, wo du so lange bleibst. Aber wie ich sehe, in einem wichtigen Gespräch mit unserem Kanzler. Herr Doktor Rössler, was ich Sie noch fragen wollte?“
Und weg war er mit seiner Aufmerksamkeit, ihr förmlich entrissen. Was war denn das mit ihr? Sie hatte ein Durcheinander in ihrem Kopf, kannte sich nicht mehr aus. Irgendetwas geschah mit ihr. Dieser Mann machte Eindruck auf sie in einer Art und Weise, die sie noch nicht einordnen konnte. Sie wollte doch nur in diese tiefbraunen Augen blicken und den Geruch aufnehmen, den er ausströmte. Hoffentlich fiel niemandem ihre Verwirrung auf. Aber warum schaute er nur so oft zu ihr herüber? Fühlte er vielleicht Ähnliches? Immer wieder trafen sich ihre Blicke. Als nun schon einige Zeit vergangen und die Laune der Gäste sehr heiter geworden war, wozu der bereitstehende Wein das Seine beigetragen hatte, merkte sie, dass der Kanzler nicht nur nah neben ihr stand, sondern, dass seine Arme versteckt die ihrigen berührten. Normalerweise müsste sie zur Seite treten, aber genau das tat sie nicht. Sie fühlte Wärme in sich aufsteigen, wohlige Wärme. Als sie sich versicherte von niemandem gesehen zu werden, bewegte sie ihre Finger weiter nach vorne und berührte damit seine Hand. Bevor sie über ihr Verhalten erschrecken konnte, merkte sie, wie die Finger des Kanzlers sanft über ihre Hand strichen. Sie hatte sich nicht geirrt, auch er suchte ihre Nähe. Die kurze Zweisamkeit wurde jäh getrennt, als sich ein bärtiger Mann näherte und den Kanzler ohne viel Überlegung in Beschlag nahm. Hanna konnte sich rasch sammeln, war aber dann sehr beruhigt, dass sich die Gästerunde langsam aufzulösen begann. Sie war die Letzte, die zur Garderobe kam und sich den Mantel anziehen wollte, als sie merkte, dass jemand hinter ihr stand und ihr dabei behilflich war.
„Danke“, meinte sie und drehte sich dabei langsam um.
„Aber gerne“, antwortete der Kanzler. „Ich weiß nicht, ob sich das jetzt geziemt, aber ich würde sie gerne wiedersehen.“
Ohne darüber viel nachzudenken, antwortete sie impulsiv: „Würde ich auch gerne.“
„Dann geben Sie mir doch Ihre Karte“, antwortet er rasch, bevor jemand dazu stoßen konnte. Sie reichte ihm ihre Visitenkarte, lächelte ihn schon deutlich weniger verstohlen an und ging. Eilig suchte sie ihren Mann und fand ihn vor der Tür, die aus dem Festsaal führte. Sie war beruhigt, er begann sich von den Umstehenden zu verabschieden und lächelte sie an, als er sie sah. Nur zurück in die gewohnte Sicherheit, ging es ihr durch den Kopf. Arm in Arm in vertrauter Zweisamkeit verließen beide die Gesellschaft.
„Was war das? Bin ich von allen guten Geistern verlassen?“ Sie stand im Badezimmer vor dem gut beleuchteten Spiegel und redete mit sich selbst. Sie spürte einen Kampf in sich toben zwischen der strengen Vernunft und ihrem jungen Mädchen, das begehren wollte.
„Kommst du? Ich möchte schlafen“, hörte sie ihren Mann aus dem Schlafzimmer schon etwas ungeduldig rufen.
Mit dem Ausschalten des Badezimmerlichtes versuchte sie auch ihre ambivalenten Gedanken auszuschalten. Jedoch das gelang nur teilweise. Viel zu unruhig war diese Nacht für sie, intensive Träume rissen sie immer wieder aus ihrem Schlaf. Am nächsten Morgen war sie beruhigt, nun würde ein normaler Tag beginnen. Ein Tag, der geplant und mit Wichtigem gefüllt sein würde. Wichtigem?
Leicht dämmerte es. Sie saß in ihrer Praxis, das Notebook vor sich. Fast unaufhörlich tippte sie etwas in die Tastatur, stand dazwischen auf, um diverse Unterlagen zu holen, einiges daraus zu lesen und weiter ging es mit dem Schreiben. Als das Handy läutete, riss es sie hoch, so vertieft war sie in ihre Arbeit.
„Delargo“, meldete sie sich sachlich.
„Guten Tag, Frau Delargo, hier spricht Michael Rössler.“
„Oh, was nun?“, ging es ihr durch den Kopf. Bevor sie weiterdenken konnte, hörte sie die Stimme an der anderen Leitung sagen:
„Ich hoffe, ich habe Sie nicht erschreckt mit meinem Anruf?“
„Nein, das haben Sie nicht. Erschreckt auf keinen Fall. Was kann ich für Sie tun, Herr Doktor Rössler“, sagte sie mit deutlichem Bemühen sachlich zu bleiben.
„Ich wollte Sie nur fragen, ob wir uns zu einem kleinen Spaziergang treffen könnten. Ich fand das Gespräch mit Ihnen sehr interessant. Ich möchte mich gerne wieder mit Ihnen unterhalten.“
„Äh… ja… natürlich gerne. Ein bisschen Bewegung tut ja jedem gut. Wann und wo möchten Sie sich denn treffen?“
„Wie schaut es denn am Freitagnachmittag bei Ihnen aus, so um 16 Uhr? Sagen wir am Schottenhof, am Parkplatz genauer gesagt?“
„Das würde gut passen, ich komme gerne.“
Die nächsten Tage zwang sie sich, nicht an den kommenden Freitag zu denken und vor allem nicht an ihn zu denken. Dies gelang ihr sogar recht gut, auch, weil die Arbeit in ihrer psychotherapeutischen Praxis diese Woche alles andere als leicht war. Am besagten Freitag zwischen zwei und drei Uhr hatte sie, wie zumeist am Ende der Woche, ihre Praxisgemeinschaftssitzung, bei der es um administrative Belange, aber auch um schwierige Patientenfälle ging. An diesem Tag konnte sie sich allerdings nur schwer konzentrieren, eine leichte innere Unruhe kroch in ihr hoch. Sie war froh, dass die Besprechung endlich vorbei war. Sie räumte rasch ihr Bürozimmer auf und beeilte sich zu ihrem Auto zu kommen, um die Fahrt Richtung Schottenhof zu starten. Nach 30 Minuten Fahrtzeit gelangte sie zu dem Treffpunkt. Auf dem Parkplatz konnte sie zwar drei Fahrzeuge entdecken, aber von dem Kanzler war nichts zu sehen. Plötzlich bemerkte sie ein größeres grünes Auto, wie es gerade auf den Platz einbog. Sie blieb stehen und beobachtete den Kanzler, wie er einparkte, noch einen Blick in den Rückspiegel warf und aus dem Fahrzeug ausstieg. Mit einem freundlichen Lächeln näherte er sich ihr.
„Guten Tag, Frau Doktor Delargo. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.“
„Guten Tag, Herr Doktor Rössler.“
„Bitte lassen Sie das Doktor weg, das klingt wirklich zu förmlich.“
„Tu ich gerne Herr Rössler, dann lassen Sie aber bitte auch meinen Titel weg.“
Noch verwundert darüber, dass der Kanzler in einem Privatauto ohne Chauffeur gekommen war, begannen sie ihren Spaziergang. Der Weg durch den Wald war noch feucht von dem letzten Schnee und aufpassen musste sie, dass sie nicht am Wegrand in nasse Erdpatzen stieg. Obwohl es noch recht kühl in diesem Waldstück war, merkte man doch schon leicht die wärmenden Sonnenstrahlen des herannahenden Frühlings. Immer wieder kämpfte sich die Sonne durch die dicht nebeneinanderstehenden Bäume.
„Frau Delargo, warum ich Sie auch treffen wollte, ist eine etwas heikle Angelegenheit.“
Die Verwirrung in ihrem Kopf begann erneut Platz zu nehmen.
„Ich,… wie soll ich beginnen, habe ein persönliches Problem, über das ich nicht so einfach mit jemandem reden kann. Ich weiß aber, wenn ich nicht jetzt etwas dagegen tue, dann wird es schwieriger.“
Gebannt, was nun kommen würde, starrte Hanna ihn an.
„Ich habe manchmal das Gefühl, die Luft bleibt mir stecken. Ich spüre dann so einen Druck in der Brust und so ein Engegefühl.“
Hanna versuchte sich rasch zu sammeln und erwiderte professionell darauf: „Und Sie verspüren Hitze aufkommen und haben Angst ohnmächtig zu werden.“
„Genau, woher wissen Sie das?“
„Sie leiden unter Panikattacken, Herr Rössler. Angstzustände mit panikähnlichen körperlichen Zuständen.“
„An so etwas habe ich auch schon gedacht. Ich weiß nur nicht, was ich dagegen tun kann. Vor allem darf niemand etwas davon erfahren. Ein Bundeskanzler, der Ängste hat und der unter Panikattacken leidet, wäre nur ein allzu gutes Fressen für meine Gegner und für die Presse.“
„Sie wären aber nicht die erste öffentliche Person, die psychische Probleme hat. Da gibt es eine Menge davon.“