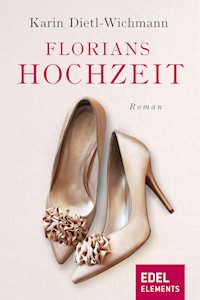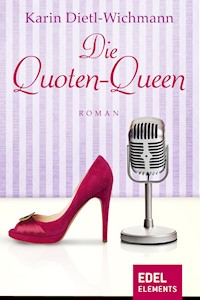2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Glamour, Macht und lukrative Geschäfte in Deutschlands High Society! Paul und Hannah Ebner haben nach dem 2. Weltkrieg ein Imperium aus Immobilien, Druckereien und Tuchfabriken geschaffen. Nur die Nachfolge ist nicht gesichert – und hinter den Kulissen bahnt sich ein schmutziger Machtkampf zwischen den drei Söhnen an. Denn es geht nicht nur um Geld, sondern um Einfluss und die Erbfolge, um Glanz und Glamour in Deutschlands High Society. Da gelingt Johannes Ebner, "Mamas Liebling", ein genialer Coup: Er heiratet die wunderschöne Clarissa, die ganz genau weiß, was sie will. Mit ihr an seiner Seite plant Johannes, das Imperium zu erobern. Denn der Tag, an dem das bestgehütete Testament Deutschlands eröffnet wird, kann nicht mehr weit sein. Noble Absichten und niedere Instinkte: eine Familiensaga, wie sie nur das Leben schreibt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Karin Dietl-Wichmann
Die Erben
Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 2012 by Karin Dietl-Wichmann
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-189-7
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Prolog
1 Der Alte
2 Paul II.
3 Richard
4 Franziska
5 Marie
6 Johannes
7 Hanna
8 Clarissa
9 Franziska
10 Klaus Herzog
11 Sophie
12 Der Alte
13 Richard
14 Hanna
15 Franziska
16 Marie
17 Der Alte
18 Johannes
19 Franziska
20 Richard
21 Paul II.
22 Der Alte
23 Franziska
24 Marie
25 Hanna
26 Sophie
27 Der Alte
28 Paul II.
29 Franziska
30 Johannes
31 Richard
32 Hanna
33 Paul II.
34 Sophie
35 Marie
36 Der Alte
37 Franziska
38 Hanna
39 Johannes
40 Richard
41 Paul II.
42 Marie
43 Der Alte
44 Die Ebners
45 Hanna
46 Der Alte
47 Franziska
48 Das Fest
49 Testamentseröffnung
50 Abschied
Epilog
Sämtliche Personen und Schauplätze dieses Romans sind frei erfunden. Alles, was hier geschildert wird, betrifft Gesetzmäßigkeiten des Wirtschaftslebens und könnte sich deshalb so abgespielt haben, ist aber real so nie geschehen. »Die Erben« ist kein Schlüsselroman. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen wären rein zufällig und keinesfalls von Autorin oder Verlag beabsichtigt.
Prolog
Von der Aussegnungshalle bis zum Grab hüpfte der große schwarze Vogel vor ihr auf dem Kiesweg. Er schien darauf bedacht, den kleinen Zug nicht näher als zwei Meter an sich herankommen zu lassen. Manchmal flog er kurz auf, setzte sich auf einen Ast und wenn sie dachte, dass er verschwunden sei, war er wieder vor ihr.
Franziska hatte den Eindruck, dass der Vogel sie mit seinen starren Augen musterte. Eine Krähe, dachte sie und musste lachen, eine Krähe begleitet Mutter auf ihrem letzten Weg. Alles an diesem Tag kam ihr falsch vor. Auf dem Friedhof roch es nach Frühling. Alle Zeichen standen auf Neuanfang. Für eine Beerdigung war dieser Tag einfach zu schön. Tod, Tränen und Abschied schienen fehl am Platz.
Auf dem ganzen Weg fühlte Franziska eine Leichtigkeit, die nicht zu dem Anlass passte. Selbst der üppige Strauß weißer Lilien, den sie im Arm hielt, wirkte nicht wie ein Trauerbouquet, sondern eher wie ein Brautstrauß. Verstohlen sah sie zur Seite, wo mit ernstem Gesicht die Schwester ihrer Mutter schritt. Franziska schämte sich, dass sie nicht weinen konnte.
Vor drei Tagen war ihre Mutter gestorben. Magenkrebs – die Krankheit hatte sie von innen aufgefressen.
Immer hatte ihre Mutter mit dem Entsetzen und der Besorgnis der Familie gespielt. Hatte die Todkranke gemimt, als es noch keine Krankheit gab. Dann, als die Krankheit sie wie eine Strafe für diese Leichtfertigkeit überfiel, hielt es die Familie für ihr gewohntes Spiel und reagierte nicht. Ihre Mutter hatte derartige Spiele geliebt. Sie inszenierte häusliche Dramen, deren tatsächliche Bedrohung Franziska nicht einschätzen konnte. Einmal, erinnerte sich Franziska, als sie von der Schule heimkam, hatte sie ihre Mutter leichenblass in der Küche kauernd vorgefunden. Die blonden Haare klebten ihr auf der schweißnassen Stirn.
»Was ist mit dir?«, hatte Franziska gefragt. Müde hatte die Mutter abgewinkt.
»Es ist nichts, Schatz«, hatte sie geflüstert. »Ich habe manchmal so einen furchtbaren Schmerz im Kopf! Du weißt doch, Gehirntumore liegen in unserer Familie!« Franziska hatte die Mutter gedrängt zum Arzt zu gehen. Aber das tat sie nicht. Sie sagte lediglich: »Was soll der mir noch helfen!«
Niemals würde Franziska den Blick ihrer Mutter vergessen, als sie trotz dieses neuen Leidens nicht bereit war, ein Rendezvous abzusagen. Der panische Blick verfolgte sie den ganzen Abend. Und noch Jahre später ergriff sie eine große Wut, wenn sie an diese perfide Art der Erpressung dachte. Die Jahre ihrer Kindheit verbrachte Franziska in einem Zustand der Verängstigung und der Anspannung. In der bescheidenen Dreizimmerwohnung herrschte der Terror. Alles schien auf eine unausweichliche Katastrophe zuzulaufen. Immer wieder erwähnte die Mutter, dass sie ein großes Geheimnis hüte. Eines, von dem sie ihr, der Tochter, erst auf dem Sterbebett erzählen werde. Im Laufe der Zeit wurde Franziska dieser ewigen Andeutungen müde. Sie sehnte sich nach einfachen, klaren Worten. Sie wollte nicht mehr raten, nichts mehr deuten müssen. Sie verließ ihr Zuhause ohne Abschied.
So lange sie zurückdenken konnte, hatte Franziska das Gefühl gehabt, dass ihre Mutter auf etwas wartete. Ob es sich dabei um einen Menschen oder ein Ereignis handelte, wusste sie nicht.
Warum nur hatte Franziska diesen Eindruck?
Ihre Mutter würde sie auch jetzt beobachten. Erneut beschlich sie das Gefühl, diese Beerdigung sei nur eine weitere Inszenierung. Ein Test, um zu sehen wie viele Menschen sie beweinten. Mit einem Mal überfiel sie die Traurigkeit wie ein schneller, spitzer Schmerz. Sie hatte sich nicht die Mühe gemacht herauszufinden, welchen Grund ihre Mutter gehabt hatte, die Familie mit dem lächerlichen Schauspiel einer Dahinsiechenden zu quälen. Warum war ihr niemals in den Sinn gekommen, dass diese immer neuen Krankheiten ein verstecktes Betteln nach Liebe gewesen waren?
Franziskas Leichtigkeit war verschwunden. Die helle Frühlingssonne erschien ihr plötzlich wie ein Verrat an der Toten.
1 Der Alte
Er war unruhig. Die letzte Nacht hatte er kaum geschlafen. Die Gespenster der Vergangenheit überfielen Paul Ebner nahezu jede Nacht. Sie drangen in sein abgedunkeltes Schlafzimmer, lachten höhnisch über den Greis und unterhielten sich, ohne dass er ihre Worte verstand. Er wusste, sie sprachen über ihn. Über sein Leben, seine Arbeit, seine Familie. Es hätte viel zu bereden gegeben, doch er musste schweigen, musste ihnen lauschen und konnte nur hoffen, dass sie nicht auch noch seine Richter sein würden.
Morgens, wenn er zerschlagen erwachte, waren die Gestalten und ihre Stimmen verschwunden. Manchmal fragte er sich, ob er am Abend zuvor zu schwer gegessen oder zu viel getrunken hatte. Er begann darauf zu achten, was er zu sich nahm. Teilte sich jeden Schluck Rotwein, der ihm sonst immer zu einem traumlosen Schlaf verholfen hatte, sorgfältig ein. Vergebens. Sie schienen ihm schon aufzulauern, schienen in den Ecken seines großen Schlafzimmers zu nisten und nur darauf zu warten, dass er das Licht löschte.
Es gab Tage, da fürchtete er den Verstand zu verlieren. Dann betrachtete er seine flatternden Hände, die nicht mehr seinem Willen gehorchten. Denen er Ruhe befahl, ohne dass sein Gehirn diesen Befehl weiterleitete. Er bemerkte, wie seine Füße unruhig scharrten und die Beine seltsame staksige Schritte machten. All das geschah, ohne dass er noch Einfluss darauf hatte.
»Du hast Parkinson, Paul«, sagte seine Frau. »Wir werden das schon in den Griff bekommen!«
Seit einiger Zeit sprach sie mit ihm in diesem widerwärtigen Krankenschwestern-Plural. Jetzt gehen wir spazieren, sagte sie, und: Wir müssen wirklich darauf achten, Disziplin zu halten.
Es ärgerte Paul Ebner, wie sie mit ihm umging. Aber meistens war er zu müde, um sie zum Teufel zu jagen.
Seit fünfundfünfzig Jahren war er mit Hanna verheiratet und sie war so klug gewesen, sich rechtzeitig aus seinem intimen Umfeld zu verabschieden. Beide hatten damals mit Mut und großen Visionen ihre Karrieren begonnen. Er mit dem väterlichen Erbe, einer Tuchfabrik, die im Krieg Uniformteile hergestellt hatte und nach Kriegsende vor dem Aus gestanden hatte. Sie mit einer Vorkriegsnähmaschine. Es war die Zeit, in der Ideen und Elan mehr bewirkten als Kredite einer Bank. Die Ebners wollten vorankommen. Auf ihre Ehe verschwendeten sie wenig Gedanken. Sie war so gut oder so schlecht wie jede andere Ehe gewesen. Er betrog sie, sie machte Szenen, wenn sie es bemerkte. Er versprach alles zu ändern, woran er allerdings nicht im Traum dachte. Immer wieder gab es wilde Streitereien. Ihre vier Kinder duckten sich darunter hinweg. Die beiden älteren Jungen steckten das häusliche Gekeife achselzuckend ein. Johannes, der Jüngste, wurde darüber zum Bettnässer und Marie, die einzige Tochter, schwor niemals zu heiraten.
Eines Tages, es muss im sechzehnten Jahr ihrer Ehe gewesen sein, hörten die ehelichen Gewitter plötzlich auf. Paul entdeckte, dass Hanna einen Geliebten hatte. Zuerst ärgerte es ihn. Sie setzte ihm Hörner auf, das passte nicht in sein Selbstbild. Doch dann trafen sie eine Vereinbarung, von der jede Partei profitierte. Nach außen hin blieben sie die vorbildliche Familie. Ihre erotischen Höhepunkte allerdings lebten sie mit anderen Partnern aus. Aus Hannas kleiner Schneiderei war inzwischen ein blühender Versandhandel geworden. Sie verlegte ihre wachsende Firma von Nürnberg nach Fürth. Auf das Dach des Verwaltungsgebäudes ließ sie sich ein Penthaus bauen. Das Arrangement sah vor, dass sie nur am Wochenende in die gemeinsame Villa kam. Dann versuchte sie nachzuholen, wovon sie glaubte, dass es zur Rolle einer Mutter und Ehefrau gehöre.
Inzwischen waren die Ebners ein öffentliches Paar geworden. Paul, von den amerikanischen Besatzungsoffizieren umworben und begabt mit dem Gespür dafür, was im Nachkriegsdeutschland gebraucht wurde, hatte sich in eine marode Stahlfirma eingekauft. Es dauerte keine zwei Jahre, bis »Steel United« aus den roten Zahlen heraus war und zu florieren begann.
Paul Ebner kaufte weiter: einen Lebensmittelkonzern, eine daniederliegende Batteriefirma, eine weitere Tuchfabrik, die er der eigenen einverleibte und mit neuesten Maschinen aus Amerika ausstattete. Bereits zehn Jahre nach Kriegsende war er ein reicher, mächtiger Mann, ohne den in seiner Heimatstadt Nürnberg nichts ging.
Ohne die Ebners war kein gesellschaftliches Ereignis mehr denkbar. Sie galten als Pioniere. Als Menschen, die sich nicht hatten unterkriegen lassen. Nicht von der schweren Zeit nach dem Krieg und nicht von der Missgunst der Landsleute, die munkelten, dass der Ebner eine so blütenreine Weste nun doch nicht gehabt haben konnte. Paul Ebner und seine Frau waren Vorbilder.
Die Kinder schienen wohlgeraten. Selbst sie wurden angehalten, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Nichts sollte, nichts durfte das Bild einer heilen Welt beschädigen. Das Abkommen der Eheleute wurde deshalb penibelst eingehalten. Jeder hatte seine Rolle, und die spielte er gut. Verunsicherungen gab es nur dann, wenn Hanna in der wenigen Zeit, die sie bereit war, ihren Kindern zu widmen, die besonders gute Mutter sein wollte. Dann bestand sie darauf, genau zu erfahren, wer mit wem befreundet war. Ob die Großen schon eine richtige Freundin hätten und wie die beiden Jüngeren beim Schulsport waren. Sie machte das so ungeschickt und übte so viel Druck aus, dass die vier sich verweigerten. Hanna spürte die Ablehnung. Jeden Montagmorgen flüchtete sie daher in ihr, wie sie es nannte, »normales Leben«.
Paul Ebner, dessen Firmengeflecht immer größer wurde, merkte von all dem nichts. Die Kinder wuchsen heran, waren mal gute, mal schlechte Schüler und gingen schließlich ihrer Wege.
Meine Firmen sind meine Kinder, pflegte er zu sagen. Der wirkliche Nachwuchs hatte sich dieser Prämisse zu fügen.
Jetzt, im Alter von vierundachtzig Jahren, befielen ihn immer häufiger Zweifel, ob er wirklich alles richtig gemacht hatte.
Seine Söhne waren keine Überflieger. Er hoffte, dass sie zumindest das Erbe, das er ihnen hinterlassen würde, sorgfältig und nach seinem letzten Willen verwalten würden. Marie, das schwierige Kind, war als erwachsene Frau nicht einfacher geworden. So sehr er gerade dieses Kind liebte, verstanden hat er es nie. Obwohl es ihm doch charakterlich am ähnlichsten war. Marie war jähzornig und unduldsam. Ihr gelang es immer ihren Willen durchzusetzen.
»Des Madla is scho recht!«, sagte er, wenn sich Lehrer oder Freunde über sie beschwerten. »Des Madla« war in keines der bürgerlichen Korsette ihrer Eltern zu zwingen.
Zum Kummer ihres Vaters ging sie schon mit achtzehn aus dem Haus. In ein paar Wochen, an seinem fünfundachtzigsten Geburtstag, würde er sie nach Jahren zum ersten Mal wieder sehen.
Seit zwei Monaten war Paul Ebner auf den Rollstuhl angewiesen. Nach außen hin hatte er es sehr gleichmütig hingenommen.
»Die wenigen Schritte, die ich noch gehen kann«, hatte er gesagt, »kann ich auch rollen.«
Es gab kaum etwas, was sein Feuer noch entfachen konnte. An guten Tagen, wenn die nächtlichen Albträume nicht zu arg gewesen waren, freute er sich an seiner Kunstsammlung. Über die Jahre hatte er sie zusammengetragen, die Meister der klassischen Moderne. Lovis Corinth, Marc und Macke. Einige van Goghs, Picassos – und Oskar Kokoschka, dem er für ein Porträt Modell gesessen hatte. Das Werk, das einen von Sorgen gebeutelten Mann zeigte, hatte Ebner erst unlängst aus seinem Schlafzimmer entfernen lassen. Auf das leere Rechteck hatte er eine Idylle von Monet gehängt. Seine Bilder sollten ihm die Entspannung bringen, die sie ihm stets gebracht hatten.
Früher hatte er in Stunden, in denen er verzweifelt oder einsam war, Trost in diesen Gemälden gefunden. Hatte sich die schwierigen Lebensgeschichten der Maler ins Gedächtnis gerufen und seine gegenwärtigen Probleme vergessen. Aber es funktionierte nicht mehr. Immer mehr machte ihm sein fortschreitender Verfall Angst. Er registrierte jeden einzelnen Muskel, der nicht mehr so wollte wie zuvor, spürte, wie er langsam sein Gedächtnis verlor, wie der Parkinson begann ihn zu zerstören. Heimlich, weil er sich vor den anderen schämte, machte er Übungen, um sein Gehirn zu trainieren.
Sein Kampf um einen Rest von Würde war mühsam. Stoisch nahm er es hin, dass er einen nach dem anderen von seinen Weggefährten beerdigen musste. Die Jagdfreunde, zum Teil Schulfreunde, aber auch Politiker, Schauspieler und Wirtschaftsbosse, denen er ein guter Gastgeber und deftiger Kumpel gewesen war, hatten die Wochenenden in seinem Revier genossen. Bei ihm konnten sie sich gehen lassen. Konnten saufen, fressen und dreckige Witze über die Weiber reißen. Nichts drang von diesen Gelagen nach außen. Hier war man unter seinesgleichen. Alles Männer, die – jeder auf seinem Gebiet – das Nachkriegsdeutschland geschaffen hatten. Sie waren eine verschworene Gemeinschaft. Geriet einer von ihnen in Schwierigkeiten, paukte ihn ein anderer wieder heraus. Ebner vermisste diese Männergesellschaft sehr. Die Jungen, seine eigenen Söhne zum Beispiel, hatten andere Interessen. Zwar gingen sie auch zur Jagd, doch in seinen Augen besaßen sie keinen Schneid. Sie schossen wie die Kirchweihschützen und brachten auch noch Frauen mit. Wohlweislich nicht die eigenen. »Bald gibt es niemanden mehr, mit dem ich über die alten Zeiten sprechen kann«, sagte er zu seiner Frau.
Hanna Ebner ging die depressive Haltung ihres Mannes auf die Nerven.
»Was gibt es da noch zu besprechen?«, fragte sie. »Ihr habt euch doch alles schon hundertmal erzählt!« Sie hatte diese Zechkumpane, wie sie die Jagdfreunde ihres Mannes nannte, stets gehasst. »Sie klüngeln wieder etwas aus!«, hatte sie zu ihrem Jüngsten gesagt, der ihr im Laufe der Jahre immer näher stand als ihre anderen Kinder. Am meisten hatte sie die Politiker verachtet. Speichellecker, die nur ihre Wahlkampfkassen füllen wollten. Sie war froh, als ihr Mann schließlich so schlecht sah, dass er einen Treiber nicht von einem Hasen unterscheiden konnte. Danach war er nur noch mit einem ungeladenen Gewehr auf die Jagd gegangen.
»Wozu nimmst du überhaupt noch eine Flinte mit?«, hatte Hanna ihn gefragt.
Er hatte über das Holz seines Gewehrs gestrichen und geantwortet: »Ohne sie würde ich mich nackt fühlen!«
Obwohl Hanna Ebner nur ein paar Jahre jünger war als ihr Mann, war sie noch immer aktiv in ihrem Firmenimperium. Es tat ihr gut, sich jeden Morgen einer neuen Aufgabe zu stellen. Sie fühlte sich stark und hielt die Zügel straff in ihrer Hand. In Gegenwart ihres Mannes allerdings wurde sie unablässig an das eigene Alter erinnert. Nicht dass sie noch einmal das naive, junge Ding von damals hätte sein mögen. Nur sterben wollte sie noch lange nicht. Und hier, in der ehelichen Villa, roch es nach Tod und Verfall. Der Geruch hing in allen Räumen, ein wenig wie Kampfer, gemischt mit säuerlichem Altmännerschweiß, nur notdürftig mit irgendeinem Tannenduft übersprayt. Paul Ebners einst kräftiger Körper war knabenhaft dünn geworden. Die einst strahlenden blauen Augen wurden, als seien sie schon nach innen gerichtet, von einem Schleier überzogen.
»Des Madla kommt«, sagte er zu seiner Frau und hatte bereits vergessen, dass sie es gewesen war, die ihm vom Anruf seiner Tochter erzählt hatte.
»Das wird ja wohl auch Zeit«, sagte Hanna Ebner leise. Ihre Tochter war vor sechsundzwanzig Jahren nach New York gegangen. Im Gepäck ein Baby, das man nur zu gern verschwiegen hätte. Marie hatte sich geweigert, den Vater ihres Kindes zu nennen. Als ihr der Druck der Familie zu groß wurde, war sie nach Amerika gegangen. Nur für das erste Jahr hatte sie Geld vom Vater angenommen. Sie hatte eine Ausbildung als Fotografin gemacht. Ein paar Jahre lang lebte sie auf bescheidenstem Niveau, musste jeden Cent dreimal umdrehen – bis sie ein Foto schoss, das um die Welt ging.
Marie hatte amerikanische Kinder in den Slums der Großstädte fotografiert. Eines dieser Bilder, aufgenommen in Chicago, zeigte einen weißen Halbwüchsigen, der grinsend eine Pistole putzt. »Jugend, weiß, männlich«, hatte die Chicago Tribune darunter geschrieben.
»Jugend, weiß, männlich«, ging um die Welt. Die unbekannte Fotografin bekam einen Vertrag mit der renommierten Fotoagentur Magnum. Damit hatte sie alle Trümpfe für ihre Zukunft in der Hand.
Auch Paul Ebner sah das Foto seiner Tochter.
»Des Madla«, sagte er leise. Unbändiger Stolz und Freude waren in seinem Gesicht zu lesen.
2 Paul II.
Immer wenn Paul Ebner II. Ruhe brauchte, zog er sich in sein häusliches Arbeitszimmer zurück, dessen Tür schalldicht gepolstert war. Nicht einmal die schrille Stimme seiner Frau drang durch diesen Schutzwall. Hier stand auch eine bequeme Liege aus schwarzem Leder, auf der er schon manche Nacht, die er nicht im Ehebett verbringen wollte, geschlafen hat. In diesem Jahr feierte der Senior seinen fünfundachtzigsten Geburtstag. Es würde ein großes Fest werden.
Sein letztes Fest, wie sein Vater behauptete, und wenn Paul sich den rapiden Verfall des Alten ansah, musste er ihm Recht geben. Dennoch wünschte er sich, dass sein Vater noch eine Weile leben würde. Zu viel war noch ungeordnet. Sein Teil des väterlichen Konzerns – des »Gemischtwarenladens«, wie sein Bruder Johannes das riesige Firmengeflecht nannte –, die Stahlwerke in Deutschland und in den USA, liefen zwar hervorragend, doch er misstraute den Brüdern. Paul wusste zu wenig, woran Richard, der Zweitälteste, gerade werkelte. Der Alte hatte ihn, weil er schon als Junge großes technisches Gespür gezeigt hatte, als Vorstand bei den DKW-Werken eingesetzt. Für den Jüngsten, Johannes, hatte der Senior sein Lieblingsspielzeug, das Zeitschriftengeschäft, vorgesehen. Johannes ließ sich am wenigsten in die Karten blicken. Als er vor kurzem zwei private TV-Sender dazugekauft hatte, hatte er sich still und heimlich nur mit dem Alten abgesprochen. Nicht die feine Art, wie Paul II. fand. Überhaupt stanken ihm die Extratouren seines Bruders gewaltig. Wenigstens untereinander sollte ein Mindestmaß an Fairness gelten, fand er.
Im Augenblick hatte der Alte zwar die Zügel noch in der Hand, aber ob er seine verzweigten Geschäfte tatsächlich überblickte, daran zweifelte Paul II. Immer öfter wimmelte ihn der Sekretär seines Vaters ab.
»Ihr alter Herr möchte nicht gestört werden. Er denkt nach!«, hieß es. Ein großer Zorn ergriff Paul dann. Worüber der Vater nachdachte, gerade das wollte er ja wissen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich in Geduld zu üben. Und so ergab es sich unweigerlich, dass er begann über sein Leben nachzudenken.
Seine persönliche Bilanz sah ziemlich düster aus. Zwei Ehen, die eine zu lange in gegenseitiger Abneigung erduldet, die andere im Chaos beendet. Zahlreiche Liebschaften mit unschönem Ausklang. Zwei Kinder, der Sohn harmlos und mäßig begabt, die Tochter eine emotionale Erpresserin. Das Verhältnis zu den Geschwistern konnte schlechter nicht sein. Die Beziehung zu den Eltern war frostig. Er war jetzt achtundfünfzig Jahre alt. Die Zeit, die Restzeit, wie er bitter bemerkte, lief immer schneller ab. Irgendwann würde er, wie der Alte, im Rollstuhl sitzen. Dann, so dachte er, wäre es definitiv zu spät. Paul Ebner II. griff zum Whiskyglas. Das tat er regelmäßig, obwohl er wusste, dass der Alkohol seine Probleme nicht lösen würde. Er musste in seinem Leben einige Dinge ändern. Nur, wo sollte er beginnen?
Sowohl geschäftlich als auch privat herrschte ein beunruhigender Stillstand. Es kam ihm vor, als befände er sich im Auge des Orkans. Eine Bewegung in die falsche Richtung und all die Gebäude, die er über so lange Zeit aufgebaut hatte, würden fortgeblasen werden.
Paul II. war kein ängstlicher Mann. In jungen Jahren hatte er sich geradezu unverwundbar gefühlt. Die Macht des Vaters hatte auf ihn abgefärbt. Sein bulliger Körper war durchdrungen von dem Bewusstsein, dass er zum Siegen geboren wurde. Er war der Älteste der drei Brüder. Die Schwester zählte für ihn nicht. In der Schule war es seine körperliche Kraft gewesen, auf die er stolz war. Später waren es die Weiber, die er aufriss, und in seinen mittleren Jahren die Macht, die ihm allein schon der Name Ebner verlieh. Dennoch schien es ihm jetzt, als habe er bestimmte Sachen aus den Augen verloren.
Es machte ihn unsicher, nicht zu wissen, wonach er suchte. Nicht zu begreifen, wo die Gefahr lauerte. Ob sie aus seiner nächsten Umgebung kam oder aus einer Ecke, die er nicht einmal in seine Überlegungen einbezog. Vielleicht war es auch die Paranoia, die ihn immer häufiger überfiel. Dann schlug er blind um sich, immer in der Furcht einen Gegner, der sich von hinten näherte, zu spät zu bemerken.
Seit zwei Jahren nahm Paul Ebner Antidepressiva. Stimmungsaufheller, nannte er sie. Auch hier wich er der Wahrheit aus. Die Pillen, die er schluckte, galten als wahre Psychohämmer. Er war sorgfältig darauf bedacht, dass niemand davon erfuhr. Oder davon, dass er eine Therapie bei einem Frankfurter Psychiater machte.
Erst nachdem seine Depressionen so schlimm wurden, dass er von Todesfantasien heimgesucht wurde, hatte er diesen Arzt aufgesucht.
Anfangs war es Paul völlig abwegig erschienen, die Hilfe eines Psychiaters in Anspruch zu nehmen. Das ist etwas für Weicheier, sagte er in seinen Jagd- und Saufrunden, wenn das Gespräch auf dieses Thema kam.
Die Adresse des Psychiaters fand er im Branchenbuch. Wen hätte er auch fragen können, ohne Farbe zu bekennen. Paul Ebner junior hatte Glück und landete bei Professor Stark, einer Kapazität auf dem Gebiet der Psychoanalyse.
Eigentlich fehle ihm nichts, sagte er bei seinem ersten Besuch. Nur manchmal diese Stimmungsschwankungen, die würden ihn sehr beunruhigen. Ob es dagegen nicht Pillen gäbe. Er lachte gequält. »Es gibt doch inzwischen für alles die Chemiekeule!«
Der Arzt hatte geantwortet, er könne ihm erst dann etwas verschreiben, wenn er die Ursachen seiner »Stimmungsschwankungen« kenne. Hilflos stotternd hatte Paul versucht die Betonplatten zu beschreiben, die auf seiner Brust zu liegen schienen. Immer wieder hatte er den Professor dabei angeschaut und gesagt: »Sie verstehen. Nichts wirklich Ernstes. Aber lästig, sehr lästig!«
Der Doktor hatte genickt und ihn aufgefordert weiterzusprechen. So war Paul Ebner in eine Therapie geraten. Zweimal wöchentlich fuhr er nach Frankfurt. Zigmal versuchte er diese Sitzungen bei Professor Stark abzubrechen.
»Es hilft doch nichts. Verschreiben Sie mir endlich etwas Stärkeres!«, forderte er immer wieder.
»Sie bekommen schon ein starkes Mittel. Ein stärkeres kann ich nicht verantworten«, sagte der Doktor.
Langsam, ganz langsam spürte Paul Ebner, wie es ihm leichter wurde. Wie er den einen oder anderen Mechanismus in seinem Innern erkannte. Wie ihm Dinge klar wurden, die er jahrelang verdrängt hatte. Obwohl seine Selbstherrlichkeit kaum noch zu steigern war, konnte er nicht ohne Schönfärberei über sich sprechen. Der Professor saß ruhig in einem Sessel und machte sich Notizen. Nur zu gern hätte Paul II sie gesehen. Was denkt der Mensch über mich, überlegte er stets bei der Heimfahrt. Wer bin ich für ihn? Nach und nach merkte Ebner, dass er sogar in diesen Sitzungen, bei einem Mann, der ihm nichts bedeutete, Eindruck schinden wollte. Es ärgerte ihn. Er dachte an den Preis, den er Stunde für Stunde bar bezahlte. Dafür muss ich nicht Männchen machen, entschied er. Diese Einsicht war der erste Erfolg seiner Therapie gewesen.
Inzwischen fuhr er nur noch einmal wöchentlich nach Frankfurt. Er sprach viel von seiner Ehe, die ein qualvolles Nebeneinander geworden war. Von seiner Tochter, die ihm dümmliche Kerle ins Haus brachte, und von seinen Geschäften. Er redete so offen es ihm zum jeweiligen Zeitpunkt möglich war. Sich jedoch restlos zu offenbaren, dagegen sträubte er sich noch immer. Wenn er die Praxis des Professors verließ, hatte er eine entsetzliche Wut auf sich. Was bin ich für ein Waschweib, sagte sich Paul II Was, wenn der Doktor mich eines Tages erpresst? Mit dem, was ich ihm über meine Geschäfte erzähle, könnte er schon auf finstere Gedanken kommen. Es machte ihn rasend, dass er wie ein Süchtiger jede Woche im Frankfurter Westend auftauchte, den Wagen in Nebenstraßen parkte, damit ihn niemand in die weiße Villa gehen sah.
Wenn er mal eine oder zwei Wochen verhindert war, erschienen ihm die Praxisräume, wenn er wiederkam, wie ein sehr vertrauter Ort, den er vermisst hatte. Mittlerweile fragte er nicht mehr, wann die Therapie beendet wäre. Im Gegenteil, manches Mal beschlich ihn die Angst, dass Professor Stark eines Tages sagen würde: Mein lieber Paul Ebner, jetzt kann ich nichts mehr für Sie tun!
Professor Dr. med. Dr. phil. Nepomuk Stark war der erste und einzige Mensch, vor dem er seinen ganzen menschlichen Müll ausbreitete. Es machte ihm nichts aus, von seinem Vater als einem starrköpfigen Greis zu sprechen, über die Liebschaften seiner Mutter herzuziehen und seine beiden Brüder der Dummheit und der bodenlosen Naivität zu bezichtigen. Über die Schwester sprach er nicht. Er hatte sie einfach aus seinem Gedächtnis gestrichen.
Doch trotz der gewissen Erleichterung, die ihm seine Besuche in Frankfurt verschafften, türmten sich die Probleme in beängstigender Zahl vor ihm auf. Über dem Firmenimperium thronte immer noch, wie Gottvater, der Senior. Und zu all den Ungeklärtheiten kam, dass Paul II. ahnte, wie das Testament des Alten aussah. Er würde von seinem Modell »keiner ohne den anderen« niemals lassen. Außerdem spielte seine eigene Familie gerade mal wieder verrückt. Sissi, von der er seit acht Jahren geschieden war, produzierte einen Skandal nach dem anderen. Sie war mit den beiden Kindern nach München gezogen. Paul II. konnte keine Zeitung aufschlagen ohne ihr Foto zu erblicken. Sissi amüsierte sich rund um die Uhr. Hier ein Ladys-Brunch, dort eine Hochzeit und am Abend eine rauschende Party.
Die geschiedene Ebner zeigte Standvermögen.
»Wann kümmert sich deine Ex eigentlich um die Kinder?«, fragte seine Mutter oft.
»Sie weiß einfach net, was sich g’hört«, murmelte der Alte und vergaß dabei, dass er, als sein Körper dazu noch in der Lage war, es selbst am wildesten getrieben hatte.
Doch Sissi Ebner scherte die Franken-Mafia, wie sie die Ebners auch öffentlich nannte, wenig. Sie hatte einige Millionen auf dem Konto und wollte ihr Leben genießen. Die Kinder hatten sich schon längst selbstständig gemacht. »Ich habe keine Lust sie zu gängeln«, erwiderte sie auf die Vorwürfe ihrer Schwiegermutter. »Schließlich bin ich nicht zuletzt deswegen nach München gegangen – um euerem fränkischen Mief zu entgehen!«
Paul II. war Zeuge dieser Szene gewesen. Am liebsten hätte er seiner Ex eine Ohrfeige verpasst, so wie er es während ihrer Ehe öfter getan hatte. Aber er wusste, dass seine Mutter dies nicht goutieren würde. Er beließ es bei diffusen Drohungen. Es kränkte ihn noch immer, dass Sissi ihm keine Träne nachgeweint hatte. Im Gegenteil, obwohl jeder wusste, dass sie ihn auch während ihrer Ehe laufend betrogen hatte, waren nur seine Seitensprünge ein Thema in der Klatschpresse gewesen. Oh, wie er seine Ex hasste. Auch dafür, wie er ihr zu Füßen gelegen hatte. Wie er am Ende ihrer Beziehung um den Sex gebettelt und ihr schließlich für jedes Mal ein neues Schmuckstück hingelegt hatte. Im Bett, das musste er auch heute noch zugeben, war Sissi einsame Klasse. Und dass sie auch mit den Jahren nichts von ihrer Klasse eingebüßt hatte, zeigte sie ihm, wenn ihr gerade der Sinn danach stand, auch heute noch. Wie ein läufiger Dackel erfüllte er ihr danach jeden Wunsch.
Wenn nur die Kinder nicht wären. Paul hatte den Eindruck, dass sie bei seiner Exfrau verkamen. Sein Sohn Paul III., ehemals der ganze Stolz des Großvaters, war inzwischen ein dicklicher junger Mann ohne große Ambitionen. Er würde irgendeinen Job im Ebner-Imperium übernehmen. Aber eben nur irgendeinen.
Die Tochter, so schön wie ihre Mutter, war zwar auch keine Geistesathletin, dafür aber charmant und begehrt. Paul war eifersüchtig auf jeden Mann, der sich ihr näherte. Das ging inzwischen so weit, dass er heimlich eine Detektei beauftragte, wenn Sophie einen neuen Freund hatte.
Verdammte Weiber, fluchte Paul und meinte damit alle Frauen dieser Familie.
3 Richard
Im Inneren des Taxis war die Luft heiß wie in einem Backofen. Es stank nach kaltem Zigarettenrauch. Die Plastikpolster klebten. Richard Ebner kurbelte das Seitenfenster herunter. Mit einem Taschentuch wischte er sich den Schweiß von Gesicht und Nacken. Den letzten Drink hätte ich mir sparen sollen, dachte er. Doch gestern Abend war Richard Ebner nach einem Besäufnis zumute gewesen. Sein Bruder Paul hatte mal wieder den dicken Maxe markiert, hatte im Jagdhaus der Familie herumgetönt, wie groß und mächtig er doch war und was für Arschlöcher all die anderen seien. Richard kotzte diese Nummer an.
»Der hat doch ein Problem«, sagte der Mercedes-Boss neben ihm. Richard hatte nur die Schultern hochgezogen.
»Frag ihn selbst!«, hatte er geantwortet und den letzten Schnaps hinuntergestürzt. Und jetzt dieses ranzige Taxi. Er konnte sich nicht erinnern, dass er jemals so lange vom Flughafen in Marseille bis zum Yachthafen gebraucht hatte. Der Fahrer hatte einen lokalen Musiksender eingestellt. Die Lautstärke malträtierte Richards Trommelfell. In seinem schlechten Französisch versuchte er den Fahrer zu bitten, das Radio leiser zu stellen. Er verstand ihn nicht.
»Nice music«, sagte der Franzose stattdessen und nickte seinem Fahrgast begeistert zu. In der Werft im Yachthafen lag das neue Boot. Heute sollte er es abnehmen. Obwohl Richard von Bordtechnik nichts verstand, wollte er diesen Termin gern wahrnehmen.
Nichts wie weg aus dem Dunstkreis der Familie. Je älter er wurde, desto mehr widerten ihn die sonntäglichen Familienmahlzeiten in der elterlichen Villa in Nürnberg an. Ihm ging die Stadt in ihrer kleinbürgerlichen Enge sehr an die Nieren. Die Franken, so sagte er immer mit einem entschuldigenden Lächeln zu den Besuchern aus Big Apple oder anderen Metropolen, die Franken sind wie ihre Fachwerkhäuser: eng und geduckt. Dass er damit auch über sich selbst sprach, fiel ihm nicht auf. – Richard Ebner hatte vor einem Monat seinen fünfundfünfzigsten Geburtstag gefeiert. Eigentlich hätte seine Motoryacht zu diesem Zeitpunkt schon startklar sein sollen. Sein Plan war es, den ganzen Feierlichkeiten zu entgehen und mit ein paar Freunden die Jungfernfahrt zu machen. Doch es kam anders. Das Boot war nicht bereit, seine Mutter befand, dass ein fünfundfünfzigster Geburtstag in der Familie zu feiern sei. Und was immer die Chefi’ befahl, wurde auch gemacht. Richard konnte sich nicht entsinnen, jemals den Anordnungen der Mutter nicht gefolgt zu sein.
In früheren Jahren hatte sich Richard Ebner vorgestellt, einfach zu verschwinden. Ein bisschen Geld zusammenzuraffen und weit wegzugehen. Ihm hingen die Familientreffen zum Hals heraus. Die Alten waren unerträglich. Zu seinem jüngeren Bruder Johannes hatte er überhaupt keinen Draht. Der umgab sich mit Leuten, von denen Richard immer sagte, man könne sie alle in der Pfeife rauchen.
»Intellektuelles G’schwerl«, befand auch der Alte. Auf jeden Fall hatten sie nicht Richards Wellenlänge. Besser ging es da schon mit dem handfesteren Paul. Der soff und hurte und war auf der anderen Seite ein knochenharter Geschäftsmann. Richard, zeitlebens das mittlere Kind, war nicht so gebildet wie der Kleine und nicht so brutal wie der Erstgeborene. Er bewunderte Paul, Johannes war ihm fremd, und mit Marie gab es ebenfalls kaum Berührungspunkte. Sie war Papas Liebling gewesen. Auch als sie schwanger wurde und niemandem sagen wollte, wer der Vater ihres Ungeborenen war, hielt der Alte zu ihr. So was kann doch passieren, hatte er bei einem Familienessen geraunzt.
»Aber natürlich!«, hatte seine Mutter süffisant geantwortet. »Besonders in dieser Familie!«
»Wozu brauchst jetzt du ein größeres Boot«, hatte der Alte gemurmelt, als Richard von seiner Neuerwerbung gesprochen hatte. »Könntest dir ja gleich einen Flieger kaufen!«
Niemand am Tisch sagte etwas dazu. Tatsache war, dass den Ebners bereits zwei Firmenjets gehörten, der Alte sich aber weigerte davon Kenntnis zu nehmen. »Das ist was für die Großkopferten!«, sagte er. »Die Ebners bleiben auf dem Boden!«
Obwohl sie schon lange zu den reichsten Familien Deutschlands gehörten, wollte Paul I. nichts von dergleichen hören, von neuen Boots-, Flugzeug- oder Villenkäufen. Er wollte, dass es allen gut ginge. Das musste genügen. »Mir san net die Rothschilds oder die Rockefellers. Mir kommen aus Franken und da zeigt mer net her, was mer hat.«
Paul Ebner war der festen Überzeugung, dass es dem lieben Herrgott nicht gefallen würde, wenn seine Familie sich wie Krösus aufführte.
»Neid ist schlimm!«, sagte er. »Und der kommt schnell auf!«
Obwohl Paul Ebner kein gottesfürchtiger Mann war, spendete er viel. Seine Frau Hanna sagte einmal: »Glaubst wohl, dass dein Geld als Ablass für deine Sünden angerechnet wird!« Doch der Alte hatte nur unwirsch den Kopf geschüttelt.
Seine Marotten nahmen immer mehr zu, weshalb die Familie glaubte, dass es für ihn einfach an der Zeit wäre abzudanken. Endgültig das Zepter aus der Hand zu geben. Ihm das zu sagen, hatte bisher allerdings noch niemand gewagt. Dabei wäre das sonntägliche Mittagessen bestens dafür geeignet gewesen. Alle fürchteten den Zorn des Seniors, der immer wie ein Vulkanausbruch über sie kam und nur verbrannte Erde hinterließ. Die Enkel konnten sonderbarerweise sagen, was sie wollten, sie erregten nie den Zorn des Großvaters. Nur leider hatte Richard keine Kinder. Was wiederum auch zu allerlei Schmähungen am Mittagstisch führte.
»Was suchst dir auch für Frauenzimmer aus«, sagte der Vater. »Koa Kinder zu harn gibt’s bei die Ebners net. Schicks doch vorher zum Doktor. Is a gute alte Art sicher zu sein, dass der Stamm erhalten bleibt!«
Dabei war sich Richard Ebner keineswegs sicher, dass es nicht an ihm lag. Wenn er aber sah, was sein Bruder Paul in die Welt gesetzt hatte! Sophie war zwar ein schönes Mädchen, aber die Kerle, die sie anschleppte, waren wahrlich nicht nach dem Geschmack der Familie. Und Paul III. – na ja, auf einen solchen Erben konnte er gut verzichten.
Überhaupt hatte er mit dem Alten eine Rechnung offen. Die Angelegenheit lag zwar schon zwanzig Jahre zurück, weh tat sie aber immer noch.
Vor genau zwanzig Jahren hatte ihm der Senior ein hübsches Mädchen vorgestellt. »Des ist die Martina«, hatte er gesagt und ihr väterlich den Arm getätschelt. »Die Martina muss was lernen. Sie wird bei dir als Sekretärin anfangen!«
Richard Ebner, eben erst mit dem Studium und der Lehrzeit in den DKW-Werken fertig, hatte nichts dagegen einzuwenden gehabt. Martina Sauer, ein für seinen Geschmack etwas zu dralles Ding, bezog sein Vorzimmer. Der Senior hatte genau berechnet, was geschehen würde. Natürlich konnte Richard den schönen blauen Augen nicht lange widerstehen. Aus dem Arbeitsverhältnis wurde ein heftiges »Pantscherl«. Schon nach fünf Wochen behauptete Martina, dass sie schwanger wäre. Richard war für Abtreibung. Martina heulte schrecklich. Wie es der Alte erfuhr, war ihm damals schleierhaft. Auf jeden Fall verdonnerte er den Filius dazu, den angerichteten Schaden wiedergutzumachen.
»Des arme Hascherl«, sagte er. »So was lässt man doch nicht im Stich! Die Familie wird sie vor die Tür setzen. Du heiratest sie!«
Richard wehrte sich nach Kräften. Doch irgendwie verfing bei seinem Vater keines der Argumente. »Wir Ebners«, hieß es, »drücken uns nicht vor der Verantwortung!« Dass seine Tochter Marie, gerade weil sie sich geweigert hatte, ihr uneheliches Kind abtreiben zu lassen, von zu Hause wegging, schien der Alte vergessen zu haben.
Richard Ebner heiratete Martina Sauer. Es war eine kleine Hochzeit. Das Paar bezog eine große Altbauetage in München. Martina richtete das Kinderzimmer ein. Sie lebten damals, wie Richard sich erinnerte, recht harmonisch vor sich hin. Ende des vierten Schwangerschaftsmonats bekam Martina Blutungen. Die Ärzte bemühten sich, aber das Baby war nicht zu retten.
Es dauerte lange, bis Martina den Verlust überwunden hatte. Aber auch Richard hatte sich inzwischen sehr auf das Kind gefreut. Gemeinsames Leid verbindet. Es schien, als würde die Ehe funktionieren. Doch so sehr beide sich bemühten, ein zweites Mal wurde Martina nicht schwanger. Und so richteten sie sich im Laufe der Jahre in einem kinderlosen Leben ein. Aus der Altbauwohnung waren sie in ein komfortables Haus am Starnberger See gezogen. Martina hatte sich einen eigenen Freundeskreis aufgebaut.
»Lauter Weiber, die den lieben langen Tag nix anderes tun als über die grad nicht Anwesenden herzuziehen!«, hatte Richards Mutter einmal abfällig bemerkt. Doch sie tat Martina unrecht. Richards Frau hätte gern wieder gearbeitet.
»Aber als was denn?«, hatte Richard sie kopfschüttelnd gefragt. »Kannst doch als eine Ebner nicht in irgendeinem Vorzimmer sitzen!«
Martina hatte es schließlich akzeptiert. Schlecht ging es ihr ja nun wahrlich nicht. Sie schaffte sich einen Streichelzoo von heimatlosen Tieren an und unterstützte »Greenpeace«.
»Siehst, so findet doch auch ein schlichtes Gemüt eine Aufgabe«, hatte sein Bruder Paul gehöhnt.
Richard war immer seltener ins eheliche Heim gekommen. Er hatte sich in München eine eigene Wohnung zugelegt. Martina sagte nichts dazu. Auf Familienveranstaltungen erschienen sie gemeinsam. Ein in die Jahre gekommenes Paar, das freundschaftlich miteinander umging.
Das Gerede, weshalb er keine eigenen Kinder habe, verstummte allerdings nie. Es ärgerte Richard sehr, wenn er das verlogene Geschwätz seiner Eltern hörte: Nur wer Kinder großgezogen habe, wisse, was es heiße, Verantwortung zu übernehmen.
»Alles was ich im Leben erreicht habe, habe ich nur für meine Kinder getan!«, hatte sein Vater noch vor ein paar Monaten gesagt, ohne vor Scham im Erdboden zu versinken. Damals hätte Richard ihm am liebsten geantwortet:
»So edel bin ich nicht. Ich stehe mir am nächsten und mein Geld gebe ich mit größtem Vergnügen für mich selbst aus!«
Und diese Fahrt jetzt, von der nicht einmal Martina etwas wusste, war für ihn wie ein Befreiungsschlag aus der engen Umklammerung seiner Familie. Niemanden von ihnen würde er je an Bord dieses Schiffes einladen. Dieses Schätzchen würde sein großes Geheimnis sein. Eines für das er ein Vermögen ausgegeben hatte. Sicher so viel, wie ihn zwei oder drei Kinder gekostet hätten. Aber ob diese Kinder ihm auch eine solch große Freude bereitet hätten?
Richard Ebner zog aus seiner Brieftasche ein zerknittertes Foto. Er strich es auf seinem Knie glatt. Wie beim Anblick einer schönen Frau, so verspürte er beim Anblick seines Schiffes ein aufgeregtes Herzklopfen.
»Meine Yacht«, dachte er. »Meine wunderschöne Yacht!«
In der Tat galt die White Heaven III als eine der schönsten Yachten der Welt. Richard Ebner hatte sich in das elegante Stahl- und Aluminiumschiff sofort verliebt. Vor drei Jahren war er bei einem Neffen des Sultans von Brunei zu einem Cocktail an Bord seines neuen Schiffes eingeladen. Die Hoheit, ein ziemlich einfältiger Bursche, hatte den halben Golfclub von Saint Tropez geladen. Ebner, der nichts mehr liebte als Schiffe, ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Die Shalimar war in dieser Nacht die große Attraktion im Yachthafen gewesen. Sie war von Fackeln beleuchtet und mit Tausenden von Lilien geschmückt, und als Haremsdamen verkleidete Kellnerinnen servierten Unmengen von Champagner. Ebner, der sich mit einer blondierten Strandbekanntschaft schmückte, bat den Gastgeber das Schiff besichtigen zu dürfen. Hassan, ein dicklicher Mann Ende zwanzig, zeigte voller Stolz sein neuestes Spielzeug.
»Wollen Sie übermorgen mit uns nach Positano fahren«, fragte er seinen Gast, und der nahm die Einladung an. Es war eine wunderbare Reise. Die Shalimar hatte Eleganz, Speed und lag dennoch ruhig im Wasser. Seit diesem Ausflug interessierte Ebner nur noch das Schiff. Doch selbst für ihn, der viele Millionen auf dem Konto hatte, war der Preis, enorm. Und natürlich spielte der Senior bei seinen Überlegungen eine wichtige Rolle.
Richard Ebner war sich nicht sicher, ob der Alte seine privaten Kontostände überprüfte. Zutrauen würde er es ihm. Also hatte er, um jeder Diskussion zu entgehen, sein geheimes Konto in Liechtenstein geplündert.
Als er jetzt verschwitzt das Taxi vor der Werft verließ, ergriff ihn eine seltsame Erregung. Er stürmte zu Halle 3, wo sie lag, wie er wusste, und blieb dann unvermittelt stehen. Was, wenn sich sein Baby als nicht so perfekt und schön erwies, wie er es sich erträumt hatte?
Doch seine Angst war unbegründet. Die Schöne war prächtiger, als Richard sie in Erinnerung hatte. Er strich ganz sanft über den hellen Lack. Betrachtete sie zärtlich von allen Seiten. Tränen stiegen ihm in die Augen. Und morgen, morgen würde er dabei sein, wenn sie zu Wasser gelassen würde.
Ein solches Glücksgefühl hatte er in seinem Leben vielleicht noch nie verspürt.
4 Franziska
Der Flur der kleinen Dreizimmerwohnung war vollgestopft mit blauen Müllsäcken. Noch nie hatte Franziska so viel Plunder gesehen. Ihre verstorbene Mutter hatte alles aufgehoben, von den Babyschuhen ihrer Tochter bis zum gemalten Muttertagsbild.
Im Wohnzimmer mit der königsblauen Couch und den dazu passenden Sesseln roch es modrig. Ein Alpenveilchen hing verdorrt in seinem Topf, der Fikus hatte die Blätter verloren und in einer Schale auf dem Esstisch faulte eine Orange. Friedhofsgerüche, dachte Franziska. Sie öffnete das Fenster. Auf dem Fensterbrett stand ein Blumenkasten mit verdorrter Erika. Ihre Mutter hatte immer für die Kästen auf dem Balkon und den Fensterbrettern eine Sommer- und eine Winterbepflanzung. Das wirkt doch viel lebendiger, hatte sie stets gesagt. Franziska empfand es einfach als spießig. Zumal keine der Pflanzen die überschwängliche Pflege überstand.
Als sie noch zu Hause lebte, hatte sich Franziska immer gewünscht, dass einer dieser hässlichen Kästen aus dem dritten Stock hinunterfiele. Am besten dann, wenn unten die tratschende Hausmeisterin stand. Dann würde man ihrer Mutter verbieten Kästen auf die Fensterbretter zu stellen.
Die Straße hatte sich kaum verändert. In die Bäckerei war ein Nagelstudio gezogen. Über der ehemaligen Wäscherei hing jetzt das Firmenschild eines Fitnessclubs. Die rachitisch wirkenden Bäume waren kahl. Franziska hatte diese Straße nie gemocht. Als sie fünf Jahre alt war, beschloss die Mutter umzuziehen. Eine Neubauwohnung, hatte sie geschwärmt. Du wirst schon sehen, Wie viel schöner wir es dort haben.
Davon hatte Franziska nichts bemerkt. Für sie wurde alles schwieriger. Schokoladenfinger mussten sofort abgeputzt werden, damit die teuere Tapete nichts abbekam. Die Schuhe blieben vor der Wohnungstür und im Badezimmer herrschte peinlichste Sauberkeit. Franziska trauerte der alten Wohnung und ihren Freunden nach. Jahre später, als viele der Mieter von den Eigentümern auf die Straße gesetzt wurden, sagte ihre Mutter: »Da müssen wir uns wenigstens keine Sorgen machen. Wir können so lange hier wohnen bis wir schwarz werden.«
Das hatte Franziska nicht vor. Als sie das Abitur bestanden hatte, zog es sie nach Heidelberg. In die Wohnung ihrer Mutter war sie nie mehr zurückgekehrt. Mit ihrem ersten selbst verdienten Geld hatte sie die Mutter nach Italien eingeladen. Danach waren sie in Frankreich und Schweden gewesen. Nur nicht nach Nürnberg fahren, dachte Franziska. Sie lud ihre Mutter lieber zu kostspieligen Reisen ein, für die sie das Jahr über eisern sparte.
Jetzt stand sie in dem ganzen Plunder und fragte sich, womit sie es verdient hatte, ihn auch noch sortieren zu müssen.
Während der Chemotherapien war sie zweimal im Krankenhaus gewesen. Sie war erschrocken, wie abgemagert und apathisch die Kranke in ihrem Bett lag. »Es wird schon wieder, Mama«, hatte sie hilflos gesagt. »Du musst nur auch fest dran glauben.«
Auf der Heimfahrt dachte Franziska: Wie soll sie dran glauben, wenn sogar die Ärzte sie aufgegeben haben.
Drei Monate später rief eine Angestellte des Krankenhauses an. »Ihre Mutter ist friedlich entschlafen«, sagte sie.
Franziska wusste, dass von einem friedlichen Tod nicht die Rede sein konnte. Trotzdem war sie erleichtert.
Für die Schwester ihrer Mutter war es selbstverständlich gewesen, dass die Tochter die Wohnung auflösen würde, da Franziska sich, wie sie boshaft anmerkte, sonst schon nie um die Mutter geschert habe.
Franziska hatte sich nach der Beerdigung ein Hotelzimmer gesucht. Nie und nimmer würde sie in der Wohnung übernachten. Alles dort nahm ihr die Luft zum Atmen. Wenn sie das Appartement betrat, hatte sie das Gefühl in eine künstliche Welt zu geraten. Ihre Mutter hatte sich in ihren Traum vom Großbürgertum eingerichtet. Jeder Teppich, jedes Möbelstück, jede Türklinke gaben vor etwas Besseres zu sein. Nichts mit den Fußböden aus Kunststoff und den Türen aus Pressholz zu tun zu haben. Selbst die genormten Fensterstöcke wurden mit üppigen Raffgardinen verhängt. Das Telefon bekam einen mit Goldlitze verzierten Überzug. Die Klopapierrolle hatte ein gehäkeltes Mützchen. Alles wurde ein bisschen hübscher gemacht und so seiner normalen Form und Bestimmung entfremdet. Das galt für die viel zu schweren Brokatschals wie für die in höfischem Gelb gehaltenen Seidentapeten.
Franziska hatte früher nie Schulfreundinnen mit nach Hause gebracht. Sie hatte sich geschämt. Nicht nur weil die Mädchen ihre Schuhe vor der Tür ausziehen mussten.
»Bei euch ist alles so aufgebrezelt!«, hatte ihre damalige beste Freundin gesagt. »Man darf nirgends hinfassen, immer ist deine Mutter da und wischt alles ab!«
Bis heute konnte Franziska dieses dumpfe Gefühl der Wut und der Ohnmacht, das sie damals empfand, nicht vergessen. Sie schüttelte sich, zog einen neuen Müllsack heran und öffnete die Türen des Geschirrschranks. Sammeltassen in ihrer prunkvollen Scheußlichkeit, falsches Meissner und schwere geschliffene Gläser, die ihre Mutter aus Venedig mitgebracht hatte. Ich hätte ihre Schwester fragen müssen, was sie von diesen Dingen haben will, überlegte sie.
Am liebsten hätte sie ein Unternehmen mit der Auflösung des Hausstandes betraut. Abgesehen von ein paar Fotos würde sie sowieso nichts behalten. Warum sie es nicht getan hatte, wusste sie nicht.
Aus der obersten Schublade des verschnörkelten Sekretärs holte sie einen Bogen Papier und einen Kugelschreiber. Ich muss mir einen genauen Plan machen, dachte sie. Sie würde jedes Fach ausleeren und den Inhalt untersuchen müssen. Die Wohnung musste gekündigt, das Bankkonto aufgelöst und etwaige Versicherungen eingesehen werden.
Vielleicht fand sie auch Unterlagen darüber, wer ihr Vater war. Sie nahm an, dass das Geheimnis, von dem ihre Mutter immer gesprochen hatte und schließlich doch nicht preisgegeben hatte, etwas damit zu tun hatte.
Als Kind hatte Franziska die anderen um ihre Väter beneidet. Später dann war dieser Unbekannte nicht mehr so wichtig für sie. Ihre Mutter ließ nie eine Bemerkung über ihn fallen. Weder sagte sie, dass er ein mieser Kerl war und sie verlassen hätte, noch stilisierte sie ihn zu ihrer großen Liebe. Es gab ihn einfach nicht.
Der Inhalt der Schreibtischschubladen gab nicht viel her. Programmhefte von Theaterbesuchen, die Jahre zurücklagen, Kochrezepte, Rechnungen, Fotos und ein Bündel Briefe. In einem kleinen Hefter fand sie Kontoauszüge, ein anderer enthielt Versicherungspolicen und Verträge. Sie würde sich die Sachen im Hotel ansehen.
Was aber sollte sie mit all dem anderen Krempel machen? Kurz entschlossen rief Franziska eine Freundin der Mutter an sowie ihre Tante. Sie sollten sich aussuchen, was sie haben wollten. Danach würde sie die Angelegenheit in die Hände einer entsprechenden Firma geben.
Sie nahm die Einkaufstasche vom Haken an der Küchentür. Sie war groß genug für die Unterlagen aus dem Schreibtisch.
Franziska schloss die Wohnungstür zweimal ab.
Den Weg zum Hotel ging sie zu Fuß. Die Enge und Tristesse der Stadt legten sich auf ihr Gemüt. Der ihr wohlbekannte Fluchtreflex überkam sie. Schnell ins Hotel, einen Tee trinken und die Unterlagen durchsehen, dachte sie. Dann kann ich vielleicht morgen oder übermorgen abfahren.
Franziska leerte den Inhalt der Tasche auf das große Doppelbett. Aus einem Kuvert fielen Fotos. Bilder von ihr, Franziska, mit bockigem Gesicht in einem blauweißen Dirndl. Dann das Foto vom Abschlussball der Tanzschule. Wie eine Quarktasche sah sie mit ihren blonden Haaren und der hellen Haut in dem rosafarbenen Tüllungetüm aus. Damals wäre sie am liebsten zu Hause geblieben, so sehr schämte sie sich für das Kleid. Nur ihre Mutter war entzückt. »Meine Prinzessin«, hatte sie sie genannt. Mit großem Geschick hatte ihre Mutter immer genau die Kleider für sie ausgesucht, die an ihr unmöglich aussahen. Pastellfarbene Twinsets, längsgestreifte Hosen, die ihre ein Meter achtundsiebzig noch besonders betonten. »Hopfenstange«, hatten sie ihre Mitschüler genannt.
»Ach Mama«, seufzte Franziska, »wärst du doch wenigstens in diesen Dingen nicht so verbohrt gewesen! Wir hätten uns so viele Krache erspart.«
Sie legte die Fotos beiseite und nahm sich den Ordner mit den Versicherungen vor. Es gab eine Sterbe- und eine kleine Lebensversicherung. Damit würde sie alle anstehenden Kosten bezahlen können. Zu kündigen gab es nur die Hausratsund die Unfallversicherung. Vergeblich suchte sie nach dem Mietvertrag. Sie fand eine Mitteilung der Hausverwaltung über die Abrechnung der Nebenkosten.
Bei den Rechnungen über Renovierungskosten und den Umbau des Badezimmers lag in einer Klarsichtmappe ein Kaufvertrag. Für 180 000 DM hatte ihre Mutter vor fünfundzwanzig Jahren die Wohnung in der Johannisstraße gekauft. Franziska starrte auf den Vertrag, las wieder und wieder den Namen der Mutter. Damals hatte Irene Mager als Chefsekretärin bei den Nürnberger Nachrichten gearbeitet. Sie hatte gut, aber nicht üppig verdient. Hatte sie das Geld geerbt? Aber von wem? Und warum wusste sie nichts davon?
Franziska blätterte die Kontoauszüge durch. Sie waren vom letzten Jahr. Es gab nichts Ungewöhnliches darin. Dann begann sie die Briefe zu lesen. Es waren Liebesbriefe. Die frühesten waren fünfunddreißig Jahre alt. Der allererste begann mit den Worten: »Mein süßes Rehchen«, und war mit »Dein alter Esel« unterschrieben. Der letzte Brief war erst ein Jahr alt. Es war ein trauriger Brief. Der Schreiber beklagte sich, dass er nichts von ihr, Franziskas Mutter, höre. Er wolle endlich seine Tochter kennen lernen. Weshalb sie ihm das noch immer verwehre? »Ich bin ein alter Mann«, schrieb er, »und muss meine letzten Dinge regeln. Wie kannst du nur so hart sein?« Unterzeichnet war dieser Brief mit »Dein Paul«.
5 Marie
Im Gramercy Park roch bereits die feuchte Erde nach dem kommenden Frühling. Nach einem langen, düsteren Winter wurde es endlich wieder heller in New York. Marie Ebner setzte sich auf eine der Parkbänke und atmete tief durch.
Mit der Rechten fuhr sie sich durch die halblangen, dunkelbraunen Haare. Sie hatte den Eindruck, dass selbst ihr sonst so glänzendes Haar dünn und strähnig geworden war. Seit Wochen fühlte sie sich alt und ausgelaugt. Wenn sie morgens ihr Gesicht im Spiegel betrachtete, entdeckte sie immer mehr Ähnlichkeit mit ihrer Mutter. Meist trug sie dann ganz schnell ein Make-up auf. Die fünfundzwanzig Jahre in New York und der harte Reporterjob der Anfangszeit hatten sie mehr Kraft gekostet, als sie wahrhaben wollte. In den ersten Jahren hatte sie oft an zu Hause gedacht. Hatte sich vorgestellt, wie ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn sie sich damals anders entschieden hätte. Ob sie sich schließlich dem Willen ihrer Mutter gefügt hätte, einen ihrer langweiligen Wunschkandidaten zu heiraten?
Sie lächelte und zündete sich eine Zigarette an. Marie schloss die Augen und sog den Rauch tief in die Lungen. Ihre Mutter war eindeutig der schwierigste Mensch, den sie je in ihrem Leben getroffen hatte. Noch nach fünfundzwanzig Jahren hatte sie ihre zu hohe Stimme ganz genau im Ohr.
»Es ist deine Entscheidung. Niemand zwingt dich nach Amerika zu gehen. Aber du kennst unsere Bedingungen.«