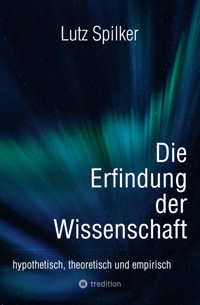
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ist Wissenschaft? Wann begann sie? Und wer entschied, welche Erkenntnisse als wissenschaftlich gelten? Dieses Buch nimmt den Leser mit auf eine faszinierende Reise durch die Geschichte der Wissenschaft – von den ersten naturphilosophischen Überlegungen der Antike über die bahnbrechenden Entdeckungen der Neuzeit bis hin zu den aktuellen Herausforderungen moderner Forschung. Die Wissenschaft wurde nicht an einem bestimmten Tag ›erfunden‹, sondern entstand aus dem menschlichen Bedürfnis, die Welt zu verstehen. Während frühe Kulturen Wissen oft mit Mythen und Religion verknüpften, führten Denker wie Aristoteles, Galileo Galilei und Isaac Newton neue Methoden ein, die unser Verständnis der Natur revolutionierten. Doch Wissenschaft ist nicht gleich Wissenschaft: Manche Erkenntnisse verändern unser Leben sofort, andere bleiben abstrakt und theoretisch. Dieses Buch beleuchtet nicht nur die Entwicklung wissenschaftlicher Methoden, sondern auch die Frage nach der Bedeutung und den Grenzen der Wissenschaft. Ein tiefgehender Blick auf die Evolution des Wissens – spannend, kritisch und inspirierend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eine Betrachtung
von
Lutz Spilker
DIE ERFINDUNG DER WISSENSCHAFT
HYPOTHTISCH, THEORETISCH UND EMPIRISCH
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Softcover ISBN: 978-3-384-55832-9
E-Book ISBN: 978-3-384-55833-6
© 2025 by Lutz Spilker
https://www.webbstar.de
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen denNutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).
Sämtliche Orte, Namen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind daher rein zufällig, jedoch keinesfalls beabsichtigt.
Das Werk einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Reproduktion (auch auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt oder auszugsweise, sind ohne ausdrückliche schriftliche
Genehmigung des Autors oder des Verlages untersagt. Alle Rechte vorbehalten.
Inhalt
Inhalt
Das Prinzip der Erfindung
Vorwort
Die Geburt der Neugier
Die ersten Erklärungsversuche
Muster und Zyklen
Der Beginn des systematischen Denkens
Die Geburt der Wissenschaft aus der Neugier
Von Mythen zur Logik
Wissen in Erzählform
Der Zweifel erwacht
Wissen wird begründet
Die Wissenschaft nimmt Form an
Ein Erbe, das die Welt veränderte
Die ersten Denker
Die Abkehr vom Mythos
Die Suche nach dem Urprinzip
Pythagoras und die Ordnung der Zahlen
Empedokles und die Vier-Elemente-Lehre
Demokrit und die Geburt der Atomtheorie
Die Naturphilosophie als Vorläufer der Wissenschaft
Aristoteles und die Systematisierung des Wissens
Aber mit eigenem Denken
Wissen in Kategorien
Logik als Grundlage wissenschaftlichen Denkens
Empirie und Erfahrung
Der Nachhall von Aristoteles' Denken
Das Vermächtnis des Systematikers
Die Bibliothek von Alexandria
Der Traum vom universellen Wissen
Das größte Wissensarchiv der Antike
Bahnbrechende Entdeckungen und wissenschaftlicher Fortschritt
Mythos und Realität
Das Vermächtnis der Bibliothek
Die islamische Blütezeit
Ein Zentrum des Wissens
Die Erweiterung der antiken Wissenschaften
Die Weitergabe des Wissens an Europa
Warum endete die islamische Blütezeit?
Das Vermächtnis der islamischen Gelehrten
Das Mittelalter
Die Kirche als Bewahrerin und Begrenzung des Wissens
Ein Versuch der Versöhnung
Konflikte zwischen Wissenschaft und Glauben
Die Rolle der arabischen Welt als Vermittlerin
Wissenschaft als eigenständige Disziplin
Ein Zeitalter des Spannungsfeldes
Die Wiederentdeckung antiken Wissens
Der Umbruch in der Wissenschaft
Die größte Revolution der Renaissance
Der Aufstieg der experimentellen Methode
Eine fruchtbare Verbindung
Das Vermächtnis der Renaissance
Galileo Galilei und die Revolution der Methode
Der Aufbruch in eine neue Denkweise
Das Fernrohr und die Entdeckung einer neuen Welt
Experiment und Mathematik
Wissenschaft gegen Dogma
Die Wissenschaft als Methode
Newtons Prinzipien
Der Abschied vom aristotelischen Denken
Mechanik als universelle Sprache
Die Vereinigung von Himmel und Erde
Die Mathematik als Sprache der Natur
Newton und die wissenschaftliche Methode
Der lange Schatten Newtons
Das Vermächtnis einer wissenschaftlichen Revolution
Wissenschaft als Beruf
Die ersten Zentren der Wissenschaft
Die Renaissance und die Emanzipation der Wissenschaft
Die wissenschaftlichen Akademien der Aufklärung
Die Professionalisierung der Wissenschaft im 19. Jahrhundert
Wissenschaft als globales Netzwerk
Chancen und Herausforderungen
Die Aufklärung
Die Geburt eines neuen Denkens
Die Vernunft als Leitprinzip
Ein neues Verständnis von Wissen
Fortschritt und Konflikte
Das Erbe der Aufklärung
Die ›Industrielle Revolution‹
Eine neue Epoche beginnt
Wissenschaft wird zur treibenden Kraft
Neue Materialien für eine neue Zeit
Die zweite Welle der Industriellen Revolution
Die Wissenschaft als Triebkraft wirtschaftlicher Innovationen
Der Mensch im Zeitalter der Wissenschaft
Das Vermächtnis der Industriellen Revolution
Die Entdeckung der Evolution
Eine Reise, die alles veränderte
Die Theorie der natürlichen Selektion
Widerstand und Kontroversen
Die Evolutionstheorie entwickelt sich weiter
Die Natur als Prozess
Eine Wissenschaft, die nie stillsteht
Die Relativitätstheorie
Ein Universum in Bewegung
Die berühmteste Gleichung der Welt
Die Krümmung der Raumzeit
Neue Konzepte von Zeit und Raum
Die Zukunft der Physik
Die Quantenmechanik
Der Zerfall der klassischen Gewissheiten
Ein Universum aus Wahrscheinlichkeiten
Das Ende der klassischen Determinismus
Die Quantenmechanik und ihre Paradoxa
Die Auswirkungen auf Technologie und Wissenschaft
Die offenen Fragen der Quantenmechanik
Das Erbe der Quantenmechanik
Das 20. Jahrhundert
Der Wandel von der Einzelwissenschaft zum Netzwerk der Disziplinen
Von der Quantenmechanik zur Kosmologie
Die Biologie im Zeitalter der Moleküle
Eine neue Denkweise
Menschliches Verhalten unter der Lupe
Die Herausforderung der Ethik und die Verantwortung der Wissenschaft
Ein Jahrhundert des exponentiellen Wissenswachstums
Wissenschaft und Ethik
Die doppelte Natur wissenschaftlicher Entdeckungen
Wissenschaft ohne Grenzen?
Das Dilemma der freien Forschung
Die Rolle der Wissenschaftsethik
Ein Ausblick
Die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft
Warum Vertrauen in die Wissenschaft wichtig ist
Die Ursachen wissenschaftlicher Skepsis
Die Verantwortung der Wissenschaft
Wie Skepsis konstruktiv genutzt werden kann
Ein Balanceakt zwischen Vertrauen und kritischem Denken
Technologische Revolutionen
Der Computer als neues Werkzeug der Wissenschaft
Eine neue Form der Verbreitung
Der nächste Schritt der Wissenschaft?
Die Herausforderungen der digitalen Wissenschaft
Ein neues Zeitalter der Wissenschaft
Das Universum verstehen
Die Geburt der modernen Kosmologie
Ein Universum in Bewegung
Ein Echo des Anfangs
Die unbekannten Kräfte des Universums
Die Suche nach dem endgültigen Modell
Die Zukunft der Kosmologie
Eine Reise ohne Ende
Wissenschaft zwischen Theorie und Praxis
Die Suche nach fundamentalen Prinzipien
Das Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis
Widerstand gegen das Unpraktische
Die Langfristigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse
Warum Wissenschaft abstrakt bleiben muss
Die Bedeutung des Experiments
Die Geburt der experimentellen Methode
Das Experiment als Prüfstein der Wahrheit
Die Reproduzierbarkeit als Gütesiegel der Wissenschaft
Die Grenzen des Experiments
Wissenschaft und Macht
Die historische Verflechtung von Wissenschaft und Macht
Wissenschaft als Treiber militärischer und politischer Strategien
Fortschritt oder Profitstreben?
Die Wissenschaft zwischen Fortschritt und Manipulation
Ein Balanceakt zwischen Erkenntnis und Macht
Der Nobelpreis
Die Geburt eines Mythos
Exzellenz als Maßstab?
Die politische Dimension des Nobelpreises
Ein veraltetes Modell?
Ein Symbol mit Schattenseiten
Das ungelöste Rätsel der Zeit
Ein menschliches Konstrukt?
Ein Schlüssel zur Zeitrichtung?
Ein neues Paradigma?
Kosmologie und die Umkehrung der Zeit
Ein subjektives Phänomen?
Eine offene Frage der Wissenschaft
Die Grenzen des Wissens
Ein wachsender Horizont?
Die Grenzen der empirischen Methode
Gibt es Dinge, die unser Geist nicht begreifen kann?
Das Unentscheidbare und das Unbeweisbare
Jenseits der Wissenschaft?
Das Wissen und seine Schatten
Wissenschaft im 21. Jahrhundert
Ein Fluch und ein Segen
Wissenschaft zwischen Wissen und Handlung
Ein neuer Partner oder eine Bedrohung?
Was wissen wir wirklich?
Offene Fragen und neue Wege
Wissenschaft in einer neuen Ära
Die Zukunft des Wissens
Die Wissenschaft als Fundament der Zivilisation
Die Evolution des Wissens
Die Rolle der Menschheit in der Zukunft der Wissenschaft
Das Erbe der Wissenschaft
Wissen als Verantwortung
Ein nie endender Prozess
Schlussbetrachtung
Die Beständigkeit der Wissenschaft
Die Rolle der Wissenschaft in der Zukunft
Die Verantwortung der Wissenschaft
Ein nie endender Prozess
Über den Autor
In dieser Reihe sind bisher erschienen
Die Wissenschaft hat keine moralische Dimension.
Sie ist wie ein Messer.
Wenn man es einem Chirurgen und einem Mörder gibt,
gebraucht es jeder auf seine Weise.
Wernher von Braun
Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun (* 23. März 1912 in Wirsitz, Provinz Posen, Königreich Preußen, Deutsches Reich; † 16. Juni 1977 in Alexandria, Virginia, USA) war ein deutschamerikanischer Raketenpionier und Wegbereiter der Raketenwaffen und der Raumfahrt.
Das Prinzip der Erfindung
Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.
Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.
Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch sesshaft zu werden. Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.
Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.
Vorwort
Die Wissenschaft ist eine der größten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte. Sie hat unser Weltbild revolutioniert, unsere Lebensweise verändert und unser Verständnis von Realität erweitert. Doch wann begann die Wissenschaft? War es ein einzelner Moment der Erkenntnis oder ein allmählicher Prozess, der sich über Jahrtausende erstreckte? Und vor allem: Was genau ist Wissenschaft? Was unterscheidet sie von anderen Formen des Wissens, von Tradition, Religion oder Philosophie?
Dieses Buch widmet sich einer spannenden Reise durch die Entstehung und Entwicklung der Wissenschaft. Es geht dabei nicht nur um große Entdeckungen und herausragende Persönlichkeiten, sondern auch um die Prinzipien und Methoden, die unser heutiges Wissenschaftsverständnis geprägt haben. Der Titel dieses Werkes, ›Die Erfindung der Wissenschaft‹, mag auf den ersten Blick provozieren – kann etwas so Fundamentales wie Wissenschaft wirklich erfunden worden sein? Die Antwort darauf hängt stark davon ab, wie man Wissenschaft definiert. Während der Mensch schon immer danach strebte, seine Umwelt zu verstehen, war es erst die systematische, methodische Erforschung der Natur, die zur eigentlichen Wissenschaft führte.
Die antiken Hochkulturen sammelten bereits astronomische und mathematische Erkenntnisse, die für ihre Zeit beeindruckend waren. Doch die eigentliche Geburtsstunde der Wissenschaft, so wie wir sie heute kennen, wird oft mit der griechischen Antike assoziiert. Philosophen wie Thales von Milet, Pythagoras oder Aristoteles begannen, Naturphänomene nicht mehr mythologisch, sondern rational zu erklären. Sie suchten nach Gesetzmäßigkeiten, nach wiederholbaren Mustern – eine fundamentale Abkehr von der bis dahin vorherrschenden religiösen Deutung der Welt.
Ein entscheidender Wendepunkt war die wissenschaftliche Revolution im 16. und 17. Jahrhundert, in der sich die moderne Naturwissenschaft etablierte. Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton und viele andere trugen dazu bei, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht mehr nur durch Nachdenken, sondern durch Beobachtung und Experiment gewonnen wurden. Der Bruch mit überlieferten Dogmen war radikal, und die neuen Methoden stellten alte Autoritäten infrage. Die Wissenschaft wurde zu einem dynamischen System, das nicht nur Wissen sammelte, sondern dieses auch kontinuierlich überprüfte und erweiterte.
Doch Wissenschaft ist nicht gleich Wissenschaft. Manche Entdeckungen sind von großer praktischer Relevanz – man denke an die Erfindung des Buchdrucks oder des Telefons –, während andere, wie das Higgs-Boson oder die Quantenmechanik, kaum unmittelbare Auswirkungen auf das tägliche Leben haben. Dies führt zu der spannenden Frage, welche Art von Wissen als wertvoll angesehen wird und warum. Wissenschaft kann sowohl greifbare Innovationen hervorbringen als auch abstrakte Theorien entwickeln, die erst nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten eine praktische Anwendung finden.
Ebenso wichtig wie die Errungenschaften der Wissenschaft sind ihre Grenzen. In einer Welt, in der technologische Fortschritte immer schneller erfolgen, muss sich die Wissenschaft zunehmend mit ethischen Fragen auseinandersetzen. Welche Verantwortung tragen Forscher für ihre Entdeckungen? Wo verlaufen die Grenzen zwischen wissenschaftlichem Fortschritt und gesellschaftlicher Verantwortung? Diese Fragen sind keine Erfindung der Moderne – sie begleiten die Wissenschaft von ihren Anfängen bis heute.
Dieses Buch soll nicht nur informieren, sondern auch zum Nachdenken anregen. Wissenschaft ist nicht statisch, sondern ein Prozess des permanenten Hinterfragens, Testens und Erneuerns. Die Leserinnen und Leser werden eingeladen, mit auf eine Reise zu gehen – eine Reise zu den Ursprüngen der Wissenschaft, zu ihren Prinzipien und Methoden, zu ihren Erfolgen und Herausforderungen. Die Wissenschaft mag sich als disziplinierte Methode präsentieren, doch sie beginnt immer mit einer grundlegenden menschlichen Eigenschaft: Neugier. Und genau diese Neugier ist es, die den Fortschritt antreibt – gestern, heute und in Zukunft.
Die Geburt der Neugier
Frühe Versuche, die Welt zu erklären
Lange bevor die ersten wissenschaftlichen Methoden entstanden, bevor Begriffe wie ›Empirie‹ oder ›Logik‹ existierten, war der Mensch bereits von einer tiefen Faszination für die Welt um ihn herum ergriffen. Die Neugier, diese unstillbare Sehnsucht nach Wissen, scheint eine der grundlegendsten Eigenschaften der Menschheit zu sein. Woher kommt der Regen? Warum leuchten die Sterne? Wieso wechselt die Natur ihre Farben mit den Jahreszeiten? Die Suche nach Antworten auf solche Fragen begann nicht mit Messinstrumenten oder Experimenten, sondern mit Beobachtung, Interpretation und Geschichten.
Die frühen Menschen lebten in einer Welt voller Mysterien. Die Kräfte der Natur waren unberechenbar und allgegenwärtig. Donner grollte aus heiterem Himmel, Feuer wuchs aus einem einzigen Funken, Flüsse schwollen ohne ersichtlichen Grund an. In dieser Umgebung war es nur natürlich, dass der Mensch versuchte, Ordnung in das Chaos zu bringen. Doch anstelle von Messreihen und Hypothesen griffen unsere Vorfahren zunächst zu dem, was ihnen am nächsten lag: ihrer Vorstellungskraft.
Von Mythen und Geistern
Die ersten Erklärungsversuche
Bevor es abstrakte wissenschaftliche Prinzipien gab, dominierten Mythen die Weltanschauung der Menschen. Jede Kultur entwickelte ihre eigenen Erzählungen, um das Unbegreifliche zu erklären. In vielen frühen Gesellschaften wurden Naturphänomene auf das Wirken übernatürlicher Wesen zurückgeführt. Der Wind war kein bloßes Wetterphänomen, sondern der Atem eines Gottes. Die Sonne war kein glühender Feuerball, sondern eine göttliche Gestalt, die auf einem Streitwagen über den Himmel fuhr.
Die Mythen boten den Menschen nicht nur eine Erklärung für die Welt, sondern auch eine moralische Orientierung. Geschichten über wütende Götter, die Fluten entsandten, um die Menschheit für ihre Vergehen zu bestrafen, waren ebenso eine Form der Wissensvermittlung wie eine Warnung. Sie erklärten nicht nur, warum etwas geschah, sondern auch, wie man sich verhalten sollte, um das Wohlwollen der übernatürlichen Mächte zu erhalten.
Die ersten Himmelsbeobachter
Muster und Zyklen
Trotz des dominierenden Einflusses von Mythen waren die frühen Menschen aufmerksame Beobachter ihrer Umwelt. Jäger und Sammler mussten die Wanderungen der Tiere verstehen, um erfolgreich zu jagen, während Bauern den Kreislauf der Jahreszeiten durchschauen mussten, um ihre Felder zur richtigen Zeit zu bestellen. So entstanden erste Muster und Zyklen, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholten – und damit ein Gefühl von Vorhersagbarkeit und Ordnung vermittelten.
Die Astronomie zählt zu den ältesten Formen der Wissenschaft, und viele der frühen Zivilisationen betrachteten den Himmel als eine Art kosmischen Kalender. Die alten Ägypter erkannten, dass das Auftauchen des Sterns Sirius am Horizont mit der jährlichen Nilflut zusammenhing. In Mesopotamien wurden akribische Aufzeichnungen über die Bewegungen der Planeten und Sterne geführt, lange bevor es ein wissenschaftliches Verständnis davon gab. Auch die Maya und Chinesen entwickelten detaillierte Kalendersysteme, um astronomische Ereignisse zu deuten.
Hier zeigt sich ein erster Übergang von rein mythologischen Erklärungen zu systematischer Beobachtung. Während der Himmel für viele noch immer die Wohnstätte der Götter war, wurde er gleichzeitig zur Quelle von Wissen – ein Wandel, der den Keim für die spätere Wissenschaft legte.
Vom Mythos zur Methode
Der Beginn des systematischen Denkens
Mit der Zeit begann sich in einigen Kulturen eine neue Denkweise zu entwickeln. Besonders in der griechischen Antike fand ein Paradigmenwechsel statt: Anstelle von göttlichen Erzählungen rückten rationalere Erklärungen in den Fokus. Thales von Milet, einer der ersten bekannten Philosophen, versuchte, Naturphänomene ohne göttliches Eingreifen zu erklären. Er vermutete beispielsweise, dass Wasser die Ursubstanz sei, aus der alles Leben hervorging – eine Überlegung, die zwar falsch war, aber dennoch einen revolutionären Denkansatz darstellte: den Versuch, die Natur durch Prinzipien statt durch Mythologie zu erklären.
Ein ähnlicher Umbruch vollzog sich in anderen Hochkulturen. In China erarbeiteten Denker Konzepte, die Naturphänomene mit dem Zusammenspiel von Yin und Yang in Verbindung brachten. In Indien entstanden Theorien über die Elemente, die versuchten, die Welt in grundlegende Bestandteile zu zerlegen. Auch in Mesopotamien wurden erste mathematische und medizinische Aufzeichnungen angefertigt, die auf wiederholbare Muster und Erfahrungswerte setzten.
Die Geburt der Wissenschaft aus der Neugier
Was all diesen frühen Kulturen gemein war, war die Neugier – das beständige Bedürfnis, den Dingen auf den Grund zu gehen. Auch wenn viele ihrer Erklärungen aus heutiger Sicht naiv oder unvollständig erscheinen mögen, war ihr Streben nach Wissen der erste Schritt auf dem langen Weg zur Wissenschaft. Ohne diese ersten Versuche, die Welt zu ordnen, hätte sich kein wissenschaftliches Denken entwickeln können.
Die Wissenschaft wurde also nicht an einem bestimmten Tag erfunden, sondern wuchs aus der tiefsten Eigenschaft des Menschen: seiner Fähigkeit, Fragen zu stellen. Ob durch Mythos, Mustererkennung oder erste philosophische Überlegungen – jede dieser Stufen war ein notwendiger Schritt, um das Wissen der Menschheit von einer intuitiven Vorstellung zu einer systematischen Erforschung zu wandeln.
Die Geburt der Neugier war damit der eigentliche Ausgangspunkt der Wissenschaft. Sie war der Funke, der später das Feuer der Erkenntnis entfachte – und bis heute brennt.
Von Mythen zur Logik
Der Übergang vom Glauben zum Wissen
Seit Anbeginn der Menschheit haben sich die Menschen Geschichten erzählt, um die Welt zu erklären. Die Natur schien unberechenbar, und ihre Phänomene – Gewitter, Sonnenfinsternisse, Erdbeben – wurden als das Werk mächtiger Götter oder Geister gedeutet. Mythen waren nicht nur Unterhaltung oder Glaubenssätze, sie waren Erklärungsmodelle, mit denen sich die Menschen ihr Dasein verständlich machten. Doch irgendwann begann sich etwas zu verändern. Die Menschheit stellte fest, dass sich gewisse Phänomene wiederholten, dass Muster existierten, die sich voraussagen ließen. Dies war der erste Schritt auf dem langen Weg von der Mythologie zur Logik, von der Glaubenswelt zur Wissenschaft.
Die Macht der Mythen
Wissen in Erzählform
In frühen Gesellschaften war das Wissen über die Welt nicht in Büchern oder Schriftrollen festgehalten, sondern wurde mündlich weitergegeben. Geschichten dienten als Lehrmittel, um Generationen überlieferte Weisheiten und Warnungen zu vermitteln. Warum gab es Gewitter? Weil der Donnergott zornig war. Warum brachte die Sonne Licht und Wärme? Weil sie ein göttliches Wesen war, das über den Himmel reiste.





























