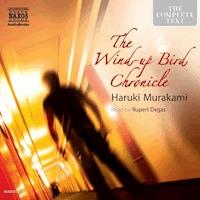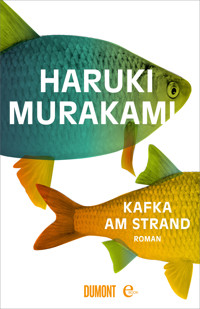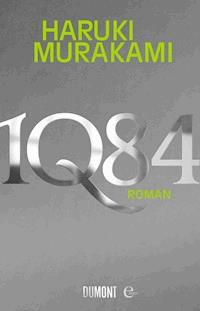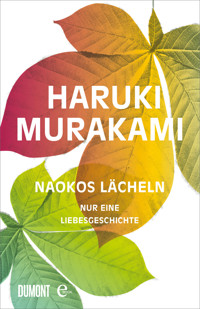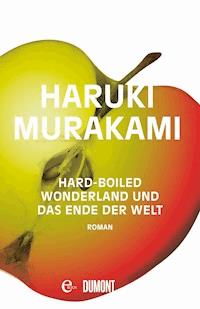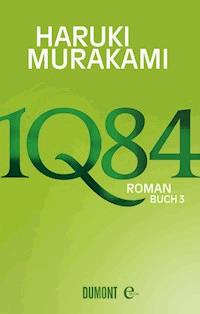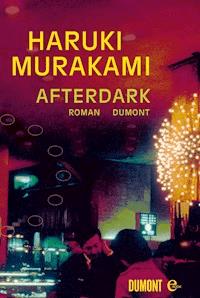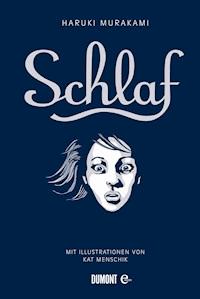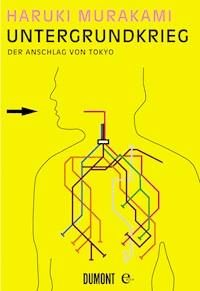9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ermordung des Commendatore
- Sprache: Deutsch
Der Porträtist – und der Abstieg in eine andere Welt. Mit dem Porträt der 13-jährigen Marie wächst allmählich das Selbstvertrauen des jungen Malers in seinen eigenen Stil. Die wiedergewonnene Sicherheit hilft ihm, das Ende seiner Ehe zu verarbeiten. Während der Sitzungen freunden sich das Mädchen und der Maler an. Er ist beeindruckt und erschrocken zugleich von Maries Klugheit und Scharfsinn. Mit ihr kehrt die Erinnerung an seine kleine Schwester zurück, deren Tod er nie überwunden und nach der er in jeder Frau gesucht hat. Auch in seiner eignen, die, wie er erfährt, schwanger ist. Als Marie verschwindet, ist er fest davon überzeugt, dass dies im Zusammenhang mit dem Gemälde ›Die Ermordung des Commendatore‹ steht und dass nur das Gemälde und sein Maler ihm den Weg weisen können, um Marie zu finden. Ein Weg, der in eine andere Welt führt. ›Eine Metapher wandelt sich‹ ist die Fortsetzung von Band 1 ›Eine Idee erscheint‹ des Romans ›Die Ermordnung des Commendatore‹, Haruki Murakamis großem Künstlerroman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mit dem Porträt der 13-jährigen Marie wächst allmählich das Selbstvertrauen des jungen Malers in seinen eigenen Stil. Die wiedergewonnene Sicherheit hilft ihm, das Ende seiner Ehe zu verarbeiten. Während der Sitzungen freunden sich das Mädchen und der Maler an. Er ist beeindruckt und erschrocken zugleich von Maries Klugheit und Scharfsinn. Mit ihr kehrt die Erinnerung an seine kleine Schwester zurück, deren Tod er nie überwunden und nach der er in jeder Frau gesucht hat. Auch in seiner eigenen, die, wie er erfährt, schwanger ist. Als Marie verschwindet, ist er fest davon überzeugt, dass dies im Zusammenhang mit dem Gemälde ›Die Ermordung des Commendatore‹ steht und dass nur das Gemälde und sein Maler ihm den Weg weisen können, um Marie zu finden. Ein Weg, der durch eine Luke in eine andere Welt führt.
›Eine Metapher wandelt sich‹ ist die Fortsetzung von Band 1 ›Eine Idee erscheint‹ des Romans ›Die Ermordung des Commendatore‹.
Credit: © Markus Tedeskino/Ag. Focus
HARUKI MURAKAMI, 1949 in Kyoto geboren, lebte über längere Zeit in den USA und in Europa und ist der gefeierte und mit höchsten Literaturpreisen ausgezeichnete Autor zahlreicher Romane und Erzählungen. Sein Werk erscheint in deutscher Übersetzung bei DuMont. Zuletzt erschienen ›Birthday Girl‹ (2017), illustriert von Kat Menschik, und ›Die Ermordung des Commendatore. Band 1: Eine Idee erscheint‹ (2018).
URSULA GRÄFE,
HARUKI MURAKAMI
DIE ERMORDUNGDES COMMENDATORE
Band 2:EINE METAPHERWANDELT SICH
Roman
Aus dem Japanischenvon Ursula Gräfe
eBook 2018
Die japanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel ›Kishidancho goroshi. Killing Commendatore‹ bei Shinchosha, Tokio.
© 2017 by Haruki Murakami
© 2018 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Ursula Gräfe
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © plainpicture / Bob Olsson – aus der Kollektion Rauschen
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8989-1
www.dumont-buchverlag.de
DIE ERMORDUNGDES COMMENDATORE
Band 2:EINE METAPHERWANDELT SICH
33 SICHTBARES UND UNSICHTBARES
Auch am Sonntag war herrliches Wetter. Es wehte ein leichter, kaum spürbarer Wind, und die herbstliche Sonne brachte das Laub, das die Berghänge in den verschiedensten Farben sprenkelte, wunderschön zum Leuchten. Kleine weißbrüstige Vögel huschten von Ast zu Ast und pickten munter nach den roten Beeren. Ich saß auf der Terrasse und konnte mich an diesem Anblick nicht sattsehen. Die Schönheit der Natur existiert für Reiche und Arme gleichermaßen. Ebenso wie die Zeit … Nein, Zeit ist Geld. Also können Wohlhabende sich ein Mehr an Zeit erkaufen.
Pünktlich um zehn kam der hellblaue Toyota Prius den Hang hinauf. Shoko Akikawa trug einen dünnen beigen Rollkragenpullover und eine schmal geschnittene hellgrüne Baumwollhose. Die goldene Gliederkette um ihren Hals schimmerte dezent. Wie beim ersten Mal war sie nahezu perfekt frisiert. Ihre schwingenden Haare gaben einen Blick auf ihren hübschen Nacken frei. Statt einer Handtasche trug sie heute eine Umhängetasche aus Wildleder über der Schulter und dazu braune Deckschuhe. Ein lässiges, unprätentiöses, doch bis in jedes Detail geschmackvoll zusammengestelltes Outfit. Und ihr Busen hatte wirklich eine schöne Form. Den internen Informationen ihrer Nichte zufolge stopfte sie den BH auch nicht aus. Ich fühlte mich – wenn auch vor allem in ästhetischer Hinsicht – ein wenig zu diesem Busen hingezogen.
Anders als beim letzten Mal war Marie in ihren verwaschenen Bluejeans und den weißen Turnschuhen von Kompass alltäglich gekleidet. Ihre Jeans hatten an einigen Stellen Risse, die natürlich absichtlich dort platziert waren. Sie trug eine dünne graue Sweatjacke und ein dickes Holzfällerhemd, unter dem sich nach wie vor gar nichts wölbte. Und wieder machte sie ein eingeschnapptes Gesicht, wie eine Katze, der man ihr Futter weggenommen hat.
Wie beim ersten Mal goss ich in der Küche schwarzen Tee auf und brachte ihn ins Wohnzimmer. Anschließend zeigte ich den beiden die drei Zeichnungen, die ich in der vergangenen Woche angefertigt hatte. Shoko Akikawa schienen sie zu gefallen. »Sehr lebensecht. Eigentlich werden sie Maries Persönlichkeit besser gerecht als jedes Foto.«
»Kann ich die haben?«, fragte Marie.
»Ja, natürlich«, sagte ich. »Sobald ich das Bild fertig habe, ja? Bis dahin brauche ich sie.«
»Das ist sehr nett von Ihnen … aber macht es Ihnen wirklich nichts aus?«, fragte die Tante mich besorgt.
»Nein«, sagte ich. »Wenn das Gemälde einmal fertig ist, habe ich keine Verwendung mehr dafür.«
»Nach welcher von den dreien werden Sie es malen?«, fragte Marie.
Ich schüttelte den Kopf. »Nach keiner. Diese drei Zeichnungen dienen mir vor allem dazu, ein plastisches Verständnis von dir zu bekommen. Auf der Leinwand werde ich dich vermutlich ganz anders malen.«
»Haben Sie schon eine konkrete Vorstellung?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, noch nicht. Wir beide werden jetzt gemeinsam darüber nachdenken.«
»Über das plastische Verständnis von mir?«, fragte Marie.
»Genau«, sagte ich. »Geometrisch gesehen, ist eine Leinwand nur eine Fläche, aber ein Porträt muss schließlich dreidimensional wirken. Verstehst du?«
Marie runzelte missvergnügt die Stirn. Vielleicht musste sie bei dem Wort »dreidimensional« an ihren nicht vorhandenen Busen denken. Tatsächlich warf sie einen kurzen Blick auf die schön geformten, wohlgerundeten Brüste ihrer Tante unter dem dünnen Pullover und sah erst dann wieder zu mir.
»Wie kommt es, dass Sie das so gut können?«
»Meinst du die Zeichnungen?«
Marie Akikawa nickte. »Ja, zeichnen und skizzieren und so.«
»Durch Übung. Wer viel übt, wird mit der Zeit immer besser.«
»Aber es gibt doch auch Leute, die nicht gut werden, egal, wie viel sie üben.«
Sie hatte natürlich recht. Ich hatte auf der Kunsthochschule eine Menge Kommilitonen gekannt, die so viel üben konnten, wie sie wollten, ohne ein anständiges Bild zustande zu bringen. Vieles hing doch von einer angeborenen Neigung ab, da konnte sich einer abzappeln, so viel er wollte. Hätte ich das jedoch gesagt, hätte das Gespräch sich in eine gänzlich andere Richtung entwickelt.
»Trotzdem geht es ohne Üben nicht. Wenn man nicht übt, kommen auch Begabung und Fähigkeiten nicht richtig heraus.«
Shoko Akikawa pflichtete mir mit einem nachdrücklichen Nicken bei. Marie schürzte nur ein wenig die Lippen, als zweifelte sie an dieser Aussage.
»Du würdest gern gut zeichnen können, nicht?«, fragte ich sie.
Marie nickte. »Mir gefällt Sichtbares genauso wie Unsichtbares.«
In ihren Augen leuchtete ein eigentümliches Licht auf. Ich verstand, was sie sagen wollte. Aber es waren weniger ihre Worte, die mich interessierten, als vielmehr dieses Licht.
»Das ist eine sehr sonderbare Ansicht, nicht?«, sagte Shoko Akikawa. »Du sprichst in Rätseln.«
Marie blickte auf ihre Hände, ohne zu antworten. Als sie kurz darauf wieder aufsah, war das eigentümliche Licht aus ihren Augen verschwunden. Es hatte sich nur einen Moment lang dort gehalten.
Marie und ich gingen ins Atelier. Wie in der letzten Woche nahm Shoko Akikawa ein dickes Buch – dem Aussehen nach vermutlich dasselbe wie zuvor – aus ihrer Tasche, setzte sich aufs Sofa und begann zu lesen. Sie schien völlig vertieft. Diesmal war ich noch neugieriger auf das Buch, aber ich hielt mich zurück.
Der Abstand zwischen Marie und mir betrug auch heute etwa zwei Meter. Nur dass ich diesmal vor der Staffelei mit der Leinwand saß. Aber noch nahm ich Pinsel und Farben nicht zur Hand, sondern schaute zwischen Marie und der leeren Leinwand hin und her. Meine Gedanken kreisten um die Frage, wie ich sie möglichst »plastisch« auf die Leinwand bannen sollte. Ich brauchte eine Art von Geschichte. Ich konnte sie ja nicht einfach so abmalen, wie sie war. So käme kein Werk zustande. Mein wichtigster Ansatzpunkt war, eine Geschichte zu entdecken, die es wert war, gemalt zu werden.
Lange betrachtete ich von meinem Hocker aus das Gesicht Marie Akikawas, die mir gegenüber auf dem Küchenstuhl saß. Sie wich meinem Blick nicht aus und sah mir, fast ohne zu blinzeln, direkt in die Augen. Es war kein herausforderndes Starren, aber es lag so etwas wie der Entschluss darin, nicht nachzugeben. Durch ihr puppenhaftes Aussehen erweckte sie vielleicht einen falschen Eindruck, denn in Wahrheit besaß dieses Kind einen harten Kern. Sie hatte ihre eigene unerschütterliche Art zu handeln. Hatte sie einmal für sich eine gerade Linie gezogen, wich sie nicht so leicht davon ab.
Bei genauem Hinsehen erinnerte mich etwas in Marie Akikawas Augen an Menshiki. Mir war das schon früher aufgefallen, aber nun erstaunte mich diese Gemeinsamkeit aufs Neue. Es war ein eigentümliches Leuchten, das einer momentan zu Eis erstarrten Flamme glich. Mit seinem kalten Feuer ließ es an einen besonderen Edelstein denken, der im Inneren eine Lichtquelle barg. Zwei widerstreitende Kräfte fochten darin einen Kampf aus – ein nach außen gerichtetes freimütiges Wollen und ein nach innen gewandtes Streben nach Vollendung.
Doch vielleicht rührten meine Empfindungen auch daher, dass Menshiki mir anvertraut hatte, Marie Akikawa sei eventuell seine leibliche Tochter, und ich deshalb unbewusst nach Ähnlichkeiten suchte.
Jedenfalls musste mein Bild dieses eigentümliche Licht in ihren Augen einfangen, es als ein Element darstellen, das den Kern ihres Ausdrucks ausmachte. Das die Anmut ihrer Gesichtszüge durchkreuzte und erschütterte. Aber ich vermochte keinen Rahmen innerhalb meines Bildes zu finden, in den es sich eingefügt hätte. Wenn ich ungeschickt vorging, würde ich höchstens die Wirkung eines kalten, leblosen Edelsteins erzielen. Woher stammte die Wärmequelle im Inneren dieses Lichts, und wohin wollte sie? Das musste ich herausfinden.
Nachdem ich ungefähr fünfzehn Minuten zwischen ihrem Gesicht und der Leinwand hin und her geschaut hatte, gab ich auf. Ich schob die Staffelei beiseite und atmete mehrmals tief durch. »Lass uns reden«, sagte ich.
»Gut«, antwortete Marie. »Worüber?«
»Ich möchte noch etwas mehr über dich wissen, wenn es dir recht ist.«
»Was zum Beispiel?«
»Zum Beispiel, was dein Vater für ein Mensch ist.«
Marie verzog ein wenig die Lippen. »Ich kenne ihn nicht sehr gut.«
»Redest du nicht mit ihm?«
»Nein, ich sehe ihn ja auch kaum.«
»Dein Vater ist wohl beruflich sehr eingespannt?«
»Keine Ahnung, was mit seiner Arbeit ist«, sagte Marie. »Aber für mich interessiert er sich ja wohl nicht besonders.«
»Wie meinst du das?«
»Na ja, warum lässt er mich sonst die ganze Zeit bei meiner Tante?«
Dazu konnte und wollte ich mich nicht äußern. »Kannst du dich an deine Mutter erinnern? Du warst sechs, als sie starb, nicht?«
»Ich kann mich daran nur lückenhaft erinnern.«
»Inwiefern lückenhaft?«
»Für mich war meine Mutter auf einmal verschwunden. Damals verstand ich noch nicht, was es bedeutet, wenn ein Mensch stirbt. Also war es für mich, als wäre meine Mutter einfach nicht mehr da. Als wäre sie wie Rauch in irgendeinen Spalt gesogen worden.« Nach kurzem Schweigen fuhr sie fort. »Und wegen dieses abrupten, unerklärlichen Verschwindens kann ich mich nicht erinnern, was vor und was nach ihrem Tod war.«
»Du musst sehr verstört gewesen sein.«
»Die Zeit, in der meine Mutter noch da war, und die, als sie nicht mehr da war, sind wie durch eine hohe Mauer getrennt. Ich kann den Übergang nicht nachvollziehen.« Sie schwieg einen Moment lang und biss sich auf die Lippen. »Verstehen Sie, was ich meine?«
»Ich glaube schon«, sagte ich. »Ich hatte dir doch erzählt, dass meine jüngere Schwester mit zwölf Jahren gestorben ist?«
Marie nickte.
»Sie litt an einem angeborenen Herzfehler. Sie hatte eine große Operation, durch die alles gut werden sollte, aber aus irgendeinem Grund blieb ein Problem bestehen. Sie lebte sozusagen mit einer Zeitbombe in ihrem Körper, weshalb wir täglich mit dem Schlimmsten rechneten. Aber wenn jemand, wie es bei deiner Mutter war, plötzlich an Wespenstichen stirbt, ist das wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel.«
»Ein Blitzschlag …«
»Das sagt man so«, erklärte ich. »Wenn etwas völlig unerwartet geschieht. Jemand wird vom Blitz getroffen, obwohl der Himmel blau ist.«
»Gibt es das wirklich?«
»Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Aber wenn du es wissen möchtest, kannst du es ja zu Hause mal nachschauen.«
»Ein Blitzschlag aus heiterem Himmel«, wiederholte sie, als würde sie diese Redensart in einer Schublade ihres Gedächtnisses ablegen.
»Jedenfalls war der Tod meiner Schwester einigermaßen erwartbar. Doch dann bekam sie ganz plötzlich einen schweren Anfall. Und als sie an dem Tag starb, nützte es uns überhaupt nichts, dass wir eigentlich damit gerechnet hatten. Mich traf buchstäblich fast der Schlag. Und nicht nur mich, der ganzen Familie ging es so.«
»Und hat sich im Vergleich zu vorher etwas in Ihnen verändert?«
»Ja, alles Mögliche in mir und außerhalb veränderte sich vollkommen. Selbst die Art, wie die Zeit verstrich, war ganz anders. So wie du war ich nicht imstande, Vorher und Nachher in Einklang zu bringen.«
Marie sah mich ungefähr zehn Sekunden lang an. »Ihre Schwester war Ihnen sehr wichtig, oder?«
Ich nickte. »Ja, sehr wichtig.«
Marie Akikawa senkte den Blick und dachte intensiv nach. Dann schaute sie wieder auf. »Durch die Kluft, die mit ihrem plötzlichen Tod entstand, kann ich mich nicht mehr richtig an meine Mutter erinnern. Ich weiß nicht, was für ein Mensch sie war, wie sie aussah oder was sie zu mir gesagt hat. Außerdem spricht mein Vater überhaupt nicht von ihr.«
Alles, was ich über Marie Akikawas Mutter wusste, war der Ablauf ihres letzten Geschlechtsverkehrs mit Menshiki, den er mir ziemlich ausführlich geschildert hatte. Er hatte auf dem Sofa in seinem Büro stattgefunden – vermutlich war Marie sogar damals gezeugt worden – und war sehr leidenschaftlich gewesen. Aber das konnte ich ihr natürlich nicht erzählen. »Hast du denn wirklich gar keine Erinnerung an deine Mutter? Immerhin hast du bis zu deinem sechsten Lebensjahr mit ihr zusammengelebt.«
»Nur an den Geruch«, sagte Marie.
»Du erinnerst dich an den Geruch deiner Mutter?«
»Nein, an den Geruch von Regen.«
»Wie das?«
»An dem Tag regnete es. So stark, dass es laut prasselte. Aber meine Mutter machte trotzdem einen Spaziergang mit mir. Hand in Hand und ohne Schirm gingen wir durch den Regen. Ich glaube, es war Sommer.«
»Ein Sommerregen am Nachmittag?«
»Wahrscheinlich. Weil es so stark roch, als der Regen auf den von der Sonne erhitzten Asphalt traf. Ich erinnere mich noch genau an den Geruch. Wir gingen zu einer Art Aussichtsplattform auf einem Berg. Und meine Mutter sang ein Lied.«
»Was für ein Lied?«
»An die Melodie kann ich mich nicht erinnern. Aber an den Text. Er handelte von grünen Feldern, die sich am anderen Ufer eines Flusses erstrecken … Kennen Sie so ein Lied?«
»Nein, ich glaube nicht.« Ich konnte mich nicht erinnern, ein solches Lied schon einmal gehört zu haben.
Marie Akikawa machte eine Bewegung, als würde sie leicht mit den Schultern zucken. »Ich habe schon so viele Leute gefragt, aber niemand scheint dieses Lied zu kennen. Wie kommt das wohl? Ob ich es mir ausgedacht habe?«
»Oder deine Mutter hat es damals erfunden. Für dich.«
Marie sah zu mir auf und lächelte. »Daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber es wäre schön, wenn es so wäre.«
Es war das erste Mal, dass ich sie lächeln sah. Es war, als ob eine dichte Wolkendecke aufreißen und ein Sonnenstrahl hell und warm auf ein auserwähltes Fleckchen Erde fallen würde.
»Würdest du dich an die Stelle erinnern? Wenn du noch einmal zu diesem Aussichtspunkt auf dem Berg kämest?«
»Vielleicht«, sagte Marie. »Aber so sicher bin ich mir da nicht.«
»Wie schön, dass du diese Szene in dir bewahren konntest«, sagte ich.
Marie nickte nur.
Anschließend lauschten Marie Akikawa und ich eine Zeit lang dem Gezwitscher der Vögel. Vor dem Fenster erstreckte sich ein herrlich klarer Herbsthimmel. Keine Wolke war zu sehen. Stumm hingen wir unseren Gedanken nach.
»Was ist denn das für ein Bild? Das umgedrehte dort«, fragte Marie ein wenig später.
Es war das Ölbild des Mannes mit dem weißen Subaru Forester, das ich gemalt hatte (oder zu malen versucht hatte). Es stand mit dem Gesicht zur Wand, damit man es nicht sah.
»Ein Bild, das ich angefangen habe. Ich will einen bestimmten Mann malen. Aber ich habe mittendrin aufgehört.«
»Kann ich es sehen?«
»Meinetwegen. Aber es ist noch nicht viel mehr als ein Entwurf.«
Ich drehte die Leinwand um und stellte sie auf die Staffelei. Marie erhob sich von ihrem Küchenstuhl, ging auf die Staffelei zu und betrachtete das Bild mit verschränkten Armen. Wieder erschien dieses durchdringende Leuchten in ihren Augen. Ihre Lippen hatte sie fest aufeinandergepresst.
Das Gemälde bestand lediglich aus den Farben Rot, Grün und Schwarz, und der Mann, den es darstellen sollte, hatte keine deutlichen Umrisse. Die Kohlezeichnung, die ich von seinem Gesicht angefertigt hatte, war bereits von den Farben verdeckt. Darüber hinaus verweigerte sich das Bild jeglicher Ausarbeitung. Aber ich wusste, dass der Mann sich dort verbarg. Ich hatte den Kern seines Wesens erfasst, hatte ihn wie einen unsichtbaren Fisch mit einem Fischernetz gefangen und eine Methode entdeckt, es einzuholen, aber mein Gegenüber wollte mich an diesem Versuch hindern. Und dieses Gezerre hatte einen Stillstand herbeigeführt.
»Haben Sie hier aufgehört?«, fragte Marie.
»Genau. In dieser Phase des Entwurfs bin ich einfach nicht weitergekommen.«
»Aber es sieht aus, als wäre es fertig«, sagte Marie leise.
Neben ihr stehend, betrachtete ich das Bild aus ihrem Blickwinkel. Hatten ihre Augen den Umriss des Mannes, der sich in der Dunkelheit verbarg, erkannt? »Du meinst, ich bräuchte diesem Bild nichts mehr hinzuzufügen?«, fragte ich.
»Ja, ich glaube, Sie können es so lassen.«
Ich musste schlucken. Denn was sie sagte, entsprach in etwa den Worten des Mannes in dem weißen Subaru Forester. Finger weg von mir. So lassen und nichts mehr hinzufügen.
»Und warum glaubst du das?«, fragte ich weiter.
Sie antwortete nicht gleich. Nachdem sie das Bild noch eine Zeit lang konzentriert gemustert hatte, löste sie die Verschränkung ihrer Arme und legte die Hände an die Wangen, wie um sie zu kühlen. »Es hat so schon genügend Kraft.«
»Was meinst du mit genügend Kraft?«
»Ich habe einfach das Gefühl.«
»Ist es eine ungute Art von Kraft?«
Marie antwortete nicht darauf. Ihre Hände lagen noch immer an ihren Wangen. »Kennen Sie den Mann auf dem Bild gut?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Offen gesagt, kenne ich ihn gar nicht. Ich bin ihm vor Kurzem zufällig auf einer längeren Reise begegnet. Ziemlich weit weg von hier. Geredet habe ich nicht mit ihm. Ich weiß nicht einmal seinen Namen.«
»Ich kann nicht sagen, ob das Bild eine gute oder weniger gute Kraft hat. Vielleicht ist sie mal gut und mal schlecht. Sie scheint sich je nach Blickwinkel zu verändern.«
»Aber du hältst es für besser, dem keine bildliche Form zu geben?«
Sie sah mir in die Augen. »Wenn Sie ihm eine Form geben und etwas Ungutes entsteht daraus, was machen Sie dann? Wenn es nach Ihnen greift?«
Sie hat recht, dachte ich. Wenn etwas Ungutes oder sogar Schlechtes dabei herauskäme und nach mir griffe, was sollte ich dann tun?
Ich nahm das Bild von der Staffelei, drehte es um und stellte es an seinen vorherigen Platz zurück. Kaum war es aus meinem Blickfeld verschwunden, spürte ich, wie die Anspannung nachließ, die bis dahin im Atelier geherrscht hatte.
Ich überlegte, ob ich das Bild vielleicht einpacken und auf dem Dachboden verstauen sollte. Ebenso wie Tomohiko Amada Die Ermordung des Commendatore dort vor den Blicken anderer verborgen hatte.
»Und was hältst du davon?« Ich deutete auf das an der Wand hängende Bild.
»Es gefällt mir«, erwiderte Marie Akikawa ohne Zögern. »Wer hat es gemalt?«
»Tomohiko Amada. Der Besitzer dieses Hauses.«
»Es hat etwas Drängendes. Es kommt mir vor wie ein Vogel, der aus einem Käfig in die Welt hinausmöchte.«
Ich sah sie an. »Ein Vogel? Was für ein Vogel soll das sein?«
»Ich weiß nicht, was für ein Vogel oder was für ein Käfig. Ich kann das nicht richtig beschreiben. Es ist nur so ein Gefühl. Vielleicht ist dieses Bild zu schwierig für mich.«
»Nicht nur für dich. Für mich vermutlich auch. Aber es ist, wie du sagst, der Künstler will dem Betrachter irgendetwas nahebringen, und dieses starke Bedürfnis hat er dem Bild anvertraut. Ich spüre das auch. Aber ich weiß nicht, was er uns mitteilen will.«
»Jemand tötet einen anderen. Mit einem starken Gefühl.«
»Genau. Der junge Mann sticht seinem Gegner aus innerster Überzeugung in die Brust. Derjenige, der getötet wird, scheint auf der anderen Seite völlig überrascht zu sein. Den Leuten um sie herum stockt vor Schreck der Atem.«
»Ist der Mord gerechtfertigt?«
Ich überlegte. »Das weiß ich nicht. Denn was richtig oder falsch ist, hängt von einer vereinbarten Norm ab. Zum Beispiel gibt es eine Menge Leute auf der Welt, die die Todesstrafe für gerechtfertigt halten.« Oder ein Attentat, führte ich den Gedanken fort.
Marie machte eine kleine Pause, bevor sie weitersprach. »Allerdings wirkt dieses Bild nicht bedrückend, obwohl ein Mensch getötet wird und ziemlich viel Blut fließt. Es will mich an einen anderen Ort versetzen. An einen Ort jenseits dieser Normen von Richtig und Falsch.«
An diesem Tag ließ ich den Pinsel ruhen. Marie und ich saßen die ganze Zeit im hellen Licht des Ateliers und unterhielten uns. Dabei speicherte ich jede Veränderung ihrer Mimik und ihre verschiedenen Gesten in meinem Hinterkopf. Ich schuf mir einen Vorrat an Erinnerungen, die sozusagen zu Fleisch und Blut des geplanten Gemäldes werden sollten.
»Jetzt haben Sie heute gar nicht gemalt«, sagte Marie.
»Auch solche Tage gibt es«, erwiderte ich. »Manches ist zeitraubend, manches spart Zeit. Wichtig ist vor allem, die Zeit zu seiner Verbündeten zu machen.«
Sie sah mir wortlos in die Augen, als würde sie durch ein Fenster in das Innere eines Hauses spähen. Sie dachte über die Bedeutung der Zeit nach.
Als um zwölf Uhr der übliche Glockenschlag ertönte, verließen Marie und ich das Atelier, um ins Wohnzimmer zurückzukehren. Shoko Akikawa saß noch immer auf dem Sofa, ihre schwarze Brille auf der Nase, und las in ihrem dicken Taschenbuch. So konzentriert, dass man es sogar an ihrer Atmung merkte.
»Was lesen Sie denn da?«, konnte ich mich nicht beherrschen zu fragen.
»Um ehrlich zu sein, lastet in dieser Beziehung eine Art Fluch auf mir.« Sie lachte verschmitzt, legte ein Lesezeichen in das Buch und klappte es zu. »Wenn ich jemandem den Titel des Buches verrate, das ich gerade lese, schaffe ich es aus irgendeinem Grund nie, es auszulesen. Meist kommt dann etwas Unvorhergesehenes dazwischen, und ich bleibe mittendrin auf der Strecke. Rätselhaft, aber so ist es. Also habe ich beschlossen, niemandem mehr zu verraten, was ich gerade lese. Sobald ich damit fertig bin, sage ich es Ihnen gern.«
»Das genügt mir natürlich. Ich war nur neugierig, weil Sie so vertieft wirkten.«
»Es ist sehr spannend. Wenn man es einmal aufgeschlagen hat, kann man nicht mehr aufhören. Also habe ich beschlossen, nur darin zu lesen, wenn wir zu Ihnen kommen. So vergehen die zwei Stunden wie im Flug.«
»Meine Tante liest sehr viel«, sagte Marie.
»Sonst habe ich ja auch nur wenig zu tun, und Lesen ist im Augenblick meine Hauptbeschäftigung«, sagte die Tante.
»Sie sind nicht berufstätig?«, fragte ich.
Sie nahm die Brille ab und glättete mit den Fingern die Falte zwischen ihren Augenbrauen. »Ich arbeite einmal in der Woche ehrenamtlich in der hiesigen Stadtbibliothek«, sagte sie. »Früher war ich Chefsekretärin an einer privaten medizinischen Hochschule in der Stadt. Aber als ich hierherzog, habe ich gekündigt.«
»Sie sind hierhergezogen, als Maries Mutter starb, nicht wahr?«
»Damals hatte ich die Absicht, nur für eine gewisse Zeit bei den beiden zu wohnen. Bis alles geregelt wäre. Doch als ich wirklich hier mit Marie zusammenlebte, konnte ich nicht mehr gehen. Also wohne ich jetzt dauerhaft hier. Aber sollte mein Bruder wieder heiraten, würde ich natürlich sofort nach Tokio zurückziehen.«
»Und ich würde mitkommen«, sagte Marie.
Shoko Akikawa lächelte nur freundlich und ließ die Bemerkung unkommentiert.
»Wenn es Ihnen recht ist, könnten wir noch zusammen essen«, schlug ich vor. »Ich kann eine Kleinigkeit zubereiten, einen Salat oder eine Pasta.«
Shoko Akikawa zierte sich natürlich, aber Marie schien begeistert von dem Vorschlag. »Ach bitte! Wenn wir jetzt nach Hause fahren, ist Papa doch sowieso nicht da.«
»Es geht auch ganz schnell. Ich habe jede Menge Soße vorgekocht, es macht keinen Unterschied, ob ich sie für einen oder für drei heiß mache«, sagte ich.
»Können wir das wirklich annehmen?«, fragte Shoko Akikawa zweifelnd.
»Natürlich. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich esse doch sonst immer allein. Alle drei Mahlzeiten am Tag. Da sehne ich mich manchmal nach ein bisschen Gesellschaft.«
Marie sah ihre Tante an.
»Dann nehme ich Ihr Angebot gerne an«, sagte Shoko Akikawa. »Aber nur, wenn wir Ihnen wirklich nicht zu viel Mühe machen.«
»Überhaupt nicht«, sagte ich. »Fühlen Sie sich wie zu Hause.«
Damit gingen wir zu dritt ins Esszimmer. Die beiden setzten sich an den Tisch, während ich in der Küche Wasser aufsetzte, die Soße mit Spargel und Bacon in einer Kasserolle erhitzte und aus Eisbergsalat, Tomaten, Zwiebeln und Paprika einen Salat bereitete. Als das Wasser kochte, gab ich die Nudeln hinein und hackte, während sie garten, etwas Petersilie. Ich nahm Eistee aus dem Kühlschrank und schenkte jedem von uns ein Glas ein. Meine beiden Gäste beobachteten erstaunt, wie emsig ich in der Küche herumwirtschaftete. Shoko Akikawa fragte, ob sie mir helfen könne. Es gebe nichts zu helfen, sie sollten nur brav sitzen bleiben, entgegnete ich.
»Sie sind sehr routiniert darin, nicht wahr?«, sagte sie, offenkundig beeindruckt.
»Ich mache das ja jeden Tag.«
Kochen bereitete mir keine Mühe. Ich hatte das schon immer gern getan. Leichte handwerkliche Tätigkeiten wie das Kochen, Fahrradreparaturen und Gartenarbeit lagen mir. Meine Schwäche war das abstrakte und mathematische Denken. Intellektuelle Spiele wie Shogi, Schach oder Puzzles überforderten mein schlichtes Gemüt.
Es wurde ein gemütliches Mittagessen an diesem schönen, klaren Herbstsonntag. Shoko Akikawa erwies sich als perfekter Gast. Die Gesprächsthemen gingen ihr nie aus, sie hatte Humor, war intelligent und interessiert. Ihre Tischmanieren waren untadelig, aber in keiner Weise affektiert. Ihr Verhalten entsprach ganz dem einer Dame aus gutem Hause, die kostspielige Schulen besucht hatte. Marie indessen sagte fast nichts. Sie überließ das Reden ihrer Tante und konzentrierte sich aufs Essen. Zum Schluss ließ Shoko Akikawa sich noch das Rezept für die Soße geben.
Als wir beinahe fertig waren, klingelte es an der Tür. Für mich war es nicht sonderlich schwer zu erraten, wer da klingelte. Kurz zuvor war mir gewesen, als hätte ich das tiefe Brummen des Jaguars – auf meiner Geräuscheskala am entgegengesetzten Ende des leisen Toyota-Prius-Motors – irgendwo auf dem schmalen Grat zwischen bewusst und unbewusst wahrgenommen. Deshalb kam das Läuten für mich keineswegs »aus heiterem Himmel«.
»Entschuldigen Sie mich.« Ich stand auf, legte die Serviette ab und ließ die beiden am Tisch zurück, um zur Tür zu gehen, nicht ahnend, was mich noch erwarten würde.
34 ÜBRIGENS HABE ICH DEN REIFENDRUCK SCHON LÄNGER NICHT GEMESSEN
Als ich die Haustür öffnete, stand Menshiki vor mir.
Er trug eine Wollweste mit einem feinen, eleganten Muster über einem weißen, durchgeknöpften Hemd und ein graues, ins Bläuliche spielendes Tweed-Jackett. Dazu blass senffarbene Chinos und braune Wildlederschuhe. Wie üblich wirkte seine gesamte Garderobe leger und wie für ihn gemacht. Sein volles weißes Haar glänzte in der herbstlichen Sonne vor dem Hintergrund seines silbern schimmernden Jaguars, der nun neben dem blauen Prius parkte. Der Anblick der beiden Wagen nebeneinander rief einen ähnlichen Eindruck hervor wie ein Mensch mit schlechten Zähnen, der beim Lachen den Mund aufreißt.
Wortlos bat ich Menshiki ins Haus. Sein Gesicht wirkte vor lauter Anspannung wie erstarrt und erinnerte mich irgendwie an eine frisch verputzte, noch nicht ganz trockene Wand. Es war das erste Mal, dass ich ihn so sah. Sonst bewahrte er stets kühle Gelassenheit und bemühte sich, seine Gefühle nicht zu zeigen. Nicht einmal nachdem er sich eine Stunde lang in der stockdunklen Steinkammer aufgehalten hatte, war ihm etwas anzumerken gewesen. Aber jetzt war sein Gesicht geradezu kreidebleich.
»Darf ich reinkommen?«, fragte er.
»Natürlich«, sagte ich. »Wir sind gerade beim Essen, aber fast fertig. Bitte, treten Sie näher.«
»Ich will Sie aber auf keinen Fall beim Essen stören«, sagte er. Fast reflexartig sah er auf seine Armbanduhr und starrte unsinnig lange auf das Zifferblatt. Als wäre er nicht einverstanden mit der Art, wie sich die Zeiger bewegten.
»Wir sind gleich fertig. Es war nur ein Imbiss. Trinken Sie doch anschließend Kaffee mit uns. Gehen Sie bitte schon mal ins Wohnzimmer. Ich stelle Ihnen die beiden Damen gleich vor.«
Menshiki schüttelte den Kopf. »Nein, nein, dafür ist es noch zu früh. Ich dachte, sie wären schon gegangen, und wollte Sie besuchen. Ich bin nicht gekommen, um vorgestellt zu werden. Dann sah ich den unbekannten Wagen vor Ihrem Haus und wusste nicht, was ich tun sollte –«
»Die Gelegenheit ist genau richtig«, unterbrach ich seinen Wortschwall. »Wir machen das ganz unverkrampft. Überlassen Sie nur alles mir.«
Menshiki nickte und begann, seine Schuhe auszuziehen, schien aber aus irgendeinem Grund vergessen zu haben, wie das ging. Ich wartete, bis er es geschafft hatte, und führte ihn dann ins Wohnzimmer. Obwohl er schon mehrmals dort gewesen war, schaute er sich neugierig um, als sähe er den Raum zum ersten Mal.
Ich legte ihm sanft die Hand auf die Schulter. »Setzen Sie sich und machen Sie es sich bequem. Wir brauchen höchstens noch zehn Minuten.«
Mit einem etwas mulmigen Gefühl ließ ich Menshiki allein und kehrte ins Esszimmer zurück. Die beiden hatten in meiner Abwesenheit zu Ende gegessen. Die Gabeln lagen auf den Tellern.
»Kommt Ihr Besuch nicht zu uns herein?«, fragte Shoko Akikawa besorgt.
»Nein, aber das ist schon in Ordnung. Ein Nachbar, mit dem ich gut bekannt bin, wollte nur kurz vorbeischauen. Er wartet im Wohnzimmer. Machen Sie sich keine Gedanken. Er ist völlig unkompliziert. Ich kann in Ruhe zu Ende essen.«
Ich aß den spärlichen Rest meines Mittagessens auf, und während die beiden den Tisch abräumten, schaltete ich die Kaffeemaschine ein.
»Wollen wir ins Wohnzimmer umziehen und noch zusammen Kaffee trinken?«, wandte ich mich an Shoko Akikawa.
»Aber Sie haben doch Besuch. Wir wollen nicht stören.«
»Sie stören überhaupt nicht. Es trifft sich sogar gut, so kann ich Sie bekannt machen. Ich sagte zwar, er sei mein Nachbar, aber er wohnt auf der anderen Seite des Tals, also könnte es sein, dass Sie ihn gar nicht kennen.«
»Wie heißt er denn?«
»Menshiki. Men wie in ›vermeiden‹ und shiki wie ›Farbe‹. ›Farbvermeider‹ sozusagen.«
»Was für ein ungewöhnlicher Name«, sagte Shoko Akikawa. »Ich höre ihn zum ersten Mal. Sie haben recht, sobald jemand auf der anderen Seite des Tals wohnt, begegnet man sich kaum, obwohl es nicht weit ist.«
Wir stellten Kaffeetassen für vier, Zucker und Milch auf ein Tablett und brachten es ins Wohnzimmer. Doch zu meinem großen Erstaunen fehlte von Menshiki jede Spur. Das Zimmer war leer. Auch auf der Terrasse und im Bad war nichts von ihm zu sehen.
»Aber wo ist er denn?«, sagte ich zu niemand Bestimmtem.
»War er hier?«, fragte Shoko Akikawa.
»Ja, gerade eben noch.«
Ich ging in den Flur, aber Menshikis Wildlederschuhe waren nicht mehr da. In Hausschuhen trat ich vor die Tür, um nachzusehen. Der silberne Jaguar stand noch an derselben Stelle. Nach Hause gefahren war er also nicht. Die Sonne spiegelte sich in den Fenstern und blendete mich, sodass ich nicht erkennen konnte, ob jemand im Wagen saß. Als ich näher heranging, sah ich, dass Menshiki auf dem Fahrersitz saß und offenbar nach etwas suchte. Ich klopfte leicht gegen die Scheibe. Menshiki ließ sie herunter und blickte mit verzweifelter Miene zu mir auf.
»Was ist denn los, Herr Menshiki?«
»Ich wollte den Reifendruck messen, aber aus irgendeinem Grund kann ich das Messgerät nicht finden. Dabei habe ich es doch immer im Handschuhfach.«
»Ist das denn jetzt so eilig?«
»Nein, eigentlich nicht. Aber als ich auf dem Sofa saß, fiel mir plötzlich ein, dass ich den Reifendruck schon länger nicht gemessen habe.«
»Haben Sie denn etwas Ungewöhnliches an Ihren Reifen festgestellt?«
»Nein, nichts. Die Reifen sind in Ordnung.«
»Dann könnten Sie das mit dem Reifendruck doch vorläufig lassen und wieder ins Wohnzimmer kommen? Ich habe Kaffee gemacht. Die beiden warten.«
»Sie warten?«, krächzte Menshiki. »Auf mich?«
»Ja, ich habe gesagt, dass ich Sie miteinander bekannt machen würde.«
»Ach du meine Güte.«
»Was ist denn?«
»Ich bin darauf gar nicht vorbereitet. Innerlich, meine ich.«
Er machte ein so angstvolles, ja panisches Gesicht wie jemand, der gerade erfahren hat, dass er aus dem sechzehnten Stock eines brennenden Gebäudes in ein Sprungtuch von der Größe eines Bierdeckels springen soll.
»Kommen Sie jetzt«, sagte ich kurz und bestimmend. »Es ist nichts dabei.«
Menshiki nickte stumm, erhob sich aus dem Sitz, stieg aus und schloss die Wagentür. Er wollte sie abschließen, doch dann fiel ihm ein, dass das nicht nötig war (niemand kam je hier herauf), und er steckte den Schlüssel in die Hosentasche.
Shoko und Marie Akikawa erwarteten uns bereits auf dem Sofa. Als wir den Raum betraten, erhoben sie sich höflich. Ich stellte ihnen Menshiki kurz vor. Ein ganz normaler, alltäglicher Vorgang.
»Herr Menshiki war ebenfalls so freundlich, mir Modell zu sitzen. Er hat sich von mir porträtieren lassen. Da er zufällig in der Nachbarschaft wohnt, sind wir seither miteinander bekannt.«
»Wie ich gehört habe, wohnen Sie am gegenüberliegenden Berghang«, sagte Shoko Akikawa.
Als die Rede auf sein Haus kam, erbleichte Menshiki noch mehr.
»Ja, ich lebe seit einigen Jahren dort. Wie viele sind es jetzt? Also, ich glaube, drei. Oder sind es schon vier?«
Er sah mich fragend an, aber ich schwieg.
»Kann man Ihr Haus von hier sehen?«, fragte Shoko Akikawa.
»Ja«, sagte Menshiki und fügte gleich hinzu, es sei nichts Besonderes. »Es ist ausgesprochen unpraktisch dort oben auf dem Berg.«
»Das ist bei uns genauso«, pflichtete Shoko Akikawa ihm liebenswürdig bei. »Das Einkaufen ist beschwerlich. Der Handyempfang ist schlecht, und auch die Radiosender kommen nicht richtig herein. Und wenn es schneit, ist das Autofahren zu gefährlich, weil es so steil ist. Aber glücklicherweise hat es nur vor fünf Jahren einmal stärker geschneit.«
»Ja, in dieser Gegend schneit es kaum«, sagte Menshiki. »Das liegt an den milden Winden vom Meer. Das Meer hat einen sehr starken Einfluss. Es ist nämlich so, dass –«
»Jedenfalls ist es erfreulich, dass es im Winter nicht schneit«, unterbrach ich ihn notgedrungen, denn ich befürchtete, wenn ich ihn ließe, würde er die Auswirkungen der warmen pazifischen Meeresströmungen in aller Ausführlichkeit erläutern.
Marie Akikawa sah zwischen ihrer Tante und Menshiki hin und her. Letzterer schien keinen großen Eindruck auf sie zu machen. Er starrte der Tante ins Gesicht, als würde er persönlich heftig davon angezogen, ohne Marie auch nur eines Blickes zu würdigen.
»Wissen Sie, im Augenblick habe ich nämlich das Vergnügen, Marie zu malen. Ich hatte sie gebeten, mir Modell zu sitzen«, sagte ich an Menshiki gewandt.
»Und ich fahre sie jeden Sonntagmorgen mit dem Wagen her«, fügte Shoko Akikawa hinzu. »Obwohl wir nur einen Katzensprung entfernt wohnen, muss man wegen der Straßenführung einen ziemlichen Umweg machen.«
Endlich sah Menshiki auch Marie an. Doch da sein Blick anscheinend nirgendwo in ihrem Gesicht Halt fand, huschte er hilflos umher wie eine aufgescheuchte Fliege im Winter.
Um ihn aus dieser Lage zu befreien, holte ich mein Skizzenbuch und zeigte es ihm. »Das sind die Zeichnungen, die ich bisher von ihr gemacht habe. Ich bin noch in der Phase des Vorzeichnens und habe noch nicht angefangen zu malen.«
Menshiki betrachtete die drei Zeichnungen so lange, als wollte er sie auswendig lernen. Und als wäre es ihm weit wichtiger, Zeichnungen von Marie anzusehen als sie selbst. Natürlich konnte das nicht sein. Er war einfach nur nicht imstande, sie direkt anzusehen. Die Zeichnungen waren letztlich nicht mehr als Stellvertreter. Da er sich zum ersten Mal in derartiger Nähe zu Marie befand, gelang es ihm wohl nicht, seine Gefühle im Zaum zu halten. Marie folgte den unaufhörlichen Bewegungen in Menshikis Gesicht, als würde sie ein seltenes Tier beobachten.
»Wunderbar«, sagte Menshiki und wandte sich an Shoko Akikawa. »Die Zeichnungen sind sehr lebensecht. Die Ausstrahlung ist hervorragend getroffen.«
»Ja, das finde ich auch.« Maries Tante lächelte.
»Aber Marie ist ein äußerst schwieriges Modell«, sagte ich zu Menshiki. »Sie zu malen ist nicht einfach. Da ihre Mimik ständig wechselt, braucht man Zeit, um zu erfassen, was den Kern ausmacht. Deshalb konnte ich auch noch nicht mit dem Gemälde anfangen.«
»Wieso schwierig?«, fragte Menshiki. Wie geblendet kniff er die Augen zusammen und sah noch einmal in Maries Gesicht.
»Jede dieser drei Zeichnungen gibt einen völlig anderen Aspekt wieder. Jeder winzige Wechsel im Ausdruck verändert komplett ihre Ausstrahlung.«
»Ich verstehe«, sagte Menshiki ergriffen und blickte immer wieder zwischen den drei Zeichnungen und Maries Gesicht hin und her. Währenddessen rötete sich sein bis dahin so blasses Gesicht. Anfangs nur ein kleiner Punkt, erlangte die Röte allmählich die Größe eines Tischtennisballs, dann die eines Baseballs und breitete sich schließlich über das ganze Gesicht aus. Marie beobachtete diesen Wechsel seiner Gesichtsfarbe interessiert. Shoko Akikawa wandte ihren Blick ab, um nicht unhöflich zu sein, während ich nach der Kaffeekanne griff und mir noch einmal einschenkte.
»Ich habe vor, nächste Woche richtig mit dem Bild anzufangen. Das heißt, mit Farbe auf Leinwand zu arbeiten«, sagte ich zu niemand Speziellem, um die Stille zu füllen.
»Haben Sie schon ein bestimmtes Konzept?«, fragte die Tante.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, noch nicht. Wenn ich nicht vor einer echten Leinwand stehe und einen echten Pinsel in der Hand halte, fällt mir nichts Konkretes ein.«
»Sie haben also auch Herrn Menshiki porträtiert, nicht wahr?«, fragte Shoko Akikawa.
»Ja, im vergangenen Monat«, erwiderte ich.
»Es ist ein wunderbares Porträt«, schwärmte Menshiki. »Da die Farben noch trocknen müssen, ist es noch nicht gerahmt, aber es hängt bereits an der Wand meines Arbeitszimmers. Aber das Porträt gibt keinen bestimmten Ausdruck wieder. Ich bin es, aber ich bin es auch nicht. Ich kann es nicht gut beschreiben, aber es ist ein sehr tiefgründiges Bild. Mitunter kann ich meinen Blick gar nicht davon losreißen.«
»Sie sind es, aber Sie sind es auch nicht?«, fragte Shoko Akikawa.
»Es ist eigentlich kein Porträt im landläufigen Sinn, sondern ein Gemälde, das weit mehr innere Tiefe besitzt.«
»Ich würde es gern sehen«, sagte Marie. Es war das erste Mal, dass sie sprach, seit wir ins Wohnzimmer umgezogen waren.
»Marie! Also wirklich! Du kannst dich doch nicht einfach bei jemandem –«
»Das macht überhaupt nichts«, schnitt Menshiki ihr das Wort ab, als würde er es mit einer Axt abhacken. Bei seinem scharfen Tonfall hielten alle einen Moment lang den Atem an.
Nach einer kurzen Pause fuhr er fort. »Besonders, wo wir doch Nachbarn sind. Sie müssen unbedingt vorbeikommen und sich das Bild anschauen. Da ich allein lebe, brauchen Sie nicht zu fürchten, jemanden zu stören. Sie beide sind jederzeit willkommen.«
Menshikis Gesicht war noch röter geworden. Wahrscheinlich hatte er die übermäßige Schärfe in seinem Ton selbst bemerkt. »Sie interessieren sich für Malerei, Marie?«, wandte er sich jetzt an das junge Mädchen. Seine Stimme klang wieder normal.
Marie nickte stumm.
»Wenn dem nichts entgegensteht, würde ich Sie am nächsten Sonntag um die gleiche Zeit wie jetzt hier abholen. Dann fahren wir zu mir und ich zeige Ihnen das Porträt, einverstanden?«
»Das sind doch viel zu viele Umstände …«, sagte Shoko Akikawa.
»Aber ich will das Bild sehen«, bestimmte jetzt Marie in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
Am Ende wurde beschlossen, dass Menshiki die beiden am nächsten Sonntag um die Mittagszeit bei mir abholen würde. Auch ich wurde eingeladen, mitzukommen, lehnte aber höflich ab, indem ich eine Verpflichtung am Nachmittag vorschützte. Ich wollte nicht noch tiefer in diese Sache verwickelt werden. Alles Weitere sollte sich selbst regeln; ich würde mich heraushalten, so gut es ging. Ich vermittelte nur zwischen den Parteien, obwohl ich das ursprünglich gar nicht vorgehabt hatte.
Wie es sich gehörte, begleiteten Menshiki und ich die schöne Tante und ihre Nichte nach draußen. Shoko Akikawa betrachtete interessiert Menshikis neben ihrem Prius parkenden Jaguar, wie eine Hundebesitzerin den Hund einer anderen Person begutachtet.
»Das ist das neueste Modell, nicht wahr?«, fragte sie.
»Ja, Sie haben recht«, sagte Menshiki. »Es ist das neueste Coupé von Jaguar. Kennen Sie sich mit Autos aus?«
»Nein, eigentlich nicht. Allerdings fuhr mein verstorbener Vater früher eine Jaguar-Limousine. Er hat mich häufig darin mitgenommen und mich gelegentlich auch ans Steuer gelassen. Deshalb erfüllt mich der Anblick der Kühlerfigur immer mit Wehmut. Es war ein XJ6 mit doppelten Rundscheinwerfern. Ein 4,2-Liter-Sechszylinder.«
»Serie III, nicht wahr? Ein sehr schönes Modell.«
»Meinem Vater schien der Wagen jedenfalls besonders zu gefallen, denn er fuhr ihn ziemlich lange, auch wenn er den hohen Kraftstoffverbrauch und die Vielzahl der kleinen Reparaturen manchmal satthatte.«
»Ja, das Modell hatte einen zu hohen Verbrauch. Wahrscheinlich gab es auch einige Mängel an der Elektronik. Die ist bei Jaguar traditionell nicht sehr robust. Aber wenn er ohne größere Pannen läuft und einem der Benzinpreis nichts ausmacht, ist es noch immer ein wunderschönes Automobil. Auch Handhabung und Fahrkomfort sind unübertrefflich, da kann kaum ein anderer Wagen mithalten. Aber ein zu hoher Kraftstoffverbrauch und große Pannenanfälligkeit stören die meisten Menschen, weshalb sich auch der Toyota Prius so gut verkauft.«
»Den hat mein Bruder für mich gekauft. Ich hätte ihn nicht genommen«, sagte Shoko Akikawa und deutete beinahe entschuldigend auf den Toyota. »Aber er fährt sich leicht, ist sicher und außerdem gut für die Umwelt.«
»Der Prius ist ein exzellenter Wagen«, sagte Menshiki. »Tatsächlich habe ich selbst schon einmal ernsthaft erwogen, mir einen zu kaufen.«
Ob das stimmte? Insgeheim bezweifelte ich es. Ich konnte mir Menshiki partout nicht in einem Prius vorstellen, ebenso wenig wie ich mir vorstellen konnte, dass ein Leopard in einem Restaurant einen Salad Niçoise bestellte.
Shoko Akikawa spähte ins Innere des Jaguars. »Ich habe eine ziemlich zudringliche Bitte. Dürfte ich mich einmal für einen Moment in Ihren Wagen setzen? Ich würde gern den Fahrersitz ausprobieren.«
»Aber selbstverständlich«, sagte Menshiki und räusperte sich ein wenig, um seiner Stimme einen festen Ton zu geben. »So lange Sie möchten. Wenn Sie Lust haben, können Sie auch eine Runde drehen.«
Shoko Akikawas großes Interesse an Menshikis Jaguar schien mir ungewöhnlich. Mit ihrem sanften und adretten Auftreten wirkte sie überhaupt nicht wie der Typ, der sich für Autos interessiert. Dennoch stieg sie mit glänzenden Augen in den Jaguar, rückte sich den mit cremefarbenem Leder bezogenen Sitz zurecht, betrachtete das Armaturenbrett eingehend und legte beide Hände auf das Lenkrad. Dann umfasste sie mit der Linken den Schaltknüppel. Menshiki zog den Wagenschlüssel aus der Hosentasche und reichte ihn ihr. »Lassen Sie doch mal den Motor an.«
Shoko Akikawa nahm den Schlüssel wortlos entgegen, steckte ihn in das Zündschloss neben dem Lenkrad und drehte ihn im Uhrzeigersinn. Die große Raubkatze erwachte sofort, und Shoko lauschte eine Zeit lang verzückt ihrem tiefen Grollen.
»Ich erinnere mich genau an das Geräusch dieses Motors«, sagte sie.
»Ein 4,2-Liter-V8-Motor. Der XJ6, den Ihr Herr Vater fuhr, war ein Sechszylinder, das heißt, Umdrehungszahl und Verdichtungsverhältnis sind verschieden, aber er klang wahrscheinlich ganz ähnlich. Was die bedenkenlose und verschwenderische Verbrennung von fossilen Brennstoffen angeht, handelte es sich damals wie heute um ein sündhaftes Vergnügen.«
Shoko Akikawa schob den Blinkerhebel nach oben und blinkte rechts. Das charakteristische, fröhliche Klacken ertönte. »Klingt nostalgisch.«
Menshiki lächelte. »So klingt es bei keinem anderen Wagen.«
»Als ich jung war, habe ich heimlich mit dem XJ6 für den Führerschein geübt«, sagte sie. »Die Handbremse ist etwas anders als normal, deshalb fand ich sie nicht, als ich das erste Mal einen anderen Wagen fuhr. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte.«
»Ich verstehe, was Sie meinen«, sagte Menshiki und lächelte. »Die Engländer sind in manchen Dingen recht eigen.«
»Aber in Ihrem Wagen riecht es anders als in dem meines Vaters.«
»Ja, bedauerlicherweise. Offenbar kann man aus verschiedenen Gründen nicht mehr die gleichen Materialien für das Interieur verwenden wie früher. Besonders seit die Firma Connolly 2002 in Konkurs gegangen ist und das Leder nicht mehr von ihr kommt, hat sich der Geruch im Wageninneren völlig verändert.«
»Wie schade. Ich mochte diesen Geruch sehr. Er gehört zu den Erinnerungen an meinen Vater.«
»Offen gesagt, habe ich noch einen anderen alten Jaguar«, sagte Menshiki, als fiele es ihm schwer. »Es könnte sein, dass er den gleichen Geruch verströmt wie der Wagen Ihres Herrn Vaters.«
»Sie haben einen XJ6?«
»Nein, einen E-Type.«
»Ist es ein offener Wagen?«
»Genau. Es ist der Roadster der Serie I. Er wurde Mitte der 1960er gebaut, zieht aber noch hervorragend. Er hat auch einen Sechszylinder-4,2-Liter-Motor. Ein Original-Zweisitzer. Allerdings ist das Verdeck neu, weshalb man ihn nicht im eigentlichen Sinn als Original bezeichnen kann.«
Da ich keine Ahnung von Autos hatte, verstand ich so gut wie nichts von dem Gesagten, aber Shoko Akikawa schien diese Mitteilung sehr zu beeindrucken. Ungemein erleichternd fand ich jedoch die Entdeckung, dass die beiden ein gemeinsames Interesse an Fahrzeugen der Marke Jaguar hatten, auch wenn das ein ziemlich eingeschränktes Gebiet war. Wenigstens musste ich mir keine Gesprächsthemen für diese erste Begegnung aus den Fingern saugen. Marie schien noch weniger Interesse an Autos zu haben als ich und hörte dem Gespräch mit einem Ausdruck äußerster Langeweile zu.
Shoko Akikawa stieg aus dem Wagen, schlug die Tür zu und gab Menshiki den Schlüssel zurück. Menshiki nahm ihn und steckte ihn wieder in die Hosentasche. Daraufhin setzten Marie und ihre Tante sich in den blauen Prius, und Menshiki schloss die Tür hinter Marie. Wieder beeindruckte es mich, wie sehr sich das Geräusch des Zuschnappens von dem des Jaguars unterschied. Ein Beispiel dafür, wie viele unterschiedliche Geräusche es auf der Welt gab. So wie es bei Charlie Mingus und Ray Brown vollkommen verschieden klingt, wenn sie nur einmal die gleiche Leersaite beim Kontrabass anschlagen.
»Also dann bis nächsten Sonntag«, sagte Menshiki.
Shoko Akikawa lächelte ihm zu, umfasste das Steuer und fuhr los. Als das Heck des etwas plumpen Prius nicht mehr zu sehen war, gingen Menshiki und ich ins Haus zurück, um im Wohnzimmer unseren inzwischen ziemlich abgekühlten Kaffee zu trinken. Eine Zeit lang sagten wir nichts. Alle Kraft schien aus Menshikis Körper gewichen zu sein wie bei einem Läufer, der nach einem kräftezehrenden Langstreckenlauf durchs Ziel gegangen ist.
»Sie ist hübsch, nicht?«, sagte ich wenig später. »Marie Akikawa, meine ich.«
»Ja, das ist sie, nicht wahr? Wenn sie erwachsen ist, wird sie noch hübscher sein«, sagte Menshiki, obwohl er an etwas ganz anderes zu denken schien.
»Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie sie so aus der Nähe sahen?«, fragte ich.
Menshiki lächelte unbehaglich. »Ehrlich gesagt, habe ich sie gar nicht richtig gesehen. Weil ich so aufgeregt war.«
»Aber ein bisschen konnten Sie sie doch betrachten, oder?«
Menshiki nickte. »Ja, natürlich.« Wieder schwieg er, bedachte mich aber plötzlich mit einem sehr ernsthaften Blick. »Und was denken Sie?«
»Was denke ich worüber?«
Menshiki errötete erneut. »Gibt es eine Ähnlichkeit zwischen ihr und mir? Sie sind Maler, Porträtieren ist nicht erst seit gestern Ihr Beruf, da müssen Sie so etwas doch erkennen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ja, sicher bin ich darin geübt, Übereinstimmungen in Gesichtern ziemlich schnell zu erfassen. Aber deshalb kann ich noch lange nicht analysieren, wer ein Kind von wem ist. Es gibt Eltern und Kinder, die sich nicht im Geringsten ähneln, aber völlig Fremden geradezu aus dem Gesicht geschnitten sind.«
Menshiki stieß einen tiefen, sich scheinbar seinem ganzen Körper entringenden Seufzer aus und rieb die Handflächen aneinander. »Ich bitte Sie doch nur um eine Einschätzung, um Ihren persönlichen Eindruck. Er kann ruhig oberflächlich sein. Bitte sagen Sie es mir, falls Ihnen etwas aufgefallen ist.«
Ich überlegte. »Zwischen Ihren Gesichtszügen besteht keine konkrete Ähnlichkeit, so viel kann ich Ihnen sagen. Allerdings hatte ich hin und wieder den Eindruck einer gewissen Gemeinsamkeit im Ausdruck Ihrer Augen.«
Er presste die Lippen zusammen und sah mich an. »Zwischen unseren Augen gibt es also eine Gemeinsamkeit?«
»Bei Ihnen zeigen sich die Gefühle vor allem im Blick. Verschiedene Regungen wie Neugier, Begeisterung, Erstaunen, Zweifel, Widerstand und so weiter bilden sich in Ihren Augen ab. Ihre Mimik an sich ist nicht ausdrucksvoll, stattdessen fungieren die Augen als eine Art Fenster zur Seele. Anders, als das normalerweise der Fall ist. Bei den meisten Menschen sind die Augen nicht so lebendig, auch wenn die Mimik sehr ausgeprägt ist.«
Menshiki wirkte erstaunt. »Man sieht mir Dinge also an den Augen an?«
Ich nickte.
»Das war mir nicht bewusst.«
»So etwas kann man nicht kontrollieren, selbst wenn man es wollte. Je bewusster jemand seinen Ausdruck zu beherrschen versucht, desto stärker konzentrieren sich die Empfindungen auf die Augen. Aber das erkennt man nur bei sehr aufmerksamer Beobachtung. Für gewöhnlich bemerkt das vermutlich niemand.«
»Aber Sie haben es bemerkt.«
»Den Ausdruck von Menschen zu erfassen ist sozusagen mein Metier.«
Menshiki dachte einen Augenblick lang nach. »Marie und ich gleichen uns also in diesem Punkt, und dennoch weist das für Sie nicht unbedingt auf eine Blutsverwandtschaft hin?«
»Wenn ich mir einen Menschen ansehe, habe ich stets einige Eindrücke, die im Hinblick auf sein Porträt besonders wichtig für mich sind. Aber Eindrücke und objektive Tatsachen sind etwas sehr Verschiedenes. Eindrücke beweisen gar nichts. Sie haben keinen praktischen Nutzen, wie zarte Schmetterlinge im Wind. Und Sie? Haben Sie bei Ihrer Begegnung mit Marie etwas Besonderes empfunden?«
Er schüttelte den Kopf. »Aus einer so kurzen Begegnung lässt sich nichts schließen. Ich brauche viel mehr Zeit. Ich muss mich an das Zusammensein mit dem jungen Mädchen gewöhnen …«
Er schüttelte noch einmal langsam den Kopf, steckte beide Hände wie suchend in die Taschen seines Jacketts und zog sie wieder heraus, als hätte er vergessen, was er überhaupt gesucht hatte. »Oder nein, wahrscheinlich ist es keine Frage der Häufigkeit«, fuhr er fort. »Je öfter ich sie sehen würde, desto größer würde meine Verwirrung, sodass ich zu überhaupt keinem Schluss gelangen könnte. Möglicherweise ist sie meine leibliche Tochter, möglicherweise auch nicht. Im Grunde spielt das keine Rolle. Allein wenn ich beim Anblick dieses jungen Mädchens an die Möglichkeit denke, sie in meiner Vorstellung mit dem Finger berühre, ist es, als könnte ich dadurch frisches Blut durch meinen ganzen Körper pumpen. Vielleicht hatte ich bisher den Sinn des Lebens nicht richtig verstanden.«
Ich hielt den Mund. Zu den Regungen von Menshikis Herzen oder seiner Definition von Leben hatte ich nicht ein Wort zu sagen. Er warf einen Blick auf seine schmale, teuer aussehende Uhr und rappelte sich ungelenk vom Sofa hoch.
»Ich muss Ihnen danken. Hätten Sie mir nicht den Rücken gestärkt, wäre ich aufgeschmissen gewesen.«
Mehr sagte er nicht, bevor er mit steifen Schritten in den Flur stakste, sich langsam die Schuhe anzog, sie zuschnürte und hinausging. Ich beobachtete vom Eingang aus, wie er in sein Auto stieg und davonfuhr. Als der Jaguar verschwunden war, kehrte wieder sonntägliche Stille ein.
Es war kurz nach zwei Uhr nachmittags. Ich war ziemlich erledigt, also holte ich mir eine alte Wolldecke aus dem Schrank, wickelte mich darin ein, legte mich aufs Sofa und schlief ein Weilchen. Es war erst kurz nach drei, als ich aufwachte. Das Sonnenlicht, das ins Zimmer fiel, war kaum gewandert. Was für ein sonderbarer Tag. Ich konnte nicht entscheiden, ob ich mich vor- oder zurückbewegt oder ein und dieselbe Stelle umkreist hatte. Mein Orientierungssinn war völlig durcheinander. Marie und Shoko Akikawa und Menshiki. Von den dreien beziehungsweise von jedem einzelnen der drei ging eine magnetische Anziehungskraft aus. Ich stand umgeben von ihnen in der Mitte. Ohne jegliche Anziehungskraft.
Doch ungeachtet meiner Müdigkeit war dieser Sonntag noch nicht zu Ende. Es war ja erst drei Uhr nachmittags, und die Sonne ging noch längst nicht unter. Es würde noch dauern, bis morgen ein neuer Tag anbräche und dieser Sonntag Vergangenheit sein würde. Dennoch konnte ich mich zu nichts aufraffen. Auch nach meinem kurzen Mittagsschlaf fühlte ich mich noch benommen. Als wäre ich ein altes Wollknäuel, das jemand mit Gewalt in eine zu flache Schreibtischschublade gestopft hatte, die deshalb nicht richtig schloss. Vielleicht sollte ich heute einmal meinen Reifendruck prüfen. Wenn der Mensch sich zu nichts aufraffen kann, sollte er wenigstens den Reifendruck überprüfen. Doch genau besehen, hatte ich diese Aufgabe noch kein einziges Mal in meinem Leben selbst übernommen. Mitunter wies ein Tankwart mich darauf hin, dann ließ ich ihn messen. Natürlich war ich auch nicht im Besitz eines Reifendruckmessers. Ich wusste nicht einmal, wie ein solches Gerät aussah. Aber besonders groß konnte es nicht sein, da es offenbar in ein Handschuhfach passte. Und wahrscheinlich auch nicht so teuer, dass man einen Ratenkauf hätte in Erwägung ziehen müssen. Also nahm ich mir vor, demnächst eines zu erwerben.
Als es dunkel wurde, ging ich in die Küche und machte mir etwas zu essen. Dabei trank ich ein Dosenbier. Ich grillte mir eine in Sake-Treber eingelegte japanische Bernsteinmakrele, hackte etwas eingelegtes Gemüse und machte dazu einen Gurken- und Wakame-Salat in Vinaigrette und eine Miso-Suppe mit Rettich und gebratenem Tofu. Schweigend aß ich. Es war ja auch niemand da, mit dem ich hätte reden können, und mir wäre ohnehin kein Gesprächsthema eingefallen. Ich hatte mein einsames, stummes Mahl noch nicht beendet, als es klingelte. Fast so, als hätte der Besucher eigens abgewartet, bis ich beim Essen war.
Der Tag ist noch nicht vorbei, dachte ich. Aber ich hatte ja damit gerechnet, dass es ein langer Sonntag werden würde. Ich erhob mich vom Tisch und ging langsam zur Tür.
35 MAN HÄTTE BESSER ALLES SO GELASSEN, WIE ES WAR
Ich schritt also zur Tür, ohne die geringste Ahnung zu haben, wer da läutete. Es war auch kein Wagen vorgefahren, das hätte ich gehört. Das Esszimmer lag zwar nach hinten, doch es war ein sehr ruhiger Abend, und das Knirschen von Reifen und ein Motor wären auf jeden Fall zu hören gewesen, selbst wenn es sich um den wegen seiner geringen Geräuschentwicklung vielgepriesenen Hybridmotor des Toyota Prius gehandelt hätte. Aber ich hatte nichts dergleichen vernommen.
Und wer sollte schon nach Sonnenuntergang zu Fuß hier heraufsteigen? Der Weg war lang und steil. Auf der so gut wie unbeleuchteten Straße war es viel zu dunkel, und niemand war unterwegs. Und da die Häuser in großen Abständen an die einsamen Hänge gebaut waren, hatte ich natürlich auch keine direkten Nachbarn.
Wer konnte es also sein? Vielleicht der Commendatore? Aber der kam eigentlich nicht infrage. Schließlich konnte er jetzt jederzeit und von überall ins Haus gelangen, ohne eigens an der Tür klingeln zu müssen. Ich öffnete.
Marie Akikawa stand davor. Sie sah genauso aus wie am Vormittag, trug jedoch eine dunkelblaue, dünne Daunenjacke über ihrer anderen. Nach Sonnenuntergang kühlte es hier merklich ab. Sie hatte eine Baseballkappe mit einem Emblem der Cleveland Indians auf dem Kopf (warum eigentlich Cleveland?) und hielt in der Rechten eine große Taschenlampe.
»Darf ich reinkommen?«, fragte sie, ohne mir einen guten Abend zu wünschen oder sich für ihr plötzliches Auftauchen zu entschuldigen.
»Natürlich. Komm rein«, sagte ich nur, denn die Schublade in meinem Kopf klemmte noch immer wegen des Wollknäuels.
Ich führte sie ins Esszimmer. »Ich war gerade beim Essen. Macht es dir etwas aus, wenn ich zu Ende esse?«
Sie schüttelte den Kopf. Offenbar hatte dieses junge Mädchen keinen Begriff von den allgemein üblichen Umgangsformen.
»Möchtest du einen Tee?«, fragte ich.
Sie nickte, natürlich stumm. Sie zog die Daunenjacke aus, nahm die Baseballmütze ab und ordnete ihr Haar. Ich schaltete den Wasserkocher ein und gab Teeblätter in eine kleine Kanne. Ich hatte ohnehin Tee trinken wollen.
Marie saß mit aufgestützten Ellbogen am Tisch und beobachtete, wie ich meine eingelegte Bernsteinmakrele, den Reis und die Miso-Suppe aß, als hätte sie so etwas noch nie gesehen. Als wäre sie bei einem Dschungelspaziergang auf einen Riesenpython gestoßen, der einen jungen Dachs verschlang, und hätte es sich auf einem Felsen in der Nähe bequem gemacht, um den Vorgang zu beobachten.
»Die Bernsteinmakrele habe ich selbst gemacht«, erklärte ich, um das abgrundtiefe Schweigen zu füllen. »Wenn man sie in Sake-Treber einlegt, hält sie sehr lange.«
Sie zeigte keinerlei Reaktion. Ich war nicht einmal sicher, ob meine Erklärung bei ihr angekommen war.
»Immanuel Kant führte ein extrem streng geregeltes Leben. So geregelt, dass die Menschen ihre Uhr danach stellen konnten, wann er spazieren ging«, probierte ich es weiter.
Natürlich war das sinnloses Gerede, das die Stille um uns herum nur vertiefte. Immanuel Kant hatte jeden Tag schweigend dieselben Straßen in Königsberg durchquert. Und seine letzten Worte hatten gelautet: »Es ist gut.«
Als ich zu Ende gegessen hatte, stellte ich das benutzte Geschirr in die Spüle. Anschließend goss ich den Tee auf, holte zwei Teeschalen und ging zum Tisch zurück. Marie Akikawa blieb sitzen und folgte jeder meiner Bewegungen mit aufmerksamen Blicken, wie eine Historikerin bei der genauen Überprüfung der Fußnoten in einem Aufsatz.
»Du bist nicht mit dem Auto gekommen?«, fragte ich.
»Nein, zu Fuß.« Endlich machte sie einmal den Mund auf.
»Du bist ganz allein von zu Hause hierhergelaufen?«
»Ja.«
Ich schwieg und wartete darauf, dass sie weitersprach. Aber Marie schwieg ebenfalls. Zwischen uns dehnte sich ein langes Schweigen aus. Doch Schweigen war auch meine Stärke. Immerhin lebte ich allein auf einem Bergkamm.
»Es gibt einen geheimen Weg«, sagte Marie irgendwann. »Die Fahrt mit dem Auto dauert ziemlich lange, aber zu Fuß ist es ganz nah.«
»Ich gehe auch viel hier in der Gegend spazieren, aber diese Abkürzung habe ich noch nicht entdeckt.«
»Weil Sie nicht richtig suchen«, sagte das junge Mädchen ohne Umschweife. »Wer einfach so normal rumläuft und normal guckt, findet den Pfad nicht. Er ist gut versteckt.«
»Du hast ihn versteckt, nicht?«
Sie nickte. »Wir sind kurz nach meiner Geburt hergezogen, und ich bin hier aufgewachsen. Der Wald war immer mein Spielplatz. Schon als ich noch ganz klein war. Ich kenne hier jeden Winkel.«
»Und dieser Pfad ist raffiniert versteckt?«
Wieder nickte sie.
»Und auf ihm bist du hergekommen?«
»Genau.«
Ich seufzte. »Hast du schon gegessen?«
»Ja, vorhin.«
»Und was?«
»Meine Tante kann nicht besonders gut kochen«, sagte Marie. Das war zwar keine Antwort auf meine Frage, aber ich traute mich nicht, weiter nachzuhaken. Vielleicht hatte sie keine Lust, sich an ihre jüngste Mahlzeit zu erinnern.
»Weiß deine Tante, dass du allein hierhergekommen bist?«
Darauf antwortete Marie nun überhaupt nicht und presste nur die Lippen aufeinander. Also beschloss ich, mir die Antwort selbst zu geben. »Natürlich weiß sie es nicht. Kein verantwortungsbewusster Erwachsener würde erlauben, dass ein dreizehnjähriges Mädchen nach Einbruch der Dunkelheit hier allein durch den Wald stromert. Habe ich recht?«
Wieder Schweigen.
»Und von dem geheimen Pfad weiß sie auch nichts?«
Marie schüttelte nachdrücklich den Kopf.
»Wie dem auch sei«, sagte ich. »Irgendwo auf der Strecke von deinem Haus hierher kommst du doch bestimmt durch das Wäldchen mit dem alten Schrein?«
Marie nickte. »Den Schrein kenne ich gut. Ich weiß auch, dass der Steinhaufen dahinter kürzlich mit einem Bagger weggeräumt wurde.«
»Hast du das beobachtet?«
Marie schüttelte den Kopf. »Nein, an dem Tag war ich in der Schule. Aber es waren eine Menge Spuren und Erde da, die der Bagger hinterlassen hat. Warum haben Sie das gemacht?«
»Aus verschiedenen Gründen.«
»Und aus welchen?«
»Es würde zu lange dauern, dir das alles von Anfang an zu erklären.« Ich wollte ihr möglichst nicht sagen, dass Menshiki an der Sache beteiligt gewesen war.
»Man hätte die Stelle nicht freilegen sollen«, sagte Marie abrupt.
»Wieso meinst du das?«
Sie machte eine Bewegung, die wie ein Schulterzucken aussah. »Man hätte die Stelle so lassen sollen, wie sie war. Alle haben es so gemacht.«
»Wer, alle?«
»Ich meine, das war doch alles schon ewig so.«
Wahrscheinlich hatte das junge Mädchen recht. Wir hätten diesen Platz in Ruhe lassen sollen. So wie es bisher alle getan hatten. Doch nun war es zu spät. Die Steine waren beiseitegeschafft, die Gruft war geöffnet und der Commendatore befreit worden.
»Du hast die Bretter angehoben, stimmt’s?«, fragte ich Marie. »Du hast in die Kammer geschaut, sie wieder abgedeckt und die Bretter mit Steinen beschwert.«
Marie hob den Blick und sah mir mitten ins Gesicht, wie um zu fragen, woher ich das wisse.
»Die Anordnung der Steine war ein bisschen anders. Ich hatte schon immer ein gutes visuelles Gedächtnis. Solche kleinen Unterschiede erkenne ich auf den ersten Blick.«
»Aha«, sagte sie erstaunt.
»Aber die Kammer ist leer. Außer Dunkelheit und feuchter Luft ist da nichts. Richtig?«
»Da stand noch eine Leiter.«
»Aber du bist nicht hinuntergestiegen, oder?«
Marie schüttelte heftig den Kopf, wie um zu sagen, dass sie das niemals tun würde.
»Und mit welchem Anliegen bist du heute Abend um diese Uhrzeit gekommen?«, fragte ich. »Oder wolltest du mir nur einen Höflichkeitsbesuch abstatten?«
»Höflichkeitsbesuch?«
»Wie Nachbarn das gelegentlich tun.«
Nach kurzem Überlegen schüttelte sie leicht den Kopf. »Nein, keinen Höflichkeitsbesuch.«
»Welche Art von Besuch ist es dann?«, fragte ich. »Natürlich freue ich mich, dass du eigens vorbeikommst, aber deine Tante und dein Vater könnten das falsch auffassen, wenn sie davon erfahren würden. Es könnte zu Missverständnissen führen.«
»Zu was für Missverständnissen?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: