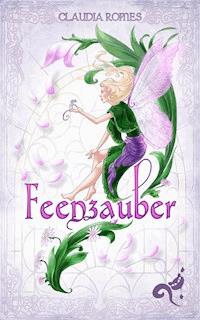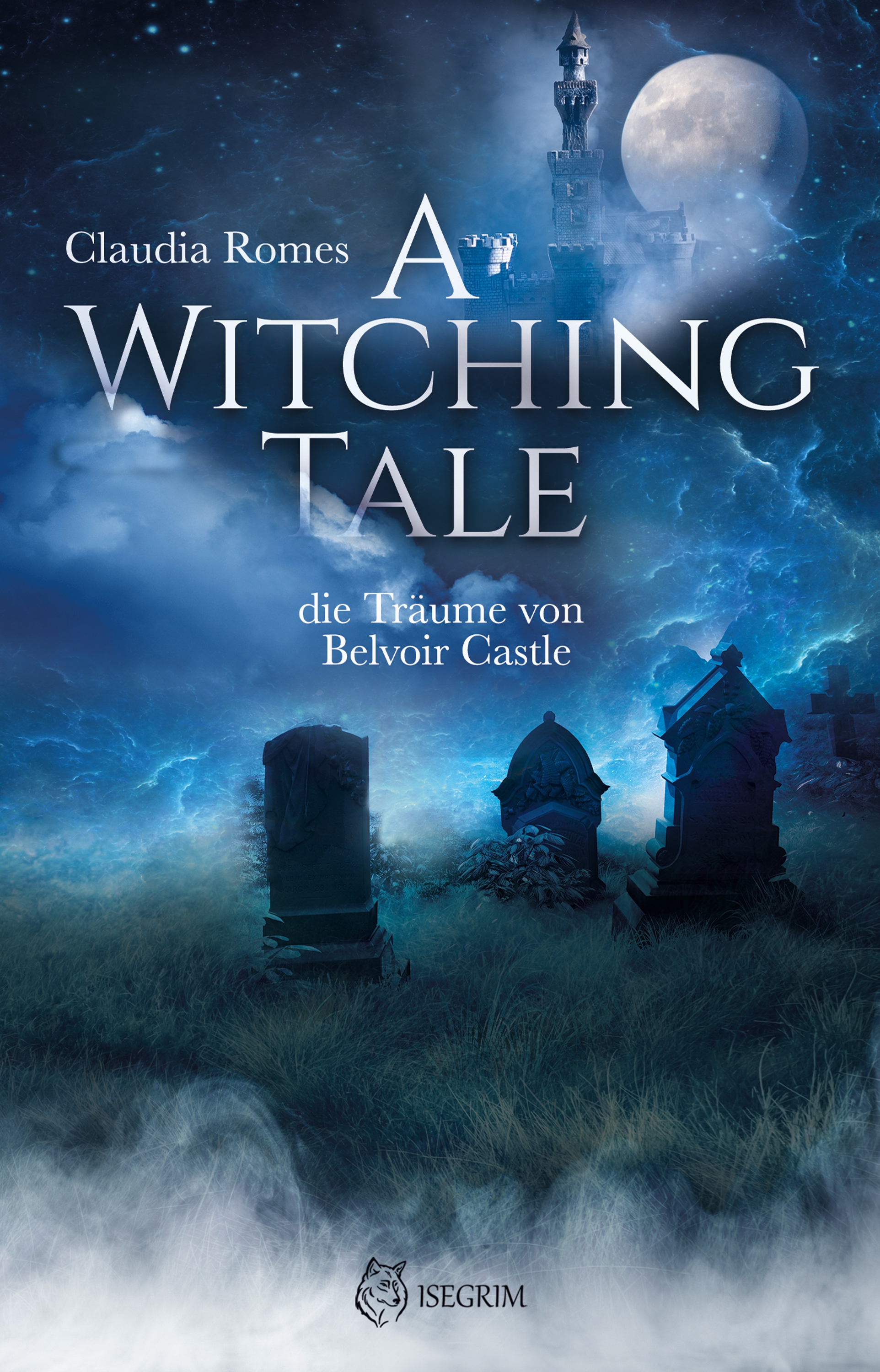9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Süßwaren-Saga
- Sprache: Deutsch
Bittersüße Offenbarungen.
Köln, 1933: Helene hat sich für die Süßwarenmanufaktur ihrer Familie entschieden und setzt alles daran, das Unternehmen erfolgreich durch die Weltwirtschaftskrise zu manövrieren. Doch ihre Ehe mit Georg bekommt bereits nach der Geburt ihrer Tochter erste Risse – und dann gerät auch noch der Ruf der Firma in Gefahr. Dass ausgerechnet Frederik, ihr einstiger Verlobter und Konkurrent aus Hamburg, sie und ihre Kreationen retten könnte, wirft Helene aus der Bahn, und längst erloschen geglaubte Gefühle kommen wieder auf ...
Liebe, Leidenschaft und Lakritz – die berührende Geschichte einer jungen Bonbonmacherin, die auch in unsteten Zeiten ihren Traum nicht aufgibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Köln, 1933: Helene von Ratschek genießt nicht nur unter den Arbeitern der Süßwarenmanufaktur ihrer Familie großes Ansehen, auch privat scheinen ihre Träume mit der Geburt ihrer Tochter Anita in Erfüllung zu gehen. Doch warum distanziert sich ihr Ehemann Georg zunehmend von ihr, und wie soll sie künftig ihren Beruf und ihre Verantwortung als Mutter unter einen Hut bekommen? Helenes Leben steht kopf, als zudem eine Urheberrechtsklage gegen sie erhoben wird. Die Erdbeer-Taler, die sie damals noch in der Fabrik Spiegel in Hamburg entworfen hat, seien ursprünglich seine Idee gewesen, behauptet ein Bremer Fabrikant. Um ihre Unschuld zu beweisen, ist Helene plötzlich ausgerechnet auf die Hilfe ihres ehemaligen Verlobten angewiesen. Dass Frederik jedoch alte, vergessen geglaubte Gefühle wieder in ihr weckt, damit hat sie auch in unsteten Zeiten wie diesen nicht gerechnet …
Über Claudia Romes
Claudia Romes wurde 1984 als Kind eines belgischen Malers in Bonn geboren. Mit neun Jahren begann sie, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, und fasste den Entschluss, eines Tages Schriftstellerin zu werden. Nach einigen beruflichen Umwegen widmete sie sich ganz dem Schreiben und lebt heute ihren Traum. Die Autorin wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in der Vulkaneifel. Im Aufbau Taschenbuch sind bereits ihre Romane »Das Geheimnis der Hyazinthen«, »Beethovens Geliebte« sowie »Die Fabrik der süßen Dinge – Helenes Hoffnung« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Claudia Romes
Die Fabrik der süßen Dinge – Helenes Träume
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1 — Köln, Ende 1933
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5 — Frühling 1934
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8 — November 1934
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12 — Januar 1935
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29 — 1. September 1939
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Kapitel 1
Köln, Ende 1933
Schwer senkte sich die frühe Abenddämmerung über das Deutzer Industrieviertel. Dichte graue Wolken hatten sich darüber gespannt und raubten das letzte Licht des scheidenden Tages.
Helene riss die Autotür auf und verstaute ihre Aktentasche auf dem Beifahrersitz. Wieder einmal hatte sie lange Stunden in der Fabrik zugebracht. Trotz Doktor Wunderlichs Warnung, sie solle sich nicht übernehmen, hatte sie die Produktion ihres neuen Lakritz-Karamell-Konfekts persönlich überwacht. Mit den Angestellten der Bonbonwerkstatt hatte sie letzte feine Änderungen am Rezept vorgenommen und eine erste Anzahl der Süßigkeit über das Band laufen lassen. Nebenbei hatte sie den Kampf mit dem Vertrieb für sich entschieden. Dieser hatte sich anfangs wenig begeistert von ihrem Vorschlag gezeigt, die Ware in Schachteln anzubieten.
»Schönes Wochenende, Frau Kronenberg!« Die Vorarbeiterin Helma Berens klopfte sacht gegen das Autofenster, und Helene hob zum Abschied die Hand. Helma führte eine Gruppe Frauen und Männer an, die zum Schichtende aus der Süßwarenfabrik strömte. Mantelkrägen wurden hochgeschlagen, Mützen aufgesetzt und Schirme aufgespannt, um dem einsetzenden Schneeregen zu trotzen.
Helene startete den Motor. Leise zischend umschloss sie mit einer Hand ihren Bauch, wieder spürte sie dieses Ziehen im Unterleib. Vor ein paar Tagen hatte sie es zum ersten Mal bemerkt, aber niemandem davon erzählt. Der Geburtstermin war in sechs Wochen und Scheinwehen, so wie Eva sie nannte, waren in dieser Zeit völlig normal. Ihre Schwägerin hatte selbst zwei Kindern das Leben geschenkt und Helene ausführlich vorbereitet. Ohnehin hatte Helene keine Zeit zur Schonung. Ihr Terminkalender war voll und eng aufeinander abgestimmt. Es galt ein weiteres Produkt auf dem Markt zu platzieren und auch das Weihnachtsgeschäft war bereits angelaufen. Möglichst viel musste bis zur Geburt erledigt werden, damit sie die Firmenleitung ruhigen Gewissens in die Hände ihres ältesten Bruders Alfred legen konnte – zumindest für ein paar Wochen.
Als sie in der Backsteinvilla ihrer Familie ankam, war sie erleichtert, dass der Tag sich dem Ende zuneigte. Im Flur nahm ihr das neue Dienstmädchen Mantel, Hut und Schal ab. »Noch ein Tee vor dem Abendessen, Frau Kronenberg?«
»Nein danke, Fanny. Ist mein Mann schon zu Hause?«
»Der gnädige Herr ließ ausrichten, dass es spät bei ihm wird. Sie mögen ohne ihn zu Abend essen.«
Helene nickte mit einem schwachen Lächeln. Fanny bestach durch angenehme Zurückhaltung. Schon nach kurzer Zeit war Helene außerdem ihr Intellekt aufgefallen. Das Dienstmädchen rechnete ihr blitzschnell die Ausgaben für den Wocheneinkauf vor und ihre Ausdrucksweise war stets gewählt. Doch in Fannys Familie war es üblich, in Stellung zu gehen. So gehörte sie, wie schon ihre Mutter vor ihr, zum Hausstand der Kronenbergs. Während Georgs Eltern durch Italien reisten, unterstützte sie das Personal der von Ratscheks in der Fabrikantenvilla.
In aufdringlicher Lautstärke hallte Marlene Dietrichs »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt« durchs Haus. Helene folgte der Musik ins Esszimmer. Ihre Mutter stand mit ihrem Hündchen Goldie auf dem Arm neben dem Plattenspieler am Fenster. Wie immer war Klara von Ratschek die Eleganz in Person. Über dem schmal geschnittenen Rock trug sie eine Samtbluse mit Puffärmeln. Gedankenverloren starrte sie hinaus auf die sich verdunkelnde Straße und summte die Melodie mit, obwohl die Platte hakte – immer an derselben Stelle.
»Guten Abend, Mama«, begrüßte Helene sie, dann hob sie die Nadel des Plattenspielers an und unterbrach damit die sich wiederholende Dietrich. »Wirf diese Scheibe endlich weg. Ich kaufe dir eine neue.«
»Die ist völlig in Ordnung«, erwiderte ihre Mutter trotzig.
»Du behältst sie, weil sie von Papa stammt.«
Klara zuckte leicht die Schultern und wechselte das Thema. »Du kommst reichlich spät, Lenchen.«
Helene küsste sie auf die Wange. »Verzeih mir. Ich konnte mich nicht eher loseisen.«
»Du verlangst dir zu viel ab.« Sie strich wie in Trance über das glatte Rückenfell ihres Jack Russell Terriers. »Georg sorgt sich ebenfalls um dich, und um euer Kind.«
»Ich kenne meine Grenzen genau.« Helene nahm am Tisch Platz und entfaltete ihre Serviette. »Außerdem bin ich nicht krank. Ich bin lediglich in anderen Umständen.«
»Gewiss doch. Nichtsdestotrotz solltest du dich nicht so strapazieren. Es ist nicht notwendig, dass du täglich in die Fabrik fährst. Du hast doch das Fräulein Berens, auf das du dich verlassen kannst. Jedenfalls behauptest du das immer.«
»Ich möchte einfach sichergehen, dass im Betrieb alles funktioniert, bevor ich niederkomme.«
Seufzend kam Klara an den Tisch. »Georg sieht es nicht gern, dass du immerzu dort bist.«
Helene nickte brummend. Im Gegensatz zu ihrer Mutter und ihrem Mann nahm sie ihre Schwangerschaft gelassen hin. Seit Georg sich vermehrt um den Außenhandel kümmerte, war sie oft allein mit ihrer Mutter in der Villa. Immer regelmäßiger blieb er auch über Nacht fort. Dann kam Helene das große Haus gespenstisch leer vor.
Das Abendessen wurde aufgetragen. Rindfleischsuppe mit Markklößchen und Hefebrötchen.
»Alfred und Eva sind von ihrer Kreuzfahrt zurückgekehrt«, durchbrach Klara die bedrückende Stille am Tisch. »Wir erwarten sie am Donnerstag zum Kaffee.«
»Da habe ich zu tun.«
»Du wirst es einrichten, Lenchen. Es ist längst an der Zeit, dass ihr eure Unstimmigkeiten beilegt. Wir sind doch eine Familie.«
Helene hob die Augenbrauen. »Ich bin nicht diejenige, die Alfred Böses will. Es ist umgekehrt.«
»So ein Unfug! Henri wollte nie etwas mit der Fabrik zu tun haben. Er hat sich gegen sie entschieden.«
»Und Alfred hat ihm die Anteile nur aus reiner Herzensgüte abgenommen?« Helene konnte ihren Zynismus nicht zügeln.
»Er hat ihm ein Angebot gemacht, und Henri befand es als recht.«
Helene legte ihren Löffel ab und seufzte tief. »Warum hat er nicht mit mir darüber geredet? Ich verstehe einfach nicht, wieso er mir nichts davon gesagt hat, dass er aussteigen will. Warum ausgerechnet Alfred?« Helene belastete die Tatsache, dass Henri wortlos nach Paris gegangen war – und das am Tag ihrer Hochzeit. Er, der stets ihr Lieblingsbruder und Verbündeter in der Familie gewesen war, hatte sich gegen sie gestellt, ohne dass sie wusste, warum.
»Er wird sich dir erklären, wenn er zurückkehrt, da bin ich sicher«, entgegnete Klara leise und trank einen großen Schluck Wein.
»Hast du etwas von ihm gehört?« Helene traute sich kaum mehr nachzufragen. Die Antwort würde doch nur wieder ernüchternd sein.
Klara säuberte sich mit ihrer Serviette die Mundwinkel, dann schüttelte sie den Kopf. Binnen Sekundenbruchteilen wechselte jedoch ihre Miene, und sie wirkte plötzlich vorfreudig. »Wir sollten allmählich die Taufe planen. Wie du weißt, sind nicht alle Gäste leicht abkömmlich, und es dauert sicher nicht mehr lang, bis das Kleine da ist.« Ihr Blick streifte Helenes Bauch.
Noch ist es nicht so weit. Noch nicht, widersprach Helene vehement in Gedanken. Innerlich war sie zerrissen und verspürte den Drang, die Zeit anzuhalten. Sie in den Wartemodus zu versetzen, bis ihr Bruder an ihre Seite zurückgekehrt war. Henri fehlte in ihrem Leben, in dem sich unverhofft so vieles zu ihren Gunsten entwickelt hatte. Inzwischen war sie neben Alfred Geschäftsführerin. Es war ihrem Engagement zu verdanken, dass die Umsätze trotz der Wirtschaftskrise gestiegen waren. Als wäre das nicht schon genug, erwarteten sie und Georg den ersehnten Nachwuchs. Manchmal schäumte Helene schier über vor Stolz. In den vergangenen sieben Jahren hatte sie allen bewiesen, dass auch eine Frau Großes schaffen konnte. Sie wurde in einer von Männern dominierten Branche akzeptiert. Allein der Umstand, dass Henri sich von der Familie, allen voran von ihr, abgewandt hatte, warf einen Schatten über ihr Glück. Dabei wünschte sie sich nichts mehr, als dass ihr jüngster Bruder die Patenschaft für ihr Kind übernehmen würde. Aber wie sollte sie sich ihm mitteilen, wenn niemand genau wusste, wo er sich momentan aufhielt?
*
Mühsam rollte Helene sich am nächsten Morgen auf die andere Seite. Unerwarteterweise war sie am späten Abend sofort eingeschlafen und hatte mehrere Stunden am Stück tief und fest geschlummert. Die bleierne Müdigkeit hallte noch in ihr nach. Kurz überlegte sie, einfach im Bett zu bleiben und sich weiter auszuruhen, kam gegen ihre innere Unruhe aber nicht an.
»Morgen«, nuschelte sie und streckte ihren Arm zur Seite aus. Sie griff ins Leere. Georgs Kissen war verwaist, seine Decke nicht einmal zurückgeschlagen. Vermutlich hatte er wieder im Gästezimmer übernachtet – wie so oft in letzter Zeit. Helene konnte es ihm nicht verdenken. Momentan war es wenig behaglich, neben ihr zu liegen. Sodbrennen und Wadenkrämpfe plagten sie und hielten sie oft stundenlang wach. Hinzu kam der häufige Harndrang, der sie immer mal wieder aus dem warmen Bett scheuchte. Zwischen all diesen Schwangerschaftsbeschwerden wälzte sie sich rastlos hin und her, auf der Suche nach einer angenehmen Liegeposition. Alles war schlichtweg anstrengend geworden.
Stöhnend hievte sie sich auf die Bettkante und zwang ihre geschwollenen Füße in die Pantoffeln. Es war unfassbar. Jedes Mal, wenn sie ihre Knöchel betrachtete, schienen sie größer geworden zu sein. Das Laufen fiel ihr zunehmend schwer. Fanny betrat das Zimmer, wünschte einen guten Morgen und zog leise die Vorhänge auf, so dass die Wintersonne ihr warmweißes Licht ins Schlafzimmer warf.
»Wie ist es heute?« Fanny half Helene dabei, sich auf den tiefen Hocker vor dem Frisiertisch zu setzen.
»Ach, ich komme mir aufgeschwemmt vor. Kein Wunder, dass mein Mann mich meidet«, entgegnete sie mit einem schiefen Lächeln.
»Gnädige Frau, aber er meidet Sie doch nicht. Er nimmt Rücksicht auf Ihren Zustand. Sie werden sehen. Sobald das Kind gesund zur Welt gekommen ist, werden sich die Dinge wieder normalisieren.« Fanny bürstete ihr das lange dunkelblonde Haar und steckte es hoch.
»Hm.« Helenes Miene war ernst. Seltsamerweise empfand sie Georgs Distanziertheit nicht als Rücksichtnahme – obwohl ihr das jeder sagte. Fanny, ihre Mutter und ihre Schwiegermutter. Sogar Katharina, das andere Hausmädchen und Alfreds Liebschaft, hatte ihr ihre Meinung dazu aufgedrängt. Es sei völlig normal, dass sich der Mann während der Schwangerschaft von der Frau zurückzieht. Aber was verstand sie schon davon? Dass Katharina bei ihrer vorlauten Art überhaupt noch im Haus angestellt war, entzog sich Helenes Verständnis. Zugegeben, es wusste niemand von ihrem Verhältnis mit dem verheirateten Fabrikantensohn, denn noch hatte Helene ihr Wissen darüber für sich behalten. In den vergangenen zwei Jahren war einfach zu viel geschehen, was ihre Mutter hatte verkraften müssen: den Tod ihres geliebten Mannes, die Angst, nach der Wirtschaftskrise in die Mittellosigkeit abzusinken und letztlich Henris Verschwinden. Helene wartete auf einen günstigen Augenblick, in dem ihre Familie einen solchen Skandal verkraftete.
Es klopfte an der Tür. Wenig später steckte Georg den Kopf hindurch. »Darf ich reinkommen?«
Fanny ließ die beiden allein.
Georg neigte sich zu Helene vor und küsste sie flüchtig auf den Mund. »Wie geht es dir?«
»So langsam wird es beschwerlich.«
Er nickte knapp, kniete sich vor sie und legte seine Hände auf ihren prallen Bauch. »Du bist auf der Zielgeraden und hast es bald geschafft.«
Helene erbebte unmerklich unter seiner Berührung. Seit er von dem Kind erfahren hatte, hatte er sie nicht mehr angefasst, nicht auf seine leidenschaftliche, liebevolle Art. Seinen Rückzug erklärte er damit, dass er das Ungeborene nicht gefährden wolle. Für Helene kam dies einer Strafe gleich. Ihr fehlten die Zärtlichkeiten. Sie fühlte sich weniger beschützt und, was noch viel schlimmer war, gebrandmarkt und hilflos in einem Zustand gefangen, der sie doch eigentlich beglücken sollte.
»War das Treffen mit dem schwedischen Handelsvertreter erfolgreich?«, fragte sie rasch.
»Es war vielversprechend. Wir werden noch ein, zwei Termine wahrnehmen müssen, aber alles sieht danach aus, als würde die Handelskette unsere Produkte aufnehmen.«
»Großartig!« Helenes Freude war aufrichtig. Sie hatten lange darauf gehofft, ihre Süßwaren endlich ins Ausland exportieren zu dürfen. Nun schien dieser Traum zum Greifen nah. Sie nahm Georgs Hand und drückte sie fest. »Das sollten wir gebührend feiern. Essen wir heute zu Mittag, in der Altstadt. Was sagst du?«
Seufzend streichelte er ihren Handrücken. »Bedaure, kleines Lenchen, ich muss nach Düsseldorf zu einer Besprechung. Der Wagen wartet schon vor dem Haus. Ich wollte mich noch von dir verabschieden. Es wird sicher wieder spät heute.«
Helene entzog ihm ihre Hand. Erneut fühlte sie sich verschmäht und allein gelassen von ihm. »Es ist Wochen her, dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Alles scheint dir momentan wichtiger zu sein.«
»Ach, Leni. Nichts ist mir wichtiger als du! Wir holen das nach, versprochen.« Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. »Und bitte, arbeite nicht mehr so viel, ja? Deine Mutter sagte mir, du hättest gestern sehr erschöpft ausgesehen.«
»Sicher«, knurrte Helene. Es war verrückt. In dieser einen Sache war er sich mit ihrer Mutter ausnahmsweise einig. Es war, als hätten sich beide gegen sie verschworen.
Verdrossen blickte sie Georg nach, wie er aus der Tür und aus ihrem Tag verschwand. Wann hatten sie sich so entfremdet? Am Anfang ihrer Ehe war alles perfekt gewesen. Entgegen der dunklen Prophezeiung von Alfred, schon die Hochzeitsreise würde ein Reinfall werden, war diese ausgesprochen harmonisch verlaufen. Als Georg mit ihr im Mondschein an Madeiras Küste entlangspaziert war, hatte sie das Gefühl gehabt, die richtige Entscheidung für ein glückliches Leben getroffen zu haben. Und auch noch bis vor einem Jahr hatte sie nicht damit gerechnet, dass sie der Alltag so schnell einholen würde. Aber vielleicht war es das, was die Ehe zweier Menschen ausmachte, die ihre Berufe liebten und nach mehr Erfolg strebten.
Als Helene hinunter ins Esszimmer zum Frühstück ging, hörte sie das Geräusch sich schließender Türen und einen aufheulenden Motor. Aus dem Fenster blickend, sah sie, wie sich der schwarze Wagen entfernte, auf dessen Rücksitz sie Georgs Umrisse erkannte. Schließlich bog er am Straßenende um die Ecke und verschwand.
Kapitel 2
Drei Wochen später war die Zusammenarbeit mit der schwedischen Handelskette vertraglich festgelegt. Die erste Auslieferung sollte noch vor Weihnachten erfolgen. In der Fabrik arbeitete man deshalb auf Hochtouren. Es wurden Sonderschichten eingelegt, um den zusätzlichen Mengen an Süßwaren gerecht zu werden. Überstunden waren an der Tagesordnung, und Personal aus den Lagern wurde herangezogen.
Seit dem frühen Morgen ging Helene die Bestellungen für die kommenden Wochen durch. Während ihrer Abwesenheit sollte Alfred keine Entscheidungen zu treffen oder Schwierigkeiten zu bewältigen haben, die letztlich auf sie zurückfallen würden. Helene gab sich für die Erholung nach der Geburt nur wenig Zeit. Auf keinen Fall wollte sie der Fabrik länger als zwei Monate fernbleiben. Damit dies funktionierte, war bereits ein Kindermädchen ausgewählt worden. Helenes Mutter war äußerst angetan von den fortschrittlichen Erziehungsmethoden von Lilo Melmann, die auf Empfehlung des Stabsführers in der Fabrikantenvilla vorstellig geworden war. Klara, die betont hatte, dass im Haus reichlich Platz wäre, hatte mit großem Eifer zwei Zimmer im Obergeschoss freigeräumt. Die Melmann würde gleich neben ihrem eigenen Schlafzimmer und der Kinderstube unterkommen. Überhaupt schien der Familienzuwachs in Klara von Ratschek die Lebensgeister neu geweckt zu haben. Eine Wandlung, die Helene sehr begrüßte.
Ein lautes Knattern ließ sie an ihrem Schreibtisch hochfahren. Wenig später war die Fabrik von einem ohrenbetäubenden Knall erfüllt, der wie ein Donnerhall bis in die oberste Etage des Gebäudes reichte. Helene ließ den Füllfederhalter auf das Auftragsbuch sinken, stand auf und lugte zur Tür hinaus. Bedienstete liefen hektisch und aufgescheucht umher. Unverständliches Gemurmel herrschte vor. Dazwischen klangen gedämpfte Schreie von unten zu ihr hinauf.
»Was ist denn passiert?«, fragte Helene ihre Sekretärin aufgewühlt.
»Es gab einen Unfall … an der Walze«, erklärte Regine Wolf mit dem Telefonhörer am Ohr.
»O nein!« Helenes Puls schnellte so rasant in die Höhe, dass ihr kurz schummrig vor Augen war. »Ist mein Mann schon informiert?«
»Er ist noch in einer Besprechung.«
Helene nickte angespannt, dann eilte sie über den Korridor.
»Gehen Sie lieber nicht da runter, Frau Kronenberg«, rief Regine ihr hinterher. Helene ließ sich aber nicht aufhalten. Auf der Treppe, die zur Produktionshalle hinabführte, strömte ihr beißender Rauch entgegen. Hüstelnd wedelte sie mit einer Hand vor ihrem Gesicht.
»Reißt alle Fenster und Türen auf«, brüllte jemand. Ihren Seidenschal vor Nase und Mund haltend, bahnte Helene sich einen Weg durch den nebligen Schleier, der zwischen ihr und der motorbetriebenen Walze stand. Vage Konturen von Menschen entstiegen dem Rauch. Einige gehetzt, andere bewegungsunfähig, am ganzen Leib zitternd. Helene klopfte das Herz bis zum Hals. Sie schluckte mühsam, als ihr aufging, dass etwas Furchtbares die Arbeit in der Fabrik zum Erliegen gebracht haben musste.
»Mehr Verbände!«, hörte sie jemanden rufen. Helene hielt inne und verfolgte mit dem Blick die Rauchschwade, welche von der Anlage zur Decke hinaufstieg. Männer mit rußverschmierten Gesichtern waren hektisch daran zugange. Einer von ihnen rüttelte kraftvoll am Rad, bis es sich endlich bewegte. Wie aus einem Teekessel, der mit kochendem Wasser befüllt war, entwich der Druck surrend und pfeifend dem Getriebe, das gerade erst gewartet worden war. Der Rauch verschwand ins Freie, und Helenes Herz verkrampfte sich unter dem Ausmaß des Unglücks.
»Frau Kronenberg. Nicht!«, mahnte Helma. Helene erbebte unter ihrer Hand, die nun schwer auf ihrer Schulter auflag. »Ich bitte Sie, gehen Sie wieder hinauf.« Helma klang unerbittlich.
Helene sah ihre Vorarbeiterin an. Helmas Augen waren schreckgeweitet. Rote Spritzer leuchteten auf Ärmel und Kragen ihres beigefarbenen Hemdes. Ein kehliges, erstickt klingendes Wimmern drängte sich Helene auf und trieb sie an, weiterzugehen. Müßig setzte sie einen Fuß vor den anderen und schaute erst nach ein paar Schritten zu Boden. Ihre Riemchenpumps standen in einer klebrigen Lache. Es war Blut. Atemlos blickte sie auf und erstarrte, als sie dessen Ursprung erkannte. Die Frau, die sie wimmern gehört hatte, war jung, fast noch ein Kind.
»Halt durch, Franzi. Halt durch«, redete ihr eine Freundin zu. »Es wird alles gut.«
Das Mädchen saß zwischen Band und Walze, die Wangen kreideweiß.
»So viel Blut!«, stammelte jemand neben Helene.
»Sie hat noch versucht, sich selbst zu befreien«, hörte sie daraufhin einen Mann leise sagen.
»Dat wird wieder.« Eine Frau presste ein Handtuch auf die blutdurchtränkten Verbände.
Helene sah das verletzte Mädchen mit den Sommersprossen an und ihr Atem stockte. Sie gehörte zu Agnes Kowalski. Einer Arbeiterin, die seit mehr als zehn Jahren in der Firma angestellt war. Kowalski hatte ihre fünfzehnjährige Tochter zur Arbeit verpflichtet, weil ihr Mann sich im Zuge des Börsenkrachs das Leben genommen hatte und die kinderreiche Familie seitdem unter Geldnot litt. Helene schauderte.
»Der Rettungswagen ist auf dem Weg.« Regines Stimme schallte von oben durch die Fabrikhalle.
»Gehen Sie wieder hoch. Sie sollten nicht hier sein«, ermahnte Helma Helene. »Wir kümmern uns schon.«
»Ich bleibe, wo ich bin.« Sie entriss einer vorbeigehenden Arbeiterin die Verbände und kniete sich zu der Verletzten auf den Boden. »Du bist sehr tapfer, Franzi. Darf ich mir das mal ansehen?«
Auf das zaghafte Nicken der Fünfzehnjährigen hob Helene vorsichtig den Verband an, um ihn auszuwechseln. Da ging ein erschrockenes Raunen um. Helene fuhr der Schrecken in die Glieder und im letzten Moment schluckte sie einen Laut der Bestürzung hinunter. Franziskas Hand war blau angelaufen und hing schlaff im zertrümmerten Gelenk. Zwei Fingerglieder waren abgetrennt. Flüchtig blickte Helene in das tränennasse Gesicht des Mädchens und schalt sich, selbst die Ruhe zu bewahren.
»Ich habe gesagt, sie soll nicht zu nah an die Walze. Ich hab’s ihr gesagt«, brachte sich Frau Kowalski fahrig ein.
»Holt Eis!«, forderte Helene. »Es muss gekühlt werden, damit es nicht zu stark anschwillt.«
Helma sauste ins Lager und kehrte eiligst zurück. In ihrer Schürze klimperte es. Helene gab die Eisbrocken in ein Tuch und bedeckte damit vorsichtig Franziskas Hand. Die Farbe war aus dem Gesicht des Mädchens gewichen. Ihre Lider flackerten.
»Halte durch«, sprach Helene ihr Mut zu und strich ihr sanft eine rotblonde Strähne aus der Stirn.
Sie blieb bei ihr, bis der Rettungswagen eintraf und die Sanitäter sich ihr annahmen. Als der Krankenwagen mit heulender Sirene vom Gelände fuhr, nahm Helene am Rande die schwarze Limousine wahr, die in die Einfahrt einbog und vor ihr zum Stehen kam. Alfred stieg aus, schmiss die Tür zu und warf einen brüskierten Blick auf das Personal, das mit Helene vor der Produktionshalle stand.
»Wir haben einen Zeitplan einzuhalten. Warum wird hier nicht gearbeitet?« Er tippte ungeduldig auf seine in Gold gefasste Rolex. Schnell kehrten die Arbeiterinnen und Arbeiter in die Halle zurück. Alfred hatte die Hände in die Hüften gestützt und schaute belehrend auf seine Schwester herab.
»Was ist?«, zischte er.
Helene stand unter Schock. Sie fand keine Worte für das, was soeben geschehen war, und ließ ihren Bruder an sich vorbei in die Fabrik. Bald darauf kam er aufgebracht zu ihr zurück. Er hielt das Brecheisen in der Hand, mit dem beherzte Arbeiter die Walze angehoben und einen noch schlimmeren Ausgang verhindert hatten.
»Ein Totalschaden!« Alfred war außer sich. »Welcher gedankenlose Esel hat die Walze gewaltsam vom Band getrennt?«
Im ersten Moment war Helene wie erstarrt. Perplex blinzelte sie mehrmals hintereinander. War ihm in der Halle denn ansonsten gar nichts aufgefallen? Hatte er das viele Blut etwa nicht gesehen? Sie war so fassungslos, dass sie ihm nichts entgegenzusetzen hatte als ein vages, verständnisloses Kopfschütteln.
Hinter Alfred öffnete sich die Fabriktür. Georg trat heraus und kam an Helenes Seite. Benommen blickte sie zu ihm auf. Überrascht und unendlich dankbar darüber, dass er in dieser Stunde bei ihr war.
»Wir werden das reparieren lassen«, sagte er ruhig an seinen Schwager gewandt. »Morgen ist die Maschine wieder einsatzbereit.«
Alfred nickte mürrisch.
Georg umfasste Helenes Rücken. »Ich bringe dich nach Hause. Du musst dich ausruhen!«
Helene wehrte sich nicht, als er sie in den Wagen setzte und mit ihr zur Villa fuhr. Doch ihr Blick haftete bis zuletzt an der roten Fassade der Fabrik. Ein Tränenschleier verzerrte ihre Sicht. Es war zu viel, schalt sie sich gedanklich. Wir haben zu viel gewollt.
*
Einige Tage später hatten Monteure einen Kurzschluss im Getriebe als Ursache für die außer Kontrolle geratene Walze ausgemacht. Es war kein menschliches Versagen gewesen und doch gab Helene sich die Schuld, denn sie hatte die Fünfzehnjährige arbeiten lassen. An den Tag, an dem sie ihr Einverständnis dazu gegeben hatte, erinnerte Helene sich genau. Sie hatte nicht auf ihr Bauchgefühl vertraut, das ihr davon abgeraten hatte, sondern eingewilligt, um die finanzielle Not der Familie zu lindern. Franziskas Leben würde nie wieder dasselbe sein.
Bei einer Vorstandskonferenz fand der leitende Firmenjustiziar Hans Büdenbender klare Worte: »Es ist tragisch. Unendlich tragisch.« Er rieb sich über den grauen Schnurrbart, dann schlurfte er geräuschvoll seinen Kaffee. »Aber die Fabrik trifft keinerlei Schuld.«
»Wunderbar. Dann sind wir also aus dem Schneider. Die Zeitungen werden vermelden, dass es ein unglücklicher Zwischenfall gewesen ist. Das dürfte die Produktion nicht weiter beeinträchtigen.«
Jochen Bendricks kühle Aussage veranlasste Helene dazu, unmerklich mit den Augen zu rollen. Er besaß das Einfühlungsvermögen eines Kieselsteins. Ginge es nach ihr, so wäre er längst aus dem Unternehmen entfernt worden. Bedauerlicherweise verbürgte Alfred sich für ihn und seine fragwürdigen Kompetenzen.
»Es geht mir nicht darum, die Haftung zu klären«, betonte sie nachdrücklich. »Und mir ist gleich, was irgendwelche Analysen ergeben haben. Wir haben das zu verantworten! Hätten wir das Personal nicht so angetrieben, wäre das Mädchen jetzt noch heil.« Sie sank in ihren Stuhl und konnte ein leises Ächzen nicht zurückhalten. Die sorgenvollen Nächte seit dem Unfall forderten ihre ganze Kraft.
»Noch heil. Sie sagen es, Frau Kronenberg.« Friedrich Schilling grunzte. »Das Mädchen hat es überstanden. Ihre Entlassung aus dem Krankenhaus steht kurz bevor.«
Erbost schlug Helene mit der flachen Hand auf den Tisch, so dass einige der Männer zusammenzuckten. »Nur zur Erinnerung: Franziska Kowalski wird kein normales Leben mehr führen können«, klärte sie auf. »Ihre linke Hand musste zwar nicht amputiert werden, durch die Quetschung hat sie aber verheerende Verletzungen erlitten. Sie hat Teile ihres Ring- und Mittelfingers verloren. Ihre Hand ist nahezu unbrauchbar geworden. Und nach dem Tod des Vaters ist die Familie auf ihr Einkommen angewiesen.«
»Nun ja, wir könnten eine Übernahme der Arzt- und Heilkosten anbieten«, schlug Büdenbender vor.
Helene trommelte abwägend mit den Fingern auf den Armlehnen. »Das ist zu wenig«, entschied sie dann. Eine nachdenkliche Stille schlich sich ein.
»Was ist mit einer Art Abfindung? Eine einmalige Zahlung, die die Familie fürs Erste versorgt?«, fragte Büdenbender.
Helene überlegte. Eine Sache gefiel ihr bei seinem Vorschlag nicht. »Warum einmalig?«
»Wie meinen?« Büdenbender lehnte sich mit schmalem Blick vor.
Helene stand auf und ging einige Schritte. »Was wäre, wenn wir monatliche Zahlungen leisten würden? Eine Entschädigung für ihre Arbeitsunfähigkeit. Hätte das Mädchen nicht mehr davon?«
»Sicher …« Büdenbender zuckte die Schultern.
»Und wie lange soll das gehen?« Bendrick klang nicht angetan von Helenes Idee. »Sollen wir sie etwa bis zu ihrem Tod bezahlen? Damit würden wir uns auf unbestimmte Zeit an eine finanzielle Verpflichtung binden.«
»Hm«, machte Helene. Obwohl sie seine Abneigung gegen ihren Vorschlag spürte, den Kowalskis zu helfen, war sein Einwand nicht unbegründet.
»Wir könnten ärztliche Kontrolluntersuchungen ansetzen. In denen regelmäßig neu über ihre Arbeitstauglichkeit entschieden wird«, bot Büdenbender an.
Helene nickte. »Ich möchte, dass Sie die monatliche Zuwendung hochrechnen. Und dann setzen Sie ein Dokument auf, das allen neuen Arbeitsverträgen beigelegt wird. Ich will, dass die Menschen wissen, dass wir für sie sorgen, wenn in der Fabrik etwas passiert.« Helene warf einen Blick auf die Uhr. Schon Viertel nach neun. In einer halben Stunde musste sie bei ihrer Hebamme sein.
Schilling zeigte sich beschwichtigt. »Das wird den Kunden gefallen. Unternehmerische Fürsorge kommt immer gut an. Besonders in diesen Zeiten. Geben Sie das an den Stadtanzeiger weiter«, wies er den jungen Praktikanten neben sich an, der emsig mitschrieb.
»Ich erwarte in zwei Tagen einen ersten Entwurf auf meinem Schreibtisch«, sagte Helene an Büdenbender gewandt. Er schob sich seine Brille die Nase hinauf und machte sich Notizen.
»Also dann …« Helene holte ihre Tasche und warf sich den Mantel über. Die Herren erhoben sich mit einer obskur anmutenden Synchronizität von ihren Stühlen.
»Verzeihung, Frau Kronenberg«, bremste Bendrick sie, bevor sie zur Tür hinausgehen konnte. »Wir müssen Ihren Bruder in dieser Sache einbeziehen.«
Sie schnappte nach Luft, nickte aber schließlich. »Sicher«, knirschte sie durch zusammengebissene Zähne. »Er wird seine Zustimmung nicht verweigern.«
Wenige Tage später lief der Betrieb in der Fabrik wieder völlig normal. Es wurden Lakritz- und Zuckerwerk angesetzt. In hohen Behältern kochte die Gelatine, bis sie weich genug war, um mit den unterschiedlichsten Fruchtmischungen zu verschmelzen. Das Personal hatte den Verzug fast wieder aufgeholt. Man arbeitete akribisch und mit verkürzten Pausen. Helene hörte kein Murren und keine Klagen. In den Gesichtern vereinzelter Arbeiterinnen und Arbeiter spiegelte sich aber noch das, was sie mitangesehen hatten. Auch Alfreds Ausbruch vor Helma und den Frauen vom Band und als er seinen Unmut über die defekte Walze an den Mechanikern ausgelassen hatte, hallte nach. Die Situation hatte die Furcht vor dem Verlust der Arbeitsstelle neu geschürt. In Zeiten der Inflation schien ihnen nichts mehr sicher zu sein. Hinzu kam Alfreds Entscheidung, sich gegen seine Schwester zu stellen. Er hatte entschieden, keine Sonderzahlungen an Franziska zu leisten. Damit heizte er die Gerüchte über geplante Entlassungen in der Fabrik weiter an.
*
An Helenes Namenstag traf sich die Familie im Restaurant. Klara hatte dazu eingeladen. Als einzige Bedingung hatte sie aufgeführt, dass für die Dauer des Abendessens nicht über die Firma gesprochen wurde. Dass Alfred Helenes Autorität im Unternehmen untergraben hatte, lag dieser aber schwer im Magen. Die Geschwister hatten etwas zu klären und sobald Eva und Klara auf der Toilette verschwunden waren, nahm Helene den günstigen Augenblick wahr.
»Du hast das Personal verunsichert«, begann sie in dem Wunsch ungerührt zu klingen, doch sie bemerkte sogleich, dass sie dafür zu ernst klang. »Das Schicksal des Mädchens hat die Stimmung in der Fabrik getrübt.«
»Du setzt dich über Mutters Regel hinweg. Das ist ein wenig respektlos, findest du nicht?«, entgegnete Alfred kühl.
»Im Moment sehe ich nur uns beide an diesem Tisch.«
Er lächelte schroff. »Wir sprechen nicht mehr über den Vorfall. Er hat sich erledigt.«
Helene kräuselte die Stirn.
»Offenbar weißt du es noch nicht«, urteilte er beiläufig.
»Was weiß ich nicht?«
»Wir sind anders mit der Mutter des Mädchens verblieben. Dein Vorschlag war einigen Vorstandsmitgliedern doch etwas zu unrentabel – zu samaritanisch. Wir sind kein Wohltätigkeitsverein, Helene. Wir sind ein großes Unternehmen und wir müssen auch an die Zukunft denken.«
Helenes Miene verschloss sich. Warum war sie darüber nicht informiert worden? Wo doch die Mitglieder immerzu darauf bestanden, Alfred über sämtliche Kleinigkeiten zu unterrichten. Sie schluckte diese Frage hinunter, denn sie kannte die bittere Antwort. Offenbar war sie in den Augen einiger immer noch nur »die Frau« neben dem wichtigen Alfred von Ratschek in der Geschäftsleitung. Sie riss sich zusammen, um nicht verletzt zu klingen, konnte die Kränkung aber nicht vollständig aus ihrer Stimme verbannen. »Darf ich erfahren, was ausgehandelt wurde?«
»Jetzt sei nicht eingeschnappt. Schließlich ging es nur um eine Abweichung deines Vorhabens. Die Mutter des Mädchens hat sich bereit erklärt, zusätzliche Schichten zu übernehmen, und erhält dafür ein Drittel mehr Lohn. Du kennst unseren gegenwärtigen Produktionsaufwand. Diese Einigung kommt allen zugute.« Er spießte eine Gurkenscheibe auf und schob sie sich zwischen die Lippen.
»Am meisten kommt es uns zugute, nicht wahr?« Helene konnte nicht fassen, was er getan hatte. Er schien gar stolz darauf zu sein. »Frau Kowalski hat kleine Kinder zu versorgen, die nun ohne die Mutter auskommen müssen. Mehr noch als ohnehin schon.«
»Also ich bin der Letzte, der einer hilfebedürftigen Familie etwas verweigert. Unterstell mir nicht, ich würde ausschließlich tun, was dem Interesse der Firma dient. So jemand bin ich gewiss nicht.«
»Nein. Du doch nicht«, zischte Helene. »Und du hattest nicht vorgehabt, mit mir noch einmal darüber zu reden?«
Er setzte sein Glas an und trank einen großen Schluck vom Burgunder. »Helene, ich wollte dich nicht damit behelligen, deshalb habe ich es mit deinem Mann besprochen und der war einverstanden. Ich meine, du bist …« Er deutete mit dem Glas in seiner Hand auf ihren dicken Bauch. Helene biss die Zähne aufeinander und funkelte ihn an.
»Hat er dir das etwa nicht erzählt?« Er tat überrascht.
Langsam nickte sie und fasste sich gespielt nachdenklich an die Stirn. »Doch. Doch. Jetzt, wo du es sagst.«
Sie grinste stumpf, und er tat es ihr nach. Am liebsten hätte sie ihm den Wein ins Gesicht gekippt.
»Zitronensorbet«, trällerte Klara, als sie mit Eva an den Tisch zurückkehrte. »Gerade sind wir daran vorbeigekommen. Es sieht köstlich aus. Will sonst noch jemand ein Dessert?«
»Ich. Unbedingt.« Eva wandte sich Helene zu. »Und du?«
»Ich habe genug gehabt, danke«, antwortete Helene finster, den Blick auf ihren Bruder geheftet.
Fragend schaute Klara zwischen ihren Kindern hin und her. »Ist irgendetwas?«
Helene schüttelte den Kopf und lächelte bemüht. Sie wollte ihr nicht den Abend verderben, auf den sie sich so gefreut hatte. Schwerfällig schluckte sie ihre Gefühle und den Groll, der damit einherging, hinunter. Schlimm genug, dass Georg wieder einmal geschäftlich unterwegs war. Er hatte Alfred seine Zustimmung in einer Sache erteilt, von der er gewusst hatte, wie wichtig sie ihr war. Kein Wort hatte er ihr gegenüber dazu verloren. Sie war empört! Still vor sich hin leidend, ließ Helene den Rest des Abends über sich ergehen.
Als sie später endlich in ihrem Bett lag, war sie erleichtert, allein zu sein. Georgs Anwesenheit hätte einen Streit provoziert, dem sie nicht gewachsen gewesen wäre. Alfred hatte erneut gezeigt, dass er sich darauf verstand, ihre Schwächen zu wittern. Er hatte versucht, Georg und sie gegeneinander auszuspielen. Sie durfte ihm diese Genugtuung nicht geben.
Helene seufzte in ihr Kopfkissen und dachte an ihren anderen Bruder. Warum hatte Henri sie mit ihm allein gelassen? Erneut sah sie sich gezwungen, sich einen Schlachtplan zu überlegen, der Alfred zeigte, dass sie nicht so leicht kleinzukriegen war. Allein. Innerlich jedoch sehnte sie eine Pause vom Kämpfen herbei. Fortwährend musste sie sich im Unternehmen bewähren und doch hatten immerzu Alfred und Georg das letzte Wort. Manchmal hasste sie es, eine Frau zu sein. Gerade als sie diesen Gedanken zu Ende gebracht hatte, spürte sie die Tritte ihres Kindes. Erst zaghaft, dann kräftiger und plötzlich so heftig, dass sich ihre Bauchdecke unter dem Druck kleiner Füße wölbte. Helene drehte sich auf den Rücken und zum ersten Mal spürte sie intensiv in sich hinein. Zuvor war sie so sehr mit ihrer Arbeit in der Fabrik beschäftigt gewesen, dass sie den Bewegungen in ihrem Leib zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Jetzt war es, als verlange ihr Kind mit aller Kraft danach.
Helene knipste das Nachtlicht an und schlug die Bettdecke zurück. Ihr ganzer Körper erzitterte unter den Stößen. Abdrücke zeichneten sich ab – Schatten rund um ihren hervorgewölbten Bauchnabel. Helene griff nach der alten Spieluhr, die aus ihrer Kindheit stammte. Sie zog sie auf, und Vivaldis »Vier Jahreszeiten« erklang. Vorsichtig stellte sie sie auf ihrem Bauch ab. Ein paar kleine Knuffe folgten von innen gegen die hölzerne Schatulle, dann entspannte sich die Bauchdecke.
»Gefällt dir die Musik?«, fragte sie von einer überirdischen Ruhe erfüllt. Helene lächelte, als gäbe es weder Leid noch Unrecht auf der Welt. Das Kind, das in ihr heranwuchs, war ihr Wunder. Etwas vollkommen Neues, nie Dagewesenes, und es gehörte ihr allein.
Kapitel 3
Der Himmel war strahlend blau. Nur vereinzelte Schönwetterwolken ließen sich vom Wind rheinabwärts tragen. Es war ein freundlicher Samstagnachmittag im Dezember, an dem Helene die Familie Kowalski besuchte. Die Adresse hatte sie sich von ihrer Sekretärin heraussuchen lassen und war bei dem Straßennamen zusammengezuckt. Unter Krahnenbäumen befand sich in der Nordstadt, ein typisches Proletarierviertel in einem der ärmsten Bezirke Kölns. Nicht allein deshalb, sondern auch, weil ihr Bauch mittlerweile beim Autofahren störte, hatte Helene sich chauffieren lassen. Helmut Schmitz hatte schon bei ihrem Vater als Fahrer in Diensten gestanden und hatte eine zuverlässige, verantwortungsvolle Ader. Vor allem für Klara, die sich nie selbst hinters Steuer setzte, war er unentbehrlich.
»Soll ich Sie wirklich nicht hineinbegleiten?«, fragte er zum wiederholten Mal fürsorglich. Die Straße mit ihrem buckligen Kopfsteinpflaster lud nicht gerade zum Flanieren ein. Vielmehr strahlte sie eine Tristesse aus, der sich auch Helene nicht entziehen konnte. Dennoch schüttelte sie den Kopf. Den Gang zu den Kowalskis wollte sie allein bewältigen.
Trotz der Kälte legte sie ihren Pelzüberwurf ab. Angesichts der erbärmlichen Verhältnisse der Gegend kam er ihr unpassend vor. Viele Bewohner der Krahnenbäume hatten alles verloren. Sie waren die wahren Verlierer der Wirtschaftskrise und hatten arge Verluste erlitten. Auch Frau Kowalskis Mann hatte bis 1930 eine kleine Polsterei betrieben. Nach seiner Pleite war er eines Morgens in den Rhein gegangen und nicht mehr herausgekommen. So jedenfalls hatte Helma es Helene berichtet.
Das Reihenhaus der Familie war aus grauen Ziegelsteinen, davor spielten vier Jungen auf der Straße Fußball. Helene schaute die Fassade mit den notdürftig geflickten Fensterscheiben hinauf, und ein kalter Schauer jagte ihr den Rücken hinunter.
»Achtung!«, warnte eines der Kinder. In letzter Sekunde rettete sie sich vor einem heranschnellenden Ball auf den schmalen Bordstein.
Helmut steckte den Kopf aus dem Autofenster. Seine buschigen Brauen hatte er mürrisch nach unten gezogen. »Passt gefälligst auf, wo ihr hin schießt!«, schimpfte er mit väterlicher Strenge.
Helene bedachte die Kinder mit einem nachsichtigen Lächeln. Eines von ihnen klemmte sich den Ball unter den Arm, nuschelte verlegen »Tschuldigung« und lief dann eilends mit den anderen davon.
Helene trat durch die offen stehende Tür des Hauses und gelangte über einen Durchgang in den Hinterhof. Wäscheleinen waren hier gespannt, voll behangen mit Kleidung, die ihre besten Tage hinter sich hatte. Die unterschiedlichsten Gerüche schienen auf wenigen Quadratmetern gefangen. Gemüsesuppe, gebratene Zwiebeln, Fett und Fleisch vermischten sich mit dem Gestank des Mülls, der sich zu einer Seite hin stapelte. Ratten und Mäuse zerpflückten den Abfall auf der Suche nach Fressbarem. Gebrüll, Hundegebell und Kindergeschrei tönten aus den zahlreichen Wohnungen. Ein wenig fühlte Helene sich an das Mietshaus erinnert, in dem sie in Hamburg zusammen mit ihrer Freundin Magda gewohnt hatte. Dort hatte sie damals dasselbe mulmige Gefühl erfasst, das sie beim Betreten des schmutzigen Treppenhauses nun überkam. Ein Mädchen mit zerzaustem Haar und dreckverschmiertem Gesicht hockte auf dem Absatz zur zweiten Etage. Die Kleine schaute mit geöffnetem Mund zu Helene auf. Diese beugte sich zu dem Mädchen hinunter.
»Hallo. Kannst du mir vielleicht sagen, wo genau die Kowalskis wohnen?« Sie gab ihr einen der Dauerlutscher mit Kirschgeschmack, die sie in ihrer Jackentasche verwahrt hatte.
Das Mädchen riss staunend die Augen auf. »Da drüben«, verriet es und deutete auf eine Tür am Ende des Flurs. Helene warf einen Blick über ihre Schulter. Das Kind schnappte sich den Lutscher und rannte blitzschnell die Treppe hinunter und hinaus auf den Hof.
Kindergeschrei und Gepolter waren zu hören, als Helene an die Tür der Kowalskis klopfte. Es dauerte eine Weile, bis jemand öffnete. Ein Junge, etwa zwölf, stand vor ihr. Ungeduldig schaukelte er ein rotwangiges Kleinkind auf dem Arm, das in etwas gehüllt war, das aussah wie ein abgelegtes Herrenhemd.
»Was wollen Sie?«, fragte er misstrauisch.
Mühsam riss Helene sich vom Anblick des Kleinkindes los. »Ist deine Mutter zu sprechen? Ich komme aus der Süßwarenfabrik.«
Seine Züge entspannten sich kaum.
»Darf ich reinkommen?«
Der Junge blieb skeptisch, bis die Tür weiter aufgerissen wurde, und Frau Kowalski persönlich im Rahmen auftauchte.
»Frau Kronenberg. Was machen Sie denn hier?« Sie zog an ihrer Zigarette und scheuchte ihren Sohn mit einer hektischen Handbewegung weg.
»Ich wollte sehen, wie es Franziska geht.«
Frau Kowalski nahm einen Zug von ihrer Zigarette und blies den Rauch neben Helene ins Treppenhaus, dann winkte sie sie hinein. »Beachten Sie die Unordnung nicht. Ich hatte noch keine Zeit aufzuräumen.«
Helene kam in einen Raum, der zum Wohnen und Schlafen genutzt wurde. Es roch muffig. Matratzen lagen auf dem Boden, eng aneinandergereiht und gegen die Wand geschoben. Die Zimmerdecke war grau-weiß gesprenkelt. Vier Kinder im Alter von drei bis acht Jahren lieferten sich eine erbitterte Kissenschlacht.
»Normalerweise lasse ich niemanden rein.« Frau Kowalski führte Helene durch die enge Küche. Ein dampfender Topf stand auf dem kleinen Ofen in der Ecke und verströmte penetranten Fischgeruch. Helene unterdrückte einen Würgereiz. Sie brachte eine Hand vor die Nase und atmete durch den Mund.
»Darf ich Ihnen was anbieten? Ein Glas Wasser, ’nen Kaffee?«, fragte Frau Kowalski.
»Nein danke«, brachte Helene stockend hervor. Ihr war flau im Magen. Kalter Schweiß benetzte ihre Stirn. Frau Kowalski hob stöhnend die Oberlippe an.
»Oha, ich erinnere mich nur zu gut an diesen Zustand. Sind Sie sicher, dass Sie kein Glas Wasser wollen?«
Helene ließ kurz ihren Blick über das schmutzige Geschirr auf dem Esstisch schweifen und schüttelte den Kopf.
Frau Kowalski entging ihre Abneigung nicht. »Es ist nicht gerade geräumig hier, und wir brauchen jeden Zentimeter.« Sie klang weniger beschämt als rechtfertigend.
»Zwei Zimmer? Für Sie alle?« Helene brachte das Problem auf den Punkt.
»Muss reichen.« Frau Kowalski drückte ihre Zigarette in einer Pfanne mit Fettresten aus. »Mehr kann ich mir nicht leisten. Nachdem mein Mann gestorben ist, mussten wir aus dem Vorderhaus ausziehen. War ’ne schöne Wohnung mit ausreichend Platz für uns alle.«
»Tut mir leid, das zu hören.«
»Ist nun mal so.« Sie presste die Lippen aufeinander. »Wir hatten Glück, dass wir hier untergekommen sind.«
Helene hob unmerklich die Brauen darüber, dass Frau Kowalski von Glück gesprochen hatte. Sie empfand die Bleibe der Familie als schockierend. Nie hätte sie gedacht, dass Angestellte der Fabrik so hausten. Die Kinder sahen mager und verwahrlost aus, ihre Mutter erschöpft. Helene fühlte sich schlecht, weil es ihr im Vergleich zu ihnen an nichts fehlte. Ihr Kind würde nicht in einem feuchten Zimmer schlafen und von einem Tisch essen müssen, unter dem sich der Mäusekot türmte. Ein solches Leben war kein Leben.