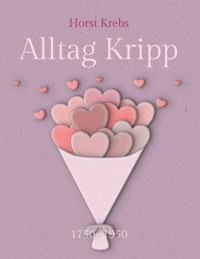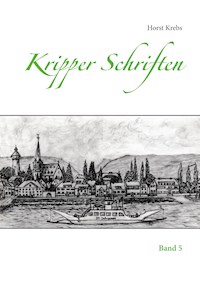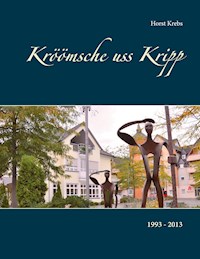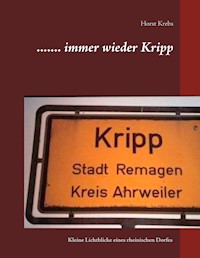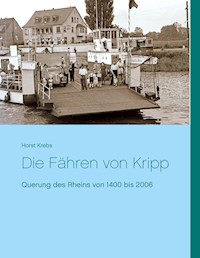
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Klein und versteckt in der Ecke von Rhein und Ahr. Ganz bestimmt nicht Kripp. Kripp hat Großstadtcharakter. Das belegen die Zahlen. Durch Kripp sind mittlerweile über 100 Millionen Fahrzeuge gefahren, der Fähre wegen, die hier am Ort den Querverkehr über den Rhein sicherstellt. Über 250 Millionen Menschen sind bislang, im Auto sitzend, zu Fuß, auf dem Motorrad oder mit dem Fahrrad gefahren, um die dortige Fähre zu benutzen. Das sind dreimal mehr, wie Deutschland Einwohner hat. Keine Großstadt in Deutschland kann das vorweisen, und somit ist es auch verständlich, dass heute nur die größten Fähren auf dem Rhein hier in Kripp ihre Heimat haben. Kripp hat Großstadtcharakter. Nicht zu vergessen die Millionen von Schiffen, die im Kripper Leben schon an Kripp vorbeigefahren sind und den Fähren beim Querverkehr zugeschaut haben. Täglich schwimmen tausende von Fischen an den Kripper Fähren vorbei. Für die vielen Touristen auf den Ausflugsbooten sind die Fähren ein abwechslungsreiches Highlight. Die Lebendigkeit unseres Dorfes wurde stets durch unsere Fähren geprägt. Dafür danken wir im Sommer mit bunten Fahnen und blühenden Blumen auf der Rheinufermauer. Die Fähren legen ab Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden eine Pause ein, erst dann geht auch Kripp zur Ruhe. Wie oft saß ich hier am Rhein auf der Uferbank und sah dem Treiben der Fähren zu. Noch heute höre ich die Geräusche, wenn die Autos von den Fährrampe herunterfahren. Dieses Klacken ist tief in mir eingebrannt. Horst Krebs
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Kripper Fähren 1400-1800
Kripper Fähren 1800-1914
Kripper Fähren 1920-1933
Kripper Fähren 1933-1952
Kripper Fähren 1954-2006
Gierponte/Querseil 1893-1937
Motorfähre Franziska 1937
Fähre Finte
Fähre St. Martin
Fähre Johannes
Fähre Stadt Linz 1971-1997
Quellenverzeichnis
Kripper Fährboote ab 1905
Fährnotizen von Weis/Funk
Fährbilder
Über den Autor
Vorwort
Klein und versteckt in der Ecke von Rhein und Ahr. Ganz bestimmt nicht Kripp.
Kripp hat Großstadtcharakter. Das belegen die Zahlen. Durch Kripp sind mittlerweile über 100 Millionen Fahrzeuge gefahren, der Fähre wegen, die hier am Ort den Querverkehr über den Rhein sicherstellt. Über 250 Millionen Menschen sind bislang, im Auto sitzend, zu Fuß, auf dem Motorrad oder mit dem Fahrrad gefahren, um die dortige Fähre zu benutzen. Das sind dreimal mehr, wie Deutschland Einwohner hat. Keine Großstadt in Deutschland kann das vorweisen, und somit ist es auch verständlich, dass heute nur die größten Fähren auf dem Rhein hier in Kripp ihre Heimat haben.
Kripp hat Großstadtcharakter. Nicht zu vergessen die Millionen von Schiffen, die im Kripper Leben schon an Kripp vorbeigefahren sind und den Fähren beim Querverkehr zugeschaut haben. Täglich schwimmen tausende von Fischen an den Kripper Fähren vorbei. Für die vielen Touristen auf den Ausflugsbooten sind die Fähren ein abwechslungsreiches Highlight.
Die Lebendigkeit unseres Dorfes wurde stets durch unsere Fähren geprägt. Dafür danken wir im Sommer mit bunten Fahnen und blühenden Blumen auf der Rheinufermauer.
Die Fähren legen ab Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden eine Pause ein, erst dann geht auch Kripp zur Ruhe. Wie oft saß ich hier am Rhein auf der Uferbank und sah dem Treiben der Fähren zu. Noch heute höre ich die Geräusche, wenn die Autos von den Fährrampe herunterfahren. Dieses Klacken ist tief in mir eingebrannt.
Horst Krebs
Kripper Fähren 1400 – 1800
von Alex Bohrer
Schon lange bevor die Fährgesellschaft Linz-Kripp GmbH die Rheinfahrt aufnahm, gab es bereits Fährverbindungen zwischen Linz und Kripp. Durch die Jahrhunderte hindurch hat man diese Verbindung auch gerne als "Brücke zwischen Westerwald und Eifel" bezeichnet. Die hier genannten Informationen und Belege wurden zum Teil von mir selbst recherchiert oder aus zuverlässigen Quellen übernommen. Aufgrund des umfangreichen Materials stellt die nachfolgende Übersicht nur einen Ausschnitt dar, ein gesamter zeitlicher Abriss bis ins Detail würde zu umfangreich werden und den Umfang der Seite sprengen. An dieser Stelle auch meinen besonderen Dank an Frau Rönz vom Stadtarchiv Linz, die mir sehr hilfreich zur Seite gestanden hat, sowie an Herrn Langes und entsprechend Herr Krebs aus Kripp, sowie an all die anderen, welche Fotos und Informationsmaterial zur Verfügung gestellt haben.
"Seit 550 Jahren besteht zwischen der "Bunten Stadt Linz" und dem Remagener Ortsteil Kripp eine Fährverbindung über den Rhein, die in alten Unterlagen im Linzer Stadtarchiv und in der Chronik der Rheinfähre als Rheinfahrt bekannt ist. Josef Siebertz stellt in seinem Beitrag zur Geschichte der Rheinfähre im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz fest, daß die Fährgerechtsame von je her im Linzer Besitz war. Sinzig lag an der drei Kilometer vom Rhein entfernten alten Römerstraße und hatte deshalb kein Fährrecht. Im zurückliegenden halben Jahrtausend gab es für den Fährbetrieb bewegte Zeiten. Aus kleinen Anfängen entwickelte sich das Fährunternehmen zum heutigen Großbetrieb. Das Unternehmen Fähre ist für die Städte Linz und Remagen ein beachtlicher Wirtschaftsfaktor. Die Fährgesellschaft verfügt über zwei leistungsfähige Autogroßfähren, die jährlich rund 870.000 Personen und 830.000 Fahrzeuge von einem zum anderen Ufer des Rheins bei täglich durchschnittlich 150 bis 160 Fahrten befördern. Die Fährverbindung Linz-Kripp ist die größte und modernste ihrer Art im hiesigen Raum als Brücke zwischen Westerwald und Eifel."
…. so Hermann Josef Fuchs in seinem Artikel aus dem Heimatjahrbuch des Kreis Ahrweiler 1995.
"Die Einrichtung einer Fähre oder einer Übersetzungsgelegenheit wird immer nur dort eingerichtet werden können, wo die Besiedlung an beiden Ufern gegeben ist. Eine beiderseitige Besiedlung lässt sich aus den früheren Ortsnamen der in Betracht kommenden heutigen Städte Linz, Remagen und Sinzig nachweisen, und zwar aus dem römischen Namen der Städte. Ortsnamen mit den römischen Endungen auf *lacum-lentiacum-Linz, *sentiacum-Sinzig und *agus rigemagus-Remagen deuten auf frühere keltische Siedlungen hin. Die Römer benutzten bei ihrem Vordringen ins Rheinland um 100 v.Chr. die vorhandenen keltischen Siedlungen zur Anlage ihrer Castelle und so entstanden Remagen und Sinzig.
Linz selbst ist nie ein Kastell gewesen, es lag außerhalb des bei Rheinbrohl endigen Grenzwalls des Limes, aber aus der Ähnlichkeit der beiden Namen Lentiacum und Sentiacum ist wohl eine nähere Beziehung dieser beiden Siedlungen sehr wahrscheinlich. Hinzu kommt noch, dass der Name lentiacum von dem keltischen Wort linter, der Kahn, abgeleitet sein soll, also auf eine Kahnverbindung in keltischer Zeit hinzudeuten scheint.
Dass Handelsbeziehungen von Ufer zu Ufer in der römischer Zeit vorhanden gewesen sind, ergibt sich daraus, dass die Römer die Kupfergruben bei Rheinbreitbach bereits ausgebeutet haben, während bei Sinzig Ziegeleien bestanden haben.
Von der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. an beginnt der Zerfall des römischen Reiches am Rhein; es wird im 5. Jahrhundert von dem Reich der Franken abgelöst, das sich auf beiden Seiten des Rheines ausdehnte. In Sinzig entstand ein Palast der Frankenkönige, der auch im 8. Jahrhundert von Karl dem Großen des öfteren besucht sein soll. Auf der rechten Rheinseite bestand in und bei Linz größere fränkische Siedlungen, wie aus umfangreichen Gräberfeldern nachzuweisen ist, und es ist wohl selbstverständlich, das zwischen diesen Siedlungen und dem fränkischen Hof in Sinzig Beziehungen bestanden haben. Von den zahlreichen Siedlungen im hiesigen Rheintal entwickelten sich Linz, Remagen und vor allem die Königspfalz Sinzig zu mittelalterlichen Städten, die andere Siedlungen an Größe bei weitem übertrafen und zu einer gewissen Bedeutung gelangten. Die ersten urkundlichen Nachrichten über diese Städte finden wir z. B. über Linz aus dem Jahre 873 und Remagen und Sinzig um das Jahr 1000.
Im 13. Jahrhundert erhalten die 3 Orte Stadtrechte, und ungefähr zur gleichen Zeit entstehen in den 3 Städten verhältnismäßig bedeutende Kirchenbauten, von denen die Kirche in Sinzig baugeschichtlich die bedeutendste ist. Auch diese gemeinsame Entwicklung der 3 Städte gibt uns die Gewissheit, das damals schon sicherlich ein reger Verkehr von Ufer zu Ufer stattgefunden hat. Kann man aus den geschichtlichen Zusammenhängen auch nur auf das Bestehen eines Fährverkehrs schließen, so haben wir die ersten urkundlichen Nachrichten über ein Fährrecht der Stadt Linz in dem Stadtarchiv der Stadt Linz, das bis ins Jahr 1325 zurückgeht."
Quelle: Stadtbaurat i.R. Walter Fuchs in seiner Rede zur Einweihung der Querseilfähre am 7. Juli 1948 im Lokal "Zur Fähre" in Kripp
Einen weiteren Hinweis auf eine bereits früher bestehende Fähre oder Übersetzmöglichkeit findet sich in der Geschichte der Pfarerei St. Martin, aufgeschrieben von Wilhelm Bretz, veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz.
Nach der Chronik von Krumscheid sollen die Linzer die St. Michaelskapelle neben der Pfarrkirche für die erste Linzer Kultstätte halten. Entspricht das der Wirklichkeit, dann war das jene Kapelle in Lensi (Linz), von welcher der Gerichtsschreiber Karls des Großen, Einhard, behauptet er habe die Kapelle verwüstet aufgefunden. 828 besichtigt Einhard ein Gut in Lohrsdorf und setzte bei Sinzig / Ahr über den Rhein. Die Nähe von Sinzig und Lohrsdorf läßt darauf schließen, das Lensi gleich ist mit dem damals in einer Urkunde genannten Linchesce.
Quelle:"Aus der Geschichte der Rheinfähre Linz-Kripp" von Josef Siebertz veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz.
Einen weiteren Hinweis auf eine bereits früher bestehende Fähre oder Übersetzmöglichkeit findet sich in der Geschichte der Pfarerei St. Martin, aufgeschrieben von Wilhelm Bretz, veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz.
Nach der Chronik von Krumscheid sollen die Linzer die St. Michaelskapelle neben der Pfarrkirche für die erste Linzer Kultstätte halten. Entspricht das der Wirklichkeit, dann war das jene Kapelle in Lensi (Linz), von welcher der Gerichtsschreiber Karls des Großen, Einhard, behauptet er habe die Kapelle verwüstet aufgefunden. 828 besichtigt Einhard ein Gut in Lohrsdorf und setzte bei Sinzig / Ahr über den Rhein. Die Nähe von Sinzig und Lohrsdorf läßt darauf schließen, das Lensi gleich ist mit dem damals in einer Urkunde genannten Linchesce.
Quelle:"Aus der Geschichte der Rheinfähre Linz-Kripp"von Josef Siebertz veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz.
12.Dezember 1409 / Die älteste urkundliche Nachricht
Bei meinen Recherchen zu dieser Chronik stieß ich auf verschiedenste Unterlagen, in denen von der ältesten, urkundlichen Nachricht zur Rheinfahrt gesprochen wurde. Bedenkt man dabei, wann diese Chroniken entstanden sind und das dem Schreiber eventuell damals meine Quellen noch nicht bekannt oder auch noch nicht zugänglich waren und wenn man davon ausgeht, das die Archive jährlich tausende von Dokumenten neu sichten, archivieren und verfügbar machen, so ist es nicht verwunderlich, das es unterschiedliche Aussagen zur ältesten, urkundlichen Nachricht über die Rheinfahrt gibt.Nach dem derzeitigen Stand befindet sich die älteste, urkundliche Nachricht im Landeshauptarchiv in Koblenz. Auf einem Pergament, datiert auf den 12. Dezember 1409 bekennen die Eheleute Hermann und Styne Uplader, und Johann und Katharine Kannroder, das die Stadt Linz Ihnen das Fahr daselbst in Erbleihe gegeben hat.
Quelle: Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 2, Urkunde 373
1411 / Die zweitälteste, urkundliche Nachricht
"Die Bürgermeisterrechnungen der Stadt gehen zurück bis zum Beginn des 15.Jahrhunderts. Im Jahre 1411 erscheint unter den Einnahmen der Stadt die erste Fährpacht; der Bürgermeister bescheinigt, das er an Pacht für das “Fahr” 20 Mark erhalten habe."
Quelle: Stadtbaurat i.R. Walter Fuchs in seiner Rede zur Einweihung der Querseilfähre am 7. Juli 1948 im Lokal "Zur Fähre" in Kripp
02.Mai 1443 / Pachtbrief des Linzer Bürgers Schade
"Beurkundet ist, daß Jakob Schade, Bürger zu Linz, für sich und Katharina, seine eheliche Tochter, erblich gelehnt hat, vom Bürgermeister, Rat und ganze Gemeinde Linz den Teil und die Rechte, die sie hat an dem „Var zu Lynss". Hierfür waren 20 Mark Erbzins an die Stadt zu zahlen, und zwar jährlich auf Maria Lichtmeß, wie es in dem Kirchspiel Recht und Gewohnheit war. Als Sicherheit gab Schade der Stadt Linz seinen Anteil am Haus, "dat gelegen is bynnen Lynns up der Bach" nebst Kelterhaus, Stallungen und Hof mit Zubehör zu einem Drittel."
Diese Pachteinnahmen für das "Fahr" erscheinen nun fortlaufend, fast lückenlos in den Linzer Stadtrechnungen bis ins 18. Jahrhundert hinein.
Quellen:
1) Die Rheinfähre – Brücke zwischen Westerwald und Eifel ...Artikel von Hermann Josef Fuchs nach einem originalem Text von Willy Weis.
2) Seit 550 Jahren ist die Rheinfähre Brücke zwischen Westerwald und Eifel ….. Artikel aus dem Heimatjahrbuch des Kreis Ahrweiler von 1995 von Hermann Josef Fuchs nach originalem Text von Willy Weis
3) "Aus der Geschichte der Rheinfähre Linz-Kripp" von Josef Siebertz veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz.
01.Mai 1597 / Verpachtung an die Eheleute Gressenich
Am 1. Mai 1597 sind die Eheleute Weynand und Gertrude Gressenich, Bürger zu Linz, mit dem "Fahr" für 24 Jahre belehnt worden. Gressenich war Nachfolger von Erhard von Erenberg und Grietgen Bieschoffs. Nach dem Tode von Gressenich übernahm Sohn und Schwiegertochter das Fahr. Als Pacht war an die Stadt jährlich 18 Taler am 1. Mai zu zahlen. In dem sehr ausführlichen Pachtprotokoll steht zu lesen:
Das "Fahr" wird an Weynand Gressenich verpachtet mit allen seinen Rechten und Gerechtigkeit, Lust und Unlust für 24 Jahre mit einem Kündigungsrecht nach 12 Jahren für 12 Taler, jeden Taler 8 Mark". Der Pächter verpflichtet sich, das "Fahr" mit aller notdürftigen und gewöhnlichen Schiffung (Fährgerätschaften) zu versehen und in gutem Bau zu erhalten. Niemand darf lange über Gebühr aufgehalten und übervorteilt werden, sondern für billige rechtmässige Belohnung nach Gestalt und Gelegenheit der Fracht, Zeit vom Jahr, Eis, Wind und Wetter nach beigefügtem Verzeichnis übergesetzt zu werden. Der Pächter muss sich eidlich verpflichten, dass niemand "durch Missbau und Mängel der Schiffung, durch langen Vollzug Aufhaltung oder sonst zu Schaden, Nachteil oder Versäumniss komme", andernfalls die Stadt das Recht hat, die Pacht sofort aufzulösen.
Dem Pachtprotokoll beigefügten Tarif hier mit anzuführen, dürfte sich erübrigen, da der Tarif auf Alben und Heller lautet, welche mit dem heutigen Gelde in keinerlei Verbindung gebracht werden können. Bemerkenswert ist jedoch, dass der Fährpächter das Recht hatte,
"wenn das Rheinwasser gewachsen, dass es über das Brücklein vor der Pforten (gemeint ist das Rheintor) steige, ein Drittel mehr, wenn es in der Pforte steht, ein Halb mehr" nehmen darf; "wenn es noch höher steigt, oder in des Winters kalten Zeit mit Eisgang, dar nach Gelegenheit der Mühe Arbeit und Gefahr genommen warden, aber niemand darf übernommen warden, damit zu keener Zeit Klagen vorkommen sollen".
Die Fährgeräte bestanden damals aus Nachen für Personen und einer Schalde für Fahrzeuge und Vieh. Der Fährpächter hatte die Verpflichtung, die Fährgeräte auf eigene Kosten anzuschaffen und zu unterhalten. Bei Aufhören der Pacht wurden die Geräte taxiert und der neue Pächter musste dem alten den Taxwert bezahlen.
Quellen:
1) Die Rheinfähre - Brücke zwischen Westerwald und Eifel von Hermann Josef Fuchs nach einem originalem Text von Willy Weis.
2) Seit 550 Jahren ist die Rheinfähre Brücke zwischen Westerwald und Eifel ...... Artikel aus dem Heimatjahrbuch des Kreis Ahrweiler von 1995 von Hermann Josef Fuchs nach originalem Text von Willy Weis .
3) "Aus der Geschichte der Rheinfähre Linz-Kripp" von Josef Siebertz veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz.
01.Mai 1604 / Verpachtung an Johannes von Pittersdorf
Am 1. Mai 1604 wird in den Akten vermerkt, daß Johannes von Plittersdorf die Linzer Fahr für 12 Taler jährlich gepachtet hat
Quellen:
2) Seit 550 Jahren ist die Rheinfähre Brücke zwischen Westerwald und Eifel …... Artikel aus dem Heimatjahrbuch des Kreis Ahrweiler von 1995 von Hermann Josef Fuchs nach originalem Text von Willy Weis
3) "Aus der Geschichte der Rheinfähre Linz-Kripp" von Josef Siebertz veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz
30. Juni 1665 / Verpachtung an den Schiffer Jost
Aktenvermerk: Pächter der Rheinfahrt wird der "ehrsame und tugendsame" Schiffer Jost Reifferscheid. Er schließt einen Pachtvertrag über 24 Jahre.
Quellen:
2) Seit 550 Jahren ist die Rheinfähre Brücke zwischen Westerwald und Eifel ….. Artikel aus dem Heimatjahrbuch des Kreis Ahrweiler von 1995 von Hermann Josef Fuchs nach originalem Text von Willy Weis
3) "Aus der Geschichte der Rheinfähre Linz-Kripp" von Josef Siebertz veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz
20. Oktober 1705 / Gründung von Kripp
Der Name „Kripp“ findet seine erste Erwähnung 1474 als Gemarkungsbezeichnung. Die Urkunde berichtet von kaiserlichen Truppen, welche die Stadt Linz im burgundischen Krieg vom gegenüberliegenden Ufer, der Kripper Seite, aus belagerten. Möglicherweise geht der Name zurück auf Futterstellen, die dort eingerichtet worden waren für die Treidelschiffer, die die Lastkähne mit Pferdegespannen gegen die Strömung den Rhein hinaufzogen.
1575 jedenfalls beschwerten sich Remagener Bürger bei Kaiser Rudolf II, weil Linz solche Futterstellen betrieb. Ursache war sicherlich nicht nur der Betrieb von Futterstellen für die Treidelschiffer, sondern so darf vermutet werden, dass die Linzer auf diese Weise auch das Remagener Stapelrecht unterliefen. Das Stapelrecht ist ein Monopol auf den Handel mit den Kaufleuten, deren Waren die Treidelschiffer, als ihren Beruf, beförderten. Der Handel war nur an bestimmten Orten erlaubt. Die Städte, die dieses Privileg hatten, nutzten es und erhoben Steuern. Der Schwarzhandel der Linzer führte also unmittelbar zu Steuerausfällen in Remagen. Der Remagener Ärger war um so größer, da das ganze auch noch auf Remagener Gebiet stattfand. Die Linzer hatten immer ein Interesse daran, dass ihnen gegenüber ein Ort entstand, so dass sie dort Handel treiben konnten, während Remagen dies zu verhindern suchte.
Der 20.Oktober 1705 war daher, außer für Johann Breuer, wohl auch für Linz ein Freudentag, denn an diesem Tag erhielt der genannte die Baugenehmigung für das erste Haus in Kripp durch Jan Wellem, dem Kurfürst von der Pfalz und Herzog von Jülich-Berg. Was waren aber die Motive des Kurfürsten? Warum verärgerte er seine eigene Stadt, Remagen, zugunsten der fremden Stadt Linz? Wir dürfen vermuten, dass der Kurfürst hier einen Angriff auf das Fährrecht führte. Dieses lag bei der Stadt Linz. Nachweislich hat Linz dieses Recht seit 1473 ausgeübt. Es verpachtete dieses Recht an den Meistbietenden. 1706 vergab Jan Wellem ebenfalls ein Fährrecht und konnte sich erst jetzt darauf berufen, dass ja auf der linken Seite ebenfalls eine Besiedlung vorhanden, wo bis dahin nur eine Haltestelle für die Pferde war, die die Schiffe auf dem Leinpfad zu Berge zogen.
Quellen:
Chronik Kripp Herausgeber Traditionsverein Kripp, Dr. Peter Ockenfels
Am 28. Juni 1706 kam es zum Fährkrieg, als der kurfürstliche Vogt zu Sinzig tags zuvor eigenmächtig die Überfahrt für 69 Goldgulden (*6) an den Remagener Bürger Christian Unkel verpachtete, obwohl das Fährrecht im Besitze der Stadt Linz war. Am 28. Juni 1706 frühmorgens, wurde unmittelbar nach der ersten Überfahrt der Fährflachen des Bürger Unkel von einem Linzer Beauftragten festgehalten. Voller Zorn hierüber wurde auf Geheiß des Kurfürsten zu Pfalz der Sinziger Vogt beauftragt, das Vermögen der kölnischen Bürger in Linz zu beschlagnahmen. Die Reaktion hierauf war, daß Soldaten der kurkölnischen Garnison in Linz am 27. November 1709 (*6) das jülische Territorium in Kripp überfielen und die Schiffe des Pächters Unkel entwendeten. Es war Kleinkrieg, der für die Beteiligten erheblichen Schaden mit sich brachte.
1730 wurde ein Vergleich geschlossen zwischen dem Kölner Domkapitel und dem Kurfürsten zu Pfalz in seiner Eigenschaft als Herzog zu Jülich-Kleve-Berg. Sinzig durfte die Überfahrt von Kripp nach Linz nicht mehr behindern. Die kurpfälzische Regierung mußte den Schaden ersetzen, der den kurkölnischen Beamten, den Linzer Bürgern und Eingesessenen durch die im Jahre 1706 erfolgte Beschlagnahme ihres Eigentums entstanden war. Die Stadt erklärte sich bereit, jährlich 6 Goldgulden an die kurfürstliche Kasse zu Sinzig zu zahlen.
Quellen:
1) Die Rheinfähre - Brücke zwischen Westerwald und Eifel von Hermann Josef Fuchs nach einem originalem Text von Willy Weis.
2) Seit 550 Jahren ist die Rheinfähre Brücke zwischen Westerwald und Eifel …. Artikel aus dem Heimatjahrbuch des Kreis Ahrweiler von 1995 von Hermann Josef Fuchs nach originalem Text von Willy Weis .
3) "Aus der Geschichte der Rheinfähre Linz-Kripp" von Josef Siebertz veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz.
4) www.Geschichte-Kripp.de Horst Krebs
1730 / Ende Fährkrieg
Nach Beendigung des Fährkriegs wurde die Rheinfahrt an den Meistbietenden verpachtet. Im Ratsprotokoll heißt es bei der Ausbietung:"Gott sei höchster Dank! daß am Nikolausabend die Fahr wiederum zuerst in wirklichen Besitz und Gebrauch genommen sei.“
Von den Schiffsleuten waren bei der Ausbietung erschienen:
Johann Merenfeldt, Gerhard Hertgen, Johann Hertgen, Augustin Mengelberg jun. und Johann Richarz, sodann aus der Bürgerschaft Koch und Anton Heckener. Der Rat hatte als Pacht 300 Taler angesetzt. Die Bieter mußten ihr Gebot auf den „Leyen" (Schiefertafel) schreiben. Es wurde bei brennenden Kerzen geboten, und als von den übrigen keiner mehr bot, wurde dem Meistbietenden bei ausgebrannter Kerze Glück gewünscht. Johannes Richarz, gebürtig aus Königswinter, wohnhaft in Linz, blieb bei 221 Talern Meistbietender. Er erhielt den Zuschlag auf die Dauer von 12 Jahren. Der Fährtarif ist den Pachtbedingungen beigefügt und der Pächter hat, wie üblich, sämtliche Geräte zu beschaffen und ist verpflichtet, fleissig überzufahren und nicht zu warten, bis viele Leute zusammen sind. In einem Zusatz, 6 Jahre später wird vereinbart, dass der Pächter Notfahrten von Andernach bis Bonn für die Stadt kostenlos auszuführen hat, wofür ihm nur die nötigen Pferde bezahlt werden. Ferner hatte er Militär kostenlos überzufahren und auch den Postbriefträger aus Niederbreisig, der montages, mittwochs und samstags die Briefe nach Linz brachte.
Quellen:
1) Die Rheinfähre - Brücke zwischen Westerwald und Eifel von Hermann Josef Fuchs nach einem originalem Text von Willy Weis.
2) Seit 550 Jahren ist die Rheinfähre Brücke zwischen Westerwald und Eifel ….. Artikel aus dem Heimatjahrbuch des Kreis Ahrweiler von 1995 von Hermann Josef Fuchs nach originalem Text von Willy Weis
.
3) "Aus der Geschichte der Rheinfähre Linz-Kripp" von Josef Siebertz veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz.
1742 / Verpachtung an den Schiffer Nonn
Aktenvermerk: 1742 pachtete der Schiffer Johann Peter Nonn die Rheinfahrt für 226 Taler jährlich auf die Dauer von 12 Jahren.
Quellen:
2) Seit 550 Jahren ist die Rheinfähre Brücke zwischen Westerwald und Eifel ….... Artikel aus dem Heimatjahrbuch des Kreis Ahrweiler von 1995 von Hermann Josef Fuchs nach originalem Text von Willy Weis .
3) "Aus der Geschichte der Rheinfähre Linz-Kripp" von Josef Siebertz veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz.
1761 / Verpachtung an Johann Kaff
Des öfteren kamen an die Stadt Klagen der Fährpächter, so z.B. dass die Linzhausener und Leubsdorfer, Personen und Waren übersetzten, oder zum Remagener Markt beförderten, wodurch dem Fährpächter Schaden entstand, denn die Fährgerechtsame der Stadt Linz erstreckte sich von Kasbach bis nach Ariendorf, also in dem Bereich des Kirchspiels Linz.
1761 ist Johann Kaff als Pächter der Rheinfahrt vermerkt. Er beschwert sich darüber, das die Franzosen die Schalde nach Köln und die Nachen nach Koblenz fortgeholt haben und der Fährbetrieb so 2 Monate lang still lag. Gleichfalls wurde Ihm 1761 die Pacht auf 200 Taler ermäßigt, da er viele französische Truppen unentgeltlich hatte übersetzen müssen.
Quellen:
1) Die Rheinfähre - Brücke zwischen Westerwald und Eifel von Hermann Josef Fuchs nach einem originalem Text von Willy Weis.
2) Seit 550 Jahren ist die Rheinfähre Brücke zwischen Westerwald und Eifel Artikel …...... aus dem Heimatjahrbuch des Kreis Ahrweiler von 1995 von Hermann Josef Fuchs nach originalem Text von Willy Weis .
3) "Aus der Geschichte der Rheinfähre Linz-Kripp" von Josef Siebertz veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz.
1796 / Besetzung des linken Rheinufers durch Frankreich
1796 besetzte Frankreich das linke Rheinufer und nahm fortan das Fährrecht vom linken zum rechten Ufer in Anspruch, und zwar unter Berufung auf die Tatsache, dass das Fährrecht von links nach rechts Sinzig gehörte, da ja hierfür von der Stadt Linz seit 1730 eine Pacht gezahlt würde.
Quellen:
1) Die Rheinfähre - Brücke zwischen Westerwald und Eifel von Hermann Josef Fuchs nach einem originalem Text von Willy Weis.
2) Seit 550 Jahren ist die Rheinfähre Brücke zwischen Westerwald und Eifel Artikel aus dem Heimatjahrbuch des Kreis Ahrweiler von 1995 von Hermann Josef Fuchs nach originalem Text von Willy Weis .
3) "Aus der Geschichte der Rheinfähre Linz-Kripp" von Josef Siebertz veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz. .
Kripper Fähren 1800 – 1914
von Alex Bohrer
1803 – 1805
Nachdem Linz 1803 an das Fürstentum Nassau-Usingen gekommen war, wandte sich der Stadtrat am 1. Februar 1804 an den Fürsten zu Nassau mit der Bitte, bei den französischen Präfekten in Koblenz zu vermitteln, dass ihr wieder das alleinige Überfahrtsrecht zugestanden werde. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass die Stadt durch die vielen Kriegsjahre und die schlechten Zeitumstände sehr gelitten habe und auf eine Verbesserung der Lebenshaltung ihrer Einwohner bedacht sein müsse. Für die Rheinüberfahrt solle eine fliegende Schiffsbrücke geschaffen werden, um den Verkehr über den Rhein zu regeln. Bevor dieses geschehe, müsse aber die alleinige Fährgerechtsame der Stadt Linz geregelt werden. Der Präfekt zu Koblenz entschied. dass, wenn die Behauptungen der Stadt Linz wahr seien, dieser ihr altes Recht wieder eingeräumt werden müsste.
Aus späteren Akten geht hervor, das er keinen Erfolg hatte und so wurde 1805 das Rheinfahr, wie es dermalen ist, verpachtet mit dem Bemerken, sollte während dieser Zeit das ganze Rheinfahr, so wie es vor dem Kriege war, wiederum der Stadt allein belassen warden, so solle diese Pachtung ipso jure aufhören.
In den Pachtbedingungen ist noch bemerkt, dass der Pächter verpflichtet ist, alle halbe Stunde überzufahren, falls auch nur eine Person vorhanden ist. Sollten aber mehrere da sein, so muss gleich gefahren werden. Ferner muss der Schiffer bei einer Strafe von 3 Reichstaler entweder an der Überfahrt oder in der Bürgernachtstube anwesend sein, damit Fremde beim Überfahren nicht aufgehalten werden.
Quelle:*4, 6
1814 – 1820
Als 1814 die Rheinlande preussisch wurden, erneuerte die Stadt wieder ihre Ansprüche auf das alleinige Überfahrtsrecht. Am 27.Juli 1817 erging folgende Entscheidung der Regierung in Koblenz:
"Dass diesem Gesuch aus dem Grunde nicht willfahrt werden kann, weil dieses Recht, insoweit es die Stadt Linz nicht mehr besitzt, durch einen förmlichen, vom Kaiser und Reich bestätigten Friedensschluss an Frankreich abgetreten worden ist, die Stadt Linz also dadurch alle Ansprüche auf die Rheinüberfahrt verloren hat. Es kann derselbe auch dafür ebenso wenig als den übrigen Gemeinden, welche durch die im letzten Pariser Frieden bestärigten früheren Friedensschlüsse etwa Verlust erlitten haben sollten, unsererseits Entschädigung zugestanden werden".
In der Folge wurden nun die Fähre von Linz nach Kripp von der Stadt, umgekehrt vom preussischen