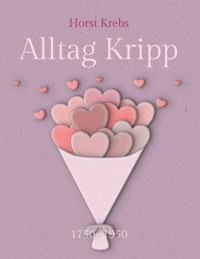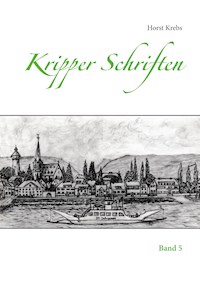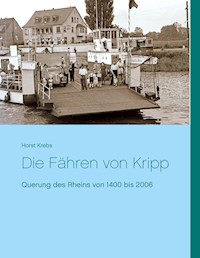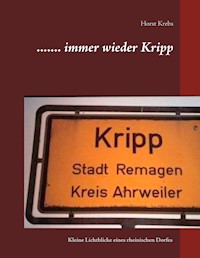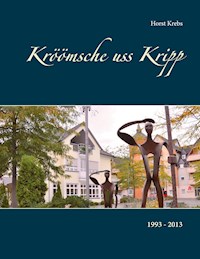
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Buch, dass die Kripper geschrieben haben und wo sie auch die Mitwirkenden sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Zwanzig Jahre Kripp, eigentlich ein langer Zeitraum, bedenkt man, dass der Ort gerade mal 300 Jahre alt wurde, und damit einer der jüngsten Orte in Rheinland Pfalz. Das vorliegende Werk umfasst Kripper Geschehnisse im Zeitraum 1993 bis 2013. Aktivitäten der Vereine, der Ortspolitik, lokaler Geschehnisse, aber auch einzelne Bürger kommen zu Wort. Am Schluss des Buches die Zeitungsartikel, die mein Vater aufbewahrt hatte (1958-1988). Viele Dinge, die in Kripp angedacht wurden, scheiterten oft am Geld, jedoch ist vieles durchgesetzt worden, nicht, weil immer Geld zur Verfügung stand, sondern die Eigeninitiative der Bürger in diesem Ort stark ausgeprägt ist. Der Ort, der 1705 geboren wurde, hat es in seiner Ortschronik schon erwähnt. Die Kripper kämpften damals schon gegen ihre Obrigkeit und blieben, trotz Eingemeindung, immer ein Völkchen für sich. Die Kripper Presseberichte in diesem Buch sind authentisch und spiegeln die Geschehnisse vergangengener Jahrzehnte. Man erkennt die Entwicklung unseres Ortes in baulicher und Generationen übergreifenden Zeiträumen, und man erkennt den Kameradschaftsgeist, der bis heute noch erhalten geblieben ist. Die Presseberichte sollen aber auch eine Aufforderung sein für mein Heimatdorf, ihre Geschichte in ihrer Zukunft weiterzuführen. Wenn wir einmal 300 Jahre weiter denken, wird die Ahr immer noch in den Rhein fließen, und dort, genau an diesem Punkt, werden Kripper leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 920
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
1993 - 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kröömsche uss Kripp 1958-1988
Anhang
Autor
Vorwort
Meinem Aufruf an die Kripper Bevölkerung, mir Presseartikel über unseren Ort Kripp zukommen zu lassen, sind viele Bürger gefolgt. Innerhalb eines Jahres war mein Schuhkarton gefüllt mit Artikeln aus der Presse, die heute einer dieser Quellen dieses Buches wurden.
Ein Buch, dass die Kripper geschrieben haben und wo sie auch die Mitwirkenden sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Zwanzig Jahre Kripp, eigentlich ein langer Zeitraum, bedenkt man, dass der Ort gerade mal 300 Jahre alt wurde, und damit einer der jüngsten Orte in Rheinland Pfalz.
Das vorliegende Werk umfasst Kripper Geschehnisse im Zeitraum 1993 bis 2013. Aktivitäten der Vereine, der Ortspolitik, lokaler Geschehnisse, aber auch einzelne Bürger kommen zu Wort. Am Schluss des Buches die Zeitungsartikel, die mein Vater aufbewahrt hatte (1958-1988).
Viele Dinge, die in Kripp angedacht wurden, scheiterten oft am Geld, jedoch ist vieles durchgesetzt worden, nicht, weil immer Geld zur Verfügung stand, sondern die Eigeninitiative der Bürger in diesem Ort stark ausgeprägt ist.
Der Ort, der 1705 geboren wurde, hat es in seiner Ortschronik schon erwähnt. Die Kripper kämpften damals schon gegen ihre Obrigkeit und blieben, trotz Eingemeindung, immer ein „Völkchen für sich“.
Die Kripper Presseberichte in diesem Buch sind authentisch und spiegeln die Geschehnisse vergangengener Jahrzehnte. Man erkennt die Entwicklung unseres Ortes in baulicher und Generationen übergreifenden Zeiträumen, und man erkennt den Kameradschaftsgeist, der bis heute noch erhalten geblieben ist. Dieser Geist ist eine Fortsetzung meines Artikels „Kripper Dorfleben“ aus den 50er Jahren, des im letzten Jahr erschienenen Buches „..... immer wieder Kripp“.
Die Presseberichte sollen aber auch eine Aufforderung sein für mein Heimatdorf, ihre Geschichte in ihrer Zukunft weiterzuführen. Wenn wir einmal 300 Jahre weiter denken, wird die Ahr immer noch in den Rhein fließen, und dort, genau an diesem Punkt, werden Kripper leben.
Horst Krebs
Kripper Bausschutt-Deponie öffnet im Sommer ihre Tore.
Volumen für acht Jahre Schutzbarriere zum Industriegebiet
Gelbe, braune, graue Tonnen. Noch sieht mancher Bürger rot bei den Sorgen der Entsorgung mit Bio-, Wertstoff-, oder Restmüll. Doch für ausgehobene Erde und unbelasteten Bauschutt brechen bald rosarote Zeiten an. Mitte des Jahres rollen die Laster gen Remagen-Kripp. Dann geht ein Rekultivierungsprogramm in die praktische Phase, das im Jahre '88 mit dem Planfeststellungsverfahren seinen Anfang nahm. Mit mehr als 100 000 Kubikmeter Erdaushub und Bauschutt soll die Kraterlandschaft in der Nähe der Kripper Beton-Union am Sinziger Kreisel verfüllt werden. Die Submission für das ehrgeizige Projekt lief Anfang der Woche an. Wenn die politischen Gremien des Kreistages ihre Zusage gegeben haben, kann die Zuwegung zur Deponie vom Wendehammer "An der Ringofenstraße" im Frühjahr gebaut werden. Und wenn das Wort Deponie fällt, dann entsteht vor den geistigen Augen der Ahrweiler Kreishäusler direkt das Bild von Bürgerdemonstrationen, Widersprüchen und politischen Fensterreden. Da schickt der Umweltfachmann Werner Reichling, direkt ein großes Lob in Richtung des ehemaligen Badeortes. "Zwar gab es im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens einige Anregungen und Bedenken, doch die konnten übernommen oder ausgeräumt werden, so dass das Verfahren mit Hilfe der Bürger zügig über die Bühne gebracht werden konnte."
Im Frühjahr nun will die Kreisverwaltung mit dem für eine Deponie preiswerten 200 000 DM Projekt beginnen. Drei Brunnen, über die ständig der Wasserhaushalt in dem Wassereinzugsgebiet kontrolliert werden soll, sind bereits im Boden. Als erstes wird ein Eingangsgebäude entstehen, in dem die zwei Bediensteten der Deponie Platz finden werden. Bürger und Gewerbetreibende aus den Rheinstädten Remagen, Linz und Kripp werden dann nicht mehr den beschwerlichen Weg nach Leimbach oder den Kettinger Tonwerken auf sich nehmen müssen. Für acht Jahre soll in Kripp Deponieraum für Erdaushub und unbelasteten Bauschutt und Straßenaufbruch zur Verfügung stehen. Die Oedinger Deponie nimmt seit zwei Jahren diese Stoffe nicht mehr auf.
Auf das Wort unbelastet legt Walter Reichling großen Wert, denn das angelieferte Material soll nach Möglichkeit wieder gebrochen und dem Straßenbau zur Verfügung gestellt werden.
Eine mobile Wiederaufbereitungsanlage wird das receyclingfähige Material "schreddern" und somit dem Wirtschaftskreislauf wieder zuführen können. Ein Kataster wird Auskunft darüber geben, wo, wer, was angeliefert hat. Darüber hinaus wird ein Nachweis erforderlich sein, daß es sich bei der Ablieferung um Material handelt, das "nicht mit umweltschädlichen Stoffen verunreinigt wurde". Auch der Erdaushub muß "natürlich gewachsen und nicht verunreinigt sein". Es dürfen infolge der chemischen Zusammensetzungen "keine nachteiligen Veränderungen zu besorgen sein". Denn schließlich grenzt die Deponie an ein als solches ausgewiesenes Biotop. Der Teich der Beton-Union ist schützenswerter Lebensraum für Flora und Fauna und wird auch als erstes durch das Aufschütten eines Walles abgetrennt werden.
Die Verkehrsbelastung wird sich in Grenzen halten, davon gehen die Beamten des Kreishauses aus. Fünf Laster pro Tag ist die durchschnittliche Rechnung. Ein wesentlich höheres Aufkommen kann durch Privatwagen entstehen. Denn für die Bürger wird es möglich sein, in extra aufgestellten Containern auf dem "Wertstoffhof" Glas, Papier und Altmetall zu entsorgen. In einigen Jahren, geht es nach dem Willen der Kreishäusler, soll das kreiseigene Gelände dann mit Eichen und Ulmen bepflanzt werden, nicht nur als biologische Barriere zum Remagener Industriegebiet dienen, sondern auch "Rückzugsraum für alles, was da kreucht und fleucht," sein. Denn die Deponieflächen, so will es die Bezirksregierung, "sind nach Auffüllung so herzurichten und zu gestalten, daß sich ein den derzeitigen Biotopen vergleichbarer Zustand mit vielfältigen Lebensgemeinschaften entwickeln kann".
Rolf Plewa, Quelle: Bonner General-Anzeiger, 23.01.1993, S. 06
Kripper Deponie bald betriebsfertig
Kreis zahlt Kosten von rund 284 000 Mark für Deponie Kreis Ahrweiler.
Der Kreis Ahrweiler baut in Remagen-Kripp eine Deponie für Erdaushub und Bauschutt, wobei diese Stoffe nach Möglichkeiten aufbereitet und wiederverwertet werden sollen. Der Kreisausschuss hatte bereits im April grünes Licht für den Bau der Anlage gegeben. Voraussichtlich am Freitag, 1. Oktober, wird die Deponie ihren Betrieb aufnehmen. Die Kripper Deponie versteht sich nach Angaben der Kreisverwaltung als Abrundung des Entsorgungskonzepts für Erdaushub und Bauschutt. Die Bauschuttdeponie bei Leimbach in der Verbandsgemeinde Adenau ist bald verfüllt. Die neue Anlage bei Kripp entsteht auf einem Grundstück zwischen dem westlichen Ortsrand von Kripp und dem Verteilerkreis. Das genehmigte Verfüllvolumen beträgt rund 95 000 Kubikmeter. Bei einer jährlichen Anliefermenge von geschätzten 12 000 Kubikmeter ergibt sich eine Laufzeit von siebeneinhalb Jahren. Den Kreis kostet die Deponie rund 150 000 Mark. Der Auftrag ging an ein kreisansässiges mittelständisches Tiefbauunternehmen. [ber die anfallenden 150 000 Mark rechnet der Kreis darüber hinaus mit zusätzlichen jährlich anfallenden Kosten von 134 000 Mark für den laufenden Betrieb. Zudem hat die Kreisverwaltung bereits jetzt die erste Teilrekultivierung geplant. Nach den Forderungen des Planfeststellungsbescheides wird die Böschung zum Biotop des Baggersees hin als erstes verfüllt und 1994 rekultiviert. Der weitere Deponiebetrieb wird somit möglichst früh in Richtung Kripp abgeschirmt. Umfangreiche Pläne liegen für das Recycling von Erdaushub und Bauschutt vor. Es ist vorgesehen, alles ankommende Material nach Baustoffarten zu trennen und zu lagern. Die Kreisverwaltung wünscht sich, daß mögliche Stoffe bereits bei der Anlieferung getrennt und sortiert werden. Dann können höherwertige Stoffe in bestehende Recyclingwerke transportiert werden; der übrige Bauschutt wird vor Ort gebrochen, gesiebt und verladen. Die Stoffe sollen vor allem bei kommunalen Bauarbeiten verwendet werden. Einrichtung und Betrieb des Recyclingcenters kosten voraussichtlich mehr als 230 000 Mark.
TRU, Quelle: Bonner General-Anzeiger, 07.08.1993, S. 07
Bauschutt dient in Kripp zur Rekultivierung
Deponie öffnet am Freitag ihre Tore
Nur unbelastetes Material Kapazität für sieben Jahre
Die Entsorgung der jährlich mehr als 100 000 Tonnen Abfall im Kreisgebiet, treibt den Kreishäuslern oftmals die Sorgenfalten auf die Stirn. Die Sorgen mit dem Bauschutt können ab heute nun ad acta gelegt werden, denn am Freitag öffnet die Kripper Bauschutt-Deponie im Industriegebiet ihre Tore. Fällt das Wörtchen "Deponie" im Amt an der Ahrweiler Wilhelmstraße, entsteht vor den Augen der Bediensteten dort direkt das Bild von Bürgerdemonstrationen, Widersprüchen, die auf den Tisch flattern und vom Heiligen Sankt Florian. Nicht so in Kripp, wie Umweltdezernent Walter Reichling in der Vergangenheit immer lobend hervorhob. Die Kripper Bürger und Kommunalpolitiker sahen nicht nur die Notwendigkeit einer Deponie ein, sie betrachten die Verfüllung der ehemaligen Kiesgruben am Eingang des ehemaligen Badeortes als "Möglichkeit der Rekultivierung".
Von der Bauschutt Deponie zum Wertstoffzentrum
100 000 Kubikmeter Erdaushub und unbelasteter Bauschutt sollen nun in der 3,2 Hektar großen Grube untergebracht werden. Damit will der Kreis eine Lücke im Entsorgungskonzept an der Rheinschiene schließen. 40 000 Kubikmeter Bauabfälle landeten im Jahre '92 in den Hausmüll-Deponien Remagen-Oedingen und Brohl-Lützing. Die raren Kapazitäten dieser Halden sollen damit geschont werden. Nicht erfaßt sind dabei die erheblichen Mengen an unbelastetem Materialien, die zur Zeit in den verschiedenen zur Rekultivierung anstehenden bergrechtlichen Grubenbetrieben abgelagert werden. Knapp 300 000 Mark hat die Errichtung der Anlage gekostet, die Hälfte davon trug der Kreis. Mit einer Anliefermenge von 12 000 Kubikmetern jährlich wird im Kreishaus gerechnet. Sieben Jahre soll es dauern, bis die Grube verfüllt ist. Und drei Brunnen wurden in den Boden gelassen, über die ständig der Wasserhaushalt in dem nahe des Wassereinzugsgebietes gelegenen Gelände kontrolliert werden soll. "Unbelastet" muß der angelieferte Bauschutt sein, darauf legte Reichling immer großen Wert. Denn das abgelieferte Material soll nach Möglichkeit wieder gebrochen werden und dem Straßenbau wieder zur Verfügung stehen. Eine mobile Wiederaufbereitungsanlage wird das receyclingfähige Material "schreddern" und somit kann es dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt werden. Jeder Anlieferer wird einen Nachweis erbringen müssen, dass seine Fuhre nicht mit umweltschädlichen Stoffen verunreinigt wurde. Für die Bürger wird es möglich sein, im Wertstoffhof Glas, Papier und Altmetall zu entsorgen. In einigen Jahren soll sich das kreiseigene Gelände, dann mit Eichen und Ulmen bepflanzt, als "biologische Barriere" zum Kripper Industriegebiet präsentieren. Denn die Deponieflächen neben dem vorhandenen "naturgeschützten Biotop" an der Betonfabrik sollen nach dem Willen der Bezirksregierung so hergerichtet werden, "dass sich ein den derzeitigen Biotopen vergleichbarer Zustand vielfältigen Lebensgemeinschaften entwickeln kann."
Rolf Plewa, Quelle:Bonner General-Anzeiger, 29.09.1993, S. 07
Verwertung von Bauschutt schont Umwelt und spart Gebühren
In der Bauschuttdeponie Remagen-Kripp werden derzeit täglich 1 200 Tonnen Material aufbereitet. Dort lässt der Abfallwirtschaftsbetrieb Kreis Ahrweiler (AWB) zurzeit in einer Großaktion den zwischengelagerten Bauschutt aufbereiten.
Eine Fachfirma aus dem Kreis, die jahrelange Erfahrungen im Bauschutt-Recycling vorweisen kann, führt die Arbeiten aus. Dabei kommen einige Schwergewichte zum Einsatz. Die fahrbare Brecheranlage hat ein Eigengewicht von 46 Tonnen, der im Einsatz befindliche Radlader 23 Tonnen. Die Radladerschaufel fasst 4,5 Kubikmeter Bauschutt. Von der fahrbaren Brecheranlage gelangt das gebrochene Material in eine radmobile Siebanlage, die den Bauschutt in verschiedene Korngrößen trennt. Magnetabscheider an Brecher und Siebanlage sorgen dafür, dass kein Eisen in das Endprodukt gelangt. Eine Bandwaage dokumentiert die genaue Leistung.
Der in Kripp gewonnene neue Baustoff wird zur Herstellung einer Gasdrainageschicht beim Bau der Oberflächenabdichtung auf der ehemaligen Deponie Brohl-Lützing verwendet.
Das sauber aufbereitete Recyclingmaterial dient als gleichwertiger Ersatz für natürliche Schuttgüter. Gleich zwei positive Nebeneffekte werden durch die Recycling-Aktion erzielt. Zum einen werden die natürlichen Ressourcen geschont, zum anderen werden die Gebührenzahler entlastet.
WTZ, Quelle: Bonner General-Anzeiger, 07.05.2002, S. 06
Hochwasser in Kripp
Der Spagat mit der Rechtsverordnung
Grundsätzliches Ja zum Umweltschutz. Hoffen auf Ausnahmegenehmigungen
Heute im Ortsbeirat
Grundsätzliche Zustimmung signalisierten gestern die Ortsvorsteher der Remagener Innenstadt, Kripp, Oberwinter und Rolandswerth zur "Rechtsverordnung zur Festlegung der Überschwemmungsgebiete" wenn Ausnahmen erlaubt sind. Über diese wird in Zukunft die Koblenzer Bezirksregierung entscheiden, die um Stellungnahme zum Entwurf bittet.
"Wir können nicht jammern, wenn das Wasser kommt, und uns nicht drum scheren, wenn es weg ist," brachte Paul Dinkelbach (CDU) gestern sein grundsätzliches Ja zu den Plänen der Bezirksregierung zum Ausdruck. Mit Einschränkungen. Da befürchtet der kernstädtische Ortsvorsteher schon "starke Einwirkungen auf das Geschehen in der Stadt", sieht die Erweiterung des Campingplatzes in Gefahr. Für die Kernstadt hofft er beim "Baulückenschluß" an der Nordeinfahrt oder in der Peter Maethstraße auf Ausnahmegenehmigungen. "Doch das wird wird schwer sein. Die Koblenzer werden nicht erst eine Verordnung schaffen, um sie dann wieder aufzuweichen," gibt sich der Oberbaurat pessimistisch. Just heute abend steht der Punkt auf der Tagesordnung des beratenden Gremiums, das seine Empfehlungen an den Stadtrat weiterleitet.
Die Ortsvorsteher Jürgen Blüher aus Kripp, Ute Kreienmeier aus Oberwinter sowie der stellvertretende Orstsvorsteher von Rolandswerth Hans-Jürgen Willeke sind sich einig: Nach der Katastrophe des Weihnachtshochwassers 1993 muß etwas passieren, so ihr Tenor. Dennoch wurden gestern einige Bedenken, Anregungen und auch Befürchtungen für die einzelnen Orte angesprochen. Was die betroffenen Ortsvorsteher aber vor allen Dingen von Ortsteilen abwenden wollen, ist, dass sie in ihrer Entwicklung lahm gelegt werden. Ute Kreienmeier (FDP) konkretisiert: "Oberwinter darf nicht wirtschaftlich, städtebaulich oder in der Infrastrukur blockiert werden". Grundsätzlich gelte zwar ein Verbot für jeden Baum, Strauch und jedes Haus im Überschwemmungsgebiet, aber ganz dürfe man das nicht sehen. Ute Kreienmeier geht davon aus, daß es sicher Ausnahmegenehmigungen geben wird. Sollte die Verordnung in Kraft treten, müssten dennoch die Bauvorhaben Anbau Turnhalle oder die Sondergenehmigungen für das Gelände der ehemaligen Möbelfabrik angestrebt werden.
Bezüglich eines Hotels am Hafen meinte Ute Kreienmeier: "Das ist ein Abwägungsprozess." Sie könne sich auch schwer vorstellen, das ein Investor bei jedem Hochwasser unter Umständen Millionenschäden in Kauf nehme. Entwicklung nicht hemmen "Ein vernünftiger Spagat muß angestrebt werden, der die wirtschaftliche Entwicklung nicht hemmt, aber dies auch nicht unbedingt zu jedem Preis", denkt die Ortsvorsteherin auch an die zahlreichen Hochwassergeschädigten. Ausnahmen müssten letztendlich zugelassen werden, insbesondere solche aus verbindlichen Bauleitplänen. Bestehende Bauleitplanungen möchte die Oberwintererin aus der Verordnung ausgenommen wissen. Dieser Meinung war auch Jürgen Blüher (SPD), Ortsvorsteher von Kripp.
Zudem müsse garantiert werden, dass bebaute Grundstücke Bestandsschutz haben. "Es kann nicht so sein, dass beispielweise nach dem Abriss des ehemaligen Quellen Lehnig-Gebäudes dort nichts mehr gebaut werden darf", so Blüher.
Anders allerdings denkt der Kripper über den Bebauungsplan auf dem ehemaligen Kurgelände, das als Hotel ausgewiesen ist. Zum einen melde sich für dort bereits seit Jahren kein Investor, und er könne sich auch nicht vorstellen, dass in diesem absoluten Hochwassergebiet Wohnungen reißenden Absatz fänden. Er persönlich könne sich vorstellen auf diesen Bebauunsplan zu verzichten, als Attribut an die Verordnung, der ja zugrunde liege, daß sich das Hochwasser verteilen solle und nicht verdrängt werde.
Grundsätzlich respektiert sehen möchte auch der stellvertretende Ortsvorsteher von Rolandswerth, Hans-Jürgen Willeke (FBL), die Verordnung der Bezirksregierung. "Die Medien sind voll von Überschwemmungskatastrophen. Wenn die Umwelt uns etwas wert ist, dann muß diese Verordnung zur Festlegung der Überschwemmungsgebiete durchgezogen werden", denkt Willeke. "Die Umweltsünden haben uns längst eingeholt, hier ist Wiedergutmachung gefragt", argumentiert er. Für den Bebauungsplan "In den Flachweingärten" sieht Willeke schwarz. "Wenn die Verordnung zum Tragen kommt, müsste eine Sondergenehmigung bei der Bezirksregierung angestrebt werden. Der Regierungspräsident wird aber nicht erst eine Verordnung herausgeben, und anschließend mit einer Sondergenehmigung versehen", ist Willeke mit Dinkelbach unabgesprochen einer Meinung. Ohne Sondergenehmigung müsten die Pläne derart reduziert werden, dass es fraglich sei, ob sich jemand dort noch ein Häuschen leisten könne, denn die Straßenbau- und Erschließungskosten könnten dann kaum mehr bezahlt werden.
Für den Nachwuchs von Rolandswerth, der sich hier, wie in zahlreichen Ortsbeiratssitzungen in Rolandswerth besprochen, hätte ansiedeln können, sieht es mit "Häuslebauen" schlecht aus. In der nächsten Ratssitzung wird der Stadtrat seine Meinung zur Rechtsverordnung der Bezirksregierung artikulieren.
Jutta Leicher, Quelle: Bonner General-Anzeiger, 26.10.1994, S. 06
"Hallig" als Bollwerk gegen den Strom
CDU diskutierte mit Hochwasser betroffenen
Ministerin kommt. Hochwasserdamm gefordert
Das Hochwasser geißelt die Rheinanlieger, darüber waren sich CDU und Bürger im Kripper Hotel "Rhein-Ahr" einig. Und darüber, daß es darum geht, für die Betroffenen Verbesserungen und Hilfen in den Krisenzeiten des Hochwassers am Rhein zu erreichen. Der "Ist-Zustand" dürfe durch den Bau der "Hallig" auf keinen Fall verschlechtert werden, so die Forderung.
Verbesserungen und Erleichterungen für die vom Hochwasser gebeutelten Rheinanlieger in Kripp durchzusetzen, darum geht es den Kripper Christdemokraten bei der Diskussion um die "Hallig" am Rande des Naturschutzgebietes. Das machte CDU-Ortsverbandsvorsitzender Arno Matuszak am
Mittwoch beim Gespräch mit nicht ach so vielen betroffenen Bürgern deutlich. Der CDU geht es in keiner Weise darum, bekräftigte auch der Fraktionssprecher im Ortsbeirat, Helmut Kremer, grundsätzlich den Bau der Wohnanlage mit mehr als 100 Wohneinheiten am Rande des Naturschutzgebietes zu verhindern. Verhindern wollen die Christdemokraten eine Verschlechterung der Hochwassersituation an der Ahrmündung, die ihrer Meinung nach durch einen Inselbau mit Erdanschüttungen entstehen könnte. Kremer befürchtete grobe Auswirkungen auf die betroffenen Häuser durch die Erdanschüttungen. Die CDU will den Ängsten der Bürger mit ihrer Diskussion Rechnung tragen. Deshalb bestehen die Christdemokraten auf strikte Einhaltung der seit dem 1. Januar in Kraft befindlichen Hochwasserverordnung und favorisiert einen Stelzenbau auf dem Gelände der ehemaligen "Villa Nagel".
Nach Meinung der CDU brechen auch Stelzen das Wasser, lassen aber soviel Strömung durch, um einen Anstieg des Oberwassers zu vermeiden. "Der Ist-Zustand darf auf keinen Fall verschlechtert werden", so der Tenor. Darin war man sich einig, aber nicht bei der Bewertung eines Stelzenbaues. Eine stärkere Strömung wollen die Rheinanlieger unter allen Umständen vermieden haben. Sie haben vom planenden Architekten Holger Leicher bereits die Zusage über Auskofferungen im Kiesbett, um weiteren Retentionsraum zu schaffen.
Da leuchtete sie ein, die Erklärung von Ingenieur Dieter Breuer, der die jetzige Ruine als "Bollwerk gegen den Strom" bezeichnete. Der erläuterte, wie die Strömung auf der Rheinallee zunehmen werde, wenn die "Hallig" nicht entstehen würde, um als "Ersatzbollwerk" zu dienen. Da räumte Breuer auf mit dem Gerücht, das in Kripp kursiert, daß das Wasser aufgrund der Wohnanlage 20 bis 30 Zentimeter steigen würde. Um 3,1 Millimeter nimmt das Oberwasser zu, zitierte er das Björnsen-Gutachten. Das hält die CDU für "verniedlicht". Doch räumten Matuszak und Kremer ein, daß man erst einmal den Fachgutachten Glauben schenken müsse. "Warten wir die Stellungnahmen der Behörden ab", so Matuszak. Kremer signalisierte, daß die Fachbehörden nach Rücksprache "Grünes Licht" für die "Hallig" geben würden, "wenn einige kleinere Änderungen beachtet würden. Dennoch wollten es die CDUler nicht versäumen, die Erfahrungen der alten hochwasserbetroffenen Kripper Bürger weiter zu geben. Die befürchten eine Verschlimmerung der Situation, quetscht sich das Wasser in Zukunft lediglich durch einen 10 Meter breiten Spalt, dort wo jetzt Ausbreitungsflächen sind. Nicht so bei einem Stelzenbau.
Den CDUlern fehlen gutachterliche Alternativen zu der jetzigen Planung. Eine neue Ansicht der "Öko-Anlage" am Naturschutzgebiet, mit der der Remagener Ortsteil einen Bevölkerungszuwachs von rund zehn Prozent bekommen soll, legte gestern der Beauftragte des Investors, Eckehard W. Stürzbecher, vor. "Die Planung allein macht schon deutlich, daß wir die Anlage nicht auf Stelzen bauen können", gab er zu bedenken. Bedenken hatten die Christdemokraten auch, was den Katastrophenschutz auf der "Hallig" bei Hochwasser anbelangt. Da verweist Stürzbecher auf die umfassenden Erfahrungen eines ähnlichen Projektes in Niederlahnstein und den umfassenden Sicherungsmaßnahmen. Niemand sei bei den letzten Jahrhunderthochwassern an der Lahn zu Schaden gekommen, beteuert der Bad Godesberger. Und weggezogen sei bislang auch niemand aus der herrlichen Wohnlage direkt an der Lahn.
Doch auf diese Sicherungsmaßnahmen will die CDU ein waches Auge werfen, "es kann nicht angehen, daß unsere Feuerwehr nachher Mädchen für alles ist", äußerte Matuszak. Forderung wird im Ortsbeirat aktualisiert Einig waren sich Christdemokraten und Bürger nach der alten Forderung eines Kripper Hochwasserdammes. Eine Forderung, die noch einmal von der Hochwassernotgemeinschaft erhoben wurde. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Klaudia Martini hat den Krippern ihr Kommen zugesagt, will das Begehren an Ort und Stelle prüfen.
Die Christdemokraten versprachen, das Thema erneut im Ortsbeirat zu aktualisieren. Für rund 20 Millionen Mark sollen in Kripp auf 15 000 Quadratmetern 99 Ein- bis Vierzimmerwohnungen sowie 16 Einfamilienreihenhäuser entstehen. Aufgrund der exponierten Baulage an der Ahrmündung legen die Planer Wert auf "ökologisches Bauen" mit Sonnenkollektoren und Photovoltaik-Anlage. Das Sammeln von Oberflächenwasser in Zisternen für Brauchwasser soll eine Selbstverständlichkeit sein. Die Versorgung der Bürger bei Hochwasser soll über eine eigene Steganlage und eigenen Booten erfolgen. Die Höhenanordnung orientiert sich am Jahrhunderthochwasser vor 200 Jahren, das vergleichsweise weit über dem der letzten Katastrophenjahre lag. Das Gelände, auf dem die "Hallig" errichtet werden soll, liegt direkt am Rhein, an der B 266. Es grenzt an das Naturschutzgebiet der Ahr und ermöglicht im Norden einen herrlichen Blick über das Vogelparadies.
Einst wurde in den zerfallenen Fabrikhallen Mineralwasser abgefüllt, dass als siebtbestes der Bundesrepublik galt. Das Gelände, zu dem vor Jahren auch die Gewinnungsanlagen "Auf der Schanze" gehörten, war schon häufig Ziel von Spekulationen. Im März 1989 wurden die Produktionsanlagen ein Raub der Flammen und nur noch eine Ruine zeugt vom einstigen Stolz des herrschaftlichen Bauwerkes.
Rolf Plewa, Quelle:Bonner General-Anzeiger, 26.07.1996, S. 06
Rheinfische schwimmen am Kaffeetisch vorbei
Einige Bürger am Strom sind sauer auf die Politik, denn sie müssen für ihre teuren Wasserschäden selber aufkommen. Heute sollen sich die Fluten wieder zurückziehen
Sie sehen die Lage noch relativ locker. Die Menschen am Strom haben gelernt, mit den mächtigen Fluten des Rheins zu leben - mit der Attraktivität und der Romantik, die Touristen anlockt, aber auch mit dem Hochwasser, das inzwischen regelmäßig und immer häufiger Keller und Häuser heimsucht. Gestern morgen machten sich auch in Remagen die obersten Feuerwehrmänner auf, um direkt am Rheinufer die Wassermassen in Augenschein zu nehmen.
Bürgermeister und Wehrchef Herbert Georgi marschierte ebenso wie Stadtwehrleiter Eduard Krahe ans Ufer und fand dort zum Beispiel Hans Schäfer, den Besitzer des Residenz-Cafés. Der ließ ohne große Hektik sein Lokal gerade mit schweren Eisenplatten "verrammeln". Seine Fenster sind mit Panzerglas so stabil ausgelegt, dass sie bisher allen Angriffen des Stromes widerstanden.
"Wir haben schon hier im Café gesessen und ein Tässchen geleert, während das Wasser draußen auf halber Etagenhöhe stand, zwei Meter über dem Erdboden. Das sieht zwar sehr bedrohlich aus, aber auch komisch, wenn die Fische an dir direkt vorbei schwimmen. Fast wie im Aquarium", berichtet Schäfer. Anfangs hatte ihn das nasse Element vor der Tür noch erschreckt und kaum schlafen lassen. Nach inzwischen acht Jahren in Remagen kennt er "seinen" Rhein, lebt geordnet mit dem Strom. Steigt das Wasser, kommen zuerst die Teppiche vor dem Lokal in Sicherheit. Eine Hochwasserstufe weiter fließen die Wogen am Lokal vorbei, umspülen es fast. Da kann dem in einer Wanne stehenden Gebäude auch noch nicht so viel passieren. Erst ab 8,50 Meter Pegelstand läuft es von hinten in den Schankraum.
"Dann geht nichts mehr. Aber wir haben zu dem Zeitpunkt längst alles geräumt und warten, bis es wieder trocken ist", kann selbst ein "richtiges" Hochwasser Schäfer kaum aus der Ruhe bringen. Und da der Pegel wieder fallen soll, wird die gestern noch teilweise überschwemmte Rheinpromenade heute wieder begehbar sein, vermuten die Experten.
Stadtwehrleiter Krahe rechnet damit, dass die Fluten zwar zurückgehen werden, allerdings beobachtet er mit Argwohn die weiteren Regenfälle. Sollte es zum Beispiel in Bayern wieder "schütten", droht ein erneuter Anstieg der Wellen. "Wir beobachten die Entwicklung sehr genau und werden sofort helfen, wenn es nötig ist."
Relativ locker sieht nach 15 Jahren Hochwassererfahrung auch René Zavodsky, der Besitzer des Fährhauses in Kripp, die Fluten vor seinem Lokal. Wenn auch der Keller schon fast völlig überschwemmt ist. "Es ist nicht das Wasser, das uns zu schaffen macht. Es ist der Schlamm, der hauptsächlich die Schäden verursachen. Wasser trocknet sehr schnell wieder, den Dreck muss man mühsam beseitigen." Und beim Thema Schäden kommt Zavodsky so richtig in Fahrt.
Dass er Einnahmeeinbußen hat, gerade hat wegen des Hochwassers ein Busunternehmen aus Prag das Mittagessen für 40 Personen abgesagt, nimmt er noch relativ leicht. Im Winter ist ohnehin wenig zu tun, und er kennt das Wasser ja schon lange. Doch beim Knackpunkt Versicherungen und Hilfen platzt ihm der Kragen beim Blick auf die Hochwasserkatastrophe im Osten. "Es war doch grob fahrlässig, was dort in vielen Fällen zu Schäden geführt hat. Die Leute haben ihre Autos stehen lassen, obwohl das Wasser kam. Sie haben ihre Möbel in den Häusern und Wohnungen nicht hochgeräumt, nicht in Sicherheit gebracht. Die Wertsachen blieben in den Gebäuden und gingen da kaputt. Wir hier kennen das Wasser und verhalten uns entsprechend. Da entstehen so hohe Schäden erst gar nicht." Auch kümmere sich keine Versicherung um die Hochwassergeschädigten an Rhein und vor allem Mosel, ereifert sich der Restaurantbesitzer. Die Politiker hätten sich im Wahlkampf medienwirksam im Osten aufgebaut, Millionen seien seitdem dorthin geflossen, es gab Hilfsaktionen landauf, landab. Doch in Kripp hätte niemand gefragt, ob er mit anfassen könne.
"Da ist in ein Haus Wasser geflossen, und es musste abgerissen werden. Wir haben mindestens zweimal im Jahr den Rhein im Keller, und da kräht kein Hahn nach", kommt Zavodsky immer mehr in Fahrt. Er schreit nicht nach Hilfe, versteht nur nicht, dass die Politik Hochwasseropfer und Hochwasseropfer so unterschiedlich behandelt. Er wird den Putz erneuern und für tausende von Euro die Schäden beseitigen - aus eigener Tasche und ohne Unterstützung aus Berlin.
Quelle: General-Anzeiger, 13.11.2002, S. 06
Zum Weihnachtsessen in Gummistiefeln
Wohnen am Rheinufer birgt Gefahren
Flutopfer wurden im Stich gelassen
Hochwasser in Kripp. Alle paar Jahre heißt es in dem Remagener Stadtteil "Land unter". Weil südlich des Ortes die Ahr in den Rhein mündet, kommt das Wasser gleich von zwei Seiten. 1993 und '95 traf es Kripp besonders hart: Dutzende von Häusern und Wohnungen standen unter Wasser.
Elmar Hammer sitzt auf seinem wuchtigen Sofa und erzählt, wie das ist mit dem Hochwasser. Der Mann ist Jahrgang 1942, in Kripp geboren und ehemaliger Einheitsführer der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes. Jede Überschwemmung hat er miterlebt, er wohnt direkt am Rheinufer. "1993 hatten wir selbst fünf Zentimeter Wasser in der Wohnung", erzählt Hammer. Fünf Zentimeter: Die Familie wohnt in der ersten Etage. Die Weihnachtsgans aßen die Hammers noch im Wohnzimmer in Gummistiefeln, danach zogen sie acht Tage zu Freunden. Die Renovierung dauerte Monate und kostete über 7000 Mark.
"Usch", ruft Elmar Hammer seine Frau, "sag' doch auch mal was zum Hochwasser." Ursula Hammer ist in der Küche und kocht Kaffee. "Ich? Was soll ich dazu sagen?" antwortet sie. "Ich flippe ja doch nur wieder aus." Die drahtige Frau mit den kurzen braunen Haaren bringt den Kaffee, bleibt dann mitten im Raum stehen, zieht an der Zigarette. Und dann sagt sie doch etwas dazu. "Was sehen wir nach dem Hochwasser? Keinen Pfennig!" schimpft sie und hebt die Stimme. "Wo bleiben denn die ganzen Spendengelder? Keine müde Mark haben wir gesehen."
Sie erzählt die Geschichte, wie drei Monate nach dem Hochwasser von 1993 endlich die Kommission kam, um den Schaden zu begutachten. Wie der vermoderte Teppich schon längst auf dem Müll war und wie einer "dieser Herren" dort stand, wo sie jetzt steht, und auf die neuen Fliesen tippte mit dem Fuß, so wie sie jetzt auf die Fliesen tippt. Und fragte: "Und die sollen wirklich neu sein, diese Fliesen?" Ursula Hammer hört gar nicht mehr auf, auf die Fliesen zu tippen. "Wenn ich daran denke, dann flippe ich jedes mal aus."
Nach den Jahrhundert-Hochwassern in Folge hatten es einige Bewohner satt, suchten eine neue Wohnung. "Noch ist aber keiner gegangen", sagt Ortsvorsteher Jürgen Blüher. Auch der 41 jährige ist gebürtiger Kripper, und er hat Respekt vor dem Rhein. Seine Frau hätte gerne in Flussnähe gebaut, ihm war das aber nicht geheuer. "Jetzt", sagt er und deutet mit dem Kopf weg vom Rhein, "wohnen wir da oben."
Jürgen Blüher stapft über die saftige grüne Wiese hinter der Ruine der Lehnig-Mineralwasserwerke am südlichen Ortsrand. "Das Schlimmste bei Hochwasser ist die Strömung." Die sei so stark, daß einige Häuser völlig von der Außenwelt abgeschnitten seien. Würde man hier am Ortsrand den dammähnlichen Badenackerweg verlängern, könnte die Strömung um den Ort herumgeleitet werden. Überflutet würde Kripp zwar weiterhin, aber durch ein ruhiges Gewässer. Glauben die einen Experten, die anderen Experten den Erfolg einer solchen Maßnahme anzweifeln, da die öffentlichen Gelder ohnehin knapp sind, scheint eine Verlängerung des Damms unrealistischer denn je.
Jürgen Blüher bleibt stehen und zeigt auf ein wuchtiges Einfamilienhaus. "Das wurde vor zehn Jahren gebaut", erzählt er, "von einem Einheimischen." Der hat sich eingestellt auf das Hochwasser: Die Wohnung liegt im ersten Stock, das Erdgeschoß läßt sich schnell räumen. Nebenan steht ein weißes Häuschen, klein und schnuckelig. "Da wohnen meistens junge Pärchen", erzählt er, "immer bis zum nächsten Hochwasser."
Quelle: Storebeck Bonner General-Anzeiger, 06.01.1998, S. 07
Mit Pferdestärken gegen den reißenden Strom
Treidelschifffahrt Raddampfer als Konkurrenz
Vom Leinpfad zum Radweg
Im April 1848 gehen die Menschen am Ufer des Rheins auf die Barrikaden. "Für die Arbeit und gegen das Kapital" laden sie ihre Büchsen mit Kugeln und Nägeln und schießen auf die vorbeifahrenden Dampfschiffe. Der Grund: Die neuartige Technik bedroht die berufliche Existenz vieler Rheinanwohner. Noch stärkeres Geschütz fahren zur gleichen Zeit die Bürger in Kripp auf. Sie postieren eine kleine Kanone am Batterieweg und feuern dicke Felsbrocken auf die "Feuerschiffe". Doch während der Aufstand in anderen Gegenden anhält, donnert die Kanone in Kripp nicht lange. Die Preußische Regierung lässt eine Truppe Husaren nach Kripp marschieren, die den Ort besetzen und die Rädelsführer verhaften. Den Aufruhr hatten die Raddampfer provoziert, die seit 1816 auf dem Rhein fuhren und die Schifffahrt revolutioniert hatten. Für die heftige Reaktion der Rheinländer hat der Heimatforscher und ehemalige Bürgermeister von Remagen, Hans Peter Kürten, eine einfache Erklärung: "Die Menschen kämpften damals um ihre Existenz. Sie fühlten sich von einer neuartigen Technik bedroht, die sie arbeits- und brotlos machte." Die motorisierten Schiffe waren für die alteingesessenen Leinschiffer zur übermächtigen Konkurrenz geworden. Während die Dampfer leicht gegen die Strömung ankamen, mussten sie ihre Segelboote mühsam und langsam flussaufwärts ziehen lassen. Sie spannten dafür Pferde oder manchmal auch Menschen ein, die den Kahn stromaufwärts "treidelten". Von der Treidelschifffahrt lebten die Gastwirte am Rhein und die Pferdebauern, Rheinhalfen genannt. Von diesen mieteten die Leinschiffer etappenweise ihre Zugtiere samt den dazugehörigen Knechten. Nach 10 bis 15 Kilometern wechselten sie das Gespann an der nächsten Krippe, einem Rastplatz für Mensch und Tier. In der Halferkneipe verzechten die Knechte ihr "Schnapsgeld". Sogar die Pferde im Stall bekamen alkoholhaltigen Kraftstoff vorgesetzt: Hafer pur, übergossen mit billigem Wein. Eine solche Krippe entstand nach 1700 auch in der Nähe von Remagen. Darum herum ließen sich viele Pferdebauern nieder. Ihr neues Zuhause nannten sie Kripp. "Der alte Leinpfad führte von Holland bis zum Oberrhein am linken Rheinufer entlang", berichtet Hans Peter Kürten. Bei gutem Wetter dauerte die "große Fahrt" von Köln nach Mainz drei Tage, eine Reise nach Straßburg zwei bis drei Wochen. Entscheidend für die Fahrtzeiten war weniger die Länge der Strecke als ihr Zustand. Bei Niedrigwasser bekamen die Leinschiffer Probleme mit Sandbänken. Und oft verhedderte sich die Treidelleine, die vom Schiffsmast zum Ufer führte, in Bäumen und Gestrüpp.
Ein berüchtigtes Hindernis am Leinpfad war die alte Sankt-Maternus-Kirche in Köln-Rodenkirchen. Sie stand so nahe am Fluß, daß alle Fährleute dort ihre Leinen "umstechen" mussten. Die Knechte spannten die Pferde aus und ruderten das Zugseil in einem Nachen um das Gotteshaus herum. Tiefe Wasserlöcher, Sandhügel und dichte Böschungen am Uferweg machten die Treidelei zur Tortur. Den Kahn im Schlepptau zogen die Pferde immer zum Ufer hin. Schon nach kurzer Zeit gingen die Tiere ganz schief und waren für andere Arbeiten kaum mehr zu gebrauchen. Zum Schutz vor der gleißenden Sonne trugen die Gäule Scheuklappen. Die Treideltechnik an den Rhein gebracht hatten die Römer. Sie zogen ihre Fracht- und Kriegsschiffe stromaufwärts, was sie "tragulare", auf deutsch "schleppen" nannten.
Auch christliche Missionare, Pilger und Kreuzritter nutzten in den darauffolgenden Jahrhunderten lieber den Wasserweg als die von Banditen bevölkerten Landstraßen. Ende des 18. Jahrhunderts pendelten regelmäßig Schiffe zwischen Köln und Bonn. Aktuelle Fahrtzeiten konnten die Passagiere 1791 im Bönnischen Intelligenzblatt, dem Vorläufer des General-Anzeigers, nachlesen: "Das ordinäre Marktschiff fährt vom 15. August bis 1. Oktober um ein Uhr, vom 1. Oktober bis zum Ende des Jahres um 12 Uhr von Bonn nach Köln ab", hieß es da. Einen richtigen Boom erlebten die Leinschiffer und Rheinhalfen, als mit der einsetzenden industriellen Revolution überall die großen Fabriken in Betrieb gingen. Für die maschinelle Produktion brauchten sie Unmengen von Steinkohle. Die schwarze Fracht war so begehrt, daß es um 1840 auf dem Rhein fast vierhundert Kohleschiffe gab, die mit 16 bis 20 Pferdestärken rheinaufwärts geschleppt wurden. Das Aus für die Treidelschiffer kam, als große Zechenbesitzer wie Stinnes und Haniel nach 1840 eigene Schleppdampfer bauen ließen. Alles Protestieren und Lamentieren half nicht, innerhalb von wenigen Jahren wurden die kohlefahrenden und kohlefressenden Dampfschiffe zur erdrückenden Konkurrenz. Die letzten Rheinhalfen arbeiteten bis zum Ersten Weltkrieg am Binger Loch. Dort war die Strömung so reißend, daß die Schiffsmotoren ohne Hilfe von Treidelpferden nicht gegen sie ankamen. "Wirklich schade", findet Kürten, "daß heute fast nichts mehr an die Leinschifffahrt erinnert, wo sie doch für die Region früher eine so große Bedeutung hatte." Geblieben ist von dem jahrhundertealten Gewerbe nur der Leinpfad. Und auch über den wäre in der Zwischenzeit Gras gewachsen. Wenn nicht der damalige Bürgermeister Kürten Ende der siebziger Jahre eine Idee gehabt hätte: Denn damals kamen sich auf der B 9 immer mehr Autofahrer und Radfahrer in die Quere. Die Stadt Remagen und der Kreis bauten den alten Uferweg aus. Seither wird der Leinpfad wieder genutzt nicht mehr von Treidelpferden, sondern von Drahteseln.
Böcker, Quelle: Bonner General-Anzeiger, 03.09.1997, S. 06
Ein tödlicher Irrtum für Kripp
Der Tag der Bombardierung des Remagener Ortsteiles jährt sich heute zum 50. Mal
Die gezielten Angriffe alliierter Bomberverbände nahmen in Kripp ab Herbst 1944 dramatisch zu. Im Kripper Gebiet galten sie besonders dem Abzweiggleis der Ahrtalbahn, die unmittelbar an der B 9 im angrenzenden Feld liegt und für den Nachschub der auf Hochtouren laufenden Ardennenoffensive sorgte. Man lebte in ständiger Angst, da die Luftschutzmeldungen über den Rundfunk und das alarmierende Sirenengeheul ab dieser Zeit an der Tagesordnung waren. Während den Alarmierungen suchten die Bewohner die Luftschutzkeller auf. Dies war für die Rheinanwohner nicht möglich, da der Fluß zu dieser Zeit Hochwasser führte und die Schutzkeller überflutet waren. Pegelhöchststand 15. Februar 1945: 8,38 Meter (Andernach). Der 9. Februar 1945, der leidvollste Tag in der Kripper Geschichte! Ein wolkenverhangener Tag und der Rhein führte Hochwasser. Es geschah gegen 16.15 Uhr. Ein Bombeninferno legte Teile der Rheinallee in "Schutt und Asche". Aus der Schnelligkeit des Angriffes und des Schocks konnte keiner sofort so richtig ermessen, was eigentlich passiert war. Zuvor hatte man nur die Sirenen und dann das Dröhnen von Flugzeugmotoren wahrgenommen, konnte aber infolge der dichten Wolkendecke nichts sehen. Der gelegte Bombenteppich, der sich vom südwestlichen Teil Linz bis über den Rhein herüber nach Kripp über die Rheinallee bis zur Ahrstraße zog, forderte insgesamt 19 Tote. Die Informationen dieses Berichtes stützen sich auf mündliche Angaben von Heinz Schmalz, Verfasser der Dokumentation Sinzig 1939-45, über den Verlauf aus militärischer Sicht der Alliierten und einigen Ortsbewohnern. Am besagten Tage startete ein Bomberverband des 322. Bombergeschwaders mit 36 Bombern des Typ B 26 (Marauder) von einem Flugplatz in England aus in Richtung Deutschland, um die militärischen Nachschubwege für die Westfront zu zerstören. Dieser Start und der weitere Verlauf sollte für zwei Orte verheerende Folgen haben. Genaues Ziel war die Ahrbrücke in Sinzig. Der Marauder war ein zweimotoriger amerikanischer Bomber mit je 1 850 PS Motorstärke und einer Länge von 19,80 Meter. Ausgerüstet mit acht MG und sechs Mann Besatzung. Nach amerikanischer Meldung warfen die Bomber bei einer 10/10 Bewölkung (geschlossene Wolkendecke) aus einer Flughöhe von 14 500 Fuß (annähernd 5 300 Meter) 59 Sprengbomben von 2 000 lbs und vier Bomben von 500 lbs auf das Ziel. Ein lbs (libs gesprochen) hat das Gewicht von exakt 0,4536 kg. Somit ist ein lbs überschlagsmäßig annähernd mit einem Pfund Gewicht zu vergleichen. Diese enorme Abwurfhöhe war durch die große Reichweite deutscher Flak notwendig. 18 Maschinen erhielten Beschädigungen durch Flakbeschuß. Alle Maschinen kehrten zurück. Die Flakabwehr wurde vom Gegner als sehr stark, besonders im Gebiet des Laacher Sees, bewertet. Infolge der Bevölkerungsdichte konnten jedoch die Bomberpiloten ihr Angriffsziel nicht richtig orten und klinkten die Bombenlast zu spät ab. Eine Verzögerung von Sekunden wirkte sich bei dieser Flughöhe und der Geschwindigkeit für das Trefferergebnis enorm aus. An diesem Tage fiel keine Bombe auf das eigentliche Ziel, die Ahrbrücke in Sinzig. Diese verspätete Reaktion der Bomberpiloten, die den tödlichen Einsatz flogen, hatte für Kripp und Linz fatale Folgen. Für beide Orte, die bisher im Ortskern von den Bombardierungen verschont geblieben waren, war dies ein schwerer Schlag. Für insgesamt 19 Menschen wurde diese "Verspätung" zum Verhängnis. Der "tödliche Niederschlag" erstreckte sich auf das Gebiet südwestlich von Linz und auf den südöstlichen Ortsteil von Kripp. Die abgeworfenen Sprengbomben "radierten" alleine in Kripp 16 Menschenleben aus und zerstörten Häuser, die meisten an der Rheinallee bis hin zum Ahrweg. Die Häuser hielten dem Detonationsdruck nicht stand und begruben die Bewohner in den Trümmern. Verschüttete wurden mit bloßen Händen aus den Trümmern geborgen. Viele Kripper waren nach Angaben der Rheinbewohner zur Zeit des Angriffes wegen der Beschaffung von Lebensmittelkarten unterwegs, ansonsten wären vermutlich noch mehr Opfer zu beklagen gewesen. Die Autofähre Linz-Kripp, die infolge Hochwassers vor dem Haus des Fährmeisters Peter Valentin an der Rheinallee fest vertäut war, erhielt einen Volltreffer. Die Fähre "Franziska" versank in den Hochwasserfluten des Rheines und blieb auf der Rheinwiese (ehemaliger Campingplatz) auf dem Grund liegen. Der Fährmeister Peter Valentin nebst Ehefrau und 14 weitere Personen fielen diesem Bombenangriff zum Opfer. Das auf der Fähre befindliche Auto des Kripper Fährpächters Dörries wurde durch den Volltreffer zerstört. Die gesamten Fenster der Katholischen Pfarrkirche zerbarsten durch den massiven Druck der Detonationswellen. In Linz wurde die Familie des Studienrates Lohmann mit drei Personen ein Opfer des Bombenabwurfes und zwei der 20-Zenter-Bomben durchschlugen das Reichsbahnviadukt und blieben als Blindgänger liegen. Erst nach dem Rückgang des Hochwassers konnten diese durch zwei Feuerwerker (Leutnant Schneider und Colombo) entschärft werden. Dieser Angriff, der gezielt der Sinziger Ahrbrücke galt, gilt als der schwärzeste Tag in der Kripper Kriegsgeschichte.
Quelle: Weis/Funk Bonner General-Anzeiger, 09.02.1995, S. 07
Ökologie und Politik gegen Computer-Konkurrenz
Franz Scholles entwirft seit 1979 Brettspiele
Die Ausstattung hat sich im Lauf der Zeit sehr verändert
"Meine Spiele sind kommunikativ und abendfüllend." Der Mann, der das von seinen Produkten mit viel Selbstbewußtsein sagt, schaudert ein wenig bei dem Gedanken an Computerspiele. Aber Franz Scholles aus Kripp weiß, wovon er spricht. Denn seit 1980 entwirft er fast in jedem Jahr ein neues Brettspiel. Und: Er behauptet sich in der Spielszene recht gut, mit dem kleinen Ökospiele-Verlag seiner Frau Uschi. Ein breites Spektrum weisen die Themen für die Spiele auf. In "Global", das 1993 entstand und in diesem Jahr durch einen neuen Kartensatz ergänzt wurde, geht es um die Länder dieser Welt. "Die Fragen über Land und Leute vermitteln den Reiz fremder Länder und fördern zugleich das Verständnis für die Menschen, die in anderen Kulturen leben", heißt es im Beipackzettel. Basisdemokratisch geht es beim Spiel mit den 1 000 Fragen über 70 Länder der Welt zu. Denn die drei bis fünf Mitspieler sind gleichzeitig Teilnehmer und Quizmaster. Laut Autor ist es, wie fast in allen seinen Spielen, ein Mix aus Wissen, etwas Glück und in diesem Fall einigen Bingo-Elementen, was den Reiz ausmacht. In Gen-Zeit und Gen-Welt, die in den Jahren 1988 und 1989 entstanden, geht es um die Gefahren der Gen-Forschung.
"Am Pranger", heißt ein weiteres Spiel, das 1991 in Zusammenarbeit mit amnesty international entstand, und die Verletzung der Menschenrechte auf dem Globus anprangert. Wie kommt man zum Spiele machen? Wie wird man Spiele-Autor? Der 42jährige, der sich heute in seinen Rollen als Lehrer in den Berufsbildenden Schulen in Bad Neuenahr- Ahrweiler, als Spiele-Autor und Verleger und als Ehemann und Vater zweier Töchter, Sina (acht Jahre) und Jana (fünf Jahre) wohl fühlt, holt etwas weiter aus. Denn da waren 1979 die intensiven Prüfungsvorbereitungen von Ehefrau Uschi, die Franz Scholles etwas "Freizeit" bescherten. Die wurde zu einem Ökologie-Seminar in Berlin genutzt. "Und dort kam dann ganz spontan die Idee zu einem Ökospiel", erinnert sich Scholles an die Anfänge seiner Karriere als Spiele-Autor zurück. Damals schrien die Zeiten regelrecht nach neuen Spielen. Bester Beweis: Ein Blick in die internationale und nationale Spieleszene. Denn just 1979 entwickelten die beiden kanadischen Journalisten Chris Haney und Scott Abbot ein Ding in Sachen Spiele, das heute noch die Welt bewegt: "Trivial Pursuit".
In den Wohnküchen der Wohngemeinschaften und in den Szene-Kneipen sorgte ein anderes Spiel für Furore: "Provopoli". Und 1980 war Franz Scholles mit seinem Ökö-Umweltspiel auf dem sich rasant entwickelnden Markt. Der Kripper hatte seine gesamten Ersparnisse in die Entwicklung und Produktion der ersten tausend Spiele gesteckt. "Die Sachen wurden uns regelrecht aus den Händen gerissen", erinnert sich Scholles gerne an die Anfangszeiten. Das Äußere des Spiels Papprolle als Verpackung, eher schlichte grafische Gestaltung und die Fragekarten in Schreibmaschinen Layout spielte in diesen Zeiten eine kleinere Rolle. Etwas, das sich inzwischen geändert hat. "In der Ausstattung von damals wäre heute kein Spiel zu verkaufen", so Scholles und er verweist auf die fünfte Auflage des Klassikers des kleinen Verlages, die heute ganz anders daherkommt.
Heute arbeitet Scholles mit den großen Verlagen und qualifizierten Grafikern zusammen. Damals fand sich für das Öko-Spiel kein Verleger, so daß der Eigenvertrieb über den eigenen Verlag und über die alternative Buchladen-Szene lief. Gründliche Studien Geblieben sind der Eigenvertrieb und die stets neuen Ideen des Spieleautors Franz Scholles. "Das Thema muß was hergeben", sagt er. Und dann ist Lesen angesagt. Denn das gründliche Studium der Literatur über das Thema, ist für Scholles die Pflicht, ehe die Kniffligkeiten ins Spiel als Kür hinzukommen.
So auch geschehen bei "Polit-Poker", das 1990 entstand und 1994 aktualisiert wurde. Dort stehen die programmatischen Aussagen der Parteien auf dem Prüfstand und es gilt die Aussagen zuzuordnen. Die totale Verblüffung der Spieler scheint vorprogrammiert. In der Mache für 1996 hat der Spiele-Autor aus Kripp ein Spiel mit dem Arbeitstitel "Typisch Mann Typisch Frau". Und auch dieses Spiel soll die Grundsätze beinhalten: "Kommunikativ, mit aktuellen Themen, gleichermaßen für Erwachsene wie Jugendliche spielbar, abendfüllend".
Quelle: Bernd Linnarz Bonner General-Anzeiger, 08.12.1995, S. 06
Die Schwarze Madonna von Remagen
Ein Soldat modellierte die Statue 1945 aus Lehm
Vor vielen Jahren erzählte mir eine alte Frau aus Linz, wie es abends über den Rhein erklang, wenn mehr als hunderttausend Kriegsgefangene das Marienlied anstimmten:
"Meerstern ich Dich grüße! Oh Maria hilf! Gottesmutter süße. Oh Maria hilf! Maria hilft uns allen aus unserer großen Not."
Niemals könne sie diesen Schall der Frühlings- und Sommerabende 1945 vergessen. Zu dieser Zeit modellierte ein gefangener Soldat um die Vierzig aus dem Lehm der Goldenen Meile von Remagen/Sinzig/Kripp, die für Millionen deutscher Soldaten zum Schindanger wurde, Madonnen aus der fruchtbaren Erde dieser Region. Ringsum starben seine Kameraden wie die Fliegen oder siechten in nicht nachvollziehbarem Elend dahin. Für ein Stückchen Brot überließ der Mann seine Kunstwerke den anderen Armen. Er hieß wie sich erst sehr viel später herausstellen sollte Adolf Wamper, und trug den Vornamen jenes unseligen Menschen, der ihm und seinen elenden Kameraden diesen Jammer verursacht hatte. Eine dieser Madonnen-Statuen war von hinreißender Lieblichkeit und gefiel einem amerikanischen Geistlichen, der sie zu Pfarrer Keller nach Kripp brachte. Dort wurde sie vorerst aufgehoben. Später zerfiel die Lehmfigur zusehends.
Pfarrer Keller fand in dem Remagener Johann Deusen den Künstler, der die Madonna in ihrer ursprünglichen Form wiederherstellen und der Nachwelt erhalten konnte. Johann Deusen modellierte eine Hand des Jesuskindes und einen Teil des Gewandes der Madonna neu. Später präparierte er die ergreifend schöne Statue, die nun auch sein Werk war, mit Leinöl, durch die sie ihr dunkles Aussehen erhielt und haltbar wurde. So blieb diese wundersame Schöpfung am Leben.
Pfarrer Keller verunglückte 1951 tödlich und konnte seine Pläne, die er mit der Statue hatte, nicht mehr verwirklichen.
Die Zeit war dazu noch nicht reif. Vierzig Jahre sind ein biblischer Zeitabschnitt, und so ist es auch ein Wunder, daß Remagens Bürgermeister Kürten, der das Friedensmuseum in den Pfeilern der Ludendorff-Brücke gegründet hatte, erst nach dieser langen Zeit von der Existenz der Schwarzen Madonna erfuhr.
Peter Kürten hatte inzwischen Kontakt mit vielen ehemaligen Lagerinsassen, die sich auf Zeitungsartikel hin bei ihm gemeldet hatten, aufgenommen. So geschah es 1985, daß Hans Wamper bei ihm anrief und ihn wissen ließ, daß sein 1977 verstorbener Bruder, Professor Adolf Wamper, diese Madonna erschaffen hatte. Adolf Wamper war jahrelang Dozent an der Folkwangschule in Essen gewesen.
"Vielleicht können wir damit einige Ferienfahrten organisieren." für den Antrag der Grünen und der SPD gestimmt haben. Zöpel: "Hier liegt das Politikum". Als letzter Redner meinte Bundestags-vizepräsident Hans Klein (CSU): "Der Bundesaußenminister hat klug
entschieden". Hans Wamper, der Bruder, besaß eine Madonnen-Statue, die der Remagener Madonna ähnlich sah. Nun waren alle Zweifel ausgeräumt: Sie war das Werk Adolf Wampers. Der Remagener Bürgermeister fand Geldgeber für die Errichtung einer Kapelle auf dem ehemaligen Lagerareal, auf dem im Frühjahr 1945 nachweislich 1213 deutsche Soldaten verhungert und verdurstet sind.
Das waren Männer, die den Krieg überlebt hatten und im Nachhinein auf diese schreckliche Weise zu Tode kamen. Am 22. Juni 1985, ganz genau nach dem heiligen Zeitraum von vierzig Jahren, fand ein Treffen der ehemaligen Kriegsgefangenen auf der Goldenen Meile statt. Die Männer schritten zu dem Platz, auf dem die Kapelle geplant war. Sie sollte wie ein offenes Zelt sein, und in einer Ecke hinter starken Gittern war der Platz für die Statue vorgesehen. Das geplante Bauwerk war von zwei ehemaligen Lagerinsassen, Kurt Kleefisch und Otto Pickel, entworfen worden.
Das Grundstück hatte die Stadt Remagen dem Friedensmuseum "Brücke von Remagen e. V." geschenkt. Im Oktober 1987 fand nach Fertigstellung die mystische Schwarze Madonna ihren endgültigen Platz hinter schweren Gittern in der Friedenskapelle auf der Goldenen Meile. In dieser herrlichen Landschaft kann man nichts von dem erahnen, was einmal Wirklichkeit war. Möge die Wunderkraft der Schwarzen Madonna das Land vor derartigen Schrecknissen in Zukunft bewahren.
Quelle: Anneliese Barbara Baum Bonner General-Anzeiger, 30.11.1995, S. 21
Umbau Mittelstraße noch in diesem Jahr
Bürgermeister Denn stand den Einwohnern von Kripp Rede und Antwort
Auf große Resonanz stieß die Einwohnerversammlung in Kripp. Erstmals stand dort Bürgermeister Lorenz Denn den mehr als 50 Einwohnern Rede und Antwort, gab den Sachstand zu aktuellen Vorhaben bekannt und hielt Rückblick sowie Ausblick auf die Entwicklung des Remagener Ortsteils Kripp. Herzliche Grußworte richtete eingangs Ortsvorsteher Jürgen Blüher an die Versammlung. Sein besonderer Gruß galt Bürgermeister Lorenz Denn, Büroleiter Adalbert Krämer, den Beigeordneten Hermann-Josef Fuchs, Klaus Grebe und Christian Strohe sowie Bauamtsleiter Müller. Zur Entwicklung der Einwohnerzahl gab Denn bekannt, daß diese in Kripp überproportional sei. Allein in den vergangenen zehn Jahren habe es einen Anstieg um 25 Prozent gegeben. Die Entwicklung habe dazu geführt, dass an der Schule angebaut werden musste, und ein weiterer Kindergarten im Bau sei. Der neue Kindergarten verfüge über zwei Gruppen, eine dritte könne problemlos angebaut werden. Somit verfüge Kripp über sechs Kindergartengruppen. Zunächst seien nur fünf notwendig, doch ab Sommer 96 laufe der Kindergartenbetrieb sechszügig.
Verständnis zeigte der Stadtchef für den Wunsch der Einwohner zum Bau einer Halle mit Veranstaltungsräumlichkeiten, aber zur Zeit müsse die Stadt sehr sparsam mit den Finanzen umgehen. In den kommenden beiden Jahren sei eine Halle nicht realisierbar. Begonnen werden aber soll mit der Umgestaltung der Mittelstraße und der B 266 im Bereich Ortsmitte noch in diesem Jahr. Der Umbau werde nicht auf die Anlieger umgelegt. Die Platzgestaltung laufe nicht gleichzeitig, weil die Baugenehmigung für das Bauvorhaben noch nicht vorliege. Kaum vorstellen konnte sich Bürgermeister Denn die Umleitung der B 266. Die Verbindung von der A 61 zur A 3 sei zwar immer noch in Planung, doch die Anbindung der B 266 könne wohl kaum finanziert werden.
Zu dem Grundstück Lehnig müsse der Ortsbeirat die Richtung vorgeben, ob noch gebaut wird. Auch mit der Hochwasserschutzverordnung sei eine Bebauung möglich, wenn der Retentionsraum nicht eingeschränkt werde. Derzeit habe ein Architekt eine Planung für den Mündungsbereich der Lahn erstellt. Planungen für Kripp seien im Gange. Die politischen Diskussionen könnten aber erst beginnen, wenn die gutachterlichen Aussagen vorlägen. Für das Gelände des ehemaligen Kurhauses werde eine Bebauung als sehr kritisch gesehen. Bezüglich des Wasserturms habe die Stadt zugesagt, dass eine Wohnnutzung genehmigt werde. Seit September sei der Wasserturm unter Denkmalschutz gestellt. Nach jahrelanger "Sendepause" gebe es Gespräche mit dem Eigentümer und die Kreisverwaltung habe eine Wohnnutzung in Aussicht gestellt. Zum Hochwasser gab Denn bekannt, dass in Kripp vom Hochwasser 57 Häuser und 63 Familien betroffen worden seien. Nach der Hochwasserschutzverordnung des Landes bestehe für Baugebiete und bebaute Grundstücke Bestandsschutz. Städtischerseits gebe es keine Rückhaltemöglichkeiten. Eine Versickerung in privaten Bereichen sei in den meisten Fällen möglich. In Neubaugebieten solle diese mit eingeplant werden.
Quelle: JL, Bonner General-Anzeiger, 10.11.1995, S. 11
Für ein lebendiges Zentrum
Städtebauliches Konzept der CDU für Kripp
Fähre verlegen Kripp
In der Ortsmitte von Kripp entstehen Geschäfte, eine Apotheke, eine Eisdiele, eine Kinderarztpraxis und Rechtsanwaltsbüros. Die untere Quellenstraße wird zur verkehrsberuhigten Zone, und der Verkehr zur Fähre wird über die Südallee in Remagen-Süd umgeleitet. So zumindest wünscht es sich der CDU-Ortsverband Kripp, der am Freitag mit einem städteplanerischen Konzept an die Öffentlichkeit ging.
Helmut Kremer, CDU-Fraktionssprecher im Kripper Ortsbeirat, und Arno Matuszak, der Vorsitzende des Ortsverbandes Kripp, hatten am Freitag zu einem Pressegespräch in die Gaststätte "Rhein-Ahr" geladen. Dort stellten sie die "konzeptionellen Lösungen" vor, von denen sie hoffen, daß sie bei Rat, Verwaltung und Bürgern auf fruchtbaren Boden fallen. "Reaktionen" auf ihre Vorschläge zur infrastrukturellen Ortsentwicklung wünschen sie sich. Denn Handlungsbedarf für Kripp sieht der CDU Ortsverband allemal: Gleich drei konkrete Großprojekte (der Wohn- und Geschäftskomplex in der Ortsmitte, die Wohnungen auf dem Quellen-Lehnig-Gelände und die geplanten 120 Studentenwohnungen am Batterieweg) und ein weiteres, bislang nur angedachtes Projekt (ein Seniorenheim auf dem Gebiet der ehemaligen Dampfwäscherei) bringen gemeinsam mit weiteren zur Zeit im Bau befindlichen Ein- und Mehrfamilienhäusern einen Bevölkerungszuwachs von rund 500 Einwohnern in den nächsten fünf Jahren, schätzt die CDU.
Dass dieser Zuwachs einhergehen muss mit einer entsprechenden infrastrukturellen Entwicklung, damit Kripp nicht zur reinen Trabantenstadt wird, davon ist die CDU überzeugt. Nach ihren Vorstellungen sollen in dem geplanten Wohn- und Geschäftskomplex in der Ortsmitte beispielsweise eine Apotheke, ein Backshop, für junge Leute eine Eisdiele, für den überörtlichen Bedarf eine Kinderarztpraxis oder auch ein Rechtsanwaltsbüro entstehen. Für mehr Lebensqualität sorgt nach CDU-Vorstellungen auch eine Verkehrsberuhigung in der unteren Quellenstraße (B 266).
Der Verkehr auf dieser Bundesstraße, der sich wegen der Rheinfähre an manchen Tagen bis weit in den Ort hinein staut und der mit der Fachhochschule noch zunehmen wird, soll vom Sinziger Kreisel über die B 9 zur Remagener Südallee umgeleitet werden.
Dass bei dieser Lösung die Fähranlegestellen verlegt werden müssen, versteht sich. "Hierbei", so Helmut Kremer, "sind wir keine Illusionisten". Sie wissen um die Schwierigkeiten, die mit einer solchen Umlegung verbunden sind. Eine verkehrsberuhigte Quellenstraße wertet nach Meinung der Kripper CDU den Ort auf: "Durch eine Entlastung der Quellenstraße und eine damit verbundene Umgestaltung wird der Grundstein für die Identität als eigenständiger Ort gelegt", glaubt Matuszak. So könnte beispielsweise hinter der Gaststätte "Dorfschänke" ein Gemeindehaus in dem derzeit leerstehenden Tanzsaal eingerichtet werden.
"Wenn die Kripper Vereine hier entsprechende Eigeninitiative zeigen, kämen vom Land und Kreis auch finanzielle Zuschüsse", sagt Kremer. Mit diesen Vorschlägen für die Ortsentwicklung von Kripp hofft der CDU-Ortsverband nun auf öffentliche Resonanz. Von seiten der Bürger, des Kripper Ortsbeirats und von Remagens Stadtrat und Verwaltung.
Quelle: Val. Bonner General-Anzeiger, 25.11.1996, S. 08
Eine Welle der Sympathie für Pastor Klaus Birtel
Vor 30 Jahren zum Priester geweiht
Seit zehn Jahren Hirte in Remagen Großes Fest nach Gottesdienst
Menschenscharen versammelten sich am Sonntag rund um die Remagener Pfarrkirche. Menschen, die nichts anderes tun wollten, als ihrem Pastor Klaus Birtel zum 30. Priesterjubiläum zu gratulieren. Menschen, die sich dankbar zeigten, einen solchen Pastor schon zehn Jahre als Hirten ihrer Pfarrgemeinde zu haben. Eine regelrechte Welle der Sympathie schlug dem Menschen Klaus Birtel entgegen. Sicher ist Pastor Klaus Birtel das gelungen, was er sich vor zehn Jahren in seiner Antrittsrede gewünscht hat: "Ich möchte als Mensch in der Gemeinde anerkannt werden."
Den Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten gab eine heilige Messe in der Pfarrkirche, die wohl selten so viele Menschen fassen mußte, und fast zu klein war. Schon vor der Messe deutete sich an, welche Ausmaße dieses Fest in der Gemeinde, das von den Pfarrgemeinden Remagen und Kripp unter dem Mitwirken unendlich vieler helfender Hände, haben würde. Mit ihren Vereinsfahnen versammelten sich vor der Kirche die Junggesellen und die Kolpingmitglieder, die Schützen aus Remagen und Kripp kamen in Traditionstracht und mit ihren Königspaaren, die Stadtsoldatenmusiker traten in Schützenuniformen an, die Messdiener aus Remagen und Kripp kamen mit Kreuz und Weihrauch und zahlreiche auswärtige Geistliche reisten zum Jubiläum von Pastor Klaus Birtel teilweise von weit her an. Alle gemeinsam holten ihren Pastor und Präses ab, um einen festlichen Einzug in das Gotteshaus zu halten. Die Gläubigen hießen Pastor Birtel mit dem Choral "Lobet den Herren", intoniert vom Musikkorps der Stadtsoldaten willkommen. Zur Festlichkeit der Messe trug ebenso der Pfarrkirchenchor sowie Instrumentalkreis bei.
Gemeindereferentin Lucia Waszewski hob in ihrer Begrüßung hervor, dass es Klaus Birtel in den letzten zehn Jahren unter anderem gelungen sei, dass Selbstbewusstsein der Gemeinden zu stärken. Der Jubilar feierte die Messe in Konzelebration mit Domkapitular Richard Feichtner aus Trier, Regional-Dekan Helmut Schmidt, Pater Wendelin vom Apollinarisberg und Professor Alfred Bitter. Co-Zelebranten waren Pater Willi Ockenfels, Vikar Hans-Joachim Rupp, Pator Alois Weller, Pastor Udo Grub und Pastor Alois Schlenzig. In der Predigt ging der Trierer Domkapitular Feichtner auf die besondere Rolle des Priesters in der Gemeinde und in der Geschichte ein. Er wünschte sich, die "Welt zu einem Hain Gottes" zu machen. Nach dem Gottesdienst wurde Pastor Birtel die Menschen knubbelten sich in der für Autoverkehr gesperrten Kirchstraße von den Kindergartenkindern aus Sankt Martin Remagen und Johannes Nepomuk Kripp mit einem mexikanischen Tanz empfangen. Die Stadtsoldatenmusiker ehrten Klaus Birtel mit Musikstücken.
Zu einem riesigen Begegnungstreffen im Pfarrzentrum und im Pfarrgarten versammelten sich im Anschluss die Scharen der Gemeindemitglieder. Unter ihnen Kommunalpolitiker aller Couleur und aus allen Ortsteilen, die Ortsvorsteher, die Beigeordneten und Bürgermeister Lorenz Denn. Alles von Rang und Namen ließ es sich nicht nehmen, dem Jubilar zu gratulieren. Erste herzliche Worte fand Pfarrgemeinderatsvorsitzender Klaus Gansen, während die Gäste von zahlreichen helfenden Händen mit Getränken versorgt wurden. Gansen hob hervor, dass Birtel seit 30 Jahren Dienst am und für den Menschen tue, davon bereits ein Drittel der Zeit in Remagen. Er sei zum Hirten dieser Gemeinde berufen. Er habe Kinder getauft, die Jugend zu den Sakramenten geführt, Paare getraut, Sterbende begleitet und Trost den Trauernden gespendet. Zudem sei er auch Herr des neuen Pfarr- und Jugendzentrums gewesen. "Ihr Wort, ihre Stimme wird in der Gemeinde gehört. Ihre Arbeit wird von einer Welle der Sympathie begleitet. Die Menschenscharen hier zeigen dies", zollte Gansen dem Menschen und Pastor Birtel höchstes Lob. Gansen wünschte dem Jubilar, dass er am Ende seines Arbeitslebens sagen könne: "Vater hier sind sie, die du mir gegeben, keinen habe ich verloren".
Im Anschluß überreichte Gansen dem musisch interessierten Pastor im Namen beider Pfarrgemeinderäte einen Gutschein für den Besuch einer Oper oder Operette seiner Wahl in einer Stadt seiner Wahl, sowie eine Taufkanne und eine Gratulationsurkunde, kreiert von Christel Vendel. "Ich hoffe, daß dieser Tag ihnen unsere Solidarität und Wertschätzung gezeigt hat", gab Gansen das Mikrofon an Bürgermeister Lorenz Denn weiter. Der Dank von Denn galt Birtel für sein unglaubliches Engagement, besonders für die Jugend, die Ökumene und die Dritte Welt, sowie die gute Zusammenarbeit auch mit der Kommune. "Ihre klaren Worte sind in der heutigen, egoistischen Welt nötiger denn je", richtete Denn das Wort an Birtel, der kein "pflegeleichter Pfarrer" sei. Denn wünschte dem Jubilar für die Zukunft Kraft, Gesundheit, aber auch einen guten Schuß Gelassenheit, bevor er einen Gutschein für das Kulturprogramm überreichte.
Der evangelische Pastor Udo Grub stellte Worte der Ökumene, die gerade Pastor Birtel so sehr am Herzen liegt, in den Mittelpunkt seiner Ansprache, und überreichte eine Taufschale. Dank für die zahlreichen guten Worte und Präsente sagte der Jubilar Klaus Birtel. "Als Christ in der Gemeine
möchte ich wagen, wofür die Amtskirche noch keinen Mut hat", so Birtel. Und bei all dem Lob, das dem bescheidenen Menschen Birtel zuteil wurde, meinte er: "Hebt euch noch ein paar Worte für später auf." Kein Ende nehmen wollte die anschließende Gratulationstour. Ob Kommunalpolitiker, Vertreter von Schulen, Kindergärten oder anderer Institutionen, Schüler oder Gemeindemitglieder, die Herzlichkeit gegenüber dem Hirten Pastor Birtel kannte keine Grenzen.
Quelle: Schmickler Bonner General-Anzeiger, 11.03.1997, S. 07
In Blau und Weiß über den Rhein
Zwischen Linz und Kripp verkehrt eine neue Fähre
Kosten: Vier Millionen Mark
Am Samstag um Punkt 15.11 Uhr war es soweit. Mit neuem Logo und der durch die Taufe besiegelten Indienststellung der neuen Rhein-Fähre Linz-Remagen begann für die Rheinfähre Linz-Kripp GmbH eine neue Epoche. Mit der jetzt blau-weiß gestalteten Rheinfähre hat das Unternehmen nach zehn Jahren wieder ein neues Flaggschiff. Die neue Fähre, die seit Sonntag offiziell zwischen Linz und Remagen pendelt, hat ihre Vorgängerin, die alte "Sankt Johannes", im Handumdrehen vergessen lassen. Seit gestern heißt es "Rhein rüber" mit der "Linz-Remagen".
Als besonderen Tag bezeichnete der Linzer Bürgermeister Adi Buchwald die Indienststellung der mit modernster Ausrüstung versehenen Rheinfähre. Sein Dank galt vor allem dem Ingenieur Heiko Buchloh, der eine exzellente Arbeit geleistet habe. Aber auch dem Geschäftsführer der Linz-Kripp GmbH, Willi Stumpf, den er als Motor der Aktion "Neubau Fähre" bezeichnete. Gut zwei Jahre sind vergangen, seit der Verwaltungsrat der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH den Bau einer neuen Fähre beschlossen hatte. Nun wurde das etwa vier Millionen Mark teure Schiff getauft. Mit Schwung schleuderten die beiden Weinköniginnen Sandra Daub aus Linz und Nicole Bögeholz aus Remagen die obligatorische Sektflasche gegen das noch strahlend weiße Führerhaus. Dann gab der Chef der Meidericher Schiffswerft, Hans-Jürgen Walzer, das Kommando zum Niederholen der Werft- und zum Hissen der Reedereiflagge. Die Einsegnung hatten die Pastoren Christoph C. Schwaegermann und Klaus Birtel übernommen. Neben den Bürgermeistern Adi Buchwald und Lorenz Denn waren auch die Beigeordneten und Stadträte beider Städte an Bord. Mit gemischten Gefühlen verfolgte wohl der ehemalige Fährmeister Wilhelm Mending das feierliche Treiben auf der neuen Rheinfähre. Schließlich war unter seiner Regie damals die alte Fähre "Stadt Linz" gebaut worden, die nun ihren Dienst in Bremen tut. An beiden Ufern hatten sich zudem Hunderte von Menschen versammelt. Für Unterhaltung sorgte das Fanfarencorps Linz und das Tambourcorps Kripp. Für die jungen Besucher war auf Linzer Seite eine Hüpfburg aufgebaut, am Kripper Ufer lockte eine Rundfahrt mit dem Bähnchen.
Quelle: LN, Bonner General-Anzeiger, 21.07.1997, S. 06
Mit Pferdestärken gegen den reißenden Strom
Treidelschiffahrt Raddampfer als Konkurrenz
Vom Leinpfad zum Radweg
Im April 1848 gehen die Menschen am Ufer des Rheins auf die Barrikaden. "Für die Arbeit und gegen das Kapital" laden sie ihre Büchsen mit Kugeln und Nägeln und schießen auf die vorbeifahrenden Dampfschiffe. Der Grund: Die neuartige Technik bedroht die berufliche Existenz vieler Rheinanwohner.
Noch stärkeres Geschütz fahren zur gleichen Zeit die Bürger in Kripp auf. Sie postieren eine kleine Kanone am Batterieweg und feuern dicke Felsbrocken auf die "Feuerschiffe". Doch während der Aufstand in anderen Gegenden anhält, donnert die Kanone in Kripp nicht lange. Die Preußische Regierung lässt eine Truppe Husaren nach Kripp marschieren, die den Ort besetzen und die Rädelsführer verhaften. Den Aufruhr hatten die Raddampfer provoziert, die seit 1816 auf dem Rhein fuhren und die Schifffahrt revolutioniert hatten.
Für die heftige Reaktion der Rheinländer hat der Heimatforscher und ehemalige Bürgermeister von Remagen, Hans Peter Kürten, eine einfache Erklärung: "Die Menschen kämpften damals um ihre Existenz. Sie fühlten sich von einer neuartigen Technik bedroht, die sie arbeits- und brotlos machte." Die motorisierten Schiffe waren für die alteingesessenen Leinschiffer zur übermächtigen Konkurrenz geworden. Während die Dampfer leicht gegen die Strömung ankamen, mussten sie ihre Segelboote mühsam und langsam flussaufwärts ziehen lassen. Sie spannten dafür Pferde oder manchmal auch Menschen ein, die den Kahn stromaufwärts "treidelten".
Von der Treidelschifffahrt lebten die Gastwirte am Rhein und die Pferdebauern, Rheinhalfen genannt. Von diesen mieteten die Leinschiffer etappenweise ihre Zugtiere samt den dazugehörigen Knechten. Nach 10 bis 15 Kilometern wechselten sie das Gespann an der nächsten Krippe, einem Rastplatz für Mensch und Tier. In der Halferkneipe verzechten die Knechte ihr "Schnapsgeld". Sogar die Pferde im Stall bekamen alkoholhaltigen Kraftstoff vorgesetzt: Hafer pur, übergossen mit billigem Wein.
Eine solche Krippe entstand nach 1700 auch in der Nähe von Remagen. Darum herum ließen sich viele Pferdebauern nieder. Ihr neues Zuhause nannten sie Kripp. "Der alte Leinpfad führte von Holland bis zum Oberrhein am linken Rheinufer entlang", berichtet Hans Peter Kürten. Bei gutem Wetter dauerte die "große Fahrt" von Köln nach Mainz drei Tage, eine Reise nach Straßburg zwei bis drei Wochen. Entscheidend für die Fahrtzeiten war weniger die Länge der Strecke als ihr Zustand. Bei Niedrigwasser bekamen die Leinschiffer Probleme mit Sandbänken. Und oft verhedderte sich die Treidelleine, die vom Schiffsmast zum Ufer führte, in Bäumen und Gestrüpp. Ein berüchtigtes Hindernis am Leinpfad war die alte Sankt-Maternus-Kirche in Köln-Rodenkirchen. Sie stand so nahe am Fluss, dass alle Fährleute dort ihre Leinen "umstechen" mußten. Die Knechte spannten die Pferde aus und ruderten das Zugseil in einem Nachen um das Gotteshaus herum.
Tiefe Wasserlöcher, Sandhügel und dichte Böschungen am Uferweg machten die Treidelei zur Tortur. Den Kahn im Schlepptau zogen die Pferde immer zum Ufer hin. Schon nach kurzer Zeit