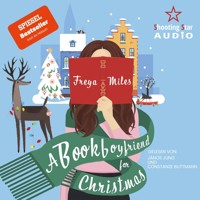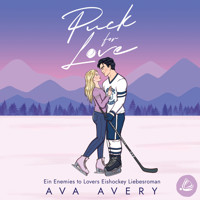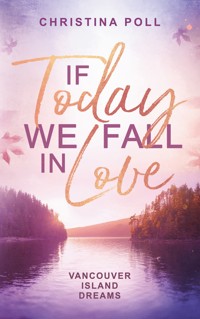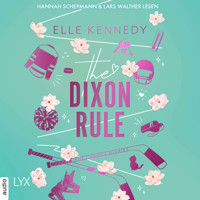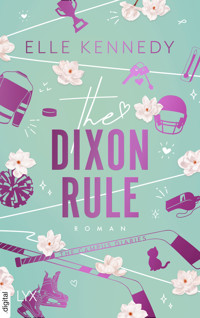7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Carl Zuckmayer, Gesammelte Werke in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
Am Abend des Fastnachtsamstags 1913 bricht im Mainzer Dom ein unbekannter junger Mann mit einem Stilett im Rücken tot zusammen. Wer ist sein Mörder? Wo liegen die Motive für die rätselhafte Tat? Während des turbulenten Treibens der Mainzer Fastnacht versucht der Staatsanwalt diese Fragen zu klären. Im Morgengrauen des Aschermittwochs finden nicht nur Mummenschanz und Maskenspiel des Narrenvolks ihr nüchternes Ende: der Ermordete hat die ins Geschehen Verwickelten zur Fastnachtsbeichte gezwungen. Carl Zuckmayers berühmte Erzählung über Liebe, Schuld, Verstrickung und die Suche nach Barmherzigkeit gehört zu den bedeutendsten Werken des Autors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Carl Zuckmayer
Die Fastnachtsbeichte
Erzählung
FISCHER E-Books
Inhalt
Die Fastnachtsbeichte
Am Fastnachtsamstag des Jahres 1913 – es war ein trübkühler, dämmeriger Nachmittag Mitte Februar – betrat ein Mensch in der Uniform des Sechsten Dragonerregiments durch einen Nebeneingang am Liebfrauenplatz das schwach erleuchtete Seitenschiff des Mainzer Doms. Unweit, am Gutenbergplatz, vor dem neuen Stadttheater, von dessen offnem Balkon herab sich Prinz und Prinzessin Karneval in ihrem barocken Aufputz der Menge zeigten, wurden grade, wie in jedem Jahr, die ›Rekruten Seiner Närrischen Majestät‹ vereidigt – die Anwärter auf Mitgliedschaft in einem der traditionellen Fastnachtsbataillone, der Prinzen- oder Ranzengarde; und wenn die gepolsterte Doppeltür des inneren Domeingangs auf- und zuschwang, wehten für eine Sekunde der heitere Lärm, Trommelschlag, Pfeifengeschrill und das schon leicht angeschwipste Gejohle, das die Stadt von der Großen Bleiche bis zum Marktplatz überall durchzog, wie ein verworrener Windgesang herein.
Drinnen aber im Dom, in dem außer dem Ewigen Licht vorm Hochaltar nur wenige Lampen und Wachsstöcke brannten, herrschte die gewohnte, steinerne Stille eines Beichtnachmittags, vom Knistern der Kerzen vertieft, und man sah da und dort vor den einzelnen, in den Seitenschiffen verteilten Beichtstühlen, deren jeder mit dem Namen des in ihm verborgenen Priesters oder Domherrn bezeichnet war, ein paar dunkle Gestalten knien, von denen einige das Gesicht in die Hände geschlagen hatten. Allzuviele Bußfertige schien der Fastnachtsamstag nicht anzulocken. Auch vor dem Altar der Madonna im Rosenhag hockten nur wenige alte Weiblein, in Erwartung der Vesperandacht.
Der Mann in der hellblauen Kavalleristenuniform mit dem steifen, samtschwarzen Kragen ging gradewegs auf den nächsten der holzgeschnitzten Beichtstühle zu – es war der des Domkapitulars Dr. Henrici –, vor dem in diesem Augenblick niemand wartete, und der überhaupt schwachen Zulauf hatte; denn der gelehrte Herr stand nicht nur im Ruf besonderer Strenge und eines ungewöhnlich scharfen Gedächtnisses, sondern auch einer zunehmenden Schwerhörigkeit. Der Dragoner schien es eilig zu haben – er stach mit sehr raschen und merkwürdig kurzen, steifen, fast hüpfenden Schrittchen, wie ein Pferd im abgekürzten Trab, schnurstracks und ohne vorher das Knie zu beugen auf den Eingang des Beichtstuhls zu. Dem Dr. Henrici, der eben den dunklen Vorhang seines hölzernen Gelasses ein wenig gelüpft hatte (in der geheimen Hoffnung, gar keinen Beichtwilligen mehr vorzufinden und etwas rascher zu seiner unterbrochenen Lektüre in der bischöflichen Bibliothek zurückkehren zu können), fiel der kurze, stelzige Schritt des späten Ankömmlings auf. Vielleicht hat er sich wundgeritten, ging es ihm durch den Kopf, da er das leise Klirren der Anschnallsporen auf den Sandsteinfliesen vernahm. Dann ließ er den Zipfel des Vorhangs fallen und wandte sein Gesicht dem Eingetretenen entgegen.
Gleich darauf aber zwängte sich die priesterliche Gestalt mit ungewöhnlicher Hast aus der schmalen Öffnung des Beichtstuhls heraus, und der Domkapitular eilte, so rasch es ihm das Alter und die Würde seines Gewandes erlaubten, durch das große Mittelschiff und über die Stufen der Apsis zum Chor hinauf, wo einer der beiden wachhabenden Domschweizer, auf seine Hellebarde gestützt, verschlafen herumstand. Auch der zweite Domschweizer, der in der Gegend des Haupteingangs patrouillierte, kam neugierig herbei, da er die erregten Gesten sah, mit denen der geistliche Herr auf seinen Wachkameraden einflüsterte.
Rasch folgten beide Schweizer, nachdem sie ihre Hellebarden an eine Steinsäule gelehnt hatten, dem Beichtvater zu seinem verlassenen Gehäuse, aus dessen seitlichem Eintritt, von der niedrigen Kniebank herunter, gleichsam umgeklappt, wie Teile einer zerlegten Gliederpuppe und als gehörten sie gar nicht zu einem Körper, ein paar Beine in den Röhren der militärischen Ausgehhosen und die blank gewichsten Stiefel mit den Radsporen heraushingen. Der Oberkörper des Mannes schien in sich zusammengesunken, die Hände waren noch vor seinem Leib gefaltet, das Kinn auf die hölzerne Kante unterhalb des Beichtgitters aufgeschlagen.
Vorsichtig hoben die beiden Männer den reglosen Körper aus dem fast sargartig engen Holzkasten heraus, und als sie ihn umdrehten, um ihn wegzutragen, baumelten der Kopf und die Arme schlenkernd herab. Das Mittelschiff vermeidend, um bei den wenigen Besuchern kein Aufsehen zu machen, schleppten sie ihn durch die Seitengänge zur Sakristei – von Dr. Henrici gefolgt, dem trotz des Herzpochens, das ihm der Schreck verursacht hatte, nicht das Skurrile und fast Theaterhafte dieses Aufzugs entging: von den beiden Domschweizern in ihren altertümlichen Kostümen war der eine sehr kurz, breit, mit vorstehendem Oberbauch, der andere lang, dürr und o-beinig, was bei den Pluderhosen und Kniestrümpfen seiner Tracht besonders auffiel. Die ungewohnte Last gab ihren Schritten, die an dem feierlichen Gang der Prozessionen und geistlichen Umzüge geschult waren, etwas knieweich Verwackeltes. Sie wirkten, als hätte man sie von der Straße weg als Statisten zu einer Opernaufführung geholt, oder als hätten sie eine Szene aus den ›Contes drôlatiques‹ darzustellen.
Die Gestalt zwischen ihnen jedoch, als man sie nun in Ermangelung einer anderen Bettungsgelegenheit auf den flachen, steinernen Sarkophagdeckel eines längst verstorbenen Kurfürsten niederlegte, strahlte in ihrer Unbeweglichkeit eine seltsame, endgültige Stille aus.
»Vielleicht ist ihm nur schlecht geworden«, sagte Henrici laut zu den schnaufenden Trägern. Dabei wußte er in seinem Innern, noch ehe er sich überzeugen konnte: dieser Mann war tot. Gleichzeitig bemerkte er auf dem weißen Rand seiner Stola, die er grade abnehmen wollte, einige Blutspritzer, und als er sich jetzt zu dem ausgestreckten Körper niederbeugte, sah er in der helleren Beleuchtung des Sakristeivorraumes, daß ein dunkler Streifen seitlich aus seinem Mundwinkel sickerte. »Ein Blutsturz aus der Lunge vermutlich«, sagte er, »man muß rasch einen Doktor holen. Kennt einer von euch den Mann?« Die beiden schüttelten die Köpfe.
»Vor dem Prälat Gottron seinem Beichtstuhl«, sagte einer von ihnen umständlich, »kniet noch der Dr. Carlebach, vom Welschnonnegäßchen.«
»Dann bitten Sie ihn doch her«, sagte Henrici, »und Sie«, wandte er sich an den anderen, »holen mal rasch etwas Wasser, für alle Fäll.«
Der Angesprochene zuckte die Achseln und legte, bevor er ging, die Militärmütze, die er vor dem Beichtstuhl aufgehoben hatte, mit dem Deckel nach oben auf die Brust des Dragoners, die sich nicht bewegte.
Henrici, als er allein mit ihm war, fühlte eine Neigung, die Mütze wieder wegzunehmen und dem Mann auf der Brust die Hände zu falten. Aber er wagte nicht, ihn zu berühren, bevor der Arzt es getan hatte. Das Gesicht mit den halbgeschlossenen Augen war jetzt von einer wächsernen Fahlheit durchtränkt, und es schien dem Priester, als beginne das Blut am Mundwinkel zu gerinnen. Es war ein hübsches, fast schönes Jungmännergesicht, mit einem kleinen, dunklen Schnurrbärtchen über starken Lippen. »Nein«, sagte Henrici vor sich hin, und schüttelte den Kopf. Einen Augenblick hatte er geglaubt, in den Gesichtszügen etwas entdeckt zu haben, das ihm bekannt vorkam. Aber es verflüchtigte sich sofort wieder und fand keine Bestätigung in seinem Gedächtnis. Leise begann er, das Vaterunser zu sagen. Er war noch nicht zu Ende, als der Arzt eintrat, ein kleiner, weißhaariger Herr in altväterlich dunkler Kleidung. Er sah aus, als habe ihn der Ruf von einer Bußübung für sehr läßliche Sünden weggeholt.
»Exitus«, sagte er nach einer kurzen Prüfung, schlug ein Kreuz und strich dem Toten leicht über die Lider.
»So ein junger Mensch«, sagte Henrici, »er kann doch kaum mehr als fünfundzwanzig sein. Was dem wohl gefehlt hat?«
In diesem Augenblick fuhr der Arzt, der den Oberkörper des Dragoners ein wenig angehoben hatte, vielleicht, um doch noch einmal nach Herztönen zu lauschen, heftig zusammen und zog seine Hand zurück, als hätte er sie verbrannt. Dann deutete er zwischen die Schultern des jungen Mannes. Dort, im grünen Strahl einer Gaslampe deutlich aufblinkend, mehr nach der linken Seite hin, war etwas, was da nicht hingehörte. Die beiden alten Herrn schauten einander an. Die rotrandigen Augen des Doktors wässerten nervös, und dem Domherrn war es, als krieche etwas Kaltes über die Haut seines Hinterkopfs. Was da im Rücken des toten Mannes steckte, mitten in der kaum befleckten, blauen Montur, war unverkennbar der Knauf einer Waffe.
»Erdolcht«, flüsterte der Arzt und ließ den Oberkörper des Toten vorsichtig auf die Seite gleiten.
»Ja – aber – wieso denn –«, brachte Henrici hervor, während tausend Gedanken und Vorstellungen gleichzeitig in ihm aufkreuzten.
Die beiden Schweizer, einer von ihnen mit einem Glas Wasser in der Hand, waren herzugetreten und starrten mit glotzigen Augen.
»Wollen Sie bitte«, sagte Henrici zu dem Arzt und den Wächtern, »das Nötige veranlassen – mit der Polizei und so weiter. Ich fühle mich nicht ganz wohl.« Er wendete sich, fuhr mit der Hand über die Stirn. »Ich stehe dann gleich wieder zur Verfügung«, sagte er noch, »nur etwas frische Luft …«
Langsam schritt er den Weg durch die Kirche zurück, den sie einige Minuten vorher mit dem leblosen Körper gegangen waren – an seinem Beichtstuhl vorbei, zu dem er einen kurzen, zerstreuten Blick hinwarf –, weiter zu dem seitlichen Eingang, durch den der Dragoner eingetreten war. Es war nichts zu sehen, keine Blutspur oder dergleichen, und Henrici suchte auch nichts. Der stelzige kurze Trab des Mannes fiel ihm ein – als ob er vor etwas habe fortlaufen wollen, das ihn doch schon ereilt hatte.
Der innere Eingang bestand im Winter aus zwei dick gepolsterten, schwingenden Holztüren. Zwischen diesen und der schweren, eisenbeschlagenen Außentür, die man mit einer Metallklinke aufzog, war ein halbdunkler Zwischenraum, jetzt schon fast gänzlich finster, da das Licht auf der Seite über den gedruckten Kundmachungen der Diözese – wohl durch die Abhaltung der Domwächter oder eine Verspätung des Küsters – noch nicht angezündet war. ›Hier‹, dachte Henrici schaudernd, ›kann es geschehen sein … Oder?‹
Als er langsam die Außentür öffnete, um seine Lungen mit der kühlen, regnerischen Abendluft zu füllen, war es ihm, als ob auf der halbdunklen Straße etwas wegliefe … Er hatte, ohne sich genau darüber Rechenschaft zu geben, ganz deutlich das Gefühl von ›etwas‹ – also nicht unbedingt von einem Menschen … Es hätte auch – etwas anderes sein können – ein Tier, ein ungewöhnlich großer Hund vielleicht – oder aber doch eine tiefgeduckte Menschengestalt? Er hatte es, in dem kurzen Augenblick, kaum zu Gesicht bekommen, mehr die Bewegung gespürt – aber es war etwas vor ihm aufgesprungen, wie ein schwerer, lautloser Schatten, dem zu folgen unmöglich war; denn erstens war sich Henrici völlig im unklaren über die Richtung, in der dieses Etwas entwichen war, falls es überhaupt eine Substanz hatte – und zweitens wälzte sich in diesem Moment, vom ›Höfchen‹ her, die ganze Straße und die Ausdehnung des kleinen Platzes füllend, unter dem dröhnenden Einsatz von Kesselpauke, Schellebaum und Schlagdeckel, von den Lichtern bunter Lampions und rötlichem Fackelschein überzuckt, schreiend, lachend, johlend und die als ›Handgeld‹ empfangenen Weinflaschen schwenkend, der frisch vereidigte Rekrutentrupp der ›Ranzengarde‹, mit närrischen Kappen auf dem Kopf, in der Richtung aufs Fischtor zu – und eine riesige Menschenmenge hinterher. Dienstmädchen und Kinder quollen aus allen Haustüren, im Nu waren auch die Nebengassen von Leuten überschwemmt, und aus unzähligen Mündern drang – zu dem raßligen Schmettern der Blechmusik – mit schrillen, kreischenden oder schon suff- und schreiheiseren Stimmen – der karnevalistische Marschgesang:
– Rizzambaa, Rizzambaa,
Morje fängt die Fassenacht aa –
wie ein päanisches Jubelgeheul zum Rheinstrom hin verhallend.
Der Domkapitular Henrici hörte es kaum. Ihm war etwas eingefallen, das – leise zuerst, dann mit immer lauterer Stimme – in ihm sprach. Er hatte nicht daran gedacht – da es zu selbstverständlich, zu gewohnt, zu unauffällig war, um sich in die Erinnerung einzukerben. Jetzt aber wußte er es ganz genau, und es nahm in seinem Innern eine unbegreifliche Bedeutung an – so als sei damit alles Unbekannte und Dunkle schon auf geheimnisvolle Weise geklärt … Der fremde junge Mann hatte nämlich im Beichtstuhl, bevor er zusammenbrach, noch zu ihm gesprochen. Es waren jedoch nur die ersten vier Worte der Beichtformel gewesen, wie sie jeder zur Einleitung seines Bekenntnisses dem an Gottes Statt lauschenden Priester zuflüstert:
»Ich armer, sündiger Mensch –«
Dann war er verstummt.
Zwischen Walluf und Eltville, von Mainz aus am besten mit dem zum rechten Rheinufer hinüberfahrenden Dampfschiff zu erreichen, lag, in der Nähe des Dörfchens Nieder-Keddrich, am Fuße des Taunus, das große Weingut Keddrichsbach, mit seinen weltberühmten Wingerten ›Keddricher Ölberg‹ und ›Keddrichsbacher Blutströpfchen‹. Es stand seit Generationen im Besitz der Familie Panezza, der außerdem ein bedeutendes Sägewerk und eine Ziegelfabrik am Rheinufer, sowie, von der jetzigen Frau Panezza in die Ehe eingebracht, eine Weinkellerei in dem damals noch österreichischen Meran gehörte. Das Herrschaftshaus, zwischen den Weinbergen in einem Park mit reichem Baumbestand gelegen, war um die Jahrhundertwende neu ausgebaut worden, und zwar in jenem schloßartigen Prunkstil, mit Erkerchen, Türmchen und vielfach verzierter Fassade, der seinen Schöpfern zuerst so stolz und heiter vorkam, und dem schon nach kurzer Zeit etwas Muffig-Morbides und Gottverlassenes anhaftete.
Dort schellte es, am gleichen Fastnachtsamstag gegen Abend, recht heftig an der Haustür, die – portalartig aufgemacht – mit einem großen, schmiedeeisernen Klingelzug versehen war.
›Wer soll denn jetzt schellen‹, dachte das Dienstmädchen Bertel, das im obersten Stockwerk des Hauses, wo die Wäschekammern und Flickstuben lagen, der alten Nähmamsell beim Herrichten von Ballkostümen half. Sie knöpfte sich ihre hübsche, hellblau mit weiß karierte Trägerschürze über den Schultern zu und warf rasch einen Blick in den Spiegel, in dem ihr frisches, dunkeläugiges und dunkel umlocktes Gesicht erschien, fuhr sich auch mit der Zunge über die Lippen und mit dem feuchten Finger über die Augenbrauen – denn es war immer möglich, im Flur dem jungen Herrn zu begegnen, wenn er, wie jetzt, auf Urlaub zu Hause war. Dann sprang sie in einem hüpfenden Galopp, der ihr bei jeder Stufe die Brüste im Hemd wippen ließ, die breite Haustreppe hinunter. Bevor sie jedoch den letzten Halbstock erreichte – es hatte inzwischen nochmals und noch etwas heftiger geschellt –, hörte sie, daß die Haustür bereits geöffnet wurde. Der junge Herr, der sich mit seiner Schwester unten im Musikzimmer aufgehalten hatte, war ihr zuvorgekommen, und sie sah, während sie auf der Treppe stehenblieb, von rückwärts seine schmale Gestalt mit der hellgrauen Litewka lose über den Schultern, wie er die mit buntem, bleigefaßtem Glas eingelegte Tür halb offen hielt, indem er sich mit einer fragenden Geste hinausbeugte. Gleichzeitig hörte sie von draußen die Stimme eines Mädchens oder einer jungen Frau, die selbst noch nicht sichtbar war, in erregtem Tonfall und mit ausländischem Akzent fragen: »Kann ich den Herrn Panezza sprechen?«
»Er ist nicht zu Hause«, antwortete der junge Herr, den sie vielleicht für einen Diener gehalten hatte, »aber ich bin sein Sohn, Jeanmarie.« – »Das kann nicht sein!« rief die Stimme der jungen Frau draußen, fast im Aufschrei, »das kann nicht sein«, fügte sie dann leise hinzu.
Der junge Herr war inzwischen auf die Stufen unter dem Glasdach hinausgetreten, und das Mädchen Bertel konnte nicht genau hören, was gesprochen wurde, doch als es neugierig näher lief, kam Jeanmarie bereits lachend zurück und führte eine junge Dame am Arm, die über einem eleganten Reisekostüm eine Regenpelerine trug und ein kleines Köfferchen in der Hand hielt.
»Helfen Sie bitte der Signora«, sagte der junge Herr heiter und winkte Bertel zu, während er der Dame das Köfferchen aus der Hand nahm, »und dann bringen Sie gleich einen heißen Tee und Rum. Das ist meine Cousine Viola, mit der ich als Kind gespielt habe – sie hat mich nicht wiedererkannt!« – »Nun«, sagte die junge Dame und versuchte ein Lächeln, »wir waren ja noch sehr klein damals.« – »Allerdings«, rief Jeanmarie aufgeräumt, »kaum vier oder fünf Jahre, aber ich habe dich trotzdem erkannt, bevor du den Namen gesagt hast! Erinnerst du dich nicht, wie wir immer am Rebgeländer auf die Gartenmauer hinauf –« Er unterbrach sich, da er so etwas wie einen gequälten Zug im Gesicht der Besucherin bemerkt hatte, woraus er schloß, daß sie ihn schlecht verstand, und begann italienisch zu sprechen.
›Sie ist schön‹, dachte Bertel, während sie der Fremden die feuchte Pelerine und das schleierverzierte Hütchen abnahm. Ein Stich von grundloser Eifersucht zuckte ihr durch die Brust. Das Gesicht der jungen Dame war blaß, vielleicht von den Anstrengungen einer langen Reise, die großen, dicht bewimperten Augen, die von einem so dunklen Blau waren, daß sie fast schwarz wirkten, ein wenig umschattet. Schwarze Locken fielen ihr über die Ohren herab, als sie das Reisehütchen absetzte. Mit einem Blick hatte Bertel taxiert, daß ihre Figuren fast die gleichen waren: nicht zu groß, jugendlich straff und schlank, mit früh entwickelten Formen schmiegsamer Weiblichkeit. Die Signorina trug Knöpfstiefelchen aus feinem Leder bis über die Knöchel hinauf, die jetzt mit Straßenkot bespritzt waren.
›Komisch‹, dachte Bertel, und schaute den beiden nach, wie sie ins Musikzimmer traten, ›warum hat sie so geschrien?‹
»Das kann nicht sein!« hatte die Fremde gerufen. Nun – sie hatte halt ihren Cousin nicht wiedererkannt, ihn sich anders erwartet … und damit hatte sich wohl auch Jeanmarie den Ausruf erklärt. Aber dem aufgeweckten Sinn des Mädchens schien es, als habe in jenem Tonfall etwas mehr mitgeschwungen als nur Staunen und Überraschung –: es war eher, wie wenn jemand eine schreckliche Entdeckung macht – oder eine schlimme Neuigkeit erfährt … ›Ach was geht’s mich an‹, sagte die Bertel, stampfte in einem ihr selbst kaum bewußten, nervösen Trotz mit dem Fuß auf und ging, um die noch offene Haustür zu schließen. Einen Augenblick trat sie auf die Stufen, sog die frühe Nachtluft ein, die hier im Rheingau, trotz der noch winterlichen Jahreszeit, ganz stark nach Gartenerde und nach keimenden Kräutern roch … Sie fuhr zusammen, da sich eine dunkle Gestalt aus dem Schatten der beiden mächtigen Edelkastanien hinter der Auffahrt löste. »Ach«, sagte sie dann, »da ist schon die Bäumlern.«
Eine schwer gebaute Frau näherte sich dem Haus, mit einem graubraunen Umschlagtuch um Kopf und Schultern. Es war eine Arbeiterwitwe aus dem Dorf, die in ihrer Jugend einmal im Haus gedient hatte und jetzt bei Gesellschaften in der Küche zu helfen pflegte.
»Es ist noch zu früh, Bäumlern«, rief Bertel ihr zu, »aber komm nur schon rein!«
Die Frau antwortete nicht, warf ihr aus einem früh gealterten, aber noch keineswegs alten Gesicht einen bösen, mißtrauischen Blick zu und entfernte sich schwerfüßig in Richtung zum Gesinde-Eingang.
Auf dem Flügel stand der Klavierauszug des ›Rosenkavalier‹, der damals zum erstenmal im Stadttheater gespielt wurde und die Geschwister Panezza bis zur Berauschung entzückte. Daß viele der Älteren die Musik wegen ihrer kühnen Harmonien als ›hypermodern‹ verschrien und das Buch dekadent oder anrüchig fanden, steigerte die Begeisterung der beiden ins Maßlose, und sie redeten sich seit Wochen nur noch mit Namen aus dem Stück an oder nannten auch in respektlosen Augenblicken ihren lebenslustigen Vater ›den Ox‹, natürlich nur unter sich und wenn er nicht dabei war.
Jeanmarie, der fünfundzwanzig, und seine Schwester Bettine, die dreiundzwanzig war, empfanden sich fast als Zwillinge und lebten im zärtlichen Einverständnis einer heimlichen Verschwörung, die sich vor allem auf die distanziert-ironische Opposition zu sämtlichen Meinungen, Gewohnheiten und Handlungen ihrer Eltern gründete. Jeanmarie, der keinerlei Neigung oder Begabung zum Geschäftsleben empfand und sich nur für Musik interessierte, ohne jedoch zur musikalischen Berufsausbildung talentiert genug zu sein, diente auf Wunsch des Vaters als aktiver Leutnant beim vornehmsten Mainzer Kavallerie-Regiment, den 6er Dragonern. »Bis ich mal sterbe«, pflegte Panezza zu sagen, »soll er ruhig Soldat und Klavier spielen, dann kann er Coupons schneiden. Viel Intelligenz braucht man zu beidem nicht.«
Die künstlerischen Neigungen seiner Kinder schienen ihm eher ein Zeichen geistiger Schwäche oder mangelnder Lebensenergie zu sein, obwohl er selbst ein angeregter Theater- und Konzertbesucher war und überhaupt allen leichteren und beschwingten Daseinselementen zugetan, doch nur innerhalb dessen, was er die ›gesunde Wirklichkeit‹ nannte.
Seine Frau Clotilde, eine geborene Moralter, aus Südtirol stammend und halb sizilianischer Abkunft, neigte mit zunehmenden Jahren zu einer Art von phlegmatischer Kränklichkeit und lebte nur auf, wenn es den Blumengarten oder das Gewächshaus zu betreuen galt.
Bettine, ein unauffälliges Mädchen von gutem Wuchs, schien die Anlage zu Phlegma und Kopfschmerzen von ihrer Mutter geerbt zu haben, doch lag in ihrem Wesen ein versteckter Zug zum Exaltierten, der sich vor der Reife in verstiegener Frömmigkeit, jetzt in einer fast vernarrten Bewunderung für ihren geistig überlegenen, in ihrer Traumvorstellung übermenschlich genialen und bedeutenden Bruder äußerte. Dieser selbst, Jeanmarie, hielt sich weder für genial noch bedeutend, doch war sein Wesen, wie das vieler gut veranlagter junger Leute in diesen Tagen, von einer feinfühligen Skepsis durchsetzt, einem nagenden und ahnungsvollen Zweifel an der Beständigkeit der sie so fest umzingelnden Ordnung, und einer lustvollen, abenteuerlichen Vorstellung von ihrer möglichen Zerstörung, was ihm in seinen eignen Augen und in denen seiner Bekannten etwas vom Außenseiter oder Frondeur verlieh. Trotzdem war er, mit seinen hübschen, dem Vater ähnlichen Zügen und seiner natürlichen Noblesse, durchaus ein angenehmer junger Herr von guten Manieren und heiterer Lebensart.
Jetzt mühten sich beide Geschwister, nicht ohne eine leise Verlegenheit, die plötzlich hereingeschneite Cousine, eigentlich Groß-Cousine oder Base zweiten Grades, deren Besuch aus dem fernen Palermo merkwürdigerweise nicht angekündigt war, ein wenig aufzutauen: denn sie machte noch immer, trotz des wohlgeheizten Salons und des dampfenden Rum-Tees, einen erstarrten oder gefrorenen Eindruck. Zwischendurch allerdings verfiel sie in eine unvermittelte, sprudelnde Lebhaftigkeit, besonders wenn sie vom Deutschen, das sie an sich gut beherrschte, in das beiden Geschwistern von Kind auf vertraute Italienisch überging. Dann hingen Jeanmaries Augen an ihren vollen, etwas zu breiten Lippen und ihrem jählings von innen aufblühenden Gesicht mit den wirklich violenfarbenen Augen, das ihn an Bilder der jungen Eleonora Duse erinnerte.
Sie redete lachend und mit einer ähnlichen Ironie, wie sie Jeanmaries und Bettinens intimen Gesprächston färbte, von zu Hause, von der sizilianischen Gesellschaft und der enormen Langweiligkeit des Lebens im elterlichen Palazzo, die in ihr die sehnsüchtige Erinnerung an ungebundene Kindertage bei ihren Verwandten im Rheingau und den plötzlichen Entschluß zu dieser Reise geweckt habe. Ja, natürlich habe sie gewußt, daß es die wirblige Zeit des Karnevals mit all seiner Tag und Nacht nicht ruhenden Geselligkeit sei, und gerade das, der Wunsch, die berühmte Mainzer Fastnacht mitzumachen, habe sie sozusagen Hals über Kopf in den nächsten und schnellsten D-Zug getrieben. Ihr Gepäck? Das sei wohl noch unterwegs, aber sie könne in ihrem Täschchen (dabei geriet sie ins Stottern und in ein unsicheres, fehlerhaftes Deutsch) dummerweise den Schein nicht finden – am Bahnhof, ja am Hauptbahnhof habe sie sich an einem Schalter nach der Verbindung, den Fahrzeiten des Dampfschiffs erkundigt und dabei – sie konnte plötzlich fast nicht weiterreden wie unter einer sie stoßhaft überfallenden Depression – »dort habe ich ihn verloren«, sagte sie, und ihre Augen füllten sich sogar mit Tränen, als handle es sich um einen ganz anderen Verlust als um den eines Gepäckscheins. »Dort habe ich ihn verloren«, wiederholte sie. Nun, meinte Bettine, beschwichtigend, das Gepäck könne man wohl auf jeden Fall auslösen, und bis es ankomme, ließe sich ihr leicht mit allem Nötigen aushelfen – sogar mit einem Maskenballkostüm, das sie wohl sowieso nicht mitgebracht habe? – Aber, fragte Jeanmarie, den das sofort einsetzende Kleidergespräch der Mädchen langweilte, warum habe sie denn nicht wenigstens vom Bahnhof aus angerufen, man hätte sie natürlich abgeholt oder jemanden an die Haltestelle des Dampfschiffs geschickt – und wie sie denn überhaupt ihren Weg heraufgefunden habe? – Das sei leicht gewesen, der Mann am Billettschalter des Dampfschiffs habe ihr die Richtung gezeigt, aber dann – sie schauerte etwas zusammen, und es sah aus, als wolle ihr Gesicht wieder gefrieren –, ja, dann sei ihr etwas Merkwürdiges, Erschreckendes passiert … Nämlich? – Nämlich eine alte oder vielleicht auch nicht so alte, aber ungepflegte, ärmliche, wohl auch gewöhnliche Frau, die sie in der Nähe des Hoftors getroffen und gefragt habe, ob dies das Gut des Herrn Panezza sei – sie zögerte oder suchte nach Ausdruck –, die habe sie statt einer Antwort beschimpft … von der sei sie (sie gebrauchte das Wort mit einem südländischen Pathos) verflucht worden … »Wie denn, beschimpft, verflucht?« fragte Jeanmarie betroffen. – Die Frau habe zunächst getan, als höre oder verstehe sie sie nicht, und ihr dann plötzlich ein gemeines Wort ins Gesicht geschleudert und die Hand gegen sie erhoben … Was für ein Wort – ob sie sich nicht verhört hätte? oder falsch verstanden? – Nein, sie habe es ihr, ganz laut, noch einmal nachgerufen, als sie dann die Stufen hinaufgelaufen sei: »Verdammte Hur« oder »Verfluchtes Hurenmensch« – sie konnte sich nicht getäuscht haben …
»Ach«, sagte Jeanmarie mit einem verlegenen Lachen, »das war die Bäumlern. Es tut mir leid, daß sie dich erschreckt hat – die spinnt ein bißchen. Sie meint das nicht so.« – »Was sie meint, weiß man nicht genau«, erklärte Bettine, »aber ich glaube, sie ist harmlos, nur nicht ganz richtig im Kopf. Sie war Jeanmaries Amme als junges Ding, da unsre Mutter krank war und nie stillen konnte, und sie haßt alle jungen Frauenzimmer, warum, weiß man nicht. Aber sie ist halt arm, und wenn wir Gesellschaft im Haus haben, holt man sie zum Geschirrspülen, damit sie was verdient und ein paar Restertöpfchen mit heimnehmen kann …« – »Erwartet man denn«, fragte Viola, »heute Gesellschaft im Haus?« – »Allerdings«, sagte Jeanmarie, und zwischen ihm und Bettine flog ein Blick gemeinsamer, temperiert-spöttischer Verzweiflung hin und her … »Eine ganz besondere Gesellschaft sogar, über die du dich vielleicht ein wenig wundern wirst, aber es kommt deinem Wunsch, die Mainzer Fastnacht zu erleben, aufs allerschnellste entgegen – du wirst sogar gradezu in ihr inneres Sanctum eingeführt und ihrer allerhöchsten Kurie konfrontiert werden …« – »Wieso denn das«, fragte Viola verwirrt und mit einem fast ängstlichen Ausdruck, und ob sie denn, als Fremde, bei einer so internen Angelegenheit nicht stören werde? »Keineswegs«, rief Jeanmarie, »die unerwartete Anwesenheit eines hübschen Mädchens wird höchstens die Stimmung steigern, die sowieso gewiß schon recht ausgelassen ist. Unser Vater«, fuhr er, mit einem halb lachenden, halb klagenden Blick zu Bettine fort, »ist nämlich ein ›alter Narr‹ – das bedeutet hier nichts Despektierliches, sondern nur, daß er von Jugend auf zum Präsidium des einheimischen Karnevalvereins gehört und sich die Pflege der Fastnacht, ihrer Gebräuche, Zeremonien, Festivitäten, zu einer Art von Lebensaufgabe gemacht hat, die er sich auch eine ganze Menge Geld kosten läßt … Er wurde vor fünfundzwanzig Jahren schon einmal zum Prinz Karneval gewählt, damals waren wir allerdings noch nicht dabei, und soll eine so glanzvolle Figur gemacht haben, daß man in den bewußten närrischen Zirkeln noch heute davon spricht … Nun, und so haben sie ihn als würdigen Fünfziger noch einmal dazu überredet, so furchtbar schwer dürfte es nicht gewesen sein, der Stadt und der Welt, urbi et orbi, zur allgemeinen Belustigung des Volkes dieses gewaltige Schauspiel zu bieten …«
Seine verzwickte Redeweise und Bettinens Kopfschütteln ließen keinen Zweifel daran, daß die Geschwister sich für ihren Vater und seine karnevalistische Passion ein wenig genierten. Für sie war die Fastnacht, der sie in ihrer Kinderzeit gewiß manches Vergnügen abgewonnen hatten, in ihrem derzeitigen Stadium der Sehnsucht nach verfeinerter Geistigkeit ein recht gewöhnliches und pfahlbürgerliches Amüsement, ein Massenspektakel und ein Ausbruch von ›Fröhlichkeit auf Befehl‹ – wie man ihn vielleicht noch dem einfachen Volk konzedieren konnte –, dessen enthusiastische Zelebrierung durch Leute von Stand, Rang und äußerer Lebenskultur sie aber als geistlosen Unfug empfanden. Sie hätten lieber Theseus zum Vater gehabt als Zettel den Weber – denn so kam er ihnen in seinem karnevalistischen Vereinsgehabe vor –, während Panezza selbst, in seiner närrischen Majestät, sich durchaus als Theseus und volksumjubelten, freudespendenden Landesfürsten fühlte. Ob denn nun ihre Mutter, fragte Viola, auch als Prinzessin Karneval fungiere? Die Geschwister lachten hell auf. Das fehlte noch! Nein, die Mutter pflegte noch nicht einmal den großen, traditionellen Maskenball in der Stadthalle mitzumachen, den kaum ein erwachsener Mensch in Mainz versäumte – sie pflegte nur ihre Blumen und ihre Migräne … Jetzt allerdings war sie mit in die Stadt gefahren, wo Panezza vom Altan des Stadttheaters aus die ›Vereidigung der Rekruten‹ vornahm; aber sie sah sich das Spektakel nur vom Salonfenster der Familie Bekker in der Ludwigstraße an – das seien die Bekkers mit zwei k, worauf diese Familie besonders stolz sei, denn das schien ihr vornehmer zu sein, als sich, wie andere Beckers, mit ck zu schreiben. Und die Tochter der Familie Bekker – mit zwei k –, die blonde Katharina, eine jüngere Schulfreundin der Bettine, war dies Jahr die gekürte und gekrönte Prinzessin Karneval, dreitägige Präsentiergemahlin ihres Herrn Vaters … »Um Gottes willen«, rief Bettine in das nun herzhaft und unbefangen sprudelnde Gespräch und Gelächter hinein, »ich höre die Autos! Sie kommen schon – und wir sind nicht angezogen!«