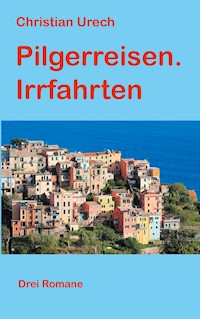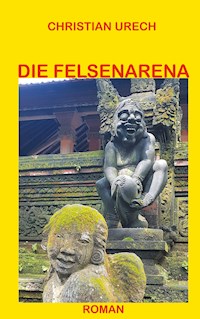
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Die Felsenarena" ist ein philosophischer, fantastischer, utopischer, dystopischer Roman, der die grossen Fragen des Lebens zwar nicht beantwortet, aber auf eine neue, überraschende Weise thematisiert. Die Felsenarena ist ein fiktives Bildungsinstitut für Superreiche im malaysischen Bundesstaat Sarawak, an dem die Eliten von Morgen mit dem Ziel ausgebildet werden, die Menschheit vor der Selbstauslöschung zu bewahren. Ob das gut kommt, darf bezweifelt werden. Auch die Kosmologie und die Quantenphysik spielen in diesem Werk eine tragende Rolle, und nicht zuletzt erleiden die Protagonistinnen und Protagonisten im Roman zwischenmenschliche Irrungen und Wirrungen rund um Geld und Macht, Berauschung und Sex. Zeitreisen, der ideale Staat, die virtuelle Realität, eine neu entstehende Oligarchie, eine Revolution von Kindern, die in einem Blutbad endet, Inseln der Glückseligen und Rockmusik sind weitere Stichworte zum Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
«If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, Infinite. For man has closed himself up, till he sees all things thro' narrow chinks of his cavern.»
William Blake, The Marriage of Heaven and Hell
Inhaltsverzeichnis
Höhenrausch
Später, viel später
Im Cyberspace
Paralleluniversum II
Im Dschungel
Oligarchie
Paralleluniversen III, IV, V und VI
Revolution
Der 15. Juli
Das Verlorene Paradies
Aliens
Alles ist Gut
Der Garten Eden
Das Ende ist der Anfang
HÖHENRAUSCH
Gott scheint einen ausserordentlich skurrilen Humor zu haben, denkt er, wenn er sich all die Wesen vorstellt, die dieser Gott sich ausgedacht und erschaffen hat, vor allem aber angesichts der Spezies Mensch. So denkt er manchmal, stundenlang, versunken in einen einzigen Gedanken. Meistens aber hört er Musik. Er liebt vor allem die Klänge der elektrischen Gitarren, hört zu, wie sie wimmern, schmeicheln, jubilieren, klagen, triumphieren, heulen, drohen und dann in die Stille verzitteren. Manchmal hört er auch Stimmen, oft ganz nah an seinem Ohr, dann wieder weiter weg im Raum, Türen, die behutsam oder auch energisch geöffnet und geschlossen werden. Eine Alarmglocke, die in der Ferne auf- und untergeht. Gedämpfte Schritte auf dem Linoleum. Es ist faszinierend, was man alles aus gedämpften Schritten auf Linoleum heraushören kann. Die Stimmen sprechen Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, Spanisch, Portugiesisch, Serbisch, Tagalog. Er kann problemlos verstehen, was die Stimmen sagen, worüber er etwas erstaunt ist, denn er hat seines Wissens weder Serbisch noch Tagalog jemals gelernt. «Der arme Mann!», sagt zum Beispiel eine weibliche Stimme auf Tagalog. «Er kann einfach nicht sterben!» – «Ja, der hat wirklich Glück gehabt – ein Glück, das sich als riesengrosses Pech erwiesen hat», eine männliche Stimme, ebenfalls auf Tagalog, dann ein glucksendes kleines Lachen, «das heisst, eigentlich hat er ja immer noch Pech.» – «Ach komm!», die weibliche Stimme, vorwurfsvoll, «mach dich nicht auch noch lustig über ihn!» Und dann, beinahe flüsternd: «Das gibt schlechtes Karma.» Und so weiter. Die Stimmen sind dann schnell wieder weg. Meistens hört er, wie gesagt, sowieso lieber Musik.
Prinz Jefri gilt heute als Enfant terrible der Familie, als Playboy. Ein paar Beispiele: Er gab einst bis zu 50 Millionen Dollar aus. Pro Monat. Er leistete sich noble Karossen – je mehr Pferdestärken, desto besser. Er besass einen Helikopter, acht Privatjets für sein Leben im Jetset. Er konnte fünf Schiffe sein Eigen nennen, darunter eine Jacht namens «Titten», die zwei Begleitboote wurden auf «Nipple 1» und «Nipple 2» getauft. Die Bezeichnung mag etwas erstaunen in einem Land, dessen Staatsreligion der Islam ist.
Doch Jefri fiel, nachdem in den 90er-Jahren ans Licht kam, dass er in seiner Funktion als Bruneis Finanzminister 14,8 Milliarden Dollar unterschlagen hatte. Jefri musste ins Exil. Es kam zum Zwist zwischen den Brüdern.
MAX
Wahrscheinlich verdanken wir die Felsenarena einem Vulkanausbruch. Tief unten leuchtet dunkelblau ein Bergsee. Die Felsenarena – weiss der Teufel, warum wir sie so nennen – umschliesst den See auf drei Seiten, bildet einen Dreiviertelkreis. Dort, wo der Kreis sich öffnet, ist auf einem erheblich tieferen Höhenniveau das satte Grün des tropischen Urwalds zu erahnen. Das Institut ist etwa zweihundert Meter unterhalb des Grates in den Fels hineingebaut. Von aussen ist es kaum wahrzunehmen; wenn man weiss, worum es sich handelt, kann man Fensterlöcher erahnen und ergeben die rampenartigen Einbuchtungen einen Sinn. Sei es durch Zufall, sei es gewollt – das Institut ist perfekt getarnt. Niemand würde annehmen, dass es gegen tausend Zöglinge und über zweihundert Lehrkräfte beherbergt (und dann noch eine unbekannte Zahl von Hilfspersonal) und neben Hörsälen, Schulzimmern, Trainingsräumen, Labors, Kinos, Theatersälen, Turnhallen, Schwimmbädern auch eine gigantische Aula enthält – natürlich alles digitalisiert und mit den neusten und ausgefeiltesten technischen Errungenschaften ausgestattet. Der Zugang zum Institut erfolgt auf der anderen, dem Institut abgewandten Seite der Bergkette durch einen Tunnel, der in den Berg hineinführt und keinen Ausgang hat. Die Strasse, die zu diesem Tunnel gehört, mündet in eine gigantische Empfangshalle, wo ankommende Fahrzeuge, Waren und Güter triagiert werden. Ausserdem befindet sich auf dem Bergkamm oberhalb des Instituts ein Landeplatz für mehrere Dutzend Helikopter. Der Bau des Instituts muss Unsummen verschlungen haben.
Hier in der Höhe sind die Temperaturen trotz tropischem Klima angenehm. Wann immer ich auf dem Felsvorsprung vor meinem Apartment stehe, auf meinem «Balkon» gewissermassen, bin ich fasziniert und ergriffen von der Schönheit des Rundblicks, den mein Arbeitsplatz mir bietet. Ich bin seit sieben Jahren im Institut als Lehrer tätig. Mein Fach heisst «Kommunikation und Kreativität», und es steht mir ausdrücklich völlig frei, wie ich meine Lektionen gestalten und was ich meinen Studenten beibringen will. Ich schreibe bewusst «Studenten», denn ich unterrichte nur männliche Schüler. Die Leiterin des Instituts hält nichts von Koedukation und hat die Klassen nach Geschlechtern getrennt.
Diese Leiterin ist eine weltbekannte Architektin, die sich aber auch auf anderen Feldern der Kunst hervortut. Vor allem ist sie eine grossartige Malerin und Bildhauerin. Sie hat das Institut entworfen und mit dem Ziel gegründet, eine Elite zu formen, die die Zukunft der Menschheit, die sich bekanntlich in keinem guten Zustand befindet, sichern soll. Da sie die grosse Mehrheit der Menschen für unfähig hält, sinnvoll zu denken und zu handeln, nimmt sie in ihrem Institut nur jene jungen Menschen auf, die später einmal die Fähigkeiten und die Macht haben werden, wirklich etwas zu bewirken – zukünftige Wirtschaftskapitäne, Wissenschaftlerinnen, Politiker und Künstler. Das erste Hindernis, in die Schule aufgenommen zu werden, ist zunächst einmal das (fehlende) Geld. Nur Familien, die sehr reich sind, können es sich leisten, ihre Töchter und Söhne auf das Institut zu schicken. Nur solche Familien wissen überhaupt von der Existenz des Instituts. Die Leiterin hält nämlich auch nichts von Öffentlichkeitsarbeit. Und übrigens auch nichts von Demokratie. Damit aber nicht genug – die Kandidatinnen und Kandidaten werden überdies einem strengen Assessment unterzogen, bevor sie akzeptiert werden. Unterbelichtete Wohlstandskids haben in der Felsenarena nichts zu suchen.
Ich heisse Max. Das ist, finde ich, ein perfekter Name. Drei Buchstaben, ein Effekt, ein Knall, eine Explosion. Ich habe mich immer als Max gefühlt. Ich weiss nicht, wer mir diesen Namen gegeben hat, denn ich kenne meine Eltern nicht. Ich weiss nichts vom Ursprung meiner Existenz, aber das ist mir egal. Es wäre mir recht, wenn ich in der Retorte gezeugt worden wäre. Aber ich weiss, wem ich alles verdanke, was ich bin.
Die Leiterin des Instituts ist eine sehr kluge, sehr charismatische Persönlichkeit, die das Menschliche, wie wir es gemeinhin kennen, weit hinter sich gelassen hat. Das Menschsein ist ja nicht gerade etwas, was man sich wünscht. Menschen sind sehr destruktiv. Nicht per se, aber sobald die Umstände es zulassen, verwandeln sie sich in Bestien. Kein Lebewesen würde wünschen, sich als Mensch auf dieser Welt zu inkarnieren. Kein Baum, sagt die Weise, würde mit einem Menschen tauschen wollen. Und auch nicht ein Tier, nicht mal eine Stubenfliege oder eine Zecke. Nicht mal eine Kuh, obwohl die Angehörigen dieser Spezies weiss Gott nicht viel Gutes zu muhen haben. Der Mensch, dieses Arschloch, tadelt die Kühe sogar für ihr Furzen. Dabei furzen die Menschen doch auch. Aber eben, das ist natürlich nicht das Gleiche. Die Mächtigen dürfen ungestraft ihre Gase fahren lassen, die Sklaven nicht.
Wie gesagt, ich, Max, der ich auf diesen Namen wenn schon nicht stolz bin, ihn aber doch mit Würde trage, weiss nicht, wer meine Eltern sind. Meine Hautfarbe ist braun, ich habe ein indisch-asiatisches Aussehen, aber aufgewachsen bin ich in der Schweiz. Meine Eltern gehören – oder gehörten, denn sowohl meine Adoptivmutter als auch mein Adoptivvater sind schon seit längerer Zeit tot – der oberen Mittelschicht an. Mein Vater war ein Professor an der ETH, der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich, meine Mutter, ursprünglich Primarlehrerin, gab ihre Berufstätigkeit augenblicklich auf, nachdem sie meinen Vater – meinen Adoptivvater – geheiratet hatte. Meine «Ersatzeltern» waren schon relativ alt, als sie mich adoptierten. Irgendwie hatten sie das Gefühl, dass ein Kind zu einer einigermassen abgerundeten Biographie einfach dazugehört. Ich wuchs also als farbiges Kind am noblen Zürichberg auf, in einem Haus, das man auch als Villa hätte bezeichnen können, das aber von meinen Adoptiveltern niemals als solche benannt worden wäre – schliesslich gab man etwas auf die Liberalität, die man sich als aufgeklärte Zeitgenossen auf die Fahne geschrieben hatte. Mein Vater war Physiker – ein Gebiet, das sich mir problemlos erschloss – und meine Adoptivmutter eine überzeugte Anthroposophin. Rudolf Steiner war ihr Guru. Sie duldete keine Kritik an seinen Theorien. Kartoffeln machen dumm, davon war sie überzeugt. Deshalb habe ich in meiner Kindheit nie Kartoffeln zu essen bekommen. Was nicht tragisch ist, denn ich konnte Kartoffeln nie leiden – kann sie auch heute noch kaum herunterwürgen, wenn es denn sein muss, und in der Schweiz muss es zwangsläufig fast dauernd sein. Rösti, Raclette mit Kartoffeln, Kartoffelstock mit Seelein, das gehört doch genuin zum Schweizer Kulturgut. Der Physikprofessor, mein Vater, hätte zwar gern Kartoffeln gegessen, zum Beispiel in Kombination mit geschmolzenem Käse, aber er wagte es nicht, seiner Frau ein Widerwort zu geben. Er war in der Tat ein Höseler. Ein Höseler, das ist Schweizerdeutsch und heisst so viel wie ein Angsthase, ein Duckmäuser, ein Leisetreter, und, in Beziehung zu seiner Frau, ein Pantoffelheld.
Das alles war mir als Kind egal. Ich litt nicht unter meinen «Eltern». Ich dachte, Erwachsene sind sowieso verrückt, also können auch die meine «Eltern» verrückt sein. Ich war ein superintelligentes Kind. Die Schule war langweilig. Was sie mir dort beizubringen versuchten, wusste ich schon lange. Ich gab mit keine Mühe und schrieb dauernd schlechte Noten. Ich schrieb in Prüfungen absichtlich die falschen Antworten hin. Dass ich braun war und nicht wie die anderen, erfüllte mich mit Stolz. Ich wollte immer anders sein als die anderen. Man muss wissen, dass es damals kaum braune oder schwarze oder exotische Kinder in Schweizer Schulklassen gab, und schon gar keine übermässig arroganten braunen und schwarzen Kinder wie mich. Meine Einzigartigkeit war demnach ein Privileg. Gewiss, ich wurde bis aufs Blut geplagt wegen meiner Andersartigkeit, aber das machte mich eher froh. Froh aus Stolz. Wenigstens manchmal, und immer mit einem Anflug von Trotz. Ich war imstande, die Kinder, die mich verachteten, meinerseits zu verachten. Wenn sie mich schlugen, schlug ich zurück. Und wenn ich dafür von den Erwachsenen bestraft wurde, streckte ich ihnen die Zunge heraus.
Eine Herrscherfamilie, die seit über 500 Jahren am Ruder ist. Ein Prinz, der seine Jacht «Titten» nennt. Eine Halbschweizerin, die bei ihrer Hochzeit einen Brautstrauss aus purem Gold trägt: Das ist das Sultanat Brunei.
School: Supertranp
Ich kann euch sehen, wenn ihr morgens zur Schule geht
Vergesst eure Bücher nicht! Ihr müsst die goldenen Regeln lernen.
Nichts ist wichtiger als das!
Oder wollt ihr etwa zu Versagern werden,
Zu drogensüchtigen Pennern?
Wollt ihr das?!
Die Lehrer sagen euch, ihr sollt aufhören
Zu spielen und lieber zusehen,
Dass ihr mit eurer Arbeit vorankommt,
Und so werdet wie Hans, der Streber.
Ja, der! Der scheut keine Hausarbeit und ist immer auf zack,
Wenn es darum geht,
Seine Leistung abzuliefern.
Der kommt gut klar, der wird Karriere machen!
Wenn die Schule vorbei ist, spielt ihr im Park.
Schön, aber bleibt nicht zu lange draussen und schon gar nicht,
Wenn es dunkel wird.
Wenn es dunkel wird, beginnt die gefährliche, wilde Zeit.
Hängt nicht rum, sondern stellt euch dem Ernst des Lebens,
Werdet schon als Zehnjährige erwachsen, werdet wie wir!
Wir sind euer Vorbild,
Ihr braucht das Versagen nicht selbst auszuprobieren,
Braucht eure Hände nicht selbst auf der Herdplatte zu verbrennen.
Wir haben es für euch getan. Seht uns an!
Wollt ihr so werden wie wir?
Sind wir nicht grossartig?
Deshalb: Glaubt nicht an euch selbst, glaubt an uns!
Seid unsicher und passt euch an!
Tut dies nicht, tut das nicht!
Wir haben es ausprobiert und bekamen eins auf die Schnauze!
Längst vergessen! Wir meinen es nur gut!
Wir wollen einen guten Jungen,
Ein braves Mädchen aus dir machen.
Wir kennen das Leben, also piss uns nicht ins Auge!
Kritisier mich nicht, schliesslich bin ich alt und weise.
Mach, was ich dir sage!
Sonst kommt der Teufel und kratzt dir die Augen aus.
Vielleicht liege ich falsch, wenn ich hoffe, dass ihr euch wehrt.
Vielleicht bin ich einfach nur verrückt und
Kann nicht «richtig» von «falsch» unterscheiden.
Aber solange ich Versager noch lebe, habe ich nur eins zu sagen:
Es ist ganz allein eure Entscheidung, wie ihr sein wollt.
Ihr kommt schon zurecht!
MAX
Als Kind konnte ich nie so recht daran glauben, dass ich ein Kind sein sollte. Ein Kind zu sein, ist Erniedrigung. Ein Kind zu sein heisst, nicht ernst, sondern dauernd ausgelacht zu werden. Als Kind wirst du wie ein Idiot behandelt, was dich schliesslich zu einem Idioten macht: Man nennt es Erziehung. Erziehung zum Erwachsenwerden, also zur kompletten Verdummung. Wenn ich mein Spiegelbild sah, erschrak ich: Dieser Wicht da, diese paar Kilo Menschlein, sollte mein Ich, das mir doch als so riesengrosse Last erschien, schon damals, beinhalten? Genauso, wie ich später einmal nicht werde glauben können, dass dieser ältere und dann alte und uralte welke Körper eine kindlich junge Seele, eine Blume im Morgentau, die übersprudeln will vor Lebenslust, beherbergen soll. In der Schule war ich ein Fremder. Ich sprach nicht die richtige Sprache. Ich sass in der Klasse, hörte aber nicht dem Lehrer zu, sondern schaute aus dem Fenster. Vor dem Fenster war das Leben, davon wollte ich lernen. Es gab in der Klasse ein Mädchen, das mich faszinierte. Sie war hoch aufgeschossen wie ein ungeduldiges Gemüse oder wie eine Sonnenblume, das oder die es nicht erwarten kann, erntereif zu sein und dann auf irgendeinem unwürdigen Esstisch zu landen oder als Symbol in einem idiotischen Werbeclip. Ich verehrte sie, ich weiss nicht warum. Im Turnunterricht trug sie Schühchen aus Leder oder sowas, warum interessierte ich mich ausgerechnet für ihre Füsschen und ihre Schühchen, ich perverse Sau? Weil sich das lederähnliche Material ihrer Schühchen kräuselte wie die Oberfläche eines Sees im Morgenwind. Immer, wenn ich mich auf einem See befand im kräuselnden Morgenwind (auch wenn das selten geschah), musste ich an das Mädchen denken und fühlte mich erotisch sehr stimuliert.
Ich hatte Freunde in dieser Stadt. Ich hatte einen Freund, der mich zu lieben schien, damals mit etwa neun. (Mit neun einen Freund zu haben, der dich liebt, ist von absoluter Relevanz, aber gleichzeitig so vergänglich wie ein Furz im Wind.) Er umhalste mich, küsste mich, zog mich in einem Karren die Strasse zur Schule hoch, nachdem ich mir beim Skifahren das Bein gebrochen hatte und mit meinem eingegipsten Bein nicht mehr alleine gehen konnte.
Aber dann, eines Tages, wandten sich sämtliche Schüler meiner Klasse plötzlich gegen mich. Ich hatte keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich einfach deshalb, weil ich der Fremde war. Fremd zu sein, ist Grund genug, gehasst zu werden. Plötzlich stand ich in einem Kreis von wütenden Bestien, von aggressiven Hunden, die mich zerfleischen wollten. Natürlich dachte ich nicht im entferntesten daran, mich kampflos der Meute zu ergeben. Ich schlug um mich, ich kämpfte wie ein Verrückter, wie ein Verzweifelter, und verrückt, verzweifelt war ich ja zweifellos. Die Jungs, allen voran ein grosser grobschlächtiger Junge mit einer sadistischen Fresse, droschen auf mich ein, überwältigten mich, rissen mir die Kleider vom Leib, stiessen mir erst kleine, dann immer grössere Äste in den Arsch, bevor sie ihre Schwänze hervorholten. Nachdem sie mich einer nach dem anderen vergewaltigt hatten, stellten sie sich über mich, um mich anzuspucken und anzupissen und mich auszulachen. Schliesslich liessen sie mich einfach im Dreck liegen.
Am schlimmsten war, dass sich auch mein so genannter bester Freund an dieser Orgie des Hasses beteiligt hatte. Er hatte mir also nicht nur nicht geholfen, sondern war sogar besonders eifrig mit von der Partie gewesen.
Ich verliess den schrecklichen Ort noch am selben Tag, ohne mich von meinen Pflegeeltern zu verabschieden. Ich war wie von Sinnen, meine Trauer und meine Wut waren so viel grösser als ich, ich konnte einfach nicht damit umgehen. Ich lebte ungefähr eine Woche im Wald, ernährte mich von nichts oder vielleicht von Erde, Nüssen, Blättern, Wurzeln, ich achtete nicht darauf und habe folglich auch keine Erinnerung daran. Dann wurde ich eingefangen wie ein wildes Tier.
Die Obrigkeit steckte mich in ein Heim. Meine Pflegeeltern wollten mich natürlich nicht mehr bei sich haben. In diesem Heim, das von wohlmeinenden Patres geführt wurde, fühlte ich mich einigermassen wohl. Hier wurde ich zumindest geliebt, wenn auch nicht unbedingt wegen meiner unschuldigen Seele. Ich hatte einen makellosen engelhaften Körper, der sowohl meine Mitgefangenen als auch meine Bewacher entzückte. So wurde ich von hinten bis vorn umworben und umgarnt, und ich hatte den Dreh schnell raus, wie ich daraus meinen Profit ziehen konnte. Kurz, ich wurde nur allzu bereitwillig zu einem raffinierten Bürschchen, einem Teufel mit dem Erscheinungsbild eines Unschuldslamms. Ja, ich wurde «böse», ich hatte immer diese furchtbare Wut in mir, und ich wollte böse sein. Ich glaubte an nichts als an den Hass.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nicht so in Brunei. Dort glänzt fast nur Gold. Brunei ist reich, dank schwarzem Gold. Einkommenssteuer? Gibt es nicht. Bildung und Gesundheitswesen? Gratis. Benzin? Spottbillig. Brunei ist reich, auch dank seinem Herrscher, seiner Majestät Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.
Und der zeigt seinen Wohlstand: Er lebt in einem Palast mit 1788 Zimmern, von Tonnen italienischen Marmors umgeben, leistet sich eine Ferrari-Flotte. Ein Luxus, den die Untertanen der Queen von Grossbritannien nicht dulden würden, die Bevölkerung Bruneis aber nimmt es gelassen.
Selbst dann, wenn nachts die Ampeln in der Hauptstadt auf Rot geschaltet wurden und der Sultan mit seinem jüngeren Bruder Prinz Jefri die Strassen in eine Rennstrecke verwandelte. Doch diese Zeiten sind längst vorbei.
Bad Company: Bad Company
Gesellschaft auf der Flucht
Das Schicksal ist eine aufgehende Sonne
Ich wurde geboren mit sechs Gewehren in meiner Hand
Hinter einem Gewehr
Leiste ich meinen letzten Widerstand
Deshalb sagen sie von mir
Ich bin schlechte Gesellschaft
Ich bestreite es nicht
Schlechte Gesellschaft
Bis zum Tag an dem ich
Meine sechs Flinten ins Korn werfen werde
Rebellische Seelen
Fahnenflüchtige werden wir genannt
Wählten eine Knarre aus
Eine Kalaschnikof oder eine G 29
Und warfen die Sonne weg …
Nun kennen wir all diese Städte
Saigon, Bagdad, Kabul oder wie sie alle heissen
In denen wir wüteten wie Verrückte
Und verrückt wie Scheisshausratten waren wir ja auch
Unsere Namen sind vergiftet
Der Klang von sechs Gewehren ist unser Anspruch auf Ruhm
Kann ich sie sagen hören
Ach ja, du bist kein Dieb?!
Behaupte doch, was du willst!
Aber ich, ich bin einer
Ich befinde mich in schlechter Gesellschaft
Und ich bin schlechte Gesellschaft
Auf diese Art spiele ich das Spiel
Auge um Auge, Zahn um Zahn
Und wehe, jemand spielt ein falsches Spiel mit mir
Falsches Spiel, falsches SpieI ist zu viel, viel zu viel
Ja, wir sind schlechte Gesellschaft
Kaltblütig ermordend kaltblütig ermordet
MAX
Also gut, ich wurde zu einem Gangster, einem Ganoven. Ich fing klein an, mit Taschendiebstählen, kleinen Drogendealereien, ging dann aber rasch über zu Raubüberfällen und Auftragsdelikten. Ich lernte schnell. Ich wollte in dieser Phase meines Lebens nichts anderes als Geld machen. Geld, das wars. Wer Geld hat, ist was. Wer kein Geld hat, ist ein Niemand. Um Demütigungen zu entgehen, muss man Macht haben, und um Macht zu haben, muss man Geld haben. Ohne Geld bist du ein Niemand, ein Arschloch. Und wenn du keine reiche Verwandtschaft hast und trotzdem Geld haben willst, bleibt dir nichts anderes übrig, als dich in schlechte Gesellschaft zu begeben.
Als dummer Kleinkrimineller steckt man dich bald mal ins Gefängnis und da wirst du zum definitiven Loser. Es gibt nichts Schlimmeres oder Tragischeres als einen dummen Kriminellen. Schliesslich landet er, das ist die wahrscheinlichste Option, als Dauergast in einem Knast, wo er sich zum unselbständigen Kind zurückentwickelt, zum Gegenteil des Rebellen, der er einmal sein wollte, oder unter der Brücke als Penner, oder er bringt sich um, indem er sich mit billigem Fusel zu Tode säuft oder sich irgendwann in einem Moment plötzlicher Kühnheit von einer Brücke stürzt. Ist ja auch okay und zu respektieren. Ein etwas cleverer Krimineller, wie ich es war, wollte natürlich Karriere machen. Das braucht Härte und Brutalität. Ich hatte weder das eine noch das andere, aber ich hatte meine Wut, meinen Hass. Diese starken negativen Gefühle nutzte ich als Treibstoff. Ich hasste im Grunde nicht die Menschen, sondern meine Geschichte, ich hasste die Umstände, die mich zu dem gemacht hatten, was ich war. Ich hasste meine Intelligenz, meine Cleverness. Im Grunde hasste ich mich selbst, aber das wurde mir erst viel später klar.
Ich suchte mir sogenannte Freunde. «Schlechte Freunde». Wobei, so schlecht waren sie gar nicht, innerhalb der Organisation herrschte eine mustergültige Loyalität. Gegen «aussen», gegen unsere «Feinde», waren wir dagegen gnadenlos. Das Leben eines Freundes gilt alles. Das Leben eines Feindes gilt nichts. Das ist das Gesetz des Krieges. Und im Krieg befanden wir uns permanent. Die Feinde waren einerseits unsere Konkurrenten, andererseits die sogenannte Ordnungsmacht, die Polizei, das Militär, die Behörden, der Staat. Damals befand sich die Gesellschaft in einem Zustand des harten Bruchs: Die Zivilgesellschaft existierte praktisch nicht mehr, die Reichen verschanzten sich in ihren Ghettos, der Staat war zu einem Staat im Staat geworden, zu einer gnadenlosen Machtmaschinerie, die die «eigene Bevölkerung» bekämpfte zum eigenen Machterhalt und zum Erhalt der eigenen Pfründe, oder zu einem Lakaien der Elite der Reichen. Und alle bekämpften alle. Alle bekämpften alle mit der Mission, Macht und Geld – oder Geld und Macht – zu erringen. Ich funktionierte wie ein Roboter, das Glück sagte mir nichts. Ich strebte nicht nach Glück, ich wollte überleben und Macht und Geld gewinnen. Manchmal belohnte ich mich mit ein bisschen gekauftem Sex, mit Alkohol und anderen Drogen, mit Adrenalin, dass ich in extremen Grenzerfahrungen zu erzwingen versuchte. Wir nannten es «russisch Roulette», in Anklang an ein Vergnügen ähnlicher Art aus vergangenen Zeiten. Wir sprangen von Klippen in kaum erreichbare, tief unter uns liegende Tümpel, oder indem wir uns in die Bordelle gegnerischer Banden wagten und deren Favoritinnen vögelten, oder indem wir völlig nackt durch einen Wald gingen, der voll war von giftigen Schlangen, Skorpionen und Insekten, die die schlimmsten Krankheiten übertragen können. Wir waren verrückt, denn wir wussten nichts vom Glück. Wahre Männer brauchen kein Glück, sie haben ihren Stolz. Wir hatten kein Glück, keine Liebe, keine Moral und keinen Respekt. Wir waren die schlimmsten Kerle dieser Erde mit keinem Funken Hoffnung im Hirn auf eine bessere Zukunft. Oder überhaupt auf eine Zukunft.
Zu jener Zeit lebte ich mit einem Mann zusammen, den ich begehrte, aber nicht zu lieben vermochte. (Wahre Männer brauchen kein Glück, sie haben ihren Stolz, und schwul sind sie eigentlich auch nicht.) Dazu war ich zu hart, zu brutal, zu tot. Ein Zombie. Ich liebte diesen Kerl nicht, ich konnte ihn nicht lieben, aber er ging mit nahe, er machte mir schwer zu schaffen. Ich kriegte ihn nicht aus meinem Kopf und meinem System. Und weil ich ihn, weil er mich beschäftigte, irritierte er mich, hasste ich ihn. Ich behandelte ihn wie einen Sklaven. Er hiess Natem, er war ein südamerikanischer Indianer, ein wunderbarer Mensch, sanft, intelligent, sehr einfühlsam. Aber leider auch sehr verführbar durch solche Monster wie mich. Ich weiss nicht, was ihn an mich band. Vielleicht die Einsicht, dass seine Welt nur die eine Seite der Medaille war, und die eine Seite genügte ihm eben nicht. Ein intelligenter Mensch ist ein neugieriger Mensch, und das wird ihn immer wieder in die Bredouille bringen. Neugier tötet die Katze, wie das Sprichwort sagt. Vielleicht glaubte er insgeheim, mich «retten» zu wollen, was aber definitiv ein Trugschluss gewesen wäre. Oder er reagierte einfach auf eine Art Magnetismus, der zwischen zwei unterschiedlichen Polen herrscht, metaphorisch gesprochen. Nicht zuletzt reagierte er auf mich, weil er schwul war und ich ein verdammt gut aussehender Mann.
Ich gebe es zu, ich brachte ihn schliesslich dazu, ebenfalls in mein Geschäft einzusteigen. Ich war inzwischen mittleres Kader im Drogenhandel, es liess sich viel Geld mit Drogen dieser Art verdienen – synthetischen, chemischen Drogen, die der Leistungssteigerung und der Gefühlsabtötung dienten und natürlich, um überhaupt wirksam zu sein, eine kräftige Stimulierung des Lustzentrums im Hirn bewirkten. Auf dieser Stufe des Drogenhandels gab es viel Konkurrenz, Revierkämpfe, Kämpfe mit den Ordnungskräften des Staates und mit extremistischen ausserparlamentarischen Politgruppierungen oder fanatischen Sektenmitgliedern, die den Drogenhandel für ihre Ziele zu nutzen versuchten. Unser tägliches Geschäft war also nicht nur der Ein- und Verkauf von Drogen, sondern bestand auch aus Bestechung, Entführungen, Folterungen, Morden. Man kann es sich schlimm genug gar nicht vorstellen. Aber ich war stolz auf die gesellschaftliche Stellung, die ich mir errungen hatte. Ich war jemand – ich war nicht der Pate, der Godfather, der Boss, bei weitem nicht, aber ich war auch nicht bloss der Laufbursche, sondern besass eine Villa in einem mittelamerikanischen Land, Wohnungen in verschiedenen Weltgegenden und eine stattliche Flotte von relativ teuren Autos, und ich besass Macht. Gewiss, nur geliehene Macht, Macht auf Abruf, aber das liess sich leicht verdrängen. Einen Privatjet oder Helikopter besass ich zwar nicht – noch nicht –, aber ich konnte es mir immerhin leisten, First Class zu fliegen.
Mein «Partner» – er war nicht mein Partner, eher mein Sklave, aber das hätte ich nie zugegeben – war von diesem Lebensstil gewissermassen widerwillig angezogen. Obwohl seine Seele dem Materiellen absolut nicht zugewandt war, wollte er wissen, wie die Welt im Luxusbereich funktioniert. «Ich muss alles ausprobieren», pflegte er zu erklären, «sonst kann ich das Ganze nicht überblicken.» Das war vielleicht naiv gedacht, entsprang aber einem ehrlichen Impuls. Und ich nutzte diesen Impuls gnadenlos aus. Ich betraute ihn mit immer schwierigeren Aufgaben, lockte ihn mit Zuckerbrot, drohte ihm mit der Peitsche. Nicht, dass ich ihn dazu gezwungen hätte, ein Kapitalverbrechen zu begehen – so weit ging ich nicht –, gefährlich waren seine Aufträge trotzdem. Eines Tages wurde er angeschossen, verhaftet und landete in einem der schlimmsten Knäste des Landes. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Wahrscheinlich ist er tot, und falls nicht, hätte er definitiv die Schnauze voll von mir. Mehr als diese Lektion liess sich für ihn von einem wie mir nicht lernen.
Der Verlust Natems machte mich total fertig. Wie bei einem Erdbeben wankte der Boden unter meinen Füssen. Ich fühlte mich permanent schwindlig, war ständig den Tränen nahe, meine Partner, Kumpel und Untergebenen verloren jede Achtung vor mir. In kürzester Zeit verlor ich meine Position. Erst wankte der Boden nur, dann brach er unter mir weg, und ich stützte im freien Fall mitten ins Herz der Finsternis.
The Bluest Blues: Alvin Lee
Ich konnte es nicht erwarten dich zu sehen – ich wartete an der Tür
Doch da war niemand, der mich treffen wollte –
Und deine Kleider lagen auf dem Boden
Sorry, dass ich dich verletzt und dich zum Weinen gebracht
habe
Aber ich hielt es nicht aus, dich mit einem andern Kerl zu sehen
Das ist der dunkelste Blues –
Und er dringt in mich wie ein scharfes Messer
Der dunkelste Blues, seit du mein Leben verlassen hast
Ich konnte dir nicht sagen, wie sehr du meinen Stolz verletzt hast
Etwas brach mitten in mir entzwei
Ich habe nicht gewusst, wie sehr ich dich liebe, bis du weg warst
Nun bin ich tagtäglich in Einsamkeit gefangen
Der dunkelste Blues hält mich umfangen,
Seit du aus dieser Tür gegangen bist
Der dunkelste Blues, der darin besteht,
Dass ich dich nie mehr sehen werde.
Ich hasse mich dafür, dass ich dir gegenüber versagt habe
Im Kern meiner Trauer lodert die Scham wie ein Höllenfeuer
Ich kann nicht ohne dich leben, keucht meine Verzweiflung
Während du den Heimweg nicht mehr findest
Bricht mein Herz entzwei.
Ich verkroch mich in ein Kellerloch. Jeder Atemzug war Qual. Der Körper ein festgezurrter Knoten. Das Hirn Flammenherd. Die Haut eine einzige eiternde Wunde. Ich ass nicht, ich schlief nicht, ich wusch mich nicht, ich trank manchmal aus Flaschen brennende Flüssigkeiten. Ich wollte sterben und wäre wohl auch gestorben, wenn sich nicht eines Tages eine Ratte zu mir gesellt hätte. Ja, eine Ratte, ein Wesen wie ich selbst. Diese Ratte, ich weiss nicht, wie und wieso, wurde da unten in meinem Kellerloch zu so etwas wie zu meinem Freund. Ich hatte das Gefühl, dass sich die Ratte mit mir unterhielt, aber das mögen Halluzinationen gewesen sein, ziemlich sicher aber sprach ich mit ihr. Die Ratte sagte, wie ich meinte, zu mir: «Du bist wie ich: ein komplexes Wesen, das sich auf diesem Planeten entwickelt hat. Und doch bist du nicht ich wie ich: Ich akzeptiere alles so, wie es ist. Ich denke nicht in Alternativen; ich unterscheide nicht zwischen Sein und Zeit. Du hälst dich wechselweise für ein Opfer und für einen Bösewicht, aber beides trifft nicht den Kern deines Seins. Das sind alles Gedankenkonstrukte. Ihr Menschen überzieht alles mit einem Netz von Bewertungen, indem ihr dieses bewundert und jenes verachtet. Uns Ratten zum Beispiel bewundert kaum jemand von euch. Ja, ich weiss», unterbrach sich mein Freund, «es gibt den Karni Mata-Tempel in der hinduistischen Stadt Deshnok in Rajasthan in Indien, in dem wir Ratten als Erscheinungsform der Göttin Durga geehrt und gefüttert werden. Aber rührt uns das? Nicht im Geringsten. Es geht uns, um in eurer Menschensprache zu sprechen, am Arsch vorbei.» Da erkannte ich die Ratte – und in ihr alles Existierende – als ein mir völlig gleichwertiges, ebenbürtiges, ja überlegenes Gegenüber, und diese Erfahrung machte einen tiefen Eindruck auf mich. Man könnte es beinahe als spirituelles Erlebnis deuten. Jedenfalls bewirkte es, dass ich weiterleben wollte. Und eines Tages war mein Rattenfreund denn auch wieder verschwunden.
Der Sultan ist verheiratet mit Ihrer Majestät Raja Isteri Pengiran Anak Hajjah Saleha. Seit 1965 ist sie seine Ehefrau – und Erstfrau. Zwei weitere Frauen heiratete der Sultan. Diese Lieben hielten nicht. 2003 liess er sich von einer Flugbegleiterin scheiden, 2010 von einer Fernsehreporterin. Er war unliebsame Frauen los, sie Titel und Orden. Von drei Frauen hat der Sultan 12 Kinder. Darunter den Kronprinzen Haji Al-Muhtadee Billah. Ein Musterknabe. Die einzige Sorge der Herrscherfamilie: eine dem Hof genehme Frau zu finden. 2004, inzwischen 31, war er noch immer frauenlos. Als er eines Tages einer Schule in der Hauptstadt von Brunei einen offiziellen Besuch abstattete, trafen ihn Amors Pfeile. Er verliebte sich in Sarah Salleh. 16 Jahre jung. Tochter eines Bruneiers und einer Schweizerin. Verlobung und Vermählung folgten noch im selben Jahr.
MAX
Wieder zur Vernunft gekommen, stellte ich fest, dass mir noch erstaunlich viel Geld zur Verfügung stand – ich will nicht sagen, dass es mir gehörte, so war es nicht, es war zusammengegaunertes Geld, das war mir schon bewusst, aber moralische Überlegungen lagen mir weiterhin fern. Jedenfalls duschte ich erstmals seit Wochen in einem Etablissement im Hauptbahnhof, das sich MacClean nennt, rasierte mich daselbst und liess mir – immer noch im Hauptbahnhof – die Haare schneiden, kaufte mir neue Kleider und gönnte mir eine ordentliche Mahlzeit, bestehend aus einer gebratenen Wurst, Senf und Brot. Als nächstes besorgte ich mir im Reisebüro der nationalen Eisenbahngesellschaft ein Flugticket und flog noch gleichentags nach Bali. Warum nach Bali? Vielleicht, weil Bali auf meinem Radar am weitesten entfernt war. Ich hatte Bilder im Kopf, aus Ferienprospekten, Filmen, weiss der Teufel woher. Vielleicht gefiel mir einfach der Klang des Namens der Insel so gut.
In Bali logierte ich in einem Hotel namens «Fourteen Roses», mitten in Legian gelegen, einer Touristenmeile par excellence, nicht gerade ein Luxushotel, aber von Luxushotels hatte ich nachgerade die Nase gestrichen voll. Es war mir also recht, dass dieses Hotel nichts weiter war als ein Hotel mit Gästen ohne übermächtiges Geltungsbewusstsein. Das Hotelpersonal, übermässig vertraut mit fremden Gästen, machte sich übrigens offen lustig über die Touristen, die es beherbergte, ohne dass diese es bemerkt hätten. Ich fand das okay.
Ich weiss nicht, ob du Ayahuasca kennst. Vom Namen her vielleicht, aus persönlicher Erfahrung wahrscheinlich nicht. Ich hielt nie was von halluzinogenen Drogen, da sie mich ängstigten. Einen LSD-Trip aus meiner Jugend hatte ich in allerübelster Erinnerung. Nein, ich wollte mir keinen Spiegel vorhalten lassen. Nein, ich wollte nicht wissen, wer ich wirklich bin. Ich hatte absolut kein Interesse an dieser Sorte von Realität. Das war ein Horror. Die Angst, die mich auf diesem Trip überfallen hatte, war so gross gewesen, dass ich während der ganzen Reise vor ihr davonzurennen versucht hatte. Ich hätte mich notfalls auch aus einem Fenster gestürzt, was aber damals unmöglich war, weil es weder ein Fenster gab noch eine Klippe oder sonst etwas, das in die Tiefe führte. Ich befand mich an einem Strand im indischen Goa. Natürlich, ich hätte mich im Meer ersäufen können, aber ich war, wie im Traum, nicht fähig, mich auf das Wasser oder sonst was zuzubewegen, ich strampelte an Ort. Ich lag also im Sand, mein Gesicht war bedeckt von Sand, meine Nase, mein Mund waren voll von Sand, und ich strampelte an Ort. Ich stellte mir vor, aufzustehen und davonzurennen. Der Himmel über mir zürnte mir, das Wasser vor mir schien mir voller Feindschaft, die Wogen des Meeres drohten mein Hirn zu zerschlagen, die Sterne über mir versengten mein Ich. Mein Ich zersplitterte in abertausende von mikroskopisch kleinen Teilen. Ich erfuhr nicht die kosmische Einheit, sondern die kosmische Einsamkeit, die unendliche Leere des Alls. Kälte, absolute Kälte, wahrgenommen durch ein Bewusstsein ohne Verankerung. Man hätte es als ein mystisches Erlebnis bezeichnen können, aber eines, das aus der Hölle kam. Mit allen Kräften krallte ich mich an mein Ich, bis ich wieder ich war, und ich wollte, mehr denn je, nichts sein als ein Ich, ein möglichst starkes, ja allmächtiges Ich.
Aber jetzt war mein Ich wieder zerschlagen, und nichts konnte es reparieren, denn dieses Mal ging es nicht um mich, sondern um etwas, das wie ein Schwarzes Loch mein Ich geschluckt hatte, die Liebe. Ich hatte einen Menschen verloren, durch meine eigene Schuld, einen Menschen, den ich hätte lieben können und den ich nicht geliebt hatte, weil ich ihn nicht lieben konnte, und dieser Verlust war sehr viel schlimmer als der Verlust meines Ichs. Ohne Ich kann man überleben, ohne Du und ohne Liebe nicht.
Als ich in meinem Hotel frühstückte, bekam ich mit, wie am Nebentisch über eine Ayahuasca-Zeremonie gesprochen wurde, die an einem der nächsten Tage in Ubud stattfinden sollte. Die Angehörigen diverser Amazonas-Ethnien gebrauchen Ayahuasca in rituellen religiösen Zeremonien, um sich in einen Trancezustand zu versetzen. Der Gebrauch ist im amazonischen Brasilien, in Bolivien, in Peru, im Orinocodelta von Venezuela bis an die Pazifikküste von Kolumbien und Ecuador verbreitet. Zudem sind im 20. Jahrhundert in Brasilien diverse Ayahuasca-Religionen entstanden, die in den Städten von der Mittelschicht frequentiert werden und inzwischen auch international präsent sind, erfuhr ich von Wikipedia.
Kennst du die Wirkung von Psilocybin und LSD? Eine Begegnung mit Mutter Ayahuasca hat eine gewisse Ähnlichkeit; wenn du dir Psilocybin als junges Mädchen und LSD als erwachsene Frau vorstellst, dann ist Ayahuasca die mächtige Alte vom Berg. Ayahuasca ist eine Art Tee, der gebraut wird, indem die verholzten Pflanzenteile der Lianenart Banisteriopsis caapi zusammen mit den Blättern der Pflanze Psychotria viridis, einem Rötegewächs, ausgekocht werden. Ich weiss das, weil ich, nachdem ich das Gespräch am Nebentisch belauscht hatte, sofort bei Wikipedia nachschaute. Oft würden noch DMT-Quellen aus anderen Pflanzen oder dem Hautdrüsensekret der Aga-Kröte beigefügt, las ich weiter. Das Endresultat sei eine braune Flüssigkeit, die fürchterlich schmecke. Das habe ich selber erfahren.
Geleitet wurde die Zeremonie, an der etwa zehn Personen aus aller Welt teilnahmen, von einem direkt aus Südamerika importierten Schamanen und seiner Frau, die im siebten Monat schwanger war, aber dennoch am Ritual teilnahm – als Teetrinkerin, nicht als Zuschauerin, wohlverstanden. Von den Teilnehmenden fiel mir eine Frau auf, die mich von allem Anfang an durch ihre starke Ausstrahlung beeindruckte. Sie war damals etwa 45 und die ersten grauen Strähnen durchzogen ihr tiefschwarzes Haar. Sie war klein und drahtig, ihr Gesicht war dunkel wie meines und ohne Makel. Sie wirkte alterslos. Ihre Augen waren geschlossen. Dann tranken wir unsere erste Tasse, sie blickte kurz auf und ihr Blick traf den meinen. Ich glaubte, so etwas wie ein Erkennen in ihrem Blick wahrzunehmen. Dann schloss sie die Augen wieder. Der Schamane begann mit hoher dünner Stimme ein endloses monotones Lied zu singen, dessen Text ich nicht verstand und von dem ich nicht einmal wusste, in welcher Sprache es verfasst war. Irgendein Dialekt der südamerikanischen Indigenen, vermutete ich. Oder der Schamane improvisierte und die Worte bedeuteten gar nichts. Auf jeden Fall hatte dieser Singsang zunächst eine einschläfernde Wirkung auf mich. Ich trank eine zweite und eine dritte Tasse des Gebräus, ohne einen Effekt wahrzunehmen. Ich legte mich auf meine Matte und schaute in den von Sternen übersäten Himmel, der mir unergründlich tief erschien wie ein riesiger Brunnen, in den ich mich nun fallen liess. Plötzlich hatte ich das Gefühl, in einem Astronautenanzug zu stecken. Plötzlich wird mir bewusst, dass ich jegliches Zeitgefühl verloren habe, wie im Traum. Ich verliere mich in einer komplizierten Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, ich bin ein Flüchtling, d.h. ich bin ein Jude, ein Sinti, ein Roma, ein Homosexueller, auf jeden Fall verfolgen mich Wehrmacht und Gestapo, aber ich entkomme immer unerkannt, ich tarne mich, indem ich selber eine Wehrmachts- oder SS-Uniform trage, und schliesslich lande ich in einem Raum, in dem ich Hitler begegne, der verrückt geworden ist, indem er sich einbildet, Zahnarzt zu sein; aber diese Rollenwechsel dauerten, wie man mir versichert, jeweils nur einen oder zwei Tage, d.h. man wisse nie, wie lange es brauche, bis er in eine neue Rolle schlüpfe, zum Beispiel in die eines grausamen Diktators. Ich weiss inzwischen nicht mehr, ob ich liege, sitze, stehe, schwimme oder fliege. Irgendwie erscheint mir die Luft um mich als zähflüssige Substanz. Ich habe das Gefühl zu ersticken. Ich nehme wahr, wie ich als Fötus im Bauch meiner Mutter liege, der Platz ist eng geworden und ich will unbedingt raus, aber eine Schlinge hat sich um meinen Hals gelegt und reisst mich immer wieder zurück. Ich kämpfe um ein Leben, ich kämpfe um mein Leben. Meine Angst wird immer grösser und steigert sich zur Panik, während meine Kraft immer kleiner wird. Ein Gefühl der Ohnmacht, des totalen Ausgeliefertseins ergreift mich. Ich erkenne die tröstliche Tatsache, die Erleichterung, nicht zu sein, die Gnade der Nichtexistenz. Ich erkenne die Belanglosigkeit von Geburt und Tod. Dann wieder will ich unbedingt leben, ich bin wie die Flamme einer Kerze, die vom Wind beinahe ausgelöscht wird, bevor sie im nächsten Moment umso stärker emporlodert. Ich bin ein Vogel und fliege über eine Landschaft, die von solch übernatürlicher Schönheit ist, dass es mir die Tränen in die Augen treibt. Können Vögel weinen? Ich weiss es nicht, aber damals, in Bali, konnten sie es. Ich fliege als Vogel einmal um die ganze Welt, das dauert unendlich lange oder den Augenblick eines Lidschlags, Zeit ist genauso eine Illusion, ein Traum unseres Hirns wie Gott, die Autobahn und eine Senftube. Ich reite auf einer Senftube quer durchs Universum von Galaxie zu Galaxie, durch Wurmlöcher und Schwarze Löcher und jede mögliche Form der Existenz. Dann höre ich wieder den Singsang des Schamanen, öffne meine Augen, nehme die Feuchtigkeit der Tränen auf meinen Wangen wahr, sehe das Gesicht der Frau, die mich so beeindruckt hat, spüre die Intensität ihres Blicks.
Midnight Train: Buddy Guy and Johnny Lang
Ich stand am Bahnhof
Zehn vor Mitternacht im Regen
Ich kümmerte mich um nichts
Ich hatte keinen einzigen beschissenen
Vernünftigen Gedanken in meinem verfluchten, blöden Kopf,
In meiner besoffenen Matschbirne.
Ich wartete auf den Mitternachtszug.
Niemand war zu sehen und ich starrte
Auf meine schmutzigen Schuhe.
Weiss der Teufel, was ich da sah
Oder zu sehen glaubte
Ich griff mir die Zeitung in der Hoffnung,
Ein paar erfreuliche Nachrichten zu finden
Nichts, nur der übliche Shit
Da rief der Ticketmann meinen Namen auf.
Es gibt keinen Mitternachtszug, laberte er,
stammelte er mit schwerer Zunge,
Auf dieser Linie.
Also sagte ich, mit kaum gezügelter
Ungeduld in meiner Stimme:
Wenn es nicht zu viele Umstände macht,
Wann fährt denn dann der Lokalzug
Aus diesem elenden Kaff, du Arsch?
Seine Antwort: Keine Antwort.
Nach einem Boxhieb auf seine Nase:
Zwei Uhr in der Nacht.
Wenn es in der näheren Umgebung eine offene Bar gäbe
Könnte ich gemütlich einen Whisky trinken
Und in vierzig Minuten in aller Gemütsruhe
Den Lokalzug nehmen.
Aber er es gibt hier keine Bars mehr, die noch geöffnet wären,
Und auch kein Mädchen, das mich trösten könnte.
Aber es gibt keine offene Bar in diesem traurigen Kaff
Und den Express erwische ich nicht mehr um diese Zeit
Und die Lokalzüge, die kannst du sowieso vergessen
Also, hör zu, sage ich selbst zu mir:
Es gibt keinen Mitternachtszug auf dieser Linie.
Also stand ich vierzig Minuten da
Es regnete und war kalt
Als endlich doch noch irgend ein Scheisszug heranrollte
Kümmerte ich mich nicht darum, wohin er fuhr
Ich stieg einfach ein und liess mich davontragen
Um schliesslich in der Hölle zu landen
Im Mai 2014 führt der herrschende Sultan die Scharia, das religiöse Gesetz des Islam, ein. Es gibt drei Phasen der Einführung. In Phase eins wird unter anderem die Nichtbeachtung des Fastenmonats Ramadan mit Geld- oder Haftstrafen gebüsst. In Phase zwei werden Vergehen wie Diebstahl oder Alkoholkonsum mit Auspeitschen oder Amputieren von Gliedmassen bestraft. In Phase drei droht dann die Todesstrafe bei Ehebruch, Sodomie und wenn Mohammed beleidigt wird. Wie die Bevölkerung darauf reagiert? Kritik wird nicht laut. Ob aus Angst vor Verfolgung oder weil die Scharia akzeptiert ist, ist nicht bekannt.
MAX
Wir verbrachten danach viel Zeit miteinander. Selbstredend war nichts Erotisches zwischen uns – ich bin schwul bis auf die Knochen und kann mich auf keine Bisexualität hinausreden, und Mala zeigte nie das geringste Interesse an einer erotischen Beziehung mit mir. Vielleicht gerade deshalb begann eine tiefe Freundschaft zwischen uns zu entstehen. Wir reisten kreuz und quer durch Indonesien und liessen uns schliesslich im Süden der Insel Lombok nieder, wo wir einen einfachen Bungalow ohne jeden Komfort mieteten. Wir erzählten uns unsere Geschichten, und Mala erläuterte mir ihren Plan von und mit der Felsenarena. Wir arbeiteten konzentriert an einem Konzept zur Umsetzung dieses Projekts, das heisst, Mala entwickelte das Konzept und ich diente ihr als Sparring-Partner oder Punching-Ball und Assistent; ich hatte ja keine Ahnung von Architektur und Pädagogik und man konnte mich getrost als ungebildet bezeichnen. Gerade das aber machte mich für Mala so wertvoll; sie musste mir das Projekt «verkaufen», das heisst, es so erklären, dass ich es verstand und nachvollziehen konnte. Ausserdem stellte sie mir eine Liste von Büchern zusammen, die ich lesen sollte, was ich auch begierig tat; damals auf Lombok entdeckte ich meine Leidenschaft für Literatur oder überhaupt für das geschriebene Wort. Die Liste enthielt Bücher der Weltliteratur ebenso wie zeitgenössische Belletristik, aber auch Sachbücher aus den Bereichen der Geschichte, der Philosophie, der Soziologie und der Astrophysik; die Liebe zu den Sternen war eine unserer Gemeinsamkeiten. Wenn ich ein Werk gelesen hatte, diskutierten wir stundenlang über seinen Inhalt; dadurch lernte ich eine Menge, saugte mich mit Wissen voll wie ein trockener Schwamm.
Ich erfuhr, dass Mala eine weltberühmte Architektin war, aber auch eine bedeutende Malerin, die überdies ein Studium in Politwissenschaften und Philosophie abgeschlossen hatte. Sie erzählte mir, dass sie vom Sultan von Kesultanan, einem der reichsten Männer der Welt, den Auftrag erhalten habe, diesem einen 2000-Zimmer-Palast zu bauen (die Tochter einer Freundin von ihr, eine halbe Schweizerin, ist mit dem Sohn des Sultans, dem Kronprinzen, verheiratet). Im Verlauf dieser Zusammenarbeit sei es der Meisterin gelungen, dem Sultan klarzumachen, dass er mit seinem Reichtum und seiner Macht eigentlich nichts gewinne, denn niemand könne 2000 Zimmer eines Palastes benutzen oder 7000 Luxusautos fahren und dies als Lustgewinn verbuchen. Das wiederhole sich vielmehr und werde sehr, sehr langweilig. Auch mache es einen nur gradweisen, aber nicht prinzipiellen Unterschied, ob man auf den Boden oder in ein goldenes WC scheisse. Das habe der Sultan, der ja die besten Schulen besucht habe, im Grunde auch gewusst und seufzend zugegeben, aber er sei eben in den Konventionen seiner Klasse gefangen gewesen (und sei es wohl immer noch). Wobei, Macht – politische Macht – habe ein Sultan von Kesultanan ja eigentlich nicht. Er habe jedenfalls nicht genug Macht, um im Lauf der Geschichte eine Spur zu hinterlassen. Und das sei sein heimlicher Ehrgeiz gewesen oder Mala sei es gelungen, diesen Ehrgeiz in ihm zu wecken.
Sie habe ihn davon überzeugen können, dass er sich selbst ein Denkmal setzen könne, wenn er die Idee der Akademie der Felsenarena unterstütze und finanziere; damit könne er sehr wohl einen bedeutenden Beitrag zur Menschheitsgeschichte leisten, vielleicht sogar den entscheidenden Beitrag seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte überhaupt. Denn, so habe die Meisterin dem Sultan erklärt, die Zeit des Strebens nach Macht und Besitz sei dabei, endgültig zu Ende zu gehen. Im Verlauf des 21. Jahrhunderts werde es je länger, je mehr nur noch darum gehen, das Überleben der menschlichen Spezies zu sichern – eine wahrhaft heroische Aufgabe. Denn so, wie sich die historische Entwicklung momentan präsentiere, sei die Menschheit dabei, kollektiven Selbstmord zu begehen. Das liege einerseits an komplett unfähigen Führern in Wirtschaft und Politik, die den Paradigmenwechsel noch nicht vollzogen hätten, und andererseits an der grossen Mehrheit der Menschheit, die durch das herrschende Dogma von Macht und Besitz zwangsläufig in eine immer extremere Verdummung hineingezwungen werde. Aus diesem Grund, habe die Meisterin vor dem Scheich ausgeführt, sei es zwingend notwenig, eine neue Elite – und zwar in jedem Bereich: der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik, der Kunst – zu schaffen: eine Elite eben, für die nicht Besitz und Machterhalt zähle, sondern die Rettung der menschlichen Spezies. Und die sei nur zu retten, wenn auch der ganze Rest (Fauna, Flora, Klima etc.) gerettet werden könne. Wenn Meere über die Ufer träten, fruchtbare Landstriche verödeten, riesige Küstenstädte von der Landkarte verschwänden, Wasser ein defizitäres Gut werde und das Leben auf der Erde zu einem furchtbaren Überlebenskampf, spielten Statusüberlegungen nur noch für absolut verrückte und deshalb dem Untergang geweihte Despoten eine Rolle. Er dagegen, der Sultan von Kesultanan, sei doch ein intelligenter Herrscher, einer der intelligentesten auf diesem Planeten überhaupt, flattierte sie dem Ego des Sultans etwas plump, was nicht ohne Risiko war – aber die Taktik verfing.
Der Sultan von Kesultanan habe sich das erst überlegen müssen; aber ja doch, habe er schliesslich verlauten lassen, er möchte zum Retter der Menschheit werden. Auch im Namen Allahs, natürlich aber vor allem in seinem, Hamengkubuwonos, Namen als Stellvertreter Allahs auf Erden. Und er könne noch ein paar andere Königshäuser, zum Beispiel seinen Freund Prinz Charles, Herzog von Windsor, superreiche Unternehmer, die Bill Gates-Stiftung, die Roger Federer Fundation etc. dazu bringen, Geld einzuschiessen.
Nach gut einem Jahr auf Lombok war das Projekt in den Grundzügen auf dem Papier oder vielmehr in den Rechnern abgeschlossen. Der Sultan von Kesultanan kaufte vom malaysischen Staat die Rechte ab, in einem Berggebiet im benachbarten Bundesstaat Sarawak die Anlage bauen zu lassen und zu betreiben.
Mit der Hochzeit veränderte sich für die in Brunei geborene Sarah alles. Am Tag der Verlobung zog sie mit ihren Eltern in einen Mini-Palast mit Angestellten und rotem Teppich, Pool und Basketballplatz. Ihre Mutter Suzanne Rahaman Aebby aber sagte in der SRF-Sendung «Reporter»: «Vieles ist ähnlicher als man denkt.»
Sarah – oder wie sie seit ihrer Vermählung heisst: Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Sarah – schenkte dem Kronprinzen zwei Kinder. Es werden wohl nicht die einzigen bleiben – und auch Sarah wird wohl nicht die einzige Frau an der Seite des künftigen Herrschers sein.
MAX
Es braucht genau sechs Jahre, bis das Projekt abgeschlossen wird. Und nun beginnt die Rekrutierung und Ausbildung der zukünftigen Eliten, die so gar nichts mit der bisherigen Bildung von Eliten zu tun hat. Die Ausbildung verläuft zweiteilig: Im Theorieteil werden die Kandidatinnen und Kandidaten vor allem mit philosophisch-ethischem, geschichtlichem, kulturellem, spirituellem, naturwissenschaftlichem, psychologischem und neuronalem Wissen konfrontiert (und mit der gebührenden Distanz auch mit wirtschaftswissenschaftlichen Theorien), es wird aber auch mit Meditation und halluzinogenen Drogen experimentiert; im praktischen Teil dagegen bekommt das Ganze eine existentielle Tiefendimension: Ganz abgestimmt auf den individuellen Einzelfall werden die zukünftigen Leader beiden Geschlechts in ein einjähriges Praktikum geschickt. Der eine wird für ein Jahr in ein absolut alltägliches thailändisches Kloster gesteckt, ein anderer als Rikshafahrer nach Kolkata verdonnert, wieder andere als Bettler oder Strassendiebe auf die Piste geschickt, andere arbeiten vielleicht einfach in einer Putzkolonne, in einem Supermarkt, einem Spital oder einem Bordell. Entscheidend ist, dass die Kandidaten am Schluss der Jury ein Manuskript vorlegen müssen, das durch Sachkenntnis, philosophische Tiefe, grosse Menschenkenntnis und literarische Qualitäten absolut besticht. Mittelmass wird keinesfalls toleriert. Entspricht der Schlussbericht nicht dem Geschmack der Jury, müssen (oder dürfen) die Kandidatinnen die Mühsal – die Chance – eines weiteren Praktikumsjahrs auf sich nehmen, bis ihre Auswertungen den Ansprüchen der Jury genügen.
Du fragst dich wahrscheinlich, warum ich das alles aufschreibe, und wer der Adressat, also dieses «Du», ist. Die Wahrheit ist, ich schreibe das gar nicht auf. Ich erinnere mich bloss. Das heisst, ich glaube nicht, dass ich das aufschreibe, auch wenn es sich mitunter so anfühlt. Ich bilde mir ein, dass ich an einem 250 Jahre alten Kirschbaumholztisch sitze und diese Zeilen in den Computer tippe, weiss aber anderseits, dass das gar nicht möglich ist, denn ich liege ja in einem Spitalbett, völlig unfähig, mich zu bewegen, und höre meistens alte Rocksongs. Auch wenn ich schreibe, höre ich Musik, also auch, wenn ich an meinem alten Kirschbaumholztisch sitze, ein Glas Rotwein nach dem andern trinke und in die Tasten haue mit meinen zwei Zeigefingern. Aber eben, das ist gar nicht möglich, weil ich ja gelähmt bin seit dem Erdbeben, das die Felsenarena zerstört und mich unter Geröll begraben hat, was ich, so unwahrscheinlich mir das selbst erscheint, überlebt habe. Auch das Du meiner Geschichte ist ein fiktives Du, denn alle, die ich gekannt habe, sind ebenfalls tot oder haben vielleicht auch gar nie existiert. Woher soll ich das wissen? Jegliche Realität scheint lediglich in meinem Hirn zu existieren. Wahrscheinlich ist das Du also ein Ich. Ich bin mir dessen bewusst, ich bin nicht verrückt. Leider, würde ich fast sagen. Ohne die Brechung meines Bewusstseins zu leben, schiene mir viel einfacher – es würde heissen, endlich sterben zu können. Dann wäre das, woran ich mich erinnere oder was ich mir zusammenfantasiere, einfach ein Traum, in dem ich völlig aufgehe. Dadurch, dass ich es aufschreibe, wenn auch vielleicht nur in der Fantasie, bekommt die Geschichte den Anschein echter Realität.
Der Istana Nurul Iman (Malaiisch für Palast des Lichtes des Glaubens) in der bruneiischen Hauptstadt Bandar Seri Begawan ist ein Palast (malaiisch Istana) und dient dem Sultan von Brunei (derzeit Hassanal Bolkiah) seit 1984 als Wohn- und Amtssitz. Es handelt sich um den grössten Palast der Erde. Der Palast liegt einige Kilometer westlich der Innenstadt von Bandar Seri Begawan am Brunei River. Istana Nurul Iman wurde vom philippinischen Architekten Leandro Locsin geplant und vom philippinischen Bauunternehmen Ayala International errichtet. Für das Innendesign zeichnet Khuan Chew, die auch das Burj al Arab in Dubai ausstattete, verantwortlich.
Pink Floyd: Keep Talking
Während Millionen von Jahren haben
Die Menschen wie Tiere gelebt.
Dann ist etwas passiert, das unsere
Vorstellungskraft entzügelt hat.
Wir lernten zu sprechen.
(Stephen Hawkings)
Eine Stille umgibt mich.
Ich kann nicht recht denken.
Ich sitz dickschädlig in einer Ecke.
Und nichts kann mich stören.
Ich glaub ich muss jetzt sprechen.
(Warum redest du nicht mit mir?)
Ich kann gerade irgendwie nicht sprechen.
(Nie redest du mit mir!)
Meine Worte wollen nicht richtig rauskommen.
(Was denkst du gerade?)
Mir ist, als würde ich ertrinken. (Was fühlst du gerade?)
Ich fühle mich schwach. (Warum redest du nicht mit mir?)
Ich darf das nicht zeigen. (Nie redest du mit mir)
Manchmal frage ich mich: (Was denkst du gerade?)
Wohin führt uns der Weg? (Was fühlst du gerade?)
Es müsste nicht so sein, so sprachlos und eng:
Wir müssten nur zusehen, dass wir weitersprechen
(Warum redest du nicht mit mir?)
Mir ist, als würde ich ertrinken
(Nie redest du mit mir) Du weisst, ich kann nicht atmen
(Was denkst du gerade?) Das führt uns nirgendwo hin
(Was fühlst du gerade?) Wir reisen nach Nirgendwo
(Warum redest du nicht mit mir?)
(Nie redest du mit mir)
(Was denkst du gerade?)
(Wohin führt uns der Weg?)
Es müsste nicht so sein
Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir weitersprechen:
Deshalb brauchen wir die Schriftsteller,
Die Dichter und Poeten, diese nutzlosen Gestalten,
Weiblich oder männlich, egal, auch zwischengeschlechtlich,
Denn ohne Kunst ist das Leben sinnlos.
Kunst ist systemrelevant. Haha!
MAX
Seit sieben Jahren bin ich Lehrer am Institut in der Felsenarena. Ich unterrichte das Fach «Kommunikation und Kreativität» in sieben Klassen mit je zwölf Schülern. Die Schüler sind im Alter zwischen 16 und 25 Jahren und kommen aus allen Ländern der Welt. Die Gestaltung des Unterrichts ist, wie gesagt, ganz mir überlassen. Was will ich meinen Schülern also beibringen? Ich bin kein Besserwisser, das heisst, ich bin schon ein Besserwisser, aber ich glaube eigentlich nicht an das, was ich weiss. Sokrates, der einer meiner Lehrer ist, hat gesagt, dass er weiss, dass er nichts weiss. Vielleicht sollte man das ernst nehmen, auch wenn Sokrates schon seit einiger Zeit nicht mehr unter uns weilt, wobei – angesichts der Ewigkeit ist das ein Klacks und war erst gestern. Sokrates war von seinem Wissen vom Nichtwissen erfüllt, ich bin von meinem Nichtwissen vom Wissen – besessen? Nein, ich bin leider nicht besessen, sondern eher verlassen von meiner Kompetenz. Vielleicht hat Mala mich deshalb als Lehrer auserwählt, weil ich so absolut von meiner Inkompetenz überzeugt bin. Ich lehre meine Schüler vor allem den Zweifel – den Zweifel an allem und jedem. Ich sage ihnen: Ihr seid wie die Ameisen. Ihr funktioniert aufgrund eurer Programmierung – aber ihr habt keine Ahnung von dem Stiefel des Menschen, der in euren Ameisenhaufen tritt. Letztlich bemühe ich mich also darum, meine Schüler Bescheidenheit und Demut zu lehren – und den Glauben an Wunder. Ich verführe sie dazu, in die Ahnungslosigkeit zu gleiten – unser aller natürliches Element. Es gibt kein Wissen, nur den Anschein der Wissenschaftlichkeit, der gewiss ein Recht hat, zu existieren. Wissenschaftlichkeit ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen können, aber auch der grösste aller möglichen Irrtümer.
Was tun wir im Unterricht? Wir lesen, wir schreiben, wir hören Musik, wir spielen Theater, wir kommunizieren mit Worten, aber auch nonverbal, wir diskutieren über Gott und die Welt und beobachten, was dabei mit uns geschieht. In unseren Köpfen, aber auch unseren Körpern. Wir lesen keine Sachbücher, sondern Romane, oftmals englischsprachige, da alle Schüler Englisch sprechen und Englisch auch die Unterrichtssprache ist, aber wir beziehen die anderen Sprachen mit ein. Da die jungen Männer alle über einen ausserordentlich gut gefüllten Bildungsrucksack verfügen – einen weit grösseren Bildungsrucksack als ich, aber ich bin am Aufholen –, sprechen die meisten von ihnen mehrere Sprachen, vier oder fünf oder auch acht oder zehn, was die Kommunikation reizvoller, aber auch komplizierter macht. Wir lesen also Romane, manchmal auch Novellen, Kurzgeschichten oder Gedichte, und versuchen, den grösstmöglichen Erkenntnisgewinn daraus zu ziehen – intellektuell, aber ebenso auf der Gefühlsebene und auf einem gewissermassen existenziellen Niveau. Es geht um Inhalt und Form, aber wir analysieren die Texte nicht wie in einem linguistischen Seminar quasi von aussen, als unbeteiligte Dritte, sondern versuchen zu ergründen, was sie mit uns ganz persönlich machen. Wir bringen unsere Subjektivität immer mit ein. Literatur variiert die immer paar gleichen Themen, Liebe, Sinn, Gerechtigkeit, Identität, das Verhältnis zwischen Individuum und Welt, das Verhältnis zwischen Vernunft und Empfindsamkeit, das Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Verrat, zwischen Schuld und Sühne, zwischen Hilflosigkeit und Macht, Leben und Tod. Literatur ist Philosophie mit anderen Mitteln. Indem wir uns in sie hinein plumpsen lassen, finden wir keine Lösungen, keine pfannenfertigen Antworten, keine Rezepte, eher Ahnungen als Gewissheiten, eher verschlungene als gerade Wege, eher Erkenntnisse als Resultate. Die Wahrheit ist ja nicht etwas, das sich in Worte fassen liesse, letztlich entwindet sie sich uns wie ein glitschiger Wurm.
Wir lesen nicht nur, wir schreiben auch in meinen Lektionen. Keine Aufsätze, sondern vor allem Geschichten. Wir üben ebenfalls die Debatte, die dialektische Erörterung, aber auf einem spielerischen Niveau, indem wir die Positionen, die wir vertreten, wechseln, und auf diese Weise lernen, um die Ecke zu denken, out of the Box. Wir stellen uns Situationen vor, in denen wir uns vor existentielle Herausforderungen gestellt sehen und Entscheide treffen müssen, die uns in einen Zwiespalt bringen. Und dann spielen wir sie durch.
So stellen wir uns zum Beispiel die folgende Situation vor: Eine Gruppe von zwanzig Touristinnen und Touristen ist in einer Höhle eingeschlossen, die langsam überflutet wird. Die Zeit bis zur vollständigen Überflutung reicht nur aus, um zehn der eingeschlossenen Menschen zu retten. Wir sind das Rettungsteam und müssen nun entscheiden, welche zehn der zwanzig Betroffenen wir für die Rettung auswählen. Nach welchen Kriterien entscheiden wir?
In der Klasse gibt es neben mir, dem «Lehrer», vierzehn Studenten. Zwei stammen aus Brasilien, Joao und Joaqin, einer, Manuel, aus Peru, zwei aus Indien – Shiva und Ganpati –, drei aus China – Li, Chi und Han –, Vanja aus Bulgarien, Andrej aus Russland, John aus den USA, Kai aus Deutschland, Greg aus Australien, Lucca aus Italien.
John sagt: «Wir müssen vor allem die Jungen retten. Die Jungen sind die Zukunft und auch die, die noch am meisten persönliche Zukunft vor sich haben.» – «Du meinst, wir identifizieren einfach die zehn Jüngsten, retten die und lassen die anderen ersaufen?», fragt Lucca. «Das finde ich ein wenig willkürlich.» – «Ja», mischt sich da Ganpati ein, «es müssen doch noch andere Auswahlkriterien gelten als das Alter. Zum Beispiel der gesellschaftliche Wert eines Individuums. Wieviel Bildung wurde in die Person investiert? Welcher Output ist in Zukunft noch von ihr zu erwarten?» – «Da landen wir aber geradewegs in einer Diskussion über wertes oder unwertes Leben. Findest du deinen Utilitarismus nicht etwas unethisch?», protestiert Vanja. «Warum?», wirft Han ein. Han ist mittelgross, feingliedrig und hat sexy Lippen und einen geilen Arsch. «Würdest du es ethischer finden, das Los entscheiden zu lassen?» – «Vielleicht gibt es ja welche, die zugunsten der anderen freiwillig darauf verzichten, gerettet zu werden», schlägt Manuel mit zögerlicher Stimme vor. Manuel sieht ebenso asiatisch wie Han aus. «Ja, und damit sind es dann gerade die empathischen, grosszügigen Menschen, die wir ersaufen lassen», ereifert sich Joao, «vielleicht sollten wir vor allem die retten, die sich zu opfern bereit sind. Überhaupt scheint es mir nicht unangebracht, uns die einzelnen Personen mal ein bisschen näher anzuschauen. Vielleicht fällt uns der Entscheid dann leichter», schlägt er vor.
«Dafür ist die Zeit aber zu knapp. Wenn wir noch lange weiter diskutieren, ersaufen schliesslich alle zwanzig», mische ich mich ein. «Ihr seht also, die Entscheidung stellt uns vor ein Dilemma. Wie wir uns auch entscheiden, es bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Trotzdem bin ich dafür, dass wir würfeln. Den Zufall entscheiden zu lassen, scheint mir als die am wenigsten ungerechte Lösung.»
Ich finde es interessant, dass ausgerechnet ich, der ich mich so lange Zeit meines Lebens um Moral foutiert, ja bewusst gegen die Regeln der Moral verstossen habe, nun meine Studenten zur Auseinandersetzung mit Fragen der Moral anleite. Allerdings tue ich es nicht mit dem Anspruch, Antworten zu haben. Ich habe keine, also muss ich auch nicht so tun, als hätte ich welche. Ich brauche mich nicht zu verstellen. Ich leite meine Studenten an, Fragen zu stellen und allenfalls eigene Antworten auf diese Fragen zu finden, oder dann aber, so wie ich es mache, sich mit der Antwortlosigkeit abzufinden.
Du hälst solche Diskussionen für unnötig? Ich nicht! Auch wenn wir auf unsere Fragen keine Antworten finden, müssen wir sie dennoch stellen, und zwar unerbittlich. Sonst werden wir zu feigen Lügnern. Ich weiss, die meisten Menschen drücken sich um diese Fragen herum, sie weisen sie als Zumutung weit von sich, aber ich finde, die Lenker unserer Welt, die zukünftigen Leader unserer Welt, sollten das nicht tun.
On the Border: Al Stewart
Die Fischerboote fahren aufs abendliche Meer hinaus,
Sie schmuggeln Gewehre und Waffen über die spanische Grenze.
Der Wind peitscht tosend die Wellen auf, ein Geistermond treibt
Zwischen den Wolken und lässt die Gewehrläufe wie Silber glänzen
– Dort, an der Grenze.
An meiner Wand verwischen sich die Farben der Landkarten,
Der Wind aus Afrika erzählt von kommenden Veränderungen.
In der Nacht flammen die Fackeln auf.
Die Hand, die die Farmen in Brand steckt,
Hat die Botschaft unter Denen verbreitet,